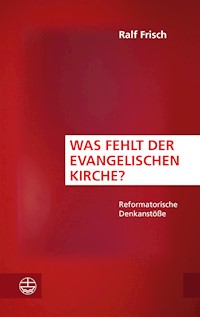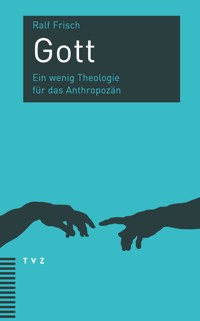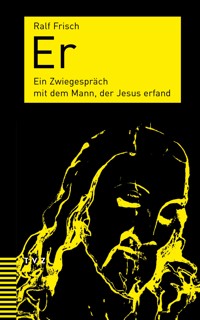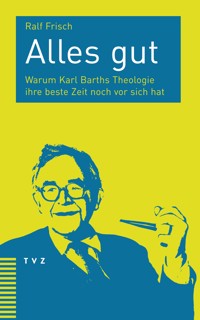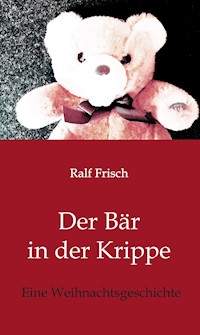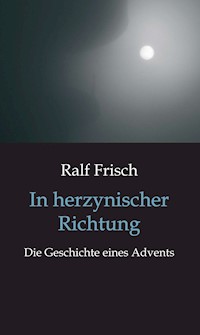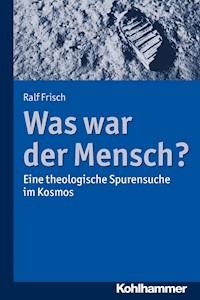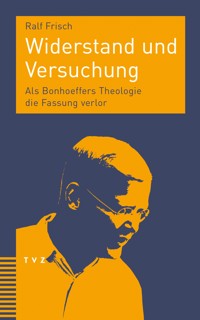
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Theologischer Verlag Zürich
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
«Wie Sternschnuppen fallen fromme Sätze von einem Himmel, der demnach nicht leer sein kann, aber doch leer sein soll – wenn man Bonhoeffer beim Wort nimmt. Aber kann man dem metaphysischen Gott den Laufpass geben und sich zugleich von guten Mächten wunderbar geborgen in diesem Gott wiederfinden?» Dietrich Bonhoeffer, der Feind Hitlers, der Widerstandskämpfer, der Spirituelle, der Märtyrer, der evangelische Heilige. Bonhoeffer ist vieles, doch was geschieht mit ihm und seiner Theologie in Tegel, in der Extremsituation seiner letzten beiden Lebensjahre? Ralf Frisch liest «Widerstand und Ergebung», die gesammelten Briefe, Notizen und Gedichte aus der Haft, nicht als wegweisenden Aufbruch zu neuen theologischen Ufern, sondern als Ausdruck einer weitreichenden Versuchung, in die die sicher gefügte Theologie Bonhoeffers im Gefängnis gerät. Das Programm eines religionslosen Christentums, die Idee einer Kirche für andere, die Vision eines mündigen Lebens ohne Gott – reagiert Bonhoeffer damit nur auf die Herausforderungen seiner Zeit oder legt er damit Hand an die Substanz des christlichen Glaubens? Ralf Frisch erzählt im Wechsel von theologischer Interpretation und Imagination, wie sich Bonhoeffers Spättheologie entwickelte. Eine Geschichte voller Versuchungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Frisch
Widerstand und Versuchung
Als Bonhoeffers Theologie die Fassung verlor
Der Theologische Verlag Zürich wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–202
5
unterstützt.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
UmschlaggestaltungSimone Ackermann, Zürich
Zitat Seite 5Heinrich Detering, Der Antichrist und der Gekreuzigte. Friedrich Nietzsches letzte Texte, Göttingen 2010, 168.
DruckCPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-290-18478-0 (Print)ISBN 978-3-290-18479-7 (E-Book: PDF)ISBN 978-3-290-18793-4 (E-Book: EBUP)
2. Auflage© 2022 Theologischer Verlag Zürichwww.tvz-verlag.ch
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Glaubensfrage
1 Dunkle Stunden und ihre theologischen Folgen
2 Nachtgesichte in Tegel
3 Im Gleichgewicht und in Gott
4 Tiefe Diesseitigkeit
5 Verborgene Phantasien
6 Kirchendämmerung
7 Gottes Beistand
8 Nachtgesichte in Tegel
9 Atheistische Seelenverwandtschaft
10 Die Bejahung des intensiven Lebens
11 Über-Nietzsche
12 Etsi Deus daretur
Bei den kalifornischen Yuki-Indianern hatte der Geschichtenerzähler die Pflicht, sich nach dem Ende seiner Erzählung von den Zuhörern ab- und der Geschichte selbst zuzuwenden. «Well, it is done», musste er ihr sagen und sie damit zurückschicken in ihre Felsenhöhle. Denn die Erzählung […] musste mit demselben Respekt behandelt werden wie jedes andere Lebewesen auch. Ohne diese Worte aber hätte sie den Erzähler verschlingen können, und seine Zuhörer gleich mit.
Heinrich Detering
1
Dunkle Stunden und ihre theologischen Folgen
Annäherung an einen Unberührbaren
Dich wundern oder vielleicht sogar Sorgen machen würden dir höchstens meine theologischen Gedanken mit ihren Konsequenzen.1
Dietrich Bonhoeffer
Dieses Buch ist in einer Art Felsenhöhle entstanden, genauer gesagt im Corona-Lockdown. Wer sich in einer solchen Höhle befindet, denkt und schreibt anders als einer, der sich frei bewegt.
Er denkt und schreibt aber nicht nur anders, sondern womöglich gar nicht, weil die vielzitierte Muse ihn nicht küsst und weil die alles bestimmende Wirklichkeit der Pandemie ihn weder zu Wort noch zu einem unbeschwerten Gedanken kommen lässt.
Mir jedenfalls ging es lange so – so lange, bis ich mich lesend einem zuwandte, der seinerseits dazu verurteilt war, eingesperrt zu sitzen, zu denken und zu schreiben.
Gewiss dürfte Dietrich Bonhoeffers Haft in Berlin ungleich fürchterlicher gewesen sein als jedes noch so nervtötende Lockdown-Szenario unserer Tage. Aber interessant ist es ja doch, zu welchen Büchern und Denkern man in ungewohnt ernster Lage greift und welche Bücher und Denker schal, oberflächlich und uninteressant bleiben. Zu Beginn der Pandemie zog es mich eigentlich nur zu Bonhoeffer. Zu dem Mann in der Zelle. Und zum Denken, Glauben, Schreiben und Dichten dieses Mannes aus dieser Zelle heraus.
Dietrich Bonhoeffer bewegt bis heute die theologische und die kirchliche Welt. Und nicht nur sie. Er bewegt auch diejenigen, die fern von Kirche und Theologie vielleicht nur einen einzigen Theologen des 20. Jahrhunderts kennen. Eben Bonhoeffer. Den Feind Adolf Hitlers, den Widerstandskämpfer, den spirituell souveränen Christen, den Märtyrer,2 den Helden, den bahnbrechenden Theologen. Womöglich ist Bonhoeffers Gefängniskorrespondenz, die sein Freund und Gesprächspartner Eberhard Bethge 1951 unter dem Titel «Widerstand und Ergebung» publizierte, das bekannteste und breitenwirksamste theologische Buch der jüngeren Zeit.
Wer sich mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt, muss sich darüber im Klaren sein, dass den Gefangenen von Berlin eine Aura der Unberührbarkeit und Unfehlbarkeit umgibt. Bonhoeffer ist sakrosankt. Sein Wort gilt als letztes Wort, weil Bonhoeffer als letzte Instanz gilt. Und so trägt das, was über ihn geschrieben wird, nicht selten hagiografische und verklärende Züge.3 Ausnahmen sind rar, dafür umso wohltuender. Eine dieser Ausnahmen ist – erwartungsgemäss – Karl Barth. Am 22. Dezember 1952, also ein Jahr nach der Veröffentlichung von Bonhoeffers Briefen und Aufzeichnungen aus der Haft, gab er Landessuperintendent Walter Herrenbrück aus Aurich in Ostfriesland auf dessen Bitte hin eine Einschätzung zu Dietrich Bonhoeffer. Barth schrieb:
«Was für ein offener und reicher und zugleich tiefer und erschütterter Mensch steht da vor einem – ‹irgendwie› beschämend und tröstlich zugleich. So habe ich ihn auch persönlich in Erinnerung. Ein aristokratischer Christ, möchte man sagen, der Einem in den verschiedensten Dimensionen voranzueilen schien […] Er war ein – wie soll ich sagen: impulsiver, visionärer Denker, dem plötzlich etwas aufging, dem er dann lebhafte Form gab, um nach einiger Zeit doch auch wieder, man wusste nicht: endgültig oder nur bis auf Weiteres, Halt zu machen bei irgend einer vorläufig letzten These […] Musste man ihm nicht immer vorgeben, dass er sich gewiss ein anderes Mal und in anderem Zusammenhang noch klarer und konziser äussern, eventuell sich zurücknehmen, eventuell weiter vorstossen werde? Nun hat er uns mit den änigmatischen Äusserungen seiner Briefe allein gelassen.»4
Umso grösser erscheint daher das Bedürfnis nach Enträtselung, aber auch nach Verletztgültigung des in diesen Briefen Geschrieben. Der Wunsch, es möge sich dabei um zu Ende5 oder doch zumindest in die richtige Richtung Gedachtes handeln, ist weiter verbreitet als die Bereitschaft, sich nüchtern, neugierig und kritisch mit Bonhoeffer auseinanderzusetzen, sich von ihm anregen zu lassen, ihn gegebenenfalls aber auch zu hinterfragen.
Aus dem Bedürfnis nach Verehrung und Verklärung Bonhoeffers spricht zweifellos die menschlich-allzumenschliche Sehnsucht nach einer theologischen, christlichen und menschlichen Ausnahmeerscheinung, nach dem inspirierenden, über jeden Zweifel erhabenen ganz Grossen, dem heiligen Helden, mit dem man sich im Rückblick auf Kirche, Politik und Gesellschaft im Dritten Reich trösten kann und den man in der Gegenwart vergebens sucht. Bonhoeffer ist Identifikationsfigur und Stellvertreter, Vorbild und Ikone, Ideal und Idol, Märtyrer und Heiliger,6 unfehlbar und unanfechtbar – alles also, was es im Protestantismus eigentlich nicht gibt und nicht geben darf, was aber gerade deshalb umso heftiger herbeigesehnt wird. So heftig, dass man sich fragt: «Was wären wir ohne Dietrich Bonhoeffer?»7 Und so heftig, dass man sich zugleich fragen muss: «Wem gehört Dietrich Bonhoeffer? Wer darf ihn für sich reklamieren? Und wer nicht?»8
Wer also nach wiederholter Lektüre von Bonhoeffers Briefen und Aufzeichnungen aus der Haft von Zweifeln überfallen wird, ob die theologische Entwicklung des späten Bonhoeffer wirklich eine gute Richtung genommen hat oder ob Bonhoeffer nicht vielmehr aus der Bahn geworfen, auf das falsche Gleis gesetzt oder zumindest an einen Abgrund geführt wurde, muss sich in seiner Felsenhöhle warm anziehen.
Ich vertrete in diesem Buch die These, dass Dietrich Bonhoeffers Theologie im Jahr 1944 aus der Fassung geriet und ihre Fassung verlor, aber diese Fassung am Ende womöglich doch wiederfand. Man könnte es auch anders beschreiben und Bonhoeffers theologische Entwicklung seines letzten Lebensjahres als Versuchungsgeschichte erzählen. Genau das will ich tun und dabei mit Bonhoeffer gegen Bonhoeffer über Bonhoeffer hinausdenken.
Ich mache kein Hehl daraus, dass ich Bonhoeffers Versuchung im Blick auf sein Gesamtwerk und im Blick auf die Entwicklung des sich auf ihn berufenden Protestantismus unserer Tage für fatal halte. Dass Bonhoeffers Versuchung bis heute nicht als Versuchung erkannt, sondern als grosses theologisches Verdienst, als Aufbruch zu neuen theologischen Ufern und als zukunftsweisende theologische Problemlösung verkannt wird, ist bezeichnend, macht sie aber nur noch fataler.
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich davon überzeugt bin, dass die theologische Lösung, zu der Bonhoeffer in Zeiten der Anfechtung und der Versuchung geführt wurde, gravierende neue theologische Probleme erzeugte. Sie entliess Geister aus der Flasche, welche die evangelische Theologie und die evangelische Kirche im Anschluss an Bonhoeffer bis heute nicht losgeworden sind – eben darum, weil sie sie nicht loswerden wollen und nicht zu sehen bereit sind, dass Bonhoeffers vermeintliche Lösung das eigentliche Problem des gegenwärtigen Protestantismus darstellt.
Dietrich Bonhoeffer glaubte vom April 1944 an, die «freie Luft der geistigen Auseinandersetzung mit der Welt»9 zu atmen. Doch wenn man ihm beim Denken zusieht, zeigt sich zuweilen, dass seine Spättheologie eine theologische Hyperventilation darstellt. Oder nochmals anders gesagt: was Bonhoeffer dachte, ist Explosion und Implosion zugleich. Sein Denken explodierte im eruptiven Rausch eines Gott und die Welt ganz anders verstehen wollenden Neuanfangs. Zugleich implodierte es und brach in sich zusammen – sicherlich auch unter den Eindrücken einer Situation, die selbst an einem so sicher gefügten und gefassten Menschen wie Bonhoeffer nicht spurlos vorüberging. Womöglich sind dessen Gefängnisbriefe trotz ihrer augenscheinlichen Klaglosigkeit ja doch als theologische Theodizee10 lesbar – vielleicht auch als kontrollierter Ausbruch aus dem Korsett eines allzu ungebrochenen Glaubens an den Vatergott, der im Regiment sitzt.
Was Dietrich Bonhoeffers Klaglosigkeit anbelangt, so spiegelt sich in ihr einer der ausgeprägtesten und eindrucksvollsten Charakterzüge des jungen Theologen. Bonhoeffers Zurückhaltung im Blick auf das Nach-aussen-Kehren der eigenen psychischen Innenwelt und sein «Überdruss an aller Psychologie»11 waren erheblich. Nichts und niemanden verachtete Bonhoeffer mehr als Menschen, die die Beherrschung verloren, schamlos12 wurden und in Selbstmitleid verfielen. Und genauso wenig hatte er für diejenigen übrig, die es darauf anlegten, anderen in ihr Innerstes hinein hinterher zu schnüffeln, um Fragwürdiges oder Defizitäres daraus hervorzuzerren und psychologisches oder theologisches Kapital daraus zu schlagen. Fast hat es den Anschein, als habe Bonhoeffer seine Idee einer «Arkandisziplin […], durch die die Geheimnisse des christlichen Glaubens von Profanierung behütet werden»13 sollen, auch im Blick auf das Verhältnis zu den Geheimnissen, Tiefen und Abgründen seiner eigenen Innenwelt zu verwirklichen versucht. Bonhoeffers Biograf, Briefadressat und engster Vertrauter Eberhard Bethge schreibt denn auch über seinen Freund:
«Schon seiner ganzen Persönlichkeit nach war er im Bedürfnis nach dem Abschirmen zentraler Lebensvorgänge darauf angelegt, sich für die frühchristliche Praxis zu interessieren, die noch nicht Wissenden, die noch ungetauften Katechumenen, von dem eigentlichen Teil des Gottesdienstes auszuschliessen, in welchem das Mahl gefeiert und das Apostolicum gesungen wurde. Das war der Ursprung der ‹Arkandisziplin›.»14
Sicherlich dienten die Selbstdisziplinierungsmassnahmen des Eingesperrten gegen den Einbruch des Chaos auch dazu, unangenehme Mitleser seiner Briefe aus seiner Person auszusperren und jene anderen, die er liebte und gern hatte, zu schützen. Seine Eltern schützte er davor, sich um ihn Sorgen zu machen. Seinem im Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftierten und am selben Tag wie Bonhoeffer ermordeten Schwager Hans von Dohnanyi schrieb er: «Du musst wissen, dass auch nicht ein Atom von Vorwurf oder Bitterkeit in mir ist über das, was dir und mir zugestossen ist. Solche Dinge kommen von Gott und ihm allein.»15 Und seinem Freund Eberhard Bethge und sich selbst signalisierte und suggerierte Bonhoeffer Stärke des Ethos und des Glaubens womöglich auch deshalb, weil diese Stärke als Ausdruck eines unerschütterlichen Vertrauens in die Vorsehung Gottes für beide der Strohhalm war, an den sie sich in bedrohlicher Zeit klammern konnten.
Liest man Bonhoeffers Briefe, dann kann man jedenfalls nur staunen, wie konsequent er der Versuchung widerstand, sich selbst gegenüber die Kontrolle, die Haltung und die Fassung zu verlieren. Von guten Mächten wunderbar geborgen war er am Ende stärker als die Dämonen, die ihn von aussen und von innen anfielen, um ihn umzuwerfen und in den Abgrund von Verzweiflung, Selbstzerstörung und theologischer Irrlehre zu stürzen. – So stelle ich es mir zumindest vor.
Aber natürlich kannte er sie, diese Dämonen. Aus seinem Gedicht «Wer bin ich?»16 blicken sie, wiewohl literarisch eingehegt, heraus. Am 18. November 1943 schreibt er an Eberhard Bethge über seine Schwermut: «Du bist der einzige Mensch, der weiss, dass die ‹acedia› – ‹tristitia› mit ihren bedrohlichen Folgen mir oft nachgestellt hat.»17 Und im Brief vom 15. Dezember 1943 öffnet er die Schleusen seines aufgewühlten Inneren weiter denn je. Er gesteht seinem Freund unumwunden,
«dass es trotz allem, was ich so geschrieben habe, hier scheusslich ist, dass mich die grauenhaften Eindrücke oft bis in die Nacht verfolgen und dass ich sie nur durch Aufsagen unzähliger Liedverse verwinden kann und dass dann das Aufwachen manchmal mit einem Seufzer statt mit einem Lob Gottes beginnt […] Ich frage mich selbst oft, wer ich eigentlich bin, der, der unter diesen grässlichen Dingen hier immer wieder sich windet und das heulende Elend kriegt, oder der, der dann mit Peitschenhieben auf sich selbst einschlägt und nach aussen hin (und auch vor sich selbst) als der Ruhige, Heitere, Gelassene, Überlegene dasteht und sich dafür (d. h. für diese Theaterleistung, oder ist es keine?) bewundern lässt? Was heisst Haltung eigentlich?»18
Aber immer wieder nimmt Bonhoeffer Haltung an, verwindet die grässlichen Eindrücke und überwindet die Dämonen. Am 27. November 1943 fragt er rhetorisch: «Ob nicht die Angst doch auch zu den ‹pudenda› gehört, die verborgen werden sollten?»19 Und mit einem Zitat Gotthold Ephraim Lessings erklärt er trotzig selbstbewusst: «Ich bin zu stolz, mich unglücklich zu denken.»20
Man wird Dietrich Bonhoeffer nicht zu viel Ehre antun und ihn auch nicht in ein ungutes Licht rücken, wenn man ihn trotz und in aller Anfechtung den geradezu mustergültigen Repräsentanten eines üblicherweise als preussisch bezeichneten Typus nennt. Bonhoeffer entstammte einer Familie, die keine Zweifel daran hegte, dass sie zur gesellschaftlichen Elite gehörte – in Sachen Bildung, in Sachen Besitz, aber auch in Sachen Verantwortung und Verpflichtung21 gegenüber der Gegenwart und Zukunft der Kirche, der eigenen Nation, ja der ganzen Welt. Er wuchs «in einer Atmosphäre auf, die zur Ritterlichkeit anhielt»22. Das machte ihn sendungsbewusst. «Ich hoffe», so Bonhoeffer im Blick auf die von ihm am 3. August 1944 umrissene theologische Arbeit, von der uns nur der Entwurf vorliegt, «damit für die Zukunft der Kirche einen Dienst tun zu können.»23
Anlässlich des Tauftags seines Patenkindes Dietrich, des Sohns von Eberhard Bethge, dachte Bonhoeffer ungeschützt über die Frage nach, «ob wir einer Zeit der Auslese der Besten, also einer aristokratischen Ordnung entgegengehen, oder einer Gleichförmigkeit aller äusseren und inneren Lebensbedingungen der Menschen»24. Im Gegensatz zu vielen, die ihm theologisch, kirchlich und politisch nachzufolgen glauben, war für Dietrich Bonhoeffer, den Aristokraten, Ersteres weit wünschenswerter als Letzteres und im Blick auf seinen gesellschaftlichen Hintergrund geradezu natürlich. Ihm stand eine «Rehabilitierung des Bürgertums […] gerade vom Christlichen her» vor Augen, und er schrieb daher «die Geschichte einer bürgerlichen Familie unserer Zeit»25.
Aber nicht nur das. Dietrich Bonhoeffer wollte «eine neue Auslese von solchen schaffen, denen auch das Recht auf starke Führung zugebilligt wird»26. Wenn die oft zitierte Formulierung des Lyrikers Emanuel Geibel, am deutschen Wesen werde einmal noch die Welt genesen,27 irgendwo im besten, aufrichtigsten Sinn verwendet werden kann, dann im Blick auf das Selbstverständnis der Familie Bonhoeffer und im Blick auf den Kreis von Menschen, in dem das Attentat auf Adolf Hitler ersonnen wurde.
Womöglich würde man auch nicht zu weit gehen, wenn man sagen wollte, dass Bonhoeffer sich für erwählt hielt. Ich «stehe», schreibt er so stoisch wie selbstgewiss am 11. April 1944 aus seiner Zelle an den Freund Eberhard Bethge, «ganz unter dem Eindruck, dass mein Leben – so merkwürdig das klingt – völlig geradlinig und ungebrochen verlaufen ist […] Wenn mein gegenwärtiger Status der Abschluss meines Lebens wäre, so hätte das einen Sinn, den ich zu verstehen glauben würde.»28 Und am 9. Mai notiert er: «Ich sehe in meinem gegenwärtigen Dasein eine Aufgabe und hoffe nur, dass ich sie erfülle.»29
Bei der Lektüre von Bonhoeffers Gefängnisbriefen drängt sich mitunter sogar der Eindruck auf, ihr Verfasser habe über Charaktereigenschaften verfügt, die nicht einmal Christus selbst zu Gebote standen – jedenfalls nicht im Garten Getsemani und auch nicht am Kreuz auf Golgota. Es scheint sogar, als seien diese überchristlichen Charaktereigenschaften für den Überchristen Bonhoeffer die eigentlich christlichen Tugenden gewesen.
Ist es denkbar, dass sich Bonhoeffer nicht nur für erwählt hielt, sondern sich als eine Art Stellvertreter in einem soteriologischen, heilsgeschichtlichen Zusammenhang sah? Schrieb er am 5. Oktober 1944 vielleicht deshalb das Gedicht «Jona», weil er sich mit dem Propheten identifizierte und als stellvertretendes Opfer begriff? Bonhoeffers Gedicht endet mit den Sätzen: «Sie zitterten. Doch dann mit starken Händen verstiessen sie den Schuldigen. Da stand das Meer.»30 Zwar opferte sich Bonhoeffer biografisch betrachtet tatsächlich, indem er alle Möglichkeiten, Deutschland zu verlassen, ungenutzt liess und etwa das Angebot einer Professur in New York ausschlug, weil er seinen Platz in Deutschland sah. «Die letzte verantwortliche Frage», so Bonhoeffer, «ist nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, sondern [wie] eine kommende Generation weiterleben soll.»31 Allerdings deutet kaum etwas darauf hin, dass Bonhoeffer, der nach seiner Hinrichtung immer mehr ins Licht eines stellvertretend leidenden Gerechten gerückt wurde, sich in irgendeiner Weise schuldig fühlte.32
Apropos Schuld. Macht man sich schuldig, wenn man Bonhoeffer gleichsam entmythologisiert und seiner idealisierenden Gewandung entkleidet? Ist es fragwürdig, die losen Enden, offenen Flanken und problematischen Sackgassen seiner Spättheologie zu markieren und zu thematisieren? Im Gegenteil. Ich glaube, es ist geradezu nötig. Drei Generationen nach Bonhoeffers Tod scheint die Zeit gekommen, sich Bonhoeffers Theologie neu und anders anzunähern – nicht mehr mit verklärendem Augenaufschlag oder dem anderen Extrem, der allzu liberalen Indifferenz gegenüber einem seltsamen Heiligen, sondern so, wie diejenigen es nicht wagen, für die er als Lichtgestalt in dürftiger Zeit über jeden Zweifel und über jede Kritik erhaben ist33. Es gehört – mit Bonhoeffer gesprochen – zur intellektuellen Redlichkeit verantwortungsbewusster Theologie, die Arbeitshypothese fallen zu lassen, Bonhoeffers Denken, das beständig veränderungsbereit blieb, könne und dürfe nicht kritisiert, über sich hinausgeführt und zu sich selbst zurückgeführt werden, wo es auf Abwege gerät.
Um Dietrich Bonhoeffers späte Theologie zur Kenntlichkeit zu entstellen und zugleich dem historischen Bonhoeffer nicht zu nahe zu treten, wähle ich in drei Kapiteln dieses Buchs ein Stilmittel, dessen sich Dietrich Bonhoeffer selbst immer wieder bediente, um seinen theologischen Erkenntnissen noch eindringlichere, das lesende Bewusstsein mit noch grösserer Plötzlichkeit34 anfallende Gestalt zu verleihen: das Stilmittel der Fiktion, genauer gesagt der erzählenden Imagination. Ich wähne mich bei der Anwendung dieses literarischen Mittels also in guter Gesellschaft mit Bonhoeffer selbst, der an Eberhard Bethge am 5. Juni 1944 schrieb, er käme sich vor «wie ein dummer Junge, wenn ich dir verberge, dass es mich hier gelegentlich zu dichterischen Versuchen treibt»35.
Es ist auffällig, dass Bonhoeffer nicht bemüht und auch nicht daran interessiert war, sein Experiment der ästhetischen Transformation und Kommunikation theologischer Erkenntnisse vor anderen geheim zu halten. In Dramen und Gedichten konnte er offenbaren, was er ansonsten mit grosser psychologischer «Arkandisziplin» verhüllte.36 Das lyrische Ich vermochte ungeschützter als der Briefeschreiber zu fragen: «Wer bin ich?»37 Was Dietrich Bonhoeffer sich im sogenannten wirklichen Leben und vielleicht auch in der theologischen Reflexion nur selten gestattete, erlaubte er sich in der Kunst. Ich halte es sogar für denkbar, dass er sich am Ende im Glauben zugestand, was er sich im Denken untersagt hatte.
Wenn aber in der Imagination möglich ist, was in der Reflexion nicht möglich ist, und wenn Bonhoeffer selbst dieser Devise folgte, warum sollte dann nicht auch ein Buch über Bonhoeffer dieser Devise folgen können, so lange es nur nicht die dreiste Torheit besitzt, seinen Leserinnen und Lesern suggerieren zu wollen, das vom Autor Imaginierte müsse sich wirklich so zugetragen haben und stelle den einzigen Schlüssel dar, der Dietrich Bonhoeffers Spättheologie wirklich erschliesst.
Um diesem Missverständnis vorzubeugen, habe ich die fiktionalen Kapitel sichtbar von den wissenschaftlich reflektierenden Kapiteln unterschieden und so als Produkte meiner Phantasie kenntlich gemacht, die sich bei meiner Lektüre von «Widerstand und Ergebung» zwischen den Zeilen entzündet hat.
Ich würde mich freuen, wenn aus der Berührung von Reflexion und Fiktion, Interpretation und Imagination erhellende und elektrisierende Funken auf Sie, liebe Leserinnen und Leser, überspringen würden. Vielleicht wird dadurch eine Theologie in ein neues Licht gerückt, die selbst in dunklen Stunden das Licht der Welt erblickte und seither die theologische Welt verändert hat.
Übrigens bin ich davon überzeugt, dass verwegene Theologie auf ausgesetzten Graten ungleich faszinierender ist als ungefährliches Nachklettern und Nachbuchstabieren auf allzu sicherem akademischen oder kirchlichen Terrain. Ich hoffe sehr, dass das auch für dieses Buch gilt. Es ist aus der Überzeugung heraus entstanden, die Karl Barth ein Jahr nach der Erstveröffentlichung von Bonhoeffers Gefängnisbriefen wie folgt zum Ausdruck gebracht hat:
«Die Briefe sind, was man auch von ihren einzelnen Sätzen denken möge […] ein einziger Stachel, von dem uns aufregen zu lassen uns allen […] nur gut sein kann […] Eine Abschwächung des Anstosses, den er uns gegeben hat, wäre das Letzte, was ich wollte.»38
Was ich geschrieben habe, hätte ohne meinen Freund und Kollegen Günter Thomas nicht entstehen können. Er hat mich unermüdlich inspiriert. Ich danke ihm herzlich dafür.
Ebenso von Herzen danke ich Herbert Weihprecht und Gerhard Mark, die mich immer dann, wenn es nötig war, auf andere Gedanken und höhere Drehzahlen gebracht und zugleich wunderbar geerdet haben.
Wer weiss, ob es zu diesem Buch gekommen wäre, wenn ich nicht vor fast einem Jahrzehnt einem anderen Buch begegnet wäre, das, wie ich nun weiss, seither beharrlich in mir weiterarbeitete. Sein Autor ist Heinrich Detering. Ich danke auch ihm, ohne ihn persönlich zu kennen.
Vor allem aber danke ich Lisa Briner und Bigna Hauser. Ohne ihr Vertrauen in ihren Autor und ohne ihre besonnenen Zügelungen von dessen mitunter überschiessender Einbildungskraft hätte dieses Buch nicht in solch schöner Gestalt im Theologischen Verlag Zürich das Licht der Welt erblicken können.
Und natürlich danke ich auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für Ihren Entschluss zur Lektüre dessen, was Sie vor sich haben. Ich würde mich freuen, wenn das, was Sie lesen, Sie mitreisst und als heilsame Unruhe in Ihnen weiterwirkt.
Doch wie auch immer: «It is done.»
Ralf Frisch
Erlangen, Ostern 2022
1Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW) Bd. 8, hg. v. Christian Gremmels, Eberhard Bethge und Renate Bethge in Zusammenarbeit mit Ilse Tödt, Gütersloh 1998, 402. Ich erlaube mir im Folgenden, in allen Zitaten «ß» durch «ss» zu ersetzen.
2So Eric Metaxas, Bonhoeffer. Pastor, Martyr, Prophet, Spy, Nashville 2010.
3Der deutsche Titel der Bonhoeffer-Biografie von Charles Marsh spielt darauf an. Charles Marsh, Der verklärte Fremde. Eine Biographie, Gütersloh 2015. Im englischen Original: Strange Glory. A Life of Dietrich Bonhoeffer, New York 2014.
4Karl Barth an Landessuperintendent Walter Herrenbrück am 22. Dezember 1952, in: Karl Barth Gesamtausgabe V. Briefe, Offene Briefe 1945–1968, hg. v. Diether Koch, Zürich 1984, 322–329, dort 324f. Vgl. auch Hermann Dembowski, Grundfragen der Christologie – erörtert am Problem der Herrschaft Jesu Christi, München 1969, 27. Übrigens setzen manche, die sich von Bonhoeffer besonders alleingelassen fühlen, den Briefwechsel mit ihm auch fort. Siehe dazu jüngst Jürgen Werth, Lieber Dietrich […] Dein Jürgen. Über Leben am Abgrund – ein Briefwechsel mit Bonhoeffer, Gütersloh 2020.
5Dagegen spricht Barth, a. a. O., 327, von einem «Tiefsinn», den Bonhoeffer «nun eben selber nicht mehr vor uns ausgebreitet, vielleicht auch selber noch nicht zu Ende gedacht hat».
6Siehe dazu die instruktive, bisher unveröffentlichte, 2013 als Habilitationsschrift im Fach Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München angenommene Untersuchung von Tim Lorentzen, Bonhoeffers Widerstand im Gedächtnis der Nachwelt, Paderborn 2023 (vom Verlag angekündigt). Lorentzen unterscheidet drei Phasen kirchlicher Erinnerungskultur und Geschichtspolitik im Umgang mit dem getöteten Dietrich Bonhoeffer: eine Phase der «Martyrisierung» von 1946 bis 1961, eine Phase der «Politisierung» von 1982 bis 1989 und eine Phase der «Sanktifizierung» von 1990 bis zum 100. Geburtstag 2006. Im Blick auf die theologische Vergegenwärtigung Bonhoeffers knapp 75 Jahre nach seiner Ermordung ist eine Gleichzeitigkeit von Martyrisierung, Politisierung und Sanktifizierung beobachtbar.
7Uwe Schulz, Was wären wir ohne Dietrich Bonhoeffer? Bonhoeffer 2.0: Was er uns heute zu sagen hat (Interviews & Gespräche), Basel 2013.
8Man muss nur einen Blick auf den Streit über die Bonhoeffer-Gedenktafel der US-Regierung werfen, die anlässlich des 75. Jahrestags der amerikanischen Befreiung des Konzentrationslagers Flossenbürg, also am 19. April 2019, dortselbst im Auftrag des damaligen Berliner US-Botschafters Richard Grenell angebracht wurde, um sich klarzumachen, wie gross die deutsche Angst der Umdeutung, Usurpation und Kontamination Bonhoeffers durch die politische oder religiöse Rechte ist. Die Demarkationslinie zwischen demokratischen und nichtdemokratischen, theologisch legitimen und theologisch illegitimen Gesinnungen und Interpretationen verschiebt sich dabei weit nach links. Siehe www.sonntagsblatt.de/kz-gedenktafel-flossenbuerg-trump-rechtsextremismus. (Zugriff am 8. Februar 2022) Siehe ausserdem Bernd Vogel, Wenn ein Mensch wie Jesus gelebt hat. Dietrich Bonhoeffers Rede von Jesus Christus für uns heute, Stuttgart 2021, 12f.
9Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW 8, 555.
10Anders Otto Schnübbe, Christus und die mündig gewordene Welt. Dietrich Bonhoeffers letzte Denkphase und ihre Bedeutung für die Verkündigung heute, Hannover 1990, 78.
11Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW 8, 235
12A. a. O., 311 unter Bezugnahme auf eine Bemerkung Eberhard Bethges.
13A. a. O., 415.
14Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer. Theologie – Christ – Zeitgenosse. Eine Biografie, Gütersloh, 9. Aufl. 2005, 988.
15Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW 8, 59.
16A. a. O., 513f.
17A. a. O., 187.
18A. a. O., 235.
19A. a. O., 211.
20A. a. O., 288.
21Siehe dazu Wolfgang Huber, Dietrich Bonhoeffer. Auf dem Weg zur Freiheit. Ein Porträt, München, 3., durchgesehene Aufl. 2020, 11.
22A. a. O., 40.
23Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW 8, 561.
24A. a. O., 434.
25A. a. O., 189. Das Drama und der Roman, den Bonhoeffer verfasst hat, sind abgedruckt in: Dietrich Bonhoeffer, Fragmente aus Tegel, DBW 7, hg. v. Renate Bethge und Ilse Tödt, Gütersloh 1994. Dagegen unternimmt es Gerhard Krause in seinem TRE-Artikel, Bonhoeffer dem bürgerlichen und aristokratischen Kontext gerade zu entreissen. Siehe Gerhard Krause, Artikel «Bonhoeffer, Dietrich», in: Theologische Realenzyklopädie Bd. VII, 1981, 55–66.
26Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW 8, 434.
27Emanuel Geibel, Heroldsrufe. Aeltere und neuere Zeitgedichte, Stuttgart 1871, in dem Gedicht «Deutschlands Beruf», a.a.O., 116–118, dort 118.
28Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW 8, 391.
29A. a. O., 421.
30A. a. O., 606.
31A. a. O., 25.
32Jürgen Henkys, Dietrich Bonhoeffers Gefängnisgedichte. Beiträge zu ihrer Interpretation, München 1986, 55. Siehe auch ders., Geheimnis der Freiheit. Die Gedichte Dietrich Bonhoeffers aus der Haft. Biografie. Poesie. Theologie, Gütersloh 2005, sowie Johann Christoph Hampe, Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten. Gebete und Gedichte, München 1976.
33Grundsätzlich kritisch mit der Theologie Dietrich Bonhoeffers setzen sich insbesondere zwei grössere Monografien auseinander: Georg Huntemann, Der andere Bonhoeffer. Die Herausforderung des Modernismus, Wuppertal und Zürich 1989, sowie Klaus M. Kodalle, Dietrich Bonhoeffer. Zur Kritik seiner Theologie, Gütersloh 1991. Eine «kritische […] Relecture», eine «vorurteilsfreie […] Erörterung der Gegenwartsrelevanz» von Bonhoeffers Denken und «eine neue, reizvoll verfremdende Perspektive auf Bonhoeffers Werk» bieten dem eigenen Anspruch nach Kirsten Busch-Nielsen, Ulrik Nissen und Christiane Tietz (Hg.), Mysteries in the Theology of Dietrich Bonhoeffer. A Copenhagen Bonhoeffer Symposium, Gütersloh 2007.
34Vgl. dazu Karl Heinz Bohrer, Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins, Frankfurt a. M. 1981.
35Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW 8, 466.
36A. a. O., 228.
37A. a. O., 513.
38Karl Barth an Walter Herrenbrück am 22. Dezember 1952, a. a. O., 324 und 328.