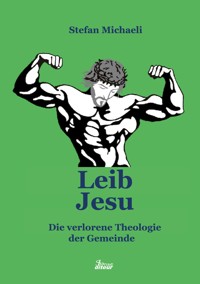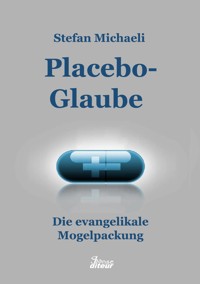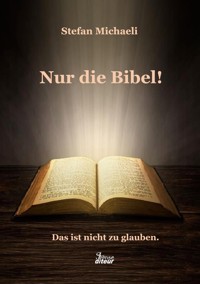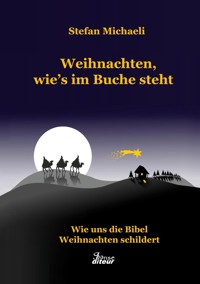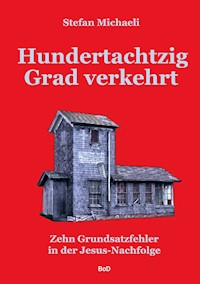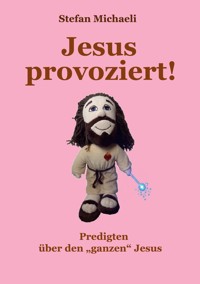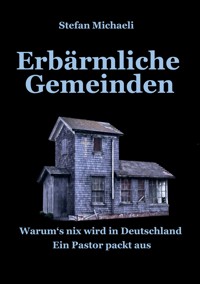
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Erfolglose Freikirchen? Warum funktionieren unsere Gemeinden nicht? Ein Pastor redet Klartext. Authentisch und ohne Blatt vor dem Mund. Ein leicht zu lesendes Buch - aber keine einfache Lektüre, sondern eine dringend notwendige Bestandsaufnahme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autor:
Stefan Michaeli ist Theologe und war Gemeindepastor in mehreren freikirchlichen Gemeinden im südlichen Deutschland. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er publiziert zum Selbstschutz unter einem Künstlernamen.
Der Autor steht gerne für Predigten, Referate, Schulungen oder Autorenlesungen zur Verfügung. Gerne kann mit dem Autor Kontakt aufgenommen werden unter: [email protected] oder über seine Webseite: stefanmichaeli.weebly.com.. Über die Webseite können auch weitere Bücher des Autors bestellt werden.
Von Stefan Michaeli liegen bisher vor:
»Erbärmliche Gemeinden« (2005/2020)
»Sterbefall Gemeinde« (2020)
»Hundertachtzig Grad verkehrt« (2020)
»Jesus provoziert!« (2021)
»Weihnachten, wie’s im Buche steht« (2023)
»Nur die Bibel!« (2023)
»Placebo-Glaube« (2025)
Allen Pastorenkollegen gewidmet, die enttäuscht, frustriert und desillusioniert ihren Dienst quittiert haben oder durch Mobbing, Intrigen und Verleumdung zum Ausscheiden aus ihren geistlichen Ämtern gezwungen wurden.
Inhalt:
Prolog
1. Mein größter Feind
2. Betonierte Omnipräsenz
3. Gemeindegründung mit „Level“
4. Unsere Gottesdienste
5. Die Pflicht zur Gemeinde
6. Sehnsucht nach „Gemeinde“
7. „Biblische“ Gemeinde
8. Verlorene retten?
9. Zum Beispiel „Willow Creek“
10. Untauglicher Lebensstil
11. Zeit für die Gemeinde
12. Gemeinschaft untereinander
13. Der Ruf zu Nachfolge
14. Gemeinde auflösen?
15. Autoritäten und Vorbilder
16. Wir züchten den Dünkel
17. Gott gehorchen
18. Menschen gehorchen
19. Die halbe Wahrheit
20. Zahlen zählen...
21. Wie denn predigen?
22. Verweltlichung
23. Geprägt durch die Bibel?
24. Der „Zehnte“
25. Tabuthema „Heilsgewissheit“
26. Mitglieder und Mitarbeiter
27. Eindeutige Bibel
28. Konfliktbewältigung mit Level
29. Fehlende Erlebnisse
30. Das „Hausschenkwunder“
31. Die großen Taten Jesu
32. Radikalität
33. Die fehlende geistliche Dimension
34. Gottes Abwesenheit
35. Wo stehen wir?
36. Was muss geschehen?
Epilog
Fünfzehn Jahre später …
Referenzen
Prolog
Dies ist ein frustrierendes Buch. Der Autor ist nämlich frustriert. Ich bin frustriert. Und zwar so sehr, dass ich ein Buch schreibe.
Dieses Buch.
Ein Buch, entstanden aus Frust. Und darum sehr unausgegoren. Da fehlt die sonst hierzulande übliche kühle Distanz. Keine überlegte Ausgewogenheit, wie sonst in solchen Büchern allgemein üblich. Auch nicht „politisch korrekt“. Manchmal schimmert sogar etwas Zynismus oder gar Sarkasmus durch. Und hin und wieder werde ich sogar persönlich und beinahe etwas gehässig.
Man wird mir darum Emotionalität vorwerfen. Sei‘s drum. Jesus war auch emotional, und der Bibel fehlt des Öftern auch die nüchterne, sachliche Distanz. Und es kommen auch die Frustrierten darin zu Wort. Diejenigen, denen es zu Halse heraushängt und denen zum Heulen ist. Einige von denen haben unverblümt davon geschrieben.
Fehlende Sachlichkeit kann man mir natürlich auch vorwerfen. Zumindest im Stil. Allerdings nicht in der Sache selbst. Denn die angeführten Beispiele sind tatsächlich passiert, fast alle davon persönlich erlebt. Und bei aller Emotionalität sind die Beispiele nach bestem Wissen und Gewissen frei von Übertreibungen.
Dann wird man mir auch Kritiksucht und Besserwisserei vorwerfen. Man wird mich „Nestbeschmutzer“ nennen und sagen: „Wer selber im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen!“. Oder noch deutlicher werden: „Mach’s doch selber besser, Du Naseweis!“
Und tatsächlich: Ich bin keinen Deut besser. Das, was ich in diesem Buch schildere, hat mich auch erfasst, hält mich gefangen. Keine Chance zu Entrinnen. Mitgefangen - mitgehangen. Mitschuldig.
Aber mit einem kleinen Unterschied: Ich bin frustriert! Offenbar im Gegensatz zur christlich-frommen Masse in unserem Land. Und das frustriert mich gleich nochmal: Dass so viele nicht frustriert sind, ja noch nicht einmal einen Anlass dazu erkennen!
Wenn Sie also nach dieser Lektüre auch frustriert sind - oder wenigstens stark verunsichert- dann freue ich mich. Zumindest darüber, dass Sie mich offensichtlich verstanden haben.
1. Mein größter Feind
„Ihr glaubt gar nicht, wie mich diese Gebetsgemeinschaften allesamt ankotzen!“
Theo, Pastor einer alteingesessenen Freikirche am Ort, war der Kragen geplatzt. Aber keiner der anwesenden Pastoren und Gemeindeleiter schaute betreten zu Boden. Alle nickten stumm. Sie wussten ganz genau, was Kollege Theo meinte. Und empfanden exakt dasselbe: „Endlich sagt es mal einer!“ Theo hatte ausgesprochen, was alle dachten.
Ich auch. Ich saß mitten drin im Pastorentreffen der evangelischen Allianz dieser Kleinstadt. Und habe mitgenickt. Es passte. Es war einfach die Wahrheit. Es traf auch auf die Gebetsveranstaltungen meiner Gemeinde zu. Vielleicht hätte ich es nicht ganz so drastisch formuliert wie Kollege Theo. Aber dass die Gebetsgemeinschaften meiner Gemeinde ein geistlicher Jungbrunnen, eine Erquickung für Herz und Seele, Höhepunkte unseres gemeinsamen Lebens mit Gott, Ausdruck unserer Liebe und Hingabe an unseren Herrn Jesus oder so was in der Art seien, hätte ich mich Sicherheit nicht behauptet. „Zum Ankotzen“, wie Theo es zu formulieren beliebte, lag wesentlich näher an der Wahrheit. Gefährlich nahe dran. Und damit viel zu weit weg von dem, was das gemeinsame Gebet eigentlich sein sollte.
Gebetsgemeinschaften „zum Ankotzen“. Soweit sind wir inzwischen. Aber solche Gebetszusammenkünfte sind nur die Spitze des Eisbergs, sozusagen einer von ganz vielen Eiterpickeln eines wuchernden, alles umfassenden Krebsgeschwürs, eine Ausgeburt des finalen Niedergangs.
Ich war damals mit meiner Familie in diese Stadt gezogen, um eine echte Herausforderung anzunehmen: Eine neue Gemeinde zu gründen an einem Ort, in dem es noch keine Gemeinde unseres Verbandes oder unserer Prägung gab. In dieser Kleinstadt warteten auch keine Christen, kein Hauskreis, keine gründungswillige Truppe auf uns. Wir mussten also beim „Punkt Null“ starten. Eine echte Herausforderung.
Nach abgeschlossenem Theologiestudium und einigen Jahren Diensterfahrung in mehreren Gemeinden habe ich es gewagt. Unser freikirchlicher Gemeindeverband gab grünes Licht und entsandte mich mit meiner Familie als Pionier-Gemeindegründer in „unsere“ Stadt.
Meine Frau und ich ahnten: Wir werden allerlei zu kämpfen haben. Wir kannten etliche Pastoren, die in Deutschland schon Gemeinden gegründet hatten oder gerade dabei waren. Und alle hatten irgendwie zu kämpfen. Manche mit sich selbst: Zeiteinteilung, psychische Belastung, einseitige Begabungen. Andere vermissten belastbare Mitarbeiter oder finanzielle Mittel. Einige kämpften gegen das Vorurteil, ein „Sekte“ zu sein und mühten sich mit vielen evangelistischen Veranstaltungen ab. Und „Anfechtungen“ waren natürlich ein Dauerthema, weil Gemeindeaufbau vor allem ein geistlicher Kampf ist.
Uns war klar: Wir werden von Herausforderungen und Kämpfen nicht verschont bleiben. Aber wer würde unser „Hauptgegner“ sein? Wogegen würden wir am meisten zu kämpfen haben? Frontlinien wird’s mehrere geben. Welche aber wird uns am meisten fordern?
Von unserem bisherigen Gemeindedienst her hatten wir so eine dumpfe Ahnung. Und diese sollte sich bestätigen. Leider.
Nicht die unbekehrte Umwelt war unser Gegner, nicht bös gesonnene Presse oder Sektengemunkel der Nachbarn. Auch nicht Konkurrenzangst anderer Gemeinden am Ort. Noch nicht mal Geldsorgen oder Zeitmangel wurden Hauptgegner, obwohl wir auch da manchmal zu kämpfen hatten. Anfechtungen erlebten wir auch, aber gegen diese hatten wir viele Beter, die unsere geplante Gemeindegründung geistlich unterstützten.
Unser Hauptgegner wurde (und ist bis heute) der „Level“. Der Level der Evangelikalen, der sogenannten „bekennenden Christen“, der Frommen – wie immer wir sie – also uns! - bezeichnen wollen.
Der Level. Was ist der „Level“?
Wir leben im Zeitalter der Computerspiele. Viele dieser PC-Spiele sind so angelegt, dass auf einem gewissen Niveau Aufgaben zu lösen sind: Steine sinnvoll stapeln, Luftballons abschießen, mit einem Joystick ein Gefährt ins Ziel steuern und Ähnliches. Wenn Du es bis ins Ziel schaffst, dann hast Du einen „Level“ erfüllt und kommst in den nächsten „Level“. Dort ist die gestellte Aufgabe etwas schwieriger, aber wenn Du diese auch lösen kannst, kommst du wiederum in den nächsthöheren „Level“. Dein Bildschirm meldet dann jeweils „Next Level“!
Der „Level“ ist also das Niveau, die Schwierigkeitsstufe, auf der du Dich bewegst. Je höher das Level, desto größere Anforderungen werden an Dich gestellt, in denen Du Dich bewähren sollst.
Das ist gemeint mit dem „Level“.
Man kann den Level auch gut mit einem sportlichen Vergleich erklären. Mir als begeistertem Fußballer fallen sofort die Ligen ein, in denen ein Verein kickt beziehungsweise ein Fußballer zum Mitkicken in der Lage ist.
Ein eher mäßiger Fußballer spielt vielleicht in einer Kreis- oder Bezirksliga. Wenn er sich weiter verbessert, kann er eventuell auch in der Landes-oder Oberliga mithalten. Und die allerbesten schaffen es dann sogar bis in die Bundesliga. Vielleicht nicht gleich in die Erste, aber darunter gibt es ja noch die Zweite und Dritte Bundesliga. Die Fußballer-Ligen in Deutschland sind eben strickt nach Leistungsklassen aufgebaut: Je besser einer spielt, desto höherklassig kann er mithalten.
Das gilt für den Einzel-Fußballer genauso wie für den ganzen Verein: Wenn das Fußballer-Kollektiv einer Mannschaft gemeinsam besser als vergleichbare Vereinsmannschaften spielt, können sie aufsteigen, nämlich in die nächsthöhere Liga. Sie spielen dann auf einem höheren Niveau oder auf einem besseren Level.
Auf welcher Stufe, oder fußballerisch gesagt „in welcher Liga“ spielen nun wir Frommen? Welchen „Level“ haben unsere Gemeinden?
Der Level ist bei uns das durchschnittliche Niveau der Christen, wie es sich in Deutschland eingependelt hat. Er ist die allgemein anerkannte Bandbreite innerhalb der Christenheit, in der sich evangelikales Leben abzuspielen hat. Bewegt sich ein Christ unterhalb dieser Bandbreite, nehmen wir sein Christsein nicht ernst; bewegt er sich hingegen oberhalb unseres Levels, ist er ein Fanatiker, ein Spinner, ein religiöser Extremist. Der Level ist das, was unsere Gemeinden als allgemein anerkannten „christlichen Lebensstil“ ansehen. Der Level ist das, wie nach unserem Verständnis ein „normaler“ Christ zu leben hat.
Dieser Level ist jedoch längst nicht mehr die jeweilige Spielklasse, in der eine einzelne Gemeinde spielt, sondern der Level hat sich hier in Deutschland über alle Gemeinden hinweg mehr oder weniger auf demselben Niveau eingependelt. Ganz Evangelikal-Deutschland spielt sozusagen in derselben frommen Liga!
Allerdings in einer beschämend niederklassigen!
Das alleine ist eigentlich schon eine ziemliche geistliche Katastrophe. Am katastrophalsten daran ist aber, dass das kaum mehr jemand wahrnimmt! Dass keiner merkt, wie unglaublich erbärmlich unser gemeinsamer Level ist!
Auch das ist in sich selbst schon wieder typischer „Level“. Es ist unter den Christen hierzulande üblich, nicht zur Kenntnis zu nehmen, was eigentlich los ist mit uns. Es gehört untrennbar zu unserem unglaublich erbärmlichen Niveau dazu, die Erbärmlichkeit unseres Niveaus zu ignorieren. Die Tatsache, dass wir den Level nicht zur Kenntnis nehmen, ist im Level inbegriffen. Unsere Ignoranz diesbezüglich ist fester Level-Bestandteil.
2. Betonierte Omnipräsenz
Unser Level hat sich inzwischen deutschlandweit und umfassend durchgesetzt. Trotz unterschiedlichsten Kirchen und Gemeinschaften haben wir in diesem einen Punkt fromme Gleichheit erreicht. Einstand allerorten.
Von „Einheit unter den bekennenden Christen“ reden wir zwar oft, diese Einheit erreichen wir jedoch nicht. Zu unterschiedlich sind die theologischen Verständnisse, die Gewohnheiten und Traditionen einzelnen Verbände. Bis auf einen einzigen Punkt. Da erreichen wir „Einheit“. Da gleichen wir uns einander rapide an, quer durch alle Fraktionen: im Level. Der Level ist unser frommer Mainstream, und er hat’s als einziger geschafft, innerhalb der erweckten Christenheit hierzulande „einheitlich“ zu werden. Bekenntnisübergreifend, alle vereinnahmend.
Unsere Mobilität macht‘s möglich. Nicht nur die fortbewegungstechnische (die auch!); vor allem aber unsere gemeindliche Mobilität. Die Frommen mischen sich fröhlich und unbekümmert querbeet durcheinander. Längst haben wir uns angewöhnt, dass wir bekenntnis- und kongregationsübergreifend Gemeinden wechseln. Solange, bis wir die diejenige gefunden haben, die uns am besten zusagt. Egal, wie sie heißt, welchem Bund sie nominell angehört und welchem Bekenntnis sie sich „pro forma“ verpflichtet fühlen sollte. Sofern eine Gemeinde einen evangelikalen Anstrich hat und der Name „Jesus“ öfters fällt, fühlt sich’s schon mal irgendwie heimatlich an. Und wenn wir dann in so einer Gemeinde auch noch nette Freunde finden, von einer einladenden Atmosphäre profitieren können und unsere persönlichen geistlichen Einsichten und Ansichten nicht allzu sehr in Frage gestellt werden, dann machen wir diese Gemeinde zu „unserer“ Gemeinde.
So haben wir uns angewöhnt, die passende Kirche oder Ortsgemeinde individuell, nach persönlichem Gusto, auszusuchen. Passt sie uns nicht oder nicht mehr, wechseln wir. Passt keine, dann haben wir eben keine. Dann bedauern wir uns, lassen uns bedauern und besuchen ab und zu mal eine Gemeinde, die leider, leider zu weit entfernt ist, um richtig dabei sein zu können. Das ist gängige Praxis.
Also ebenfalls Level.
Ingrid und Werner waren ganz begeistert, als sie zum ersten Mal unseren Gottesdienst besuchten. Die neu gegründete kleine Gemeinde hatte gerade erst mit regelmäßigen Gottesdiensten begonnen, und sie waren fortan jedes Mal dabei. Gebildete Leute, beide Akademiker mit Titel, sie sogar mit einer eigenen Praxis. Und schon seit vielen Jahren bekennende Christen, fromme Vorträge im In- und Ausland haltend, IVCG-Mitglieder und engagiert in Vorständen verschiedener christlicher Organisationen.
Beim ersten Kennenlernen erfuhr ich, dass sie schon seit mehreren Jahren in unserer Stadt lebten. Ich wollte wissen, zu welcher Gemeinde sie sich bisher gehalten hätten.
Leider, so lautete sinngemäß ihre Antwort, hätten sie in dieser Stadt keine Gemeinde gefunden und müssten darum alle paar Wochen zu ihrer über hundert Kilometer entfernten ehemaligen Gemeinde fahren, damit sie wenigstens ab und zu einen Gottesdienst mitfeiern könnten. Und in Ermangelung einer Gemeinde hier am Ort hätten sie einen eigenen Hauskreis gründen müssen, um wenigstens etwas Gemeinschaft zu haben.
Zu der Zeit war ich schon eine ganze Weile in unserer Stadt wohnhaft. Da ich in der Phase vor meiner eigenen Gemeindegründung keine eigenen Gottesdienste zu halten hatte, konnte ich mit meiner Familie die bereits bestehenden Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften der Stadt durchbesuchen und kannte sie daher alle. Mit dem einen oder anderen Pastor hatten wir uns auch schon angefreundet. Ich wusste daher, dass es in dieser Stadt mehrere Gemeinden gab, die man guten Gewissens empfehlen konnte.
Bedenkenswert - wenn nicht sogar bedenklich - war darum die Behauptung, in dieser Stadt über Jahre keine Gemeinde gefunden zu haben. Umso mehr es unbestreitbar zum biblischen Selbstverständnis christlichen Lebens gehört, dass ein Christ fest in einer Gemeinde zu Hause sein sollte. Das Neue Testament kennt ja keine Form des Christseins außerhalb einer verbindlichen Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Die meisten Aufforderungen und Lebensanweisungen des Neuen Testaments sind ohne feste Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde gar nicht ausführbar. Dazu später mehr.
Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass jeder erfahrene, langjährige Christ das längst im Neuen Testament entdeckt hat. Ingrid und Werner waren erfahrene und langjährige Christen! Aber es gehört zum akzeptierten Level hierzulande, lieber keine Gemeinde zu besuchen als eine, die nicht ganz genau den individuellen persönlichen Vorstellungen entspricht. Ingrid und Werner waren typische Level-Christen. Absolut innerhalb des Levels, aber gleichzeitig außerhalb der Bibel, die ja verbindliche Gemeinde-Zugehörigkeit voraussetzt. Und ohne irgendwelche Bereitschaft, sich selbst darüber Rechenschaft zu geben.
Sollten wir ihnen das vorwerfen? Ich habe schnell festgestellt, dass sie nicht die einzigen Christen sind in dieser Stadt, die keiner Gemeinde angehören. Zwar ist das absolut nicht in Jesu Sinn und absolut unbiblisch. Aber es ist Level! Wer denkt da schon drüber nach? Und wer wagt, diese Christen darauf hinzuweisen, dass Jesus das bestimmt nicht gut findet? Zumal, wenn es sich um hochdekorierte christliche Kapazitäten wie Ingrid und Werner handelt?
Zu meiner Nicht-Überraschung war es nach gut einem halben Jahr mit der Herrlichkeit vorbei. Frustriert verließen sie unsere Gemeinde, als sie nach und nach entdeckten, dass wir eine ungefähre Vorstellung hatten, wie unsere neugegründete Gemeinde werden sollte. Diese neue Gemeinde entsprach halt auch wieder nicht haargenau ihren Vorstellungen, genauso wie bisher alle anderen Gemeinden unserer Stadt nicht haargenau ihren Vorstellungen entsprachen.
Ich vermute, es ist mir auch nicht gelungen, den beiden bei den mühsamen „Abschiedsgesprächen“ zu vermitteln, dass offensichtlich das Hauptproblem bei Ihnen und nicht an unserer Gemeinde lag. Der Level war zu stark. Denn der Level besagt, dass es inzwischen allgemein akzeptiert ist, als Christ keine Gemeinde zu haben, oder zumindest die Gemeinden einfach immer fröhlich durchzuwechseln, wenn keine da ist, mit der man völlig übereinstimmt. Das ist Level hierzulande und gegen den habe ich als Pastor in aller Regel keine Chance, schon gar nicht, wenn die Christen Rang und Namen in der frommen Szene haben, so wie Ingrid und Werner. Da kann man als Pastor noch so gut und mit der Bibel in der Hand argumentieren.
Mitchristen wie Ingrid und Werner sind ein Extrembeispiel der „Binnenwanderung“ in unseren Gemeinden, sozusagen die Spitze des Eisbergs.
Das Angebot an Gemeinden mit unterschiedlichen Gemeindeformen ist bei uns ja enorm und dank unserer Mobilität sind meistens eine ganze Reihe davon problemlos erreichbar. Das könnt man auch als „Vielfalt im Angebot“ positiv sehen und sie als „Zielgruppenorientierte Richtungsgemeinden“ bezeichnen, unter denen jeder diejenige finden kann, die zu ihm passt. „Gottes Wiese hat viele verschiedene Blümlein“, wie das ein (katholischer) Kollege mal in einem persönlichen Gespräch über unsere konfessionelle Verschiedenheit prägnant auf den Punkt gebracht hat.
Und wenn man diese Vielfalt vernünftig ausnützt, könnte sie durchaus zu unserem Gewinn werden, bis hin zum Motto „Man muss sich ja nicht jede Gemeinde antun!“ Immerhin sind doch auch etliche Gemeinden dadurch erstarrt, dass deren Mitglieder mehrheitlich in die Gemeinde „hineingeboren“ wurden, so dass die Gemeinde irgendwann durch regelrechte Familienclans regiert wird und ihr jegliches Frischblut zur Neubelebung fehlt. Da wäre dann eine gewisse Binnenwanderung zwischen den Gemeinden durchaus hilfreich!
Und längst nicht jeder lässt sich durch die Vielzahl der Gemeindeangebote zum „Kanzelhopper“ verführen wie Ingrid und Werner. Binnenwanderung entsteht ja auch beispielsweise dort, wo jemand aus beruflichen Gründen den Wohnort wechselt, was inzwischen, statistisch belegt, eine Mehrheit der Deutschen mehrmals in ihrem Leben vollzieht. So jemand sucht sich dann am neuen Ort keinesfalls zwingend eine Kirche oder Gemeinschaft seines bisherigen Verbandes - eine Freiheit, die er sich durchaus nehmen darf.
Und deshalb präsentieren sich die Evangelikalen inzwischen als gut gemixt. Das hat Vor- und Nachteile, bietet Chancen und Gefahren. Betreffend Level hat dies allerdings eine verheerende Folge: Besagter Level pendelt sich nämlich dadurch ein und verfestigt sich quer durch die ganze Christenheit des Landes. So lange, bis er richtiggehend „betoniert“ ist. Unangreifbar, omnipräsent und alle vereinnahmend. Ein einziger, universeller, gleichgeschalteter Level.
Die größte Gefährlichkeit des Levels liegt dabei in seiner Selbstverständlichkeit. Wenn jeder Christ nach demselben Muster und auf demselben Niveau lebt, ist es egal, in welche Gemeinde du gehst, welchen Verkündiger du hörst, wer dir die Bibel auslegt: Alles wird sich innerhalb des Levels abspielen.
Logischerweise stellt dich also auch niemand in Frage, fordert dich keiner heraus, zwingt dich nichts zu neuen Gedanken – solange du innerhalb des Levels bleibst. Im Gegenteil: Innerhalb des Levels wirst du jeden Tag aufs Neue bestätigt. „Alle anderen sehen und leben das ja genauso! Also bin ich auf dem richtigen Weg; denn eine Mehrheit von 100% kann nicht irren, oder?“ Beruhigend zu wissen!
Warum also solltest du selbständig über das in deiner Gemeinde gelebte Niveau nachdenken? Und dich womöglich noch in Frage stellen?
Wozu auch! Es könnte ja höchstens sein, dass du irgendetwas ändern müsstest. Im schlimmsten Fall so, dass du aus dem Level der allgemeinen frommen Masse herausfällst. Damit würdest du dann aber zum Außenseiter, zum Besserwisser, zum Extremist. Wer möchte das schon? Wer riskiert so was?
Nein, dann lieber bequem angepasst bleiben.
Zwar: In unserer Kirchengeschichte entdecken wir anderes. Fast alle unserer Kirchenväter sind deswegen „Kirchenväter“ geworden, weil sie den Level der damaligen Christenheit verlassen haben. Sie haben gewagt, unabhängig zu denken und manche ihrer Erkenntnisse sogar zu leben! Keine Reformation, keine Mönchsorden, keine diakonischen Werke usw. ohne Menschen, die wenigstens einmal im Leben den Mut hatten, auszusteigen aus dem gängigen Level.
Und noch etwas weiter zurückblickend sehen wir Jesus. Das ist der, den wir „Herr“ nennen und als unser „Vorbild“ bezeichnen. Und ausgerechnet er war schlichtweg der Prototyp des Aussteigers aus dem vorherrschenden frommen Level. So dass wir eigentlich davon ausgehen sollten, dass das Aussteigen aus dem Level geradezu kennzeichnend für echtes, lebendiges Christsein sein müsste.
3. Gemeindegründung mit „Level“
Zurück zu unserer Gemeindegründung.
Eine Gemeinde ganz neu aufzubauen, ist eine echte Chance. Das war für uns eine wichtige Triebfeder zur Gemeindegründung. Man muss nicht alle Schwächen und Fehler, die man bisher im Gemeindedienst kennengelernt hat, wiederholen. Neues kann entstehen: eine neue Gemeindeform; neue Ziele; neues Verständnis von Christsein, Zusammengehörigkeit und geistliches Leben. Eine neu entstehende Gemeinde hat noch keine verkrusteten Traditionen, keine eingespurten Gleise, kein „Das haben wir schon immer so gemacht!“. Alles kann vorgreifend überdacht, konzipiert und dann sorgfältig eingeführt werden.
Wenn man diesen Traum zu Ende träumt, könnte man also auf eine schöne, dynamische und funktionierende Gemeinde hoffen, oder? Dachten wir. Und das hört sich in der Theorie auch gut an. Eines nur steht dem in der Praxis entgegen. Das aber mit aller Gewalt.
Sie wissen schon: Der Level.
Wie bei den meisten Gemeindegründungen ist die neue Gemeinde erst mal ein Sammelbecken vieler unterschiedlicher Christen. Man wünscht sich zwar, dass sich von Anfang an sofort viele Menschen für Jesus entscheiden und dass man mit diesen „Neubekehrten“ die neue Gemeinde bilden kann. Aber wirklich von Anfang an evangelistisch gleich wirkungsvoll zu sein, gelingt selten. Und wenn, dann ist man doch auf einen Grundstock von bewährten und erfahrenen Mitarbeitern angewiesen, um die anfallende Arbeit zu bewältigen.
Auch wir waren darum vorerst eine typische „Sammelgemeinde“. Manche, wie z.B. Ingrid und Werner, hatten uns beschnuppert und gingen wieder. Diejenigen, mit denen wir schließlich die Gemeinde formell gründeten, waren fast alle kürzlich zugezogen. Manche kamen nicht aus unserem Gemeindeverband; wir waren folglich eine ziemlich bunte Truppe. In manchen Ansichten und Fragen waren wir durchaus nicht einer Meinung. Wir konnten uns aber immerhin auf ein Gemeindemodell einigen, das wir gemeinsam verwirklichen wollten. In der Theorie zumindest. Diese Theorie brachten wir auch zu Papier, so dass jeder lesen konnte, was für eine Gemeinde entstehen sollte.
In der Praxis hat dann sofort der Level zugeschlagen. Dem Level waren Einigkeit in der Theorie und unser wunderbar formuliertes Papier absolut keine Hindernisse, viele der guten Ansätze sofort im Keim zu ersticken.
So war uns beispielsweise in der Theorie klar, dass wir unsere Gottesdienste „besucherfreundlich“ gestalten wollten. Der Hintergrund dieses Gedankens ist die inzwischen weit verbreitete Erkenntnis, dass viele unserer Gottesdienste für „entkirchlichte“ Menschen viel zu fromm sind. Manche Elemente darin sind Erstbesuchern, die lange nicht mehr in einer Kirche oder Gemeinde waren, so fremd, dass sie sich unwohl fühlen und kein zweites Mal kommen. Willow Creek hat diese Erkenntnis ja nicht nur verbreitet, sondern demonstriert sie anschaulich in ihrer Gemeindearbeit in Chicago.
Nun war mir als Gemeindegründer natürlich klar, dass wir nicht gleich mit „Gottesdiensten für Suchende“ à la Willow-Creek starten konnten. Aber so die eine oder andere Einsicht aus diesen Erkenntnissen könnte man ja verwirklichen. Immerhin sollten wir uns in Deutschland ja wahrlich nicht rühmen, mit unseren Gottesdiensten die Massen zu entzücken und Menschen in Scharen zu Jesus zu führen. Es ist unbestritten wahr, dass sich in unseren Gottesdiensten vorwiegend unsereiner wohl fühlt. Und zwar exklusiv!
Allerdings fühlen wir uns dann auch wieder nicht so sehr wohl, dass wir auch den Mut hätten, unsere Nachbarn oder Arbeitskollegen dahin mitzubringen. Wir ahnen nämlich: Unsere Gäste kämen nur einmal! Oder, um es etwas deutlicher auszudrücken: Was wir in manchen Gottesdiensten machen, ist zwar durchaus irgendwie fromm, aber für Nichteingeweihte gleichzeitig auch wieder so peinlich, dass es gut ist, wenn wir unter uns bleiben ...
Unsere Gemeindegründung hatte sich also der Frage zu stellen: Wie sollen wir unsere Gottesdienste gestalten, damit wir jederzeit und ohne Bedenken kirchenfremde Freunde dazu einladen können?
Ich gab dazu unter anderem diese Parole aus: „Lasst uns grundsätzlich auf „Gebetsgemeinschaften“ im Hauptgottesdienst verzichten“! Dies habe ich mit guten Argumenten belegt. Zum Beispiel diesen: Wer nicht regelmäßig in unseren Kreisen verkehrt, der kennt diese freie Form des Betens nicht. Außerdem kriegt er Angst, wenn links und rechts von ihn losgelegt wird - weil er nicht weiß, nach welchem Schema diese einsetzen und ob nicht zu guter Letzt auch er noch „muss“. Und was ist, wenn keiner betet? Warten jetzt alle auf ihn oder was? Kurz: Gebetsgemeinschaften verursachen Unwohlsein bei unseren Gästen. Umfragen bestätigen dies. Also: Keine freien Gebetsgemeinschaften in unserem Sonntagmorgengottesdienst. Wir Frommen kommen trotzdem nicht zu kurz, denn diese Form des Betens pflegen wir ja trotzdem in den Hauskreisen und diversen Gebetstreffen der Gemeinde. Außerdem boten wir für uns Mitarbeiter – wie in vielen Gemeinden üblich – eine Gebetsgemeinschaft jeden Sonntag vor dem Gottesdienst an.
Allgemeine Zustimmung im Gemeindegründungsteam. So wollen wir es halten.
Bis Hermann zum ersten Mal dran war mit der Leitung des Gottesdienstes. Fröhlich stand er sonntags vorne und schon nach fünf Minuten forderte er die versammelte Gottesdienstgemeinde zur Gebetsgemeinschaft auf.
Nein, er habe unsere Abmachung nicht vergessen, versicherte mir Hermann nach dem Gottesdienst. Aber er fände diese Regelung halt blöde, denn so eine Gebetsgemeinschaft gehöre doch zur „Identität“ unseres Christseins dazu und ergo sollten wir doch im Gottesdienst nicht unsere „Identität verleugnen“ und könnten das den Gästen ruhig zumuten usw.
Ich versuchte ihm nochmals einfühlsam zu erklären, was der Sinn der Abmachung wäre und dass wir vielleicht als Christen nicht verpflichtet seien, gleich bei jeder Veranstaltung sofort 100% unserer „Identität“ vorzustellen, umso mehr ja jeder Gast durchaus auch zu unseren Gebetsversammlungen oder in die Hauskreise eingeladen werden könne, um uns „identischer“ zu erleben. Ob wir nicht vielleicht den Gästen zuliebe und um des evangelistischen Auftrags willen in unseren Hauptgottesdiensten darauf verzichten könnten? Außerdem hätten wir uns ja darauf verständigt und es wäre hilfreich, wenn wir uns vorerst mal an die gemeinsam getroffenen Abmachungen halten würden.
Nein, es war nichts zu machen. So sehe er das nicht und überhaupt müsse dieser Punkt unbedingt in die nächste Hauptversammlung aller Gemeindeglieder. So geschah es, und siehe da: Der Level feierte fröhliche Urständ. Hermann hatte inzwischen einige Meinungssympathisanten um sich geschart und so begann unausweichlich die große Diskussion über Sinn und Unsinn dieser Regelung. Hinter allen Argumenten stand bald eine Botschaft ziemlich deutlich im Raum: Wir möchten eigentlich nicht auf unsere geliebte Gebetsgemeinschaft im Gottesdienst verzichten. Denn so sind wir das gewohnt, Gäste hin oder her.
So deutlich wagte es zwar keiner zu sagen. Wie üblich kreisten die Argumente hartnäckig um den heißen Brei herum. Aber eines war unüberhörbar: Der Level lebt!
Was ist uns Christen die Rettung einiger Menschen wert gegen die Preisgabe unserer geliebten Gewohnheit, im Gottesdienst unsere Gebetsgemeinschaft halten zu dürfen?
So deutlich habe ich dann in dieser Gemeindeversammlung nicht zurückgefragt. Etwas feige vielleicht. Allerdings habe ich dadurch vermieden, dass einige Mitarbeiter wutentbrannt den Saal (und vielleicht auch gleich noch die Gemeinde) verlassen haben. Denn der Level darf bei vielen Christen nur mit äußerster Vorsicht angetastet werden ...
Übrigens hat mir Hermann unbeschwert und fröhlich verraten, dass er eigentlich noch nie mit einem Gast über seine Empfindungen nach dem ersten Gottesdienst gesprochen habe. Natürlich schon gar nicht über seine Eindrücke während einer „Gebetsgemeinschaft“. Danach hatte ich ihn extra noch gefragt ...
Kurze Zeit später kam die Frage nach dem „Herrnmahl“ oder „Abendmahl“ auf. Dieses hatten wir bis zur Gemeindegründung nur bei besonderen Anlässen, etwa während einer Freizeit, gefeiert. Bis dann eine Mitarbeiterin den Wunsch äußerte, dass wir es doch öfters feiern mögen. Auch andere stimmten sofort zu, und ich habe mich von Herzen gefreut, dass dieser Wunsch aus der Gemeinde kam. Als wir dann austauschten, an welcher Stelle im Gemeindealltag wir regelmäßige Mahlfeiern planen sollten, war’s mit der ungetrübten Freude schnell vorbei. Die meisten hatten dies bisher im Gottesdienst erlebt. Meine Argumentation war dieselbe wie bei der Gebetsgemeinschaft: Was empfinden Gäste dabei (ist ja durch Umfragen längst geklärt: Unwohlsein!)? Würde nicht viel dafür sprechen, es beispielsweise als separate Abendveranstaltung mit viel Zeit drumherum zu planen?
Die Diskussion gipfelte in den Vorschlag, man möge doch probehalber erstmal eine Mahlfeier an einem Wochentagsabend und eine zweite in einem Sonntagsgottesdienst machen und danach entscheiden, wie man es weiterhin halten möge.
Vermutlich war dieser Vorschlag als Kompromiss gedacht und als Versuch, die zunehmend mühsamer werdende Diskussion zu beenden. Letzteres gelang dann auch. Nur: Es war de facto natürlich kein Kompromiss, sondern typischer Level-Ausfluss. Man überlege nur mal, was die Durchführung der beiden Anlässe zur Entscheidungsfindung im günstigsten Fall beitragen könnte: Ein Argument namens „so hat es mir aber besser gefallen!“. Und Gäste, auf die wir doch besonders Rücksicht nehmen wollten, kann man dabei natürlich nicht nach ihrem Eindruck fragen, da solche mit ziemlicher Sicherheit weder bei der einen noch bei der anderen Form anwesend sein werden. Ein sinnloser „Kompromiss“ also.
Damit sind wir wieder bei demselben Level wie beim Thema „Gebetsgemeinschaft im Gottesdienst“ angelangt: „Was kümmern uns die Gäste? Hauptsache, wir haben alles wieder dort, wo wir’s uns eh‘ gewohnt sind. Hauptsache, wir selber fühlen uns wohl!“
Gleichzeitig besteht aber nach wie vor große Einigkeit darin, dass unsere Gemeinde bewusst „besucherfreundlich“ sein soll! Daran wurde auch in den heftigsten Diskussionen nicht gerüttelt. Allerdings nicht um den Preis, das Mahl des Herrn zu verschieben oder auf die gewohnte Gebetsgemeinschaft im Gottesdienst zu verzichten.
Es lebe der Level!
Es könnte nun der Eindruck bestehen, der Level bestünde darin, dass halt die Christen in Deutschland nicht gerne von ihren Gewohnheiten lassen würden. Das stimmt zwar auch, aber das ist nicht der wahre Level, um den’s eigentlich geht.
Denn der Level, der hinter den eben genannten Beispielen sichtbar wird, ist ein viel schlimmerer: Es ist unter den Christen in Deutschland inzwischen gang und gäbe, die eigene Befindlichkeit, das eigene Wohlbefinden als oberste Priorität unseres geistlichen Handelns zu sehen. Auch dem Missionsbefehl unseres Herrn übergeordnet!
Dass wir Gottesdienste, in denen wir uns wohl fühlen, nicht gerne verändern, ist ein natürlicher und logischer Impuls. Allerdings kostet es auch nicht sehr viel, diesen Impuls mal zu überwinden. Es würde ja schon reichen, sich der Vorstellung hinzugeben, dass eine Veränderung gleichzeitig eine Verbesserung bedeuten könnte.
Das ist gerade so, wie wenn Du entspannt und bequem im Liegestuhl liegst und jemand zu dir sagen würde: „Steh‘ bitte auf und hilf mir mal eben!“ Dein erster Impuls ist dann: „Nee, keine Lust. Ich fühle mich wohl, möchte gerne liegenbleiben!“
Was braucht es nun, damit du doch aufstehst und deine Bequemlichkeit überwindest? In der Regel reicht ein kleiner Impuls wie etwa der, dass du vielleicht die Person, die dich fragt, magst. Und sie deswegen nicht enttäuschen möchtest. Oder du verstehst, dass die Sache, bei der du helfen solltest, eine gewisse Wichtigkeit hat. Oder vielleicht wird Dir mitgeteilt, Du solltest aufstehen, um gemeinsam eine Kiste perfekt gekühltes Bier für die Runde herzutragen, aus der du dann die erste Flasche entnehmen darfst. Und schwupps: Schon ist deine Lust dazu größer als deine Bequemlichkeit!
Ein kleiner Impuls nur genügt. Ein kleiner Impuls, der dir sagt: Aufstehen wäre jetzt lohnenswerter als weiterfaulenzen. Und schon gibst du deine Bequemlichkeit auf.
Welcher kleine Impuls könnte uns bewegen, unsere Bequemlichkeit als Christen aufzugeben? Was könnte uns bewegen, eine liebgewordene Gewohnheit - wie etwa die Gebetsgemeinschaft oder das Herrnmahl im Gottesdienst – preiszugeben?
Die Liebe zur Sache Jesu beispielsweise könnte ein kleiner Impuls sein, oder auch die Liebe zu den Menschen, die verloren gehen, gepaart mit der Einsicht, dass die Rettung dieser Menschen eine gewisse Wichtigkeit hat.
Aber wir kriegen unseren Hintern nicht hoch. Da kann Jesus bitten, wie er will. Statt uns zu erheben, singen wir ihm frohgemut unser „Wir lieben dich, o Herr!“ in endlosen Anbetungsliederschleifen zu. Er kann uns den Aufbruch auch befehlen, z.B. im wohlbekannten Sendungsbefehl nach Matthäus 28,19+20: „Geht hin in und macht zu Jüngern...“. Wir erheben uns trotzdem nicht, beten ihn aber in großer Selbstverständlichkeit weiterhin als „Herrn“ und „König“ an. Selbst wenn er uns – voller Verzweiflung über unsere Untätigkeit - die Konsequenzen vor Augen malt wie z.B. in Matthäus 7,19: Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen: Nein, auch das kann uns nicht erschüttern. Es werden schon irgendwelche anderen gemeint sein...
Wie gesagt: Man würde meinen, ein kleiner Impuls sollte genügen, um unsere Bequemlichkeit zu überwinden. Aber welche Impulse der Bibel können uns noch erreichen? Für wie kleinlich halten wir eigentlich die Impulse unseres Herrn? Und wie groß ist unsere Liebe zu ihm und zu den verlorenen Menschen?
Nochmal zur Erinnerung: Es geht hier nicht darum, dass wir uns aufmachen, um höchstpersönlich und zu Fuß die ganze Welt für Jesus zu erobern, sondern nur um die Frage, ob wir vielleicht bereit wären, auf die eine oder andere Gewohnheit im Sonntagsgottesdienst zu verzichten. Wobei es noch nicht mal ein echter Verzicht wäre, sondern vielleicht nur das Verschieben des einen oder anderen Elements vom Sonntag auf eine Wochenveranstaltung ...
Mit unserer Bibelkenntnis und mit unseren verbalen Behauptungen, dass wir unseren Herrn nicht nur kennen, sondern ihn sogar lieben und ihm darum nachfolgen und gehorchen wollen, müsste uns längst der Hintern brennen diesbezüglich! Tut er aber nicht.
Warum nicht?
Ganz einfach: Der Level! Die lieben Mitchristen links und rechts und alle in der Gemeinde und auch die von der Nachbargemeinde und die von zwei Ortschaften weiter, und die, die Tante Lili besucht, und alle anderen im ganzen Land tun es doch auch nicht! Wir haben halt unseren Level!
Die biblischen Aussagen wären klar. Und das Wissen, dass ein wesentlicher Hinderungsgrund unserer evangelistischen Bemühungen unsere überfrommen Gottesdienste sind, ist auch längst da. Wer unseren Stil nicht gewohnt ist, fühlt sich nicht wohl im Gottesdienst. Und die Menschen, die wir erreichen wollen und gemäß Jesus Auftrag auch sollen, sind unsere angewöhnten Sitten und Gottesdienstgepflogenheiten tatsächlich nicht gewohnt. Darum kommen sie genau ein einziges Mal und danach nie wieder. Das ist einfach so, und alle Christen in leitenden Ämtern müssten das wissen. Sonst gehören sie nicht in leitende Ämter.
Aber darüber kann man sich derzeit den Mund fusselig reden, Umfragen und Erhebungen diesbezüglich präsentieren, das Modell „Willow-Creek“ multimedial vorstellen, passende Bibelaussagen dazu rezitieren, auf die Verlorenen hinweisen und Jesu unbedingten Willen zur Menschenrettung betonen: Keine Reaktion! Auf ein paar gewohnte Gottesdienstelemente zu verzichten ist bei der Mehrheit der Christen nicht drin. Auch nicht um den Preis, dass vielleicht einige Nachbarn sich für Jesus interessieren könnten. Das ist es uns offensichtlich nicht wert. Das eigene Wohlbefinden ist Maßstab aller Gemeindearbeit.
Warum steht eigentlich keiner auf und ruft mal laut und vernehmlich – stellvertretend für Jesus - in die Runde: „Was nennt ihr mich aber „Herr, Herr“, und tut nicht, was ich euch sage!“ (Lukas 6,46)?
Ganz einfach: Weil diese unglaubliche Ignoranz von Jesu Sendungsbefehl Level ist in Deutschland. Man darf so sein. Nicht nur ungestraft, sondern von allen anerkannt. Wer also so ruft und vielleicht auch noch was ändern will an unserem Gottesdienst, der fällt aus dem Level. Er ist ein Störenfried und riskiert, wenn er nicht zum Schweigen gebracht werden kann, Amt und Würden in seiner Kirchengemeinde.
Aber die meisten rufen schon deswegen nicht, weil sie hier gar kein Problem sehen. Der Level hat längst über Jesus gesiegt: Was Jesus will, ist uns weitestgehend bedeutungslos. Der Level ist stärker. Der Level zählt, nicht Jesus.
So ist das hierzulande mit dem Level, und wenn Sie der Meinung sind, dass ich übertreibe, dann schauen sie sich um in den Gottesdiensten hierzulande. Beginnen Sie damit in ihrer eigenen Gemeinde (sofern sie überhaupt eine haben).
Natürlich, nicht überall ist das Level. Es gibt ein paar hoffnungsvolle Ansätze, sogar in Deutschland. Aber eine Trendwende beim Level ist das bei Weitem noch nicht!
4. Unsere Gottesdienste
Bleiben wir noch etwas bei unseren Gottesdiensten. Sie sind nun mal der wöchentliche Höhepunkt unseres christlichen Lebens und das Aushängeschild unserer Kirchen und Gemeinden. Wer uns kennen lernen will, besucht zuerst einmal unseren Gottesdienst. Es ist unser kirchengeschichtliches Erbe, dass wir uns hauptsächlich über unsere Sonntagmorgen-Veranstaltung definieren. Und nirgendwo wie dort präsentieren wir uns unseren Gästen und Besuchern.
Wir Evangelikalen machen hier keine Ausnahme. Auch wir sehen im Sonntagsgottesdienst die wichtigste regelmäßige Veranstaltung des Gemeindelebens. Da trifft sich die Gemeinde, oft sogar recht vollzählig. Kein Wochenanlass erreicht solch hohe Besucherzahlen wie der Sonntagsgottesdienst. Und wenn manche Mitglieder sich rarmachen und selten zu sehen sind – wenigstens zum Gottesdienst am Sonntag kommen sie dann doch noch.
Darum legen sich Pfarrer, Pastoren und Gemeindeleiter gerade für den Gottesdienst immer stark ins Zeug. Sie wissen: Da haben wir das Publikum, die Gemeinde ist da. Was die Gemeinde braucht – geistlicher Impuls, Tröstung, Ermutigung, Korrektur usw. – wird also mit Vorliebe sonntags verabreicht.
Gleichzeitig sind sich aber viele Kirchen und Gemeinschaften durchaus bewusst, dass ihr Gottesdienst auch das Aushängeschild für Neugierige ist. Ergo bemüht man sich auch um ansprechende Gestaltung und gute Atmosphäre. Vor allem in den Gemeinden, die den Wunsch haben, dass aus zufälligen oder gelegentlichen Besuchern regelmäßige Teilnehmer werden. Oder die gar den Gottesdienst als evangelistische und missionarische Chance verstehen.
Und das sind viele! Zumindest nach deren Selbstaussage. Bei der Frage nach dem Sinn des Gottesdienstes wird natürlich in erster Linie die Selbstauferbauung der Gemeinde genannt. Aber oft schon im gleichen Atemzug bekennen manche, dass man durch die Gottesdienste auch Menschen erreichen möchte, die eigentlich mit Glauben noch nicht viel am Hut haben.
Der Sonntagsgottesdienst als Hauptveranstaltung. Für Gäste genauso wie für die Gemeinde. Er liegt uns besonders am Herzen. Was tun wir für ihn?
Nun, er liegt uns nicht wirklich am Herzen. Ich zumindest zweifle offen daran. Es dürfte sich vielmehr um ein Lippenbekenntnis handeln. Und dafür gibt’s durchaus begründete Anhaltspunkte.
Bevor wir unsere Gemeinde gründeten, haben wir erst einmal nur am Aufbau von Hauskreisen gearbeitet. Da gab es noch keine eigenen Gottesdienste, und ich habe in dieser Zeit oft Predigtvertretung in befreundeten Gemeinden gemacht. Aber auch jetzt noch bin ich sonntags recht häufig in anderen Gemeinden zu Gast.
Vor kurzem war ich in einer kleinen Gemeinde in der Nähe Münchens zum Predigtdienst eingeladen. Sicherheitshalber fahre ich jeweils rechtzeitig los und bin dann oft auch sehr zeitig da. So auch diesmal: Rund eine Stunde vor Gottesdienstbeginn kam ich dort an. Die junge freikirchliche Gemeinde traf sich in Ermangelung eigener Räume in einem öffentlichen Gebäude. Was bedeutet, dass jeden Sonntag der Saal hergerichtet werden muss.
Im Flur traf ich auf ein etwa dreijähriges Mädchen. Es schob einen Rollwagen mit vier Stapelstühlen darauf Richtung Saal. Sie gab artig Auskunft nach ihrem Namen und führte mich zu ihrem Papa. Dieser war der Pastor der Gemeinde, den ich schon von einer Konferenz her kannte. Er war mit seiner Familie – Ehefrau und zwei süßen kleinen Mädchen – dabei, die Stühle für den Gottesdienst hinzustellen. Nur diese Familie war da, sonst niemand aus der Gemeinde. Als alle Stühle standen, holte der Pastor die Verstärkeranlage aus seinem Auto und baute diese auf. Seine Frau schleppte inzwischen Bücherkisten. Ich half ihr, den transportablen Büchertisch aufzubauen. Wir waren immer noch ganz unter uns.
Etwa eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn erschienen weitere Personen. Der junge Pastor hatte mich schon informiert: Diese wollten vor dem Gottesdienst gemeinsam beten. Also wurde ein Kreis von sechs oder sieben Stühlen aufgestellt, ein Lied gesungen und dann gebetet. Das heißt, wir wollten zu beten beginnen. Aber da gerade zwei weitere Mitarbeiter eintrafen, gab‘s erst mal eine Kreiserweiterung mit geräuschvollem Stühlerücken auf den Steinfliesen. Während den dann folgenden etwa 15 Gebetsminuten wiederholte sich das mehrfach. Am Ende der Gebetszeit hatte sich der Kreis mehr als verdoppelt. Einen großen Teil der Gebetszeit hatten wir leider nicht mit Beten, sondern mit Stühle hin- und herschieben verbracht.
Als dann der Gottesdienst mit ein paar Minuten Verspätung begann, war der Saal zur Hälfte gefüllt. Ich saß wie üblich als Verkündiger ganz vorne. Nach einer Viertelstunde trat ich vor zur Kanzel, drehte mich um und sah zu meinem Erstaunen, dass der Saal jetzt bereits zu 90% gefüllt war. Aber glauben sie ja nicht, dass es nicht auch noch einige geschafft hätten, fast eine halbe Stunde zu spät zu kommen...
Nach dem Gottesdienst war ich bei Pastors zu Hause zum Mittagessen eingeladen. Im Kreise seiner Familie habe ich dann meinen Kollegen gefragt, wieso eigentlich keiner aus seiner Gemeinde zu Hilfe komme beim Saal einrichten und ob er das jeden Sonntag allein mit seiner Familie mache. Die Frage ist natürlich sinnlos und interessierte mich nicht wirklich. Ich habe sie ja schon oft mit Pastoren erörtert, deren Gemeindeglieder genauso lustlos alles ihrem „Hirten“ überlassen. Immer wieder interessant ist aber jeweils der Versuch meiner Kollegen, eine halbwegs sinnvolle Antwort zu finden auf eine unverschämte Unsitte, die jeglichen Sinn vermissen lässt. Auch dieser Kollege hatte eine interessante Interpretation, mit der er die Unlust seiner Gemeindeglieder zu kaschieren versuchte: Viele seiner Gemeindeglieder hätten eben Kinder und dann sei das sonntagmorgens nicht so einfach; Stichwort „aufstehen“ undsoweiter-bla-bla-bla. Wir lachten dann gemeinsam über den Irrwitz dieser Aussage. Wie wenn Pastorenfamilien Kinder vom anderen Stern hätten ... Und dann haben sie mich noch darüber informiert, dass ja eigentlich noch eine Person mehr beim Aufstellen zugegen gewesen sei: die bücherkistenschleppende Frau Pastor war nämlich gerade schwanger...
Aber natürlich: Auch in dieser Gemeinde ist der Gottesdienst die Veranstaltung der Woche!
Stimmt. Für die Pastorenfamilie sicherlich!
Lassen Sie uns wetten: Hätte ich die geneigten Gemeindeglieder gefragt, sie hätte mir genauso mit dem Brustton der tiefsten Überzeugung versichert, dass keine Veranstaltung der Gemeinde so wichtig sei wie der sonntägliche Gottesdienst! Und hätten nächsten Sonntag wieder den Hintern nicht aus dem Bett gekriegt zur Hauptveranstaltung für ihren Herrn und Meister, der ihr Leben regiert und sie zu total neuen Menschen wiedergeboren hat und ihr Heiland und Erlöser sei undsoweiter undsoweiter ...
Habe ich eigentlich vergessen zu sagen, wann der Gottesdienst begann? Um 11:00 Uhr. Das nur für alle diejenigen, die noch immer die Illusion pflegen, in ihrer Gemeinde wäre das alles ganz, ganz anders, wenn man nur den Gottesdienst später ansetzen würde. Denkste!
Einige Wochen später war ich in einer anderen Gemeinde derselben Kongregation. Dort begann der Gottesdienst um 10:00 Uhr, die Pünktlichkeit war leicht besser. Dafür war die Gebetsgemeinschaft vor dem Gottesdienst das, was derzeit etwa erwartet werden kann hierzulande: 7 Minuten vor dem Gottesdienst standen wir zu dritt im leeren Kinderbetreuungsraum und jeder hat ein Gebet gesprochen. Natürlich mehrfach gestört durch Eltern mit Kleinkindern, die rein wollten, und der mitbetende Gottesdienstleiter hätte sich eigentlich so kurz vor Gottesdienstbeginn um ganz anderes kümmern müssen ...
Aber sei’s drum. Der Rest der Gemeinde sah wie allerorten das gemeinsame Gebet für den Gottesdienst offensichtlich als durchaus verzichtbar an.
Genauso wie die Gemeinde, die mich zu zwei evangelistischen Veranstaltungen einlud. Ein thematischer Vortrag am Samstagabend, eine evangelistische Predigt im Gästegottesdienst am Sonntag. Gebet? Fehlanzeige. Weder fanden sich am Samstagabend Menschen etwas früher ein, um wenigstens noch kurz zu beten, noch am Sonntagmorgen. Ich war nicht zum ersten Mal in dieser Gemeinde, und bisher gab’s wenigstens sonntags kurz vor Gottesdienstbeginn noch eine fünfminütige Gebetsgemeinschaft mit Verkündiger und zwei bis drei Ältesten in einem Nebenraum. Beim evangelistischen Gästegottesdienst haben sie auf diese fünf Minuten auch noch verzichtet – macht das Sinn?
Grassierende Gebetsunlust. Da erzählt Jesus das Gleichnis von der bittenden Witwe: Sie belästigt mit ihren Sorgen den Richter so lange, bis er nachgibt – nur um seine Ruhe zu haben (Lukas 18). Oder Jesus erzählt von dem Gastgeber, der mitten in der Nacht seinen Freund weckt und um Brot bittet, weil er überraschend Gäste erhalten hat (Lukas 11). Beide Male will Jesus Mut machen zum Gebet: Ihr dürft Gott unablässig in den Ohren liegen wie die bittende Witwe oder zu jeder Unzeit zu ihm kommen wie der um Brot bittende Freund …
Wir aber haben keine Lust dazu. Auch nicht vor dem ach so wichtigen Gottesdienst, noch nicht mal vor der Evangelisationsveranstaltung. Wir machen’s mit unserem Bemühen, Verlorene zu retten, etwa so wie der Urlauber, der vom Strand aus einen Ertrinkenden sieht. Er erhebt sich und geht zur Rettungsstation. Dort hängt ein Telefon sowie ein Hinweisschild, wer im Notfall sofort zu verständigen sei. Das ist dem Urlauber aber zu umständlich, also schnappt er sich einen Rettungsring und sagt sich: „Kann ich auch gleich selber machen...“. Zurück am Strand merkt er, dass er den Rettungsring nicht weit genug werfen kann. Er schmeißt trotzdem – vielleicht treibt ja eine zufällige Strömung den Ring in die richtige Richtung. Dann legt er sich wieder in die Sonne und sagt zu seiner Frau: „Funktioniert nicht, das Rettungssystem. Aber vielleicht war da draußen gar keiner am Ertrinken, jetzt höre ich auf jeden Fall keinen Hilferuf mehr.“ Und schmollt noch Stunden später ganz entrüstet: „Und dafür habe ich jetzt eine ganze Viertelstunde meines wertvollen Urlaubs geopfert! Von jetzt an können die da draußen rufen solange sie wollen ...“.
Aber das Beispiel hinkt natürlich, schon gleich am Anfang: Warum steht der Urlauber denn überhaupt auf? Schon dies wäre vermutlich für manchen unserer „Gottesdienstgenießer“ schon ein völlig unzumutbarer Aufwand…
Jeden Sonntag dasselbe: Der Gottesdienst ist unsere Hauptveranstaltung, aber dafür beten? Sollte etwa unser Herr gesagt haben: „Bittet, so werdet ihr nehmen!“ (Johannes 16,24) oder „Wieviel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!“ (Matthäus 7,11)? Und wenn schon. Auch wenn uns der Apostel Jakobus aufklärt: „Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet!“ (Jakobus 4,2): Macht nichts. Wir „haben“ ja: ziemlich lange ein warmes Bett und allsonntäglich ein Pastor, der uns den Saal einrichtet. Wahrscheinlich wird er auch - stellvertretend - für den Gottesdienst beten. Aber das wissen wir nicht so genau, denn wir sind halt nicht dabei beim Gebet. Wir werden ja auch nicht dafür bezahlt wie unser Herr Pfarrer. Eben.
Aber bekehrt sind wir. Und bekennend. Und leben nach der Bibel. Und haben einen Herrn, dem wir „bedingungslos“ folgen. Zumindest behaupten wir das, und zwar so überzeugend, dass wir selbst davon überzeugt sind.
Unser Herr allerdings hat öfters mal ganze Nächte durchgebetet. Das allerdings tun wir nicht. Nicht mal für eine Viertelstunde vor unserer Hauptveranstaltung, in der wir großen Segen für uns erwarten und unseren Gästen Jesus ans Herz legen möchten. Nein, das tun wir nicht – ansonsten aber folgen wir ganz, ganz treu unserem Herrn.
Schön wär’s. Ist aber nicht schön, sondern Level. Typischer, scheinfrommer Level. Umfassend und überall anzutreffen.
Mir graust.
5. Die Pflicht zur Gemeinde
Jesus lässt sich foltern, verhöhnen und ans Kreuz nageln. Man darf ihn mitten ins Gesicht schlagen, anfluchen und anspeien. Er lässt alles mit sich machen, erträgt alles.
Warum?
Es geht ihm darum, dass Menschen zu Gott zurückkehren können. Er will um jeden Preis – auch um den Preis seiner Menschenwürde, seines Ansehens, seiner Gesundheit, ja seines Lebens – dass Menschen sich wieder Gott zuwenden können und dann auch bei Gott angenommen werden. Um es mit einem Wort zu sagen: Er will, dass sie gerettet werden.
Damit das möglich wird, setzt er alles ein und gibt alles auf. Und nachdem es ihn am Kreuz alles gekostet hat, lässt Gott ihn an Ostern auferstehen. Und von diesem Augenblick an hat Jesus nur noch dieses eine Ziel: Menschen sollen sich bekehren. Denn jetzt ist der Weg zu Gott frei. „Es ist vollbracht“ (Johannes 19,30). Darum lädt er die Menschen ein, ihr Leben nach Gottes Maßstäben zu ordnen und unter seiner Regie und Herrschaft zu leben. Und seine Jünger damals setzten sein Werk fort: Auch sie luden ein zur Umkehr, zur Hinwendung, zum Leben mit Gott statt gegen ihn, zur Neuordnung des Lebens unter der Herrschaft Jesu.
Und ein wesentlicher Punkt dieses neuen Lebens unter der Regie Jesu und nach Gottes Maßstäben ist seither auch dieser: Der „Christ“ soll nicht alleine leben, sondern sich mit anderen Christen am Ort zusammentun. Und das nennt sich dann Gemeinde.
Das ist die neue, die neutestamentliche Lebensform, die sich an eine Bekehrung anschließt. Und es ist gleichzeitig das System Jesu, die Strategie, durch die er Menschen erreichen möchte. Daran ändert auch die Tatsache, dass heutzutage viele „Christen“ das nicht mehr ernst nehmen, nichts. Die Selbstverständlichkeit, mit der das Neue Testament von der Gemeindezugehörigkeit jedes Christen ausgeht, ist geradezu mit Händen zu greifen. Man möge nur einmal mit einer Konkordanz alle „einander-Verse“ im Neuen Testament durchgehen (d.h. die Bibelstellen, in denen das Wort „einander“ vorkommt). Es sind über Hundert, und so ziemlich alle davon sind schlicht nicht ausführbar, wenn man nicht verbindlich zu einer Gemeinde gehört.
Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ist sogar eine derart absolute Selbstverständlichkeit, dass das Gegenteil – nämlich irgendeine Art von „Solochristentum“ – in Neuen Testament nirgends erörtert wird. Als Christ alleine durchs Leben gehen? So ein Gedanke ist den Aposteln absolut fremd! Sie kommen offensichtlich gar nicht auf den Gedanken, dass so ein Unsinn von irgendeinem halbwegs denkfähigen Christen überhaupt in Erwägung gezogen werden könnte. Gerade ein einziges Mal, nämlich im Hebräerbrief, finden wir die Empfehlung, „unsere Versammlungen nicht zu verlassen“ (Hebräer 10,25), was darauf hindeuten könnte, dass es vielleicht doch schon damals Christen gab, die versuchten, ihr Christsein außerhalb einer verbindlichen Zugehörigkeit zur Gemeinde zu leben. Ansonsten war offensichtlich den Menschen, die Jesus persönlich gekannt haben, so ein Lebensstil völlig abwegig und absurd.
Und nun erleben wir derzeit eine beispiellose Welle von „Solokämpfern“, die sich zwar „bekehrt“ nennen und als „wiedergeborene Christen“ die evangelikale Szene bereichern – aber in keiner Gemeinde ein festes Zuhause haben. Die Ausreden dieser frommen Freischärler sind vielfältig und manchmal sogar nachvollziehbar, zum Beispiel wenn Christen mehrfach von Gemeinden enttäuscht wurden und jetzt einfach nicht mehr ein weiteres Mal „hineingezogen“ werden wollen. Ja, nachvollziehbar sind solche Ausreden durchaus. Aber es sind trotzdem Ausreden. Denn wie es Jesus geplant und die Jünger umgesetzt haben, ist eindeutig: Jeder Christ gehört in die Gemeinschaft einer Gemeinde. Gemeinde ist Pflicht. Alles andere ist nicht so, wie das die Bibel anordnet und wie das Jesus und Gott haben wollen. Also „unchristlich“ und „unbiblisch“.
Neutestamentliches Christsein ist eindeutig eine Gemeinschaftsreligion!
Jesus fordert in Matthäus 28,19: „Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker“. Ein gewaltiger Auftrag. Eigentlich viel zu groß. Alle Völker? Diese Handvoll Jünger? Mit den damaligen Mitteln und Möglichkeiten? Undenkbar! Nicht umsetzbar! Zum Scheitern verurteilt!
Die Jünger hätten Jesus hier auf prominente Vorbilder hinweisen können, die an „zu großen Aufträgen Gottes“ gescheitert sind.
Zum Beispiel der Prophet Elia. Einer allein gegen vierhundertfünfzig Baalspriester auf dem Berg Karmel. Ein gewaltiger Auftrag für einen einzelnen Menschen! Und siehe da: Elia fällt in Depressionen (nachzulesen in 1. Könige 18 +19).
Oder Jeremia. Ein einsamer Prophet Gottes mit einer sehr unpopulären Botschaft. Seiner Lebtag lang muss er immer wieder Gerichtsbotschaften predigen, macht sich unbeliebt, wird verachtet und bedroht. Zu groß ist dieser Auftrag für einen Menschen; Jeremia wird zum Lästerer und Gottesankläger (Jeremia 20,14-18).
Oder dann Johannes der Täufer. Der Wegbereiter Jesu schlechthin, ein Asket, ein einsamer Rufer in der Wüste. Ein gewaltiger Auftrag für diesen Mann – und Johannes wird darüber zum Zweifler und lässt aus dem Gefängnis heraus fragen: „Jesus, bist du, der da kommen soll?“ (Matthäus 11,3).
Elia, Jeremia, Johannes. Gestandene Männer, aufrichtige Diener Gottes. Sicherlich überdurchschnittlich begabt, die Besten, die Fähigsten ihrer Zeit. Und trotzdem: Ihr Auftrag war zu groß! Übermenschlich groß...
Und jetzt dies. „Die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen!“ Schon wieder ein solch unmöglicher Auftrag? „Jesus, weißt Du nicht, dass schon ganz andere Gottesmänner an zu großen Aufträgen deines Vaters gescheitert sind?“
Jesus gibt den Auftrag trotzdem. Aber mit einer neuen Strategie. Hat er vielleicht ein Problem erkannt? Elia, Jeremia, Johannes: Überragende Gottesmänner von Format. Aber - sie waren Einzelkämpfer!
Nicht so die Jünger. Von Anfang an sollen sie Gemeinden bilden und es gemeinsam machen. Teamarbeit, gegenseitige Ermutigung, Unterstützung, Hilfe. Nur so kann es gehen, nur so kann ein solch gewaltiger Auftrag angepackt werden, ohne daran kaputt zu gehen. Die Jünger packen es an – und sind erfolgreich.
Gemeinsam!
Das ist die neue Strategie Jesu, die Strategie des neuen Testaments, die Strategie, die heute noch zählt. Und bis heute hat auch jeder Christ noch immer denselben Auftrag mit derselben Strategie wie die Jünger damals.
Sicher ist: Die „Solochristen“ ohne Einbindung in eine Gemeinde werden es nicht packen. Sie sind zum Scheitern verurteilt, was den Auftrag und das vordringliche Anliegen Jesu anbelangt. Sie sind völlig bedeutungslos für das, was Jesus unter den Nägeln brennt, irrelevant für das, wofür er sich beleidigen, auspeitschen, kreuzigen ließ. Solochristen sind für Jesus verlorene Mitarbeiter, nicht einsetzbar, auf dem Abstellgleis eingemottet.