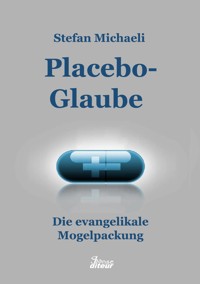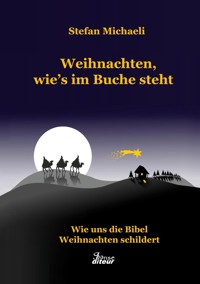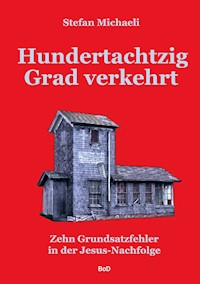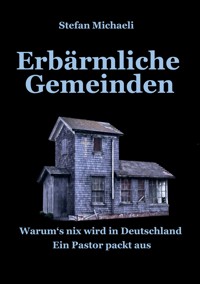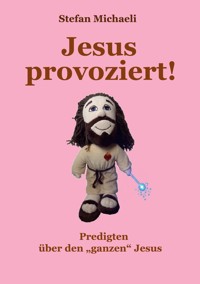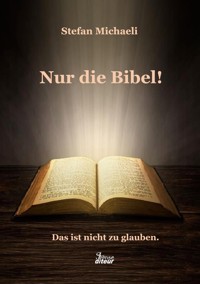
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wie vertrauenswürdig ist die Bibel? Natürlich kann jeder mit tiefster Überzeugung behaupten, dass die Bibel "Gottes Wort" sei. Aber ist das nur vollmundige individuelle Überzeugung, oder kann das auch mit Fakten oder sogar mit histo-rischen Tatsachen zuverlässig belegt werden? Wenn ja, wäre die göttliche Inspiration der Bibel weit mehr als nur eine Hypothese, mit der die Christenheit ihren Glauben abzusichern versucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autor:
Stefan Michaeli ist Theologe und war Gemeindepastor in mehreren freikirchlichen Gemeinden im südlichen Deutschland. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er publiziert zum Selbstschutz unter einem Künstlernamen.
Der Autor steht gerne für Predigten, Referate, Schulungen oder Autorenlesungen zur Verfügung. Gerne kann mit dem Autor Kontakt aufgenommen werden unter: [email protected] oder über seine Webseite: stefanmichaeli.weebly.com. Über die Webseite können auch weitere Bücher des Autors bestellt werden.
Von Stefan Michaeli liegen bisher vor:
» Erbärmliche Gemeinden« (2005/2020)
»Sterbefall Gemeinde« (2020)
»Hundertachtzig Grad verkehrt« (2020)
» Jesus provoziert!« (2021)
»Weihnachten, wie’s im Buche steht« (2023)
»Nur die Bibel!« (2023)
„Kein Buch der Welt hat schon so viele Kritiker gehabt und keines ist, wie die Bibel, allen ohne Ausnahme überlegen geblieben.“
Carl Hilty Schweizer Nationalrat und Ehrendoktor (1833 -1909)
Inhalt:
Nicht zu glauben
Was erwarten wir?
Eine erste Erkenntnis
Einheit
Zwei Vergleiche
Geschichtliches
Vertrauenswürdigkeit
Der persönliche Anspruch
Nicht zu glauben
Soll man an die Bibel glauben?
Der Leiter eines kirchlichen Gesprächskreises sagt zu seinen Teilnehmern:
„Ich habe keine eigene Meinung zu diesem Thema – ich habe die Meinung der Bibel!“
Im Konfirmationsunterricht sagt der Pfarrer nach einem freien Meinungsaustausch über ein aktuelles Thema zu seinen Schützlingen:
„Schlagt bitte jetzt alle mal die Bibel auf, wir wollen nachschauen, ob das stimmt!“
Als der zukünftige Pastor beim Vorstellungsgespräch in seiner neuen freikirchlichen Gemeinde nach seinem Bibelverständnis gefragt wird, sagt er:
„Grundsätzlich braucht ihr mir nichts zu glauben – glaubt stattdessen der Bibel!“
Zum Thema
„Wie kann man gut predigen?
“ rät der Dozent an der theologischen Hochschule seinen Studenten:
„Beruft euch stets auf die Bibel. Dann habt ihr eine sichere Grundlage!“
Und wir stimmen selbstverständlich jedes Mal zu: „Ja, an die Bibel soll man glauben!“ Das ist der gemeinsame Tenor all dieser Statements, und evangelikale Christen sind sich hierein einig. Sie glauben an die Bibel, weil sie der Überzeugung sind, dass dieses Buch „Gottes Wort“ sei und meinen damit, dass das, was darinsteht, von Gott stammt oder zumindest von ihm „inspiriert“ sei.
Deshalb glauben Christen an die Bibel. Übereinstimmend, durch alle evangelikalen Kreise hindurch: Charismatiker genauso wie konservative Freikirchler, Pietisten genauso wie Brüdergemeindler. Egal welcher frommen Couleur, in diesem „Glaubenssatz“ ist man sich einig: „Wir glauben alle an die Bibel!“
Ich nicht.
Ich bin selber „evangelikal“ und „Freikirchler“, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus und würde mich durchaus als einer seiner „Nachfolger“ bezeichnen. Und ich bete nicht nur täglich, sondern lese selbstverständlich auch jeden Tag in der Bibel.
Aber ich glaube nicht an die Bibel.
Das muss ich jetzt wohl erklären. Es hängt damit zusammen, dass das Wort „glauben“ im Deutschen eine Bedeutung hat, die angewandt auf die Bibel völlig unangemessen, ja sogar falsch ist.
„Glauben“ wird im Deutschen immer dann verwendet, wenn man etwas nicht genau weiß, aber trotzdem hoffnungsvoll oder vertrauensvoll daran festhält. Typische Glaubensätze wie etwa „Ich glaube, dass morgen das Wetter gut wird!“ oder „Ich glaube, du meinst es gut mit mir!“ suggerieren, dass ich etwas nicht wirklich weiß, aber von einer Annahme ausgehe. Vielleicht gibt es dazu durchaus das eine oder andere Indiz, das mich zum „glauben“ ermutigt, aber die absolute Sicherheit, dass es sich genau so verhält, habe ich eben nicht. Deshalb „glaube“ ich lediglich, statt es zu wissen.
„Glauben heißt nicht wissen!“ ist der dazu passende Standardsatz, der die deutsche Bedeutung von „glauben“ pointiert auf den Punkt bringt.
Folgerichtig definiert beispielsweise Wikipedia „glauben“ etwa mit „eine Vermutung oder Hypothese, welche die Wahrheit des vermuteten Sachverhalts annimmt“ oder „ein Fürwahrhalten ohne methodische Begründung“.
Sollten wir so an die Bibel „glauben“?
Natürlich sollen wir glauben. Die Bibel selbst fordert uns permanent zum „glauben“ auf. Allerdings – und leider wissen das auch viele aufrichtige Christen nicht – hatte damals der biblische Begriff des „Glaubens“ eine andere Bedeutung wie unser deutsches „glauben“ im heutigen Sprachgebrauch.
„Glauben“ (deutsch) ist nicht gleich „glauben“ (biblisch)!
Das Neue Testament ist bekanntlich in Altgriechisch, dem damals gebräuchlichen Griechisch, geschrieben. Das altgriechische Wort, das unsere deutschen Bibeln heute mit „glauben“ übersetzen, heißt „pisteuein“ und ist eigentlich ein Beziehungsbegriff. Laut „Theologischem Begriffslexion“ beschreibt dieses Wort nämlich „im Kern jene persönliche Beziehung, die durch Vertrauen und Zuverlässigkeit begründet ist“.
Was also ist der Unterschied zwischen dem biblischem, also altgriechischem Begriff „glauben“ und deutschem Wort „glauben“?
Während biblisches „glauben“ eine vertrauensvolle Beziehung bezeichnet, ist das deutsche „glauben“ eine rein philosopisch-subiektive Wahrnehmungsbeschreibung, die die Zone von hoffen, wünschen, überzeugt sein oder „für wahr halten“ von tatsächlichem Wissen und gesicherten Fakten abgrenzt.
Diesen „deutschen“ Sinn beinhaltet aber das altgriechische „pisteuein“ nicht! Man kann dieses damals gebräuchliche Wort auch problemlos mit „vertrauen“ übersetzen; diese Übersetzung ist korrekt und trifft die ursprüngliche Bedeutung sogar wesentlich genauer. Luther hat es aber nun mal vor über 500 Jahren mit „glauben“ übersetzt und dies hat sich bis heute in den meisten deutschen Bibeln so erhalten. Das mag damals eine gute Übersetzungsvariante gewesen sein. Die deutsche Verwendung von „glauben“ hat aber in den vergangenen Jahrhunderten einen sprachlichen Veränderungsprozess durchlaufen und sich dabei ziemlich weit wegentwickelt von der ursprünglichen, dem altgriechischen Wort innewohnende Bedeutung: Der „Vertrauens“-Aspekt ging verloren, und an dessen Stelle hat sich der neue Sinnschwerpunkt „nicht wissen“ etabliert.
Deshalb haben wir heute im deutschen Sprachraum folgende Situation: Die Bibel fordert ihre Leser zum „glauben“ auf, und folglich „glauben“ die Christen selbstverständlich. Da sie aber mit „glauben“ die deutsche Intension verbinden (wie sollten sie anders? Jedermann im deutschen Sprachraum verwendet das Wort ausschließlich im Sinne von „nicht wirklich wissen“…), suggerieren sie ihrer Umwelt – und fatalerweise auch sich selbst! – permanent, dass sie über den Gegenstand ihres Glaubens nicht wirklich etwas wissen, sondern nur etwas vermuten, aber trotzdem daran festhalten wollen.
Auf diese Art und Weise „glauben“ die Frommen hierzulande, und zwar nicht nur an Gott und nicht nur an Jesus, sondern eben auch an die Bibel. Denn diese fordert sie ja zum „glauben“ auf und jedermann geht (fälschlicherweise!) davon aus, dass man als aufrechter Christ auch bezüglich Bibel einfach daran festhalten (also „glauben“) muss, egal, ob und welche Fakten vorliegen und wie gesichert allfällige Erkenntnisse über dieses Buch auch sein mögen. So „glauben“ wir Frommen, daran haben wir uns gewöhnt, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen.
So an die Bibel „glauben“?
Ich nicht!
„Ich glaube (deutsche Bedeutung) nicht an die Bibel!“
Und brauche es auch nicht. Denn im Folgenden möchte ich aufzeigen, dass wir es sehr wohl mit Fakten und gesichertem Wissen zu tun haben, wenn wir über die Vertrauenswürdigkeit der Bibel nachdenken.
Und wir werden erstaunt sein, wie wenig es bei diesem Thema „zu glauben“ gibt!
Was erwarten wir?
Jetzt beginnen wir. Und zwar ganz von vorn.
Dazu stellen wir uns als Erstes einmal ganz dumm. Zumindest zu Beginn.
Ich gehe davon aus, dass wir damit gehörig Schwierigkeiten haben werden. Hoffentlich: Weil wir von Natur aus natürlich nicht so sind!
Aber wir versuchen‘s trotzdem.
Wir stellen uns also dumm, allerdings nicht grundsätzlich, sondern nur in Bezug auf die Gottesfrage. Da stellen wir uns jetzt mal so, wie wenn wir noch nie etwas von Gott gehört hätten und diesbezüglich völlig unwissend wären: „Gott? Wer ist das dann? Kennt den irgendjemand? Ist mir völlig unbekannt; ich habe noch nie von irgendeinem höheren Wesen mit diesem Namen gehört …“
Gleichzeitig werden wir jetzt auch noch etwas philosophisch (diesbezüglich brauchen wir uns aber absolut nicht dumm stellen!). Wir werden nämlich insofern philosophisch, indem wir uns die rein denkerisch-theoretische Frage stellen: „Wenn es nun aber einen Gott gäbe, was dann?“
Wie gesagt: Wir haben keine Ahnung, wer das sein könnte - aber wenn es nun doch irgendwo irgendeinen „Gott“ gäbe?
„Was, wenn es einen Gott gäbe?“ - Auf dieser hypothetischen Grundfrage kann man nämlich aufs Beste philosophische Gedanken aufbauen. Zum Beispiel diesen hier: „Wenn es so etwas namens „Gott“ tatsächlich gäbe, dann müsste dieses Wesen oder diese Kraft oder was es immer auch sein mag, sicher eines sein: Höher als wir!“
Mit "höher" meine ich Folgendes: Es (das Wesen, das Ding, die Kraft – wer/was auch immer) müsste höher sein als unsere Gedanken, als unsere Ideen, als unsere Vorstellungen, als unsere Intelligenz. Aus einem ganz einfachen Grund: Dieses „höher sein“ ist ja schlechthin so etwas wie die Definition des Begriffs "Gott"!
Wäre nämlich das, was wir als „Gott“ bezeichnen, in Wirklichkeit nicht "höher" als wir, also etwa nicht intelligenter und uns überlegen, sondern doch irgendwie begreifbar, durchaus verständlich, letztlich doch durchschaubar, mit unseren Sinnen und unserem Denken erfassbar: Dann würden wir es nicht "Gott" nennen. Es könnte dann schlicht nicht „Gott“ sein, sondern wir würden es einordnen unter "Wesen aus dem Weltraum" oder unter "physikalische Energie"; als „übergeordnetes Naturgesetz“ oder als „Kraft hinter allem“ - oder wie auch immer. Wir würden ihm irgendeinen Namen geben, es irgendwie titulieren. Aber nicht mit „Gott“! Die Kategorie "Gott" könnte es dann nicht sein!
Selbst wenn dieses übergeordnete "Wesen" oder diese universale „Kraft“ sehr viel stärker oder übermäßig grösser wäre als die Menschheit: Es wäre nicht "Gott" zu nennen, wenn wir es umfassend begreifen könnten! „Gott“ nennen wir dieses Übergeordnete nur, wenn es auch in seinem Denken, seiner Intelligenz, in seiner Begreifbarkeit über uns steht!
Daraus folgt jetzt – unumgänglich - der nächste „philosophische“ Gedanke: Alles, was sich Menschen selbst erdacht haben, kann folglich nicht Gott sein! Was menschlicher Fantasie, menschlicher Intelligenz oder menschlicher Vorstellungskraft entspringt, muss immer ein falscher Gott sein! Das kann Gott nicht entsprechen, denn "Gott" muss gemäß Definition immer "höher" sein. Folglich kann er also nicht erdacht oder von Menschen erfunden werden.
Das ist in sich schlüssig und deshalb bestimmt nicht schwierig zu verstehen!
Und es ist schon mal eine gute und hilfreiche Erkenntnis. Sie verhilft uns nämlich, „falsche“ Götter erkennen zu können! Und, daraus resultierend, unseriöse Religionen und darauf basierende sinnlose Religiosität zu entlarven.
Falsche Götter beziehungsweise sinnlose Religionen zu erkennen ist gar nicht so schwierig, wie wir vielleicht bisher dachten. Falsche Götter kann man nämlich oftmals schon recht schnell dadurch entlarven, dass man sie konsequent hinterfragt: Sind sie letztlich verstehbar, begreifbar, erklärbar, menschlich erfassbar? Wenn „ja“, dann kann es nicht wirklich ein „Gott“ sein.
Noch effektiver und genauer ist allerdings dieser Maßstab: Man klopft das zu Grunde liegende Glaubensbekenntnis und/oder die daraus resultierende Religion nach ihrem Ursprung, nach ihrer Entstehung ab: Ist der darin proklamierte Gott erklärbar, weil er selbstgemacht, selbst produziert, sozusagen selbst „hergestellt“ worden ist? Kann man dessen Entstehung sachlich-rationell nachvollziehen und erklären? Entspringt die konstituierende „Offenbarung“, mit der sich dieser „Gott“ den Menschen vorgestellt hat, menschlichem Geist, also menschlichen Ideen oder Vorstellungen? Oder etwa sogar menschlicher Fantasie?