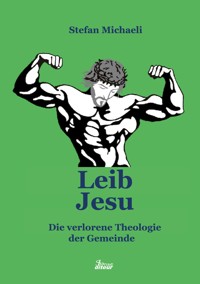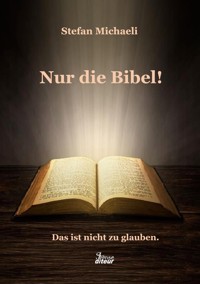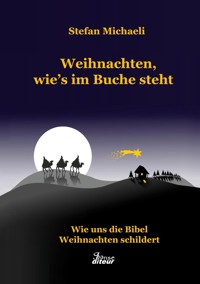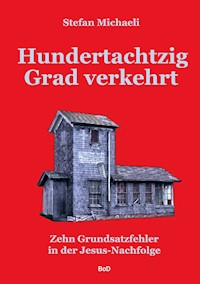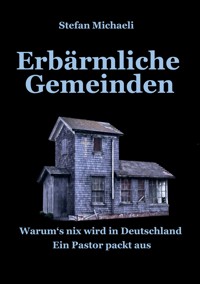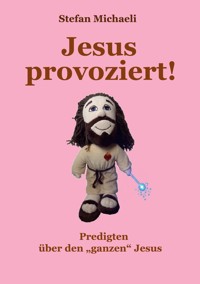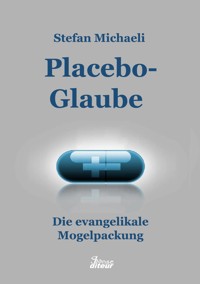
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wieviel Substanz hat unser evangelikaler Glaube noch? Wir behaupten vollmundig, den "echten Jesus" zu haben und den "wahren Glauben" zur repräsentieren. Aber wenn wir den Sendungsauftrag unseres Herrn durch Pflege unserer Behaglichkeit ersetzen, möglichst jede biblische Herausforderung vermeiden und von Jesus nur noch persönliche Erquickung und die Beseitigung unserer Alltagsprobleme erwarten, dann sind wir für Jesus keine Zeugen mehr, sondern eher eine Zumutung. Erst recht, wenn wir es noch nicht einmal bemerken, weil wir uns alle gemeinsam immer stärker ins Abseits manövrieren ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autor:
Stefan Michaeli ist Theologe und war Gemeindepastor in mehreren freikirchlichen Gemeinden im südlichen Deutschland. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er publiziert zum Selbstschutz unter einem Künstlernamen.
Der Autor steht gerne für Predigten, Referate, Schulungen oder Autorenlesungen zur Verfügung. Gerne kann mit dem Autor Kontakt aufgenommen werden unter: [email protected] oder über seine Webseite: stefanmichaeli.weebly.com. Über die Webseite können auch weitere Bücher des Autors bestellt werden.
Von Stefan Michaeli liegen bisher vor: »Erbärmliche Gemeinden « (2005/2020)
»Sterbefall Gemeinde « (2020)
»Hundertachtzig Grad verkehrt « (2020)
»Jesus provoziert! « (2021)
»Weihnachten, wie’s im Buche steht « (2023)
»Nur die Bibel! « (2023)
»Placebo-Glaube « (2025)
„Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt!“
Paulus an eine seiner Gemeinden, deren Glaubensentwicklung ihm Sorgen bereitete
(1. Korinther 15,2)
„Was nennt ihr mich aber Herr!«, Herr!« und tut nicht, was ich euch sage???“
Frustrierter Ausruf Jesu am Ende einer längeren Predigt angesichts eingebildeter Frömmigkeit
(Lukas 6,46)
Inhalt:
1. Ende der Wohlfühlzone!
2. Kritik am Tabu
3. Bestandsaufnahme
3.1 Defizit „Fehlendes Gemeindewachstum“
3.2 Defizit „Gemeindekrisen“
3.3 Defizit „Fehlende Gebetserhörungen“
3.4 Defizit „Abwesenheit Gottes“
4. Evangelikal - aber nicht biblisch
4.1 Schwachstelle „glauben statt tun“
4.2 Schwachstelle „Mainstream-Lebensstil“
4.3 Schwachstelle „Auftragsvergessenheit“
4.4 Schwachstelle „Ichbezogenheit“
4.5 Schwachstelle „Wehleidigkeit“
5. Blockaden
5.1 Ahnungslosigkeit
5.2 Angst
5.3 Verunsicherung
6. Ausblick
Persönliches Nachwort
1. Ende der Wohlfühlzone!
Hier hört der Spaß bereits auf.
Dieses Buch zu lesen macht keine Freude. Seine Lektüre löst weder Wohlbehagen noch Beruhigung aus und bringt auch keine gute Laune. Vielleicht vermiest es sogar streckenweise die Lust am Weiterlesen.
Gut möglich auch, dass meine Ausführungen an manchen Stellen wie der Ausfluss eines Kritiksüchtigen wirken oder wie die arrogante Selbstüberschätzung eines notorischen Besserwissers, der es „mal allen zeigen“ will.
Sei‘s drum. Das alles lässt sich eben nicht vermeiden bei diesem Thema. Das Risiko muss ich eingehen; umso mehr Desinteresse, Ablehnung oder sogar Gegenwind sowieso jeder Schriftsteller einkalkulieren muss, wenn er es wagen sollte, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wer unangenehme Themen ungeschminkt auf den Punkt bringen will, weiß natürlich, dass es genau dort - „auf dem Punkt“ - auch weh tun kann. Das ist dann nicht nach jedermanns Gusto.
Hier passt das geflügelte Wort „den Finger in die Wunde legen“ bestens: Wenn der Arzt zur Einleitung heilender Maßnahmen erst mal die Wunde aufdecken und untersuchen muss, dann tut das oft weh. Die gründliche Feststellung des „Ist-Zustands“ ist jedoch unerlässlich, damit anschließend die geeigneten Maßnahmen zur Heilung bestimmt und eingeleitet werden können.
Den „Finger in die Wunde legen“ ist also der erste, aber unabdingbare Schritt. Er ist noch nicht Heilung, noch nicht die Behebung des Problems, sondern nur deren Konstatierung, deren Feststellung. Da man aber gegen ein Problem, einen Missstand oder eben eine „wunde Stelle“ nur dann wirkungsvoll angehen kann, wenn man den vorliegenden Schaden erkannt und korrekt analysiert hat, muss genau da angesetzt werden: Erst mal analysieren!
Genau das ist auch die Intension dieses Buchs: Erst mal analysieren!
Und weil dieses Buch Probleme analysieren möchte und Probleme per Definition unangenehm sind, ist dies hier kein schönes Buch und bietet keine erbauliche Lektüre.
***
Natürlich: Problemanalyse kann uns durchaus auch Spaß bereiten! Nämlich immer genau dann, wenn wir die Probleme anderer analysieren. Über die Missstände bei Drittpersonen, über Schäden und „Eiterstellen“ von Abwesenden lässt sich ganz vortrefflich und mit Hochgenuss herziehen. Solange es nicht uns selbst betrifft, fühlen sich solche Schadensanalysen inklusive hypothetischer Ursachenforschung und daraus resultierender Behebungsvorschläge völlig schmerzfrei an; ja zuweilen sind sie sogar mit regelrechten Lustgefühlen verbunden.
Aber nicht, wenn es darum geht, unsere eigenen Schäden und Missstände aufzudecken und zu analysieren.
Da hört der Spaß dann schlagartig und nachhaltend auf.
Womit wir wieder bei diesem Buch hier wären. Denn hier geht es um unsere eigenen Probleme, unsere höchst persönlichen Eiterstellen. Zumindest sofern wir uns als Christen dem evangelikalen Lager zurechnen.
Mit „evangelikal“ meine ich diejenigen Gemeinden, die sich in der Regel am Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz orientieren, ob sie sich nun als „charismatisch“, „pietistisch“, „brüdergemeindlich“ oder einfach nur als „bibelgläubig“ oder wie auch immer verstehen; ob sie nun freikirchlich, gemeinschaftlich oder gar landeskirchlich organisiert sein mögen. Von Gemeinden dieser Prägung spreche ich, wenn ich nachfolgend von „wir“, „uns“ oder „den Gemeinden“ schreibe - oder eben den Sammelbegriff „Evangelikale“ verwende, der sich für diesen Glaubensstil seit den 70-er Jahren im deutschen Sprachraum etabliert hat.
Dieser „evangelikalen“ Frömmigkeitsrichtung gehöre ich auch selber an, und diese - also „unsere“ - Schieflage will ich in diesem Buch analysieren.
Was ich übrigens für ein völlig biblisches, also ur-christliches Vorgehen erachte. Denn selbst die Behebung des Problems „Getrennt sein von Gott“ (also das wohl größte Problem der Menschheit überhaupt) startet bekanntlich nicht mit „Erlösung“, sondern mit „Buße tun“! Auch hier ist der erste Schritt das Erkennen der Problematik, denn „Buße tun“ basiert immer auf dem persönlichen Erkennen, „wo mein Hund begraben liegt“, also wo genau denn nun mein Schaden zu verorten ist.
Problemanalyse ist also auch hier die Voraussetzung für nachfolgende Heilung. Erst wenn mir bewusst wird und wenn ich verstanden habe, dass ich von Gott getrennt bin, dass das für mich nicht dienlich ist und dass ich selbst verantwortlich, ja sogar selbst daran schuld bin (eine Erkenntnis, die natürlich ebenfalls schmerzt!), dann erst kann der zweite Schritt angegangen werden: Ich darf (und soll!) Jesus um Erlösung bitten.
Erst mal tut’s aber weh, wenn der Heilige Geist penetrant und so lange den Finger in meine Wunde namens „Gottlosigkeit“ legt, bis ich meinen verlorenen Zustand erkenne!
Auch hier also, schon beim Start eines Lebens in der Nachfolge Jesu, wird es erst mal ausgesprochen unangenehm! Aber das ist unausweichlich notwendig, denn Selbsterkenntnis ist eben unverzichtbare Voraussetzung für eine bewusste Besserung meines Zustands.
Und damit starten wir jetzt unsere Selbst-Analyse.
Weil sie unverzichtbar notwendig ist.
2. Kritik am Tabu
Es geht ums Ganze.
Wer beim Lesen des Buchtitels vielleicht gemeint haben sollte, es würde in diesem Buch lediglich um das schräge Glaubensverständnis von ein paar versprengten frommen Schäflein gehen, die’s nicht so ganz kapiert haben, den muss ich enttäuschen.
Ich meine uns alle.
Es geht mir um den generellen Glauben, der sich, ausgehend von Jesus und den von ihm unterwiesenen Aposteln, im Verlauf der „Alten Kirche“ herausgebildet hat, im Zuge der Reformation eine Runderneuerung erfuhr und sich dann – wesentlich geprägt durch den Pietismus – zu unserem heutigen „evangelikalen“ Glaubensverständnis entwickelt hat. Es geht mir um unseren heutigen Glaubensvollzug, der sich aus dieser historischen Entwicklung heraus konstituiert hat. Also um das, was wir heute unter „Christsein“ verstehen und wie wir unseren „Glauben“ im Alltag leben.
Die Art des Glaubensvollzugs, also auf welche Weise jemand „christliches Leben“ oder „Jesusnachfolge“ umsetzt, hat zwar durchaus unterschiedliche Facetten, je nachdem, welchem Lager man sich zurechnet: konservativ, bekenntnisorientiert, pietistisch, charismatisch-pfingstlerisch, strenggläubig - oder wie auch immer. Aber selbstverständlich – und da gleichen wir uns dann wieder an - glauben wir durchs Band weg immer „bibelorientiert“: Die Bibel ist unsere gemeinsame Basis, denn sie gilt bei uns allen als Gottes „geoffenbartes Wort“ und ist uns damit Normgeber, Richtschnur und gegebenenfalls Korrektiv unseres Glaubens.
Und noch in einem anderen Punkt sind wir uns alle absolut gleich: Wir sind alle felsenfest überzeugt von der Richtigkeit und Authentizität unseres Glaubens! Die Art und Weise, wie wir glauben, ist sozusagen „die Richtigste von allen“. Nur so, wie wir das glauben und leben, funktioniert das wahre Christentum, nur so ist es tatsächlich bibel- und christusgemäß, nur entsprechend unserem Glaubens-Verständnis kann Gott und sein Wille richtig interpretiert und umgesetzt werden.
An dieser Überzeugung darf keiner rütteln; hier darf keinesfalls hinterfragt werden. Wer das versucht, gehört nicht zu uns. Er ist dann offensichtlich kein „Rechtgläubiger“ und damit kein „Evangelikaler“.
Von der Richtigkeit unseres Glaubensverständnisses sind wir alle, ohne Ausnahme, restlos überzeugt. Diesbezüglich sind wir absolut kritikresistent.
***
Ich meine damit natürlich nicht, dass bei unsereins nicht kritisiert würde. Beileibe nicht – auch Punkto Kritik sind „geben und nehmen“ bei uns Alltag!
So werden wir als „bibelgläubige“ Christen natürlich gerne und manchmal auch recht hart kritisiert! „Die Welt“ oder auch andere Religionen stellen immer wieder unseren Glauben in Frage, gerne auch sehr kritisch nachhakend.
Aber wir teilen auch reichlich aus, und zwar nicht nur gegen andere Religionen oder Philosophien: Auch innerhalb der Christenheit, also untereinander, wird laufend kritisiert.
Unser Lager beispielweise verweist ganz gerne und durchaus kritisch auf die Evangelische Landeskirche Deutschlands (EKD) mit ihrer inzwischen außerordentlich „liberal“ gewordenen Theologie oder auf ihre aktuell sehr „ungeistliche“ und politikorientierte Weltverbesserer-Verkündigung, durch die sie sich dem zeitgeistigen Mainstream anzubiedern versucht. Oder wir kritisieren die Katholiken, indem wir deren Marienverehrung und Heiligenanbetung, das „unnötige“ Zölibat und die jegliche Neuorientierung blockierenden Dogmen als „Irrlehren“ brandmarken und die in ihren Reihen derzeit vermehrt zu Tage tretenden Missbrauchsvorfälle geißeln.
Es wird also durchaus kritisiert – in alle Richtungen. Und wir kritisieren fröhlich mit. Manchmal möglicherweise sogar zu Recht.
Aber eines tun wir nicht: Wir kritisieren uns selbst nicht. Zumindest nicht, was die Art und Weise unseres Glaubens angeht. Das ist ein absolutes Tabu, daran kann und darf nicht gerüttelt werden.
Keiner tut das. Zum einen, weil wir vollkommen von der Richtigkeit unseres evangelikalen Glaubensverständnisses überzeugt sind: „Ist doch absolut biblisch, wie wir glauben – noch biblischer geht’s doch gar nicht!“, und zum anderen, weil wir auch absolut keine Notwendigkeit dazu verspüren oder gar erkennen können.
Wobei das allerdings noch etwas eingegrenzt werden muss: In einem Bereich kritisieren wir uns sehr wohl selbst: Wenn wir unseren persönlichen, individuellen Glaubensvollzug hinterfragen. Dazu sehen wir uns nämlich immer wieder gezwungen, und zwar durch unsere unvermeidbar periodisch auftretenden Glaubenskrisen. Wenn es um unseren persönlichen, alltäglichen Glauben geht, dann sind wir durchaus kritikoffen. Der christliche Büchermarkt widerspiegelt das deutlich; es gibt massenweise fromme Literatur, die den tatsächlichen oder vermeintlichen Defiziten unseres individuellen Glaubens auf die Sprünge helfen will. Dazu lassen wir uns dann auch gerne kritisch hinterfragen.
Aber eben nur hier, wo es um den persönlichen, den eigenen, den individuellen „Glauben für meinen Alltag“ geht.
Nicht aber, wenn es um unser gemeinsames Glaubensverständnis generell, um die Basics, die Wurzeln unseres Glaubens geht. Wir Evangelikalen glauben „biblisch“ und damit richtig! Basta und Ende der Diskussion. So einfach und klar ist das. Da braucht nicht kritisch nachgefragt zu werden, denn das ist völlig unnötig.
Tabu eben.
***
Aber genau dieses Tabu muss durchbrochen werden. Jetzt und hier.
Denn dazu gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Gründen, warum wir das (eigentlich längst schon!) tun sollten. Die eben benannten persönlichen „Glaubenskrisen“ gehören beispielsweise dazu.
Unsere Büchertische mit ihren unzähligen Ratgebern zur Vorbeugung oder Behebung von Glaubensschwierigkeiten widerspiegeln unsere immer wiederkehrenden Glaubenszweifel, Glaubenskrisen oder gar Glaubensverluste. Dass diese unzähligen Bücher immer ihre Abnehmer finden, erstaunt erfahrene Christen nicht. Wer nicht selbst zumindest streckenweise immer wieder seiner eigenen Glaubensstabilität verlustig geht, hat mit Sicherheit in seinem christlichen Umfeld stets eine ganze Reihe von „Brüdern und Schwestern im Herrn“, deren Glaube aktuell erschüttert oder gar verloren gegangen ist.
Woher kommts?
Natürlich betreiben wir immer wieder Ursachenforschung und meinen, eine ganze Reihe von Gründen benennen zu können, warum Menschen in ihrem persönlichen Glauben verunsichert werden.
Aber Glaubenskrisen in dieser Häufigkeit, wie sie derzeit in unseren Breitengraden auftreten? Es mutet fast schon wie eine „evangelikale Seuche“ an, wenn wir mal genauer hinschauen, wie viele unter uns latent oder wiederkehrend mit existentieller Glaubensunlust oder gar Glaubensunvermögen zu kämpfen haben. Deren wahre Anzahl steht uns ja nur deswegen nicht klar und offen vor Augen, weil natürlich kaum einer gerne darüber spricht und wir es deshalb in der Regel nicht wirklich überblicken, wer in unseren Reihen gerade seines Glaubens alles andere als sicher ist. Wer sich jahrzehntelang in unseren christlichen Kreisen und Gemeinden bewegt hat, will natürlich sein soziales Umfeld wegen einer Glaubenskrise nicht verlieren, posaunt aber seine Glaubenszweifel oftmals auch nicht lauthals in die Runde. So bleibt er mitsamt seinen Glaubensanfechtungen mitten unter uns, wie er es gewohnt ist. Und keiner ahnt, wie instabil sich sein persönlicher Glaube aktuell präsentiert.
Wir sollten deshalb davon auszugehen, dass sich Glaubenskrisen zuhauf in unseren frommen Kreisen und Gemeinden tummeln. Wäre es also nicht sinnvoll, endlich einmal etwas grundsätzlicher darüber nachzudenken, woher das wohl kommt?
Hier allerdings geht es nun ans Tabu!
Könnte es nämlich sein, dass genau das unser Grundproblem und somit der eigentliche Auslöser unserer permanenten persönlichen Glaubenskrisen ist: Dass wir „biblischen Glauben“, so wie Jesus sich das vorstellt und von seinen Nachfolgern eigentlich erwartet, gar nicht wirklich verstanden haben? Könnte es sein, dass wir das Level von echter „Jüngerschaft“, so wie sie uns biblisch bezeugt wird, trotz aller „Bibelgebundenheit“ noch längst nicht erreicht haben, sondern auf tiefem – viel zu tiefem! – Niveau stehen geblieben sind, ohne es wirklich zu realisieren?
Und könnte es vielleicht sein, dass wir Evangelikalen unser mangelhaftes, ungenügendes Glaubensverständnis deshalb nicht erkennen, weil wir allesamt – also flächendeckend! - unseren Glauben auf demselben bescheidenen geistlichen Tiefstand leben und unsere Art zu glauben folglich als „Normalzustand“ betrachten?
Wenn das so wäre, dann würden wir also unsere aktuellen Glaubenskrisen auf dem Hintergrund eines Glaubensverständnisses zu beheben versuchen, das in sich noch völlig unausgereift und somit weitgehend untauglich ist! Basieren vielleicht unsere bisherigen Glaubensanalysen samt und sonders auf einem vorgegebenen Modell, welches wir noch gar nicht verstanden bzw. noch nicht – vielleicht sogar noch nicht mal ansatzweise! - zu leben begonnen haben?
Dann wäre es allerdings in höchstem Maße uneffektiv, ja sogar ziemlich sinnlos, unseren individuellen „christlichen“ Lebensstil zu bearbeiten und möglichst wieder auf einen guten Stand bringen zu wollen, obwohl wir de facto gar keinen „christlichen Lebensstil“ kennen, sondern lediglich einen „Placebo-Glauben“, der noch längst nicht dem entspricht, was Jesus sich eigentlich unter „Glauben“ vorstellt und von uns wünscht!
***
Womit das titelgebende Stichwort hiermit gefallen ist: „Placebo-Glaube“.
Was ist damit gemeint? Pflegen wir Evangelikalen tatsächlich einen Glauben, der nur „Placebo“-Effizienz besitzt?
Ein starker Vorwurf, wenn man sich vor Augen führt, was unter einem „Placebo“ zu verstehen ist: Der Begriff kommt aus der Medizin und bezeichnet ein sogenanntes „Scheinmedikament“, also eine Arznei oder ein Heilmittel, das keinerlei relevanten Wirkstoff beinhaltet und somit eigentlich auch keine Wirkung ausüben kann. Verabreicht man jedoch dieses an sich wirkungslose Scheinmedikament an nicht eingeweihte Patienten, also an solche, die meinen, statt des inhaltsleeren „Placebos“ ein Medikament voller Wirkstoff erhalten zu haben, kann unter Umständen der sogenannte „Placebo-Effekt“ ausgelöst werden: Heilung findet trotzdem statt! Aber nun natürlich nicht aufgrund der verabreichten Medizin (die das „Placebo“ ja eben nicht enthält), sondern ausschließlich auf Grund der Erwartungshaltung des Patienten. Denn dieser geht ja davon aus, dass er jetzt gesunden werde, weil doch sein Medikament wirksame Heilungsstoffe enthalte!
Voraussetzung ist aber stets, dass der Patient auf keinen Fall eingeweiht werden darf; dass also seine Umgebung (Arzt, Klinikpersonal, Besucher, Familie) ihn keinesfalls darüber aufklären, dass er anstelle des Medikaments nur ein Scheinmedikament, eben ein „Placebo“, erhalten hat. Der Patient muss davon überzeugt sein, dass er das richtige Heilmittel, dasjenige mit medizinischen Wirkstoffen, erhalten habe!
Übertragen bedeutet das also, dass ein „Placebo-Glaube“ ein Glaube absolut ohne Wirkstoff ist; ein „Scheinglaube“, der sich präsentiert wie echter Glaube, dem jedoch jegliche Wirksubstanz fehlt. Entscheidend ist dabei, dass der „Glaubende“ absolut davon überzeugt ist, den „echten“ Glauben zu haben; dass also niemand aus seinem Umfeld ihn darauf hinweist, dass sein Glaube lediglich ein „Placebo“ ist. Seine Erwartungshaltung an die Wirksamkeit seines Glaubens muss aufrecht erhalten bleiben – und dann kann sich unter Umständen möglicherweise auch hier der eine oder andere „Placebo-Effekt“ einstellen.
Haben wir Evangelikalen einen „Placebo-Glauben“? Und könnte es zudem sein, dass wir gleich alle, durchs Band hinweg, fälschlicherweise diese Art von Glauben für das Normale, also für den „richtigen“ Glauben halten?
Falls das tatsächlich der Fall sein sollte, dann hätten wir zumindest diesen einen konstituierenden „Placebo“-Faktor bereits erfüllt: Keiner weist uns darauf hin, dass das, was wir in unseren Kreisen mit innerster und äußerster Überzeugung als „wahren Glauben“ pflegen, in Wirklichkeit lediglich ein „Placebo“, also ein Scheinglaube sein könnte. Denn wir Evangelikalen sind uns ja alle, übereinstimmend und ohne Ausnahme, absolut sicher: „Biblischer“ - also „richtiger“ - wie wir kann man nicht „glauben“!
Diese Grundüberzeugung auch nur anzutasten wäre bereits ein absoluter Tabubruch – da wagt sich keiner ran!
Dass unser Glaube „der Richtige“ ist, gilt eben - wie bereits erwähnt – innerhalb evangelikaler Kreise als gesetzt und ist deshalb unumstößlich!
***
Im nächsten Kapitel werden wir einige Missstände in unserem evangelikalen Lager betrachten, die uns Anlass geben könnten, vielleicht doch mal über einen möglichen Placebo-Effekt hinter unserem Glaubensverständnis und unserem Glaubensvollzug nachzudenken. Aber zuvor will ich noch kurz darauf hinweisen, dass die grundsätzliche Kritikverweigerung betreffend unserer evangelikalen Glaubensart durchaus gefährlich sein kann.
Das gab es nämlich schon mal in der Kirchengeschichte, dass sich wirklich bibeltreue und ernstmeinende Gläubige genau deswegen – wegen ihres ernsthaften und aufrichtigen Bibelglaubens! – völlig ins Abseits schossen. Und zwar ausgerechnet in einer absolut entscheidenden Phase der Christenheit: Während Jesu Aufenthalt auf unserer Erde.
Das Neue Testament berichtet uns wiederholt von den „Pharisäern und Schriftgelehrten“, also von den damals maßgeblichen Theologen und geistlichen Volksvertretern in Israel.
Wir sind es gewohnt, in diesen Gruppierungen immer automatisch die damaligen Gegner Jesu zu sehen und reflexartig sofort deren Blindheit und deren Unverständnis gegenüber dem vor ihnen stehenden Sohn Gottes zu missbilligen.
Ja, es stimmt: Sie haben Jesus nicht erkannt, ihn als Bedrohung ihres Glaubens eingestuft und ihn nicht nur abgelehnt, sondern auch noch mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln bekämpft.
Das kann und soll keinesfalls schöngeredet werden. Aber wenn man diese religiösen Gruppierungen einmal neutral analysiert, dann stellt man durchaus fest, dass sie – auf der positiven Seite – Gott absolut ernst nahmen und sehr viel dafür einsetzten, seinen Willen im Alltag und Lebensvollzug umzusetzen. Die waren nicht etwa „lau“, sondern ganz im Gegenteil: Höchst engagiert als Gläubige und willig, dafür auch einiges einzusetzen.
Und zudem waren sie konsequent „bibelgläubig“: Der ihnen vorliegende Teil der Bibel, das Alte Testament, war ihnen vollumfänglich „Gottes Wort“ und wurde von ihnen sogar so ernst genommen, dass sie zusätzliche Regeln und Gebote einhielten, um nur ja nicht etwas zu tun oder zu lassen, was Gottes offenbartem Willen nicht entsprochen hätte. Sie waren als „Gläubige“ also weder ketzerisch noch abtrünnig und auch nicht sektiererisch, sondern konsequent auf Gottes Wort ausgerichtet. Zudem waren sie ja auch nicht etwa dumm oder naiv-gläubig; und selbst wenn Jesus ihnen zuweilen Geldgier, Ruhm- und Machtsucht oder Heuchelei vorwerfen musste: Sind das nicht menschliche Schwächen, vor denen auch heute noch ansonsten rechtgläubige Christen nicht ganz gefeit sind? In alledem wollten sie es trotzdem Gott nach bestem Wissen und Gewissen recht machen. Das hat sie durchaus auch einiges gekostet – aber das war’s ihnen wert.
Und trotzdem: Sie lagen völlig daneben!
Erschreckend dabei ist, dass die bei ihnen gut feststellbare „bibelgegründete Rechtgläubigkeit“ haargenau auch auf uns zutrifft! Mit denselben Begriffen, mit denen ich eben die positive Seite am „Glauben“ dieser Schriftgelehrten und Pharisäer umschrieben habe, könnte man genauso unsere evangelikale „bibelgegründete Rechtgläubigkeit“ und den darauf aufbauenden Glaubensstil beschreiben: „Gottes Wort als sein geoffenbarter Wille ernst nehmen“, „darauf ausgerichtet sein“, „es ihm recht machen wollen, selbst wenn‘s was kosten sollte …“ – das passt doch alles auch in unser evangelikales Glaubensverständnis hinein, oder?
Die damals lagen genau damit jedoch völlig daneben!
Sind wir uns bewusst, dass es durchaus möglich sein könnte, dass wir ebenso „völlig daneben“ liegen?
Genau das gab‘s eben schon einmal!
3. Bestandsaufnahme
Was also läuft schief in unseren evangelikalen Gemeinden und Gemeinschaften? Was könnte auf eine mangelhafte Glaubenspraxis, basierend auf einem durchgängigen „Placebo-Glauben“ in unseren Reihen, hinweisen?
Wenn ich nachfolgend einige Fehlentwicklungen oder Alarmzeichen aufliste, macht das weiterhin keinen Spaß. Unser spontaner Impuls, Widerwärtiges, Unangenehmes oder vielleicht sogar Selbstverschuldetes postwendend beiseite zu schieben, sozusagen „wegzudrücken“, ist manchmal durchaus dem Selbsterhaltungstrieb unserer Seele zuzuordnen. Das ist einerseits nicht von Vornherein falsch, denn wer den Blick zu stark und penetrant auf das Negative, Belastende und Entmutigende richtet, riskiert Niedergeschlagenheit und Depression. Nicht umsonst rät Paulus in Römer 12,2, dass ein Christ „durch Erneuerung seines Sinnes“ das „Gute und Wohlgefällige und Vollkommene prüfen“, also vorwiegend über Positives und Erbauendes nachsinnen sollte.
Zu einer ernsthaften Prüfung und Analyse jedoch gehört andererseits, dass Defizite ungeschminkt aufgedeckt und benannt werden. Nur dann kann sinnvoll abgewogen und beurteilt werden. „Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt!“, legt Paulus in Epheser 5,15 der Christenheit ans Herz. Genau das sollten wir tun, auch wenn es möglicherweise bei den nachfolgend aufgedeckten Missständen auch um solche geht, die wir eigentlich lieber nicht wahrhaben wollen; die wir deshalb bisher nicht aktiv zur Kenntnis nahmen oder erfolgreich verdrängt haben.
Aber jetzt gehören sie auf den Tisch.
***
Wo also liegen unsere Defizite?
Eines haben wir bereits benannt: Unsere Glaubenskrisen. Wobei das nicht ganz korrekt ist: Es handelt sich bei der übermäßigen Anzahl an persönlichen Glaubensproblemen unter uns evangelikal Glaubenden weniger um ein Defizit im Sinne eines verursachenden Mankos, sondern wohl eher um eine Auswirkung, um ein Symptom der Krankheit unseres Glaubens. Eine solche Massierung von Glaubenskrisen ist sozusagen der Gradanzeiger eines offensichtlich schwachen oder sogar untauglichen Glaubens. Und nach meiner Einschätzung eine direkte Auswirkung des bei uns grassierenden „Placebo-Glaubens“.
Nachfolgend nun also einige weitere, alarmierende Defizite. Da ich mich als Pastor schwerpunktmäßig seit langem mit dem Thema „Gemeindeaufbau und -entwicklung“ befasse, starten wir mit zwei typischen Gemeinde- Defiziten:
3.1 Defizit „Fehlendes Gemeindewachstum“
Weltweit wachsen Gemeinden. Das ist auch gut und richtig so, und zwar nur schon deshalb, weil Wachstum grundsätzlich Gottes Wesen entspricht.
Auf Wachstum basiert ja alles Leben auf dieser Erde, egal ob pflanzlich, tierisch oder menschlich; die gesamte Natur, an der bekanntlich Gottes Schöpferkraft und Allmacht erkannt werden kann (vgl. dazu Römer 1,20), ist stets auf Wachstum angelegt. Wachstum ist also ein zentrales Charakteristikum, ist der unverwechselbare Stil des Wirkens Gottes, ist das allem innewohnende Muster seiner Kreativität. Wachstum gehört untrennbar zur göttlichen Wesensart und zum Konzept fast all seiner Schöpfungen. Gott ist ein Gott, der wachsen lässt.
Und dies widerspiegelt sich eben nicht nur in der Natur, sondern auch im geistlichen Bereich. Denn auch der entspricht – logisch! - genau Gottes Art! Deshalb weisen uns das Neue Testament und darin insbesondere Jesus immer wieder darauf hin, dass auch das „Reich Gottes“ in unserer Welt auf Ausbreitung gemäß diesem göttlichen Wachstumsprinzip angelegt ist.
So schildert Jesus beispielsweise seinen Zuhörern im Markusevangelium gleich dreimal hintereinander das Wachstumspotenzial, das sich im „Reich Gottes“ beziehungsweise schon im „Wort“, sofern dieses eine Manifestation des Reichs Gottes innerhalb unserer Welt auszulösen hat, enthalten ist: Nachdem er in Markus 4,1-9 das Gleichnis vom Sämann erzählt, der sein Saatgut auf unterschiedlichen Boden sät und dementsprechend unterschiedlichen Erfolg erntet, und dieses Gleichnis anschließend den Jüngern auch noch erklärt (Markus 4,13-20), vertieft er den Gedanken des Wachstums gleich noch mit dem Gleichnis vom „Wachsen der Saat“ (Markus 4,26) und anschließend auch noch mit dem Beispiel vom „Senfkorn“ (Markus 4,30-32).
Während er im ersten Gleichnis die Unterschiedlichkeit sowie die Ursachen von erfolgreichem oder eben missglückendem Wachstum darstellt, liegt der Schwerpunkt beim zweiten Gleichnis auf dem Wechselverhältnis zwischen menschlichem Tun und göttlichem Beitrag zu gelingendem Wachstum, und am Beispiel des Senfkorns stellt er dann noch das schier unglaubliche Wachstumspotential, das Gott in unscheinbare Anfänge hineinlegen kann, ins Zentrum. Drei unterschiedliche Wachstumsaspekte also; die jedoch alle in einem Punkt übereinstimmen: Wachstum ist bei Gott stets zu erwarten; es ist das Normale!
Im Matthäusevangelium, in dessen 13. Kapitel das Gleichnis vom Sämann ebenfalls zu finden ist, fügt Jesus sogar noch zwei weitere Gleichnisse an: Das Gleichnis vom „Unkraut unter dem Weizen“ (Matthäus 13,24-30) und dasjenige vom „Sauerteig“ (Matthäus 13,33). Auch diese Gleichnisse setzen wie selbstverständlich voraus, dass Wachstum stattfindet. Und das ist tatsächlich auch selbstverständlich – weil Wachstum eben genuin zum Wesen Gottes, zu seinem Naturell, zu seinem zugrundeliegenden Konzept gehört und durchgängig seine Schöpfungstaten kennzeichnet.
Um diesen selbstverständlichen Wachstumsprozess des Reiches Gottes in dieser Welt anzustoßen, legt Jesus nun das „Wort“ als dessen Auslöser in die Hände seiner Mitarbeiter, der Jünger. Er übergibt ihnen die Verantwortung, das „Saatgut“ seiner Gleichnisse – sein „Wort“ - gleichsam als „Zündfunke“ für die Ausbreitung des „Reiches Gottes“ auszustreuen.
Das ist erklärter Wille Jesu. Genau dazu sollen seine Nachfolger beispielsweise „Zeugen“ sein: Als „Licht“, das wahrgenommen wird, sowie als „Salz“, welches seine Umgebung würzt. Außerdem hat Jesus seinen Jüngern (und allen nachfolgenden Christengenerationen, also auch uns!) gleich mehrere Sendungsbefehle ausgestellt: „Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker …“ (Matthäus 28,19); „Ihr werdet [sollt] meine Zeugen sein …“ (Apostelgeschichte 1,8); „Siehe, ich sende euch …“ (Matthäus 10,16 und Lukas 10,3); „Geht hin in alle Welt und predigt …“ (Markus 16,15); „Seid … Zeugen!“ (Lukas 24,48) oder auch „… so sende ich euch!“ (Johannes 20,21).
Durch seine Jünger soll das Reich Gottes sozusagen „ausgestreut“ und „eingepflanzt“ werden, um sich anschließend ausbreiten zu können.
Dieser mehrfach erteilte Sendungsauftrag wurde nach Jesu Himmelfahrt beziehungsweise unmittelbar nach Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten sofort in Angriff genommen, und zwar dergestalt, dass sich als allererstes und noch am selben Tag eine erste Gemeinde, die sogenannte „Urgemeinde“ in Jerusalem, bildete.
Warum sofortige Gemeindegründung? Weil natürlich die Apostel, die Ohren- und Augenzeugen Jesu, nach jahrelanger Ausbildung an seiner Seite ganz genau gewusst haben, was ihrem Herrn und Meister vorgeschwebt hat und welche Strategie sie nach seinem Weggang umzusetzen hatten. Bis heute zeigt ja das das gesamte Neue Testament überdeutlich, dass das Christentum im Kern eine „Gemeinschaftsreligion“ darstellt; Gemeindegründung und -aufbau sind deshalb absolut folgerichtig. Auf der anderen Seite kann es übrigens - aus demselben Grund - niemals Gottes Willen oder Jesu Absicht entsprechen, wenn ein Nachfolger sich erlauben sollte, sich von seinen „Geschwistern im Herrn“ abzukapseln und mutterseelenallein durchs Leben zu wandeln. Dazu später mehr.
Zusammenschluss zu lebendigen Jesusnachfolger-Gemeinden ist also das völlig Normale in der Christenheit, wobei der Nachweis der Lebendigkeit nicht etwa durch deren emsige Wuseligkeit, ein breitgefächertes Angebot für jedermann oder aufwändige Inszenierung aller Anlässe erbracht wird, sondern durch das bestätigende Wirken Gottes und den Segen Jesu innerhalb sowie auch in der Außenwirkung dieser Gemeinden.
Genau diese Bestätigung Gottes wird postwendend schon in der ersten Gemeinde, die uns zu Beginn der Apostelgeschichte durchaus als Vorbild dargestellt wird, so beschreiben: „Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden!“ (Apostelgeschichte 2,47).
Wachstum findet statt! Logisch – ist ja typisch bei Gott!
Wobei der Fokus des hier stattfindenden Gemeindewachstums eindeutig auf „der Herr fügte hinzu“ liegt, und nicht etwa auf erfolgreichem Gemeindemanagement oder schlüssigem Evangelisationskonzept! Denn das wäre ja dann weniger „Bestätigung Gottes“ als vielmehr „Bestätigung menschlicher Strategien“.
Erkenntnis also schon am Vorbild des allerersten konstituierenden Zusammenschlusses der Jünger Jesu nach dessen Weggang: Gemeinden werden bewusst und nach Jesu Plan gegründet und deren anschließendes Wachstum ist eine völlig normale Begleiterscheinung solcher Gemeinden. Denn dadurch entsprechen sie nicht nur Gottes Art und Charakter, sondern sie verkörpern gleichzeitig auch noch Gottes Willen insofern, als dieser ja bekanntlich „will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen!“ (1. Timotheus 2,4). Wenn dieser Gotteswillen sich also durchsetzt – und zwar ausgeführt durch die ausdrücklich dazu berufenen Nachfolger seines Sohnes, also durch uns! – dann gibt es laufend neue Christen. Und selbstverständlich auch wachsende Gemeinden!
Das hat damals bestens funktioniert: Auch in den nächsten Gemeinden, die entstanden, erfolgte die Umsetzung dieses Gotteswillens nach demselben Schema, etwa in Antiochia: Als dort „eine große Zahl gläubig wurde und sich zum Herrn bekehrte“, ergänzt Lukas dazu noch ausdrücklich, dass eben „die Hand des Herrn mit ihnen [den Evangelium predigenden Christen] war“ (Apostelgeschichte 11,21). Gott will gerettete Menschen und sorgt deshalb höchstpersönlich dafür, dass Evangelisation gelingt!
Folge: Die jeweiligen Gemeinden wachsen! Genau nach Jesu Vorstellungen und Gottes Plan. Weil eben Wachstum zu Gottes Wesen, zu seiner Art, seinem Charakter gehört. Und der widerspiegelt sich – logisch! – dann auch im Wachstum seiner Gemeinden, die ja immerhin den „Leib seines Sohnes“ darstellen und der Welt die Wirksamkeit und Kraft des Heiligen Geistes vordemonstrieren sollen. Deswegen sind sie so sehr mit der göttlichen Wesensart verbunden und verquickt, dass sie gar nicht anders können, als zu wachsen!
Das tun sie auch. Auch heute noch. Weltweit.
Nur nicht bei uns.
Es geht mir an dieser Stelle jetzt nicht um den (bedauerlichen) Mitgliederschwund der evangelischen und katholischen Volkskirchen in unserem Land, sondern es geht, da wir ja das evangelikale Gemeindespektrum anschauen wollen, schwerpunktmäßig um die Wachstumszahlen unserer freikirchlichen Gemeinden.
Ich kann mir hier die Auflistung konkreter Zahlen oder das Zitieren von publizierten Untersuchungen vertrauenswürdiger Organisation zum Thema „weltweites Gemeindewachstum“ sparen, denn es werden im evangelikalen Bereich laufend neue Statistiken dazu veröffentlich, viele davon sind auch im Internet abrufbar. Und allesamt kommen solche Erhebungen stets zu demselben erfreulichen Ergebnis: Die „bekennenden“ Christen vermehren sich weltweit, die bibel- und jesuszentrierten Gemeinden wachsen. In Latein- und Mittelamerika genauso wie in Afrika, in Asien, Australien und wo auch immer: Überall Gemeindewachstum.
Ausnahme: Die „westliche Welt“, insbesondere Westeuropa. Und da liegt Deutschland nicht nur mittendrin, sondern bei der Statistik „fehlendes Gemeindewachstum“ in einer Spitzenposition.
Da wird die erfreuliche Statistik für uns dann plötzlich ernüchternd.
***
Mir ist die Umfrage einer Freikirche zum Thema „Gemeindeentwicklung“ in bleibender Erinnerung. Bei dieser Erhebung wurden Fragebögen von allen Gemeindevorständen im gesamten Land Baden-Württemberg, in dem eine ganze Reihe von Gemeinden dieser Freikirche beheimatet ist, ausgefüllt. Unter anderem wurde gefragt: „Wie viele Menschen haben sich in Eurer Gemeinde in den letzten zwei Jahren bekehrt, und wie viele davon haben sich anschließend Eurer Gemeinde angeschlossen?“
Die Auswertung ergab folgendes Ergebnis: Total zwei!
In Zahlen: „2“!
Und das in allen baden-württembergischen Gemeinden dieser Freikirche – und das sind nicht wenige! – zusammengezählt!
Dass dieses Umfrageergebnis nicht an die große Glocke gehängt wurde, ist nachvollziehbar. Der Freikirchenbund verwies stattdessen lieber auf trotzdem beobachtbares Wachstum bei einigen ausgewählten Gemeinden, welches allerdings fast ausnahmslos auf „Mitgliedertransfer“ (mehrheitlich Landeskirchler, die frustriert zur Freikirche wechselten) sowie „Eigennachwuchs“ (erwachsen werdende Kinder von Gemeindegliedern, die ebenfalls Mitglieder werden) zurückzuführen war.
Als langjähriger freikirchlicher Pastor, der ich unter anderem auch in Baden-Württemberg tätig war, hat mich dieses Ergebnis nicht wirklich überrascht, aber doch ziemlich ernüchtert und in seiner Deutlichkeit dann auch erschüttert. Denn damit hatte ich jetzt den „geistlichen Effizienznachweis“ typisch evangelikaler Gemeinden schwarz auf weiß in den Händen.
Aber man braucht es hierzulande nicht schwarz auf weiß. Es genügt, wenn man sich in der evangelikalen Landschaft etwas umschaut und ein paar Gemeinden davon kennt. Dann ist ohne Mühe beobachtbar, wie „erfolgreich“ unsere evangelistischen Bemühen (sofern denn überhaupt „bemüht“ wird) tatsächlich sind und wo Gott dieses Bemühen durch Gemeindewachstum bestätigt.
Als Begründung für unsere fruchtlosen Evangelisationsbemühungen und fehlendes Gemeindewachstum wird bei solchen Überlegungen immer ganz schnell mit „harter Boden hierzulande“, „eine Folge der Aufklärung“ oder „der Wohlstand bei uns verhindert geistlichen Aufbruch“ argumentiert.
Ich wäre mir da nicht allzu sicher, ob das wirklich als Begründung taugt. Solche Argumentationen bewegen sich stets gefährlich nahe am Abgrund fauler Ausreden!
Denn mal Hand aufs Herz: Sind wir wirklich der Meinung, dass unsere westliche Kultur, also der hierzulande vorherrschende „weltliche“ Zeitgeist und die derzeitige Mentalität und Weltanschauung unserer Mitmenschen, ernsthaft Gottes Wille, „dass alle Menschen gerettet werden“ (nach 1. Timotheus 2,4) und ein daraus resultierendes „Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu“ (nach Apostelgeschichte 2,47), ausbremsen könnte? Sollte Gott tatsächlich kein Rezept, kein Mittel finden, die Hemmschwellen unserer aktuellen westlichen Kultur zu durchbrechen?
Paulus, der Vorzeigeevangelist schlechthin, geht selbstverständlich davon aus, dass „das Evangelium … in aller Welt Frucht bringt und wächst“ (Kolosser 1,5+6), was doch nichts anderes bedeutet, als dass nach seinem Verständnis durchaus an allen Orten Gemeinden wachsen könnten und auch sollten.
Auf seiner 2. Missionsreise schien allerdings auch Paulus einmal auf „harten Boden“ zu treffen: In Apostelgeschichte 16 wird berichtet, wie er wochenlang und offenbar ohne jeglichen evangelistischen Erfolg durch das vorderasiatische Inland, der heutigen Zentraltürkei, irrte. Offensichtlich schien die kulturelle Disposition der dortigen Bevölkerung ebenfalls nicht übermäßig „evangelisationsoffen“ gewesen zu sein – vermutlich also eben „harter Boden“.
Wie regierte Paulus?
Nicht durch resigniertes Schulterzucken mit anschließendem „Hände in den Schoß legen“, sondern der Heilige Geist führte ihn und sein Team durch konkrete Handlungsanweisungen zielgerichtet nach Philippi und dort zu einer Frau namens Lydia, der „der Herr das Herz auftat“ und in deren Haus anschließend eine Gemeinde entstand (Apostelgeschichte 16,6-15).
Wir können dabei davon ausgehen, dass der Heilige Geist ihn deshalb wirkungsvoll zu dieser Lydia führen konnte, weil Paulus Jesu Sendungsbefehl ernst nahm und um jeden Preis Menschen mit dem Evangelium erreichen wollte. Und Gott war sehr wohl bereit, seine Dienste anzunehmen und ihn bei nächstbester Gelegenheit wieder so einzusetzen, dass er weiterhin „Herzen auftun“ konnte. Der „harte Boden“ hat den Heiligen Geist also absolut nicht daran gehindert, Paulus seinem Auftrag gemäß wirkungsvoll einzusetzen.
Kann der Heilige Geist das heute, bei uns, nicht mehr? Kann er uns auf unserem „harten Boden“ nicht mehr so einsetzen, dass Gott an den Herzen von Menschen wieder zum Zuge kommt? Und das schon seit vielen Jahrzehnten und flächendeckend nicht mehr?
Es ist offensichtlich, dass der Heilige Geist bei uns kaum mehr erwecklich aktiv werden kann. Wann fand denn eigentlich zum letzten Mal hierzulande ein größerer geistlicher Aufbruch statt, den man zur Recht als „Erweckung“ hätte bezeichnen können? Während meiner Lebzeit – und ich bin auch nicht mehr der Jüngste - wurde mir keine bekannt. Fakt ist: Man muss in unseren Geschichtsbüchern schon sehr weit zurückblättern, um diesbezüglich fündig zu werden.
Nein, wir erleben nur noch in seltenen Ausnahmefällen, dass sich wenigstens einzelne Menschen tatsächlich noch „bekehren“, dass sie also eine bewusste Hinwendung zu Jesus aufgrund der Erkenntnis ihrer Schuldhaftigkeit vor Gott und der daraus resultierenden persönlichen Verlorenheit vollziehen. Sie kommen offenbar nicht an diesen Punkt, an dem Gott ihnen „das Herz auftun“ könnte. Genau dies allerdings wäre die Basis eines gesunden und geistlichen Gemeindewachstums, denn Bekehrungen nach erfolgter Buße sind laut Jesus das Konzept, aufgrund dessen Gott „zur Gemeinde hinzutut“.
Und das funktioniert selbstverständlich auch heute noch: Durch solche Bekehrungen, bei denen Menschen bewusst einen lebensverändernden Schnitt vollziehen und eine deutlich erkennbare „Umkehr“ stattfindet, wachsen Gemeinden in allen Regionen der Welt.
Außer bei uns. Hierzulande kommt Gott nicht mehr zum Zuge. Bei uns bekehrt sich höchst selten noch jemand.
Warum funktioniert‘s bei uns nicht?
Könnte es sein, dass uns die geistliche Qualifikation eines Paulus und seiner Gefährten irgendwie abhandengekommen ist, so dass Jesus nun hier, bei uns, seine geistlich qualifizierten Mitarbeiter, die nichts weniger als „Glieder seines Leibes“ sein sollten und damit also seine „ausführende Organe“ (denn das sind „Glieder“ nämlich gemäß funktioneller Definition!), fehlen? Und dass uns deshalb der Heilige Geist nicht zielgerichtet so führen kann, dass es immer wieder zu echten, geistgewirkten Bekehrungen kommt?
Falls der „harte Boden“ also tatsächlich nicht nur eine Ausrede sein sollte, dann dürfte uns vermutlich genau dieses Manko anhaften: „Fehlende qualifizierte Glieder seines Leibes“! Jesus fehlen die Mitarbeiter, die noch genügend geistliches Format haben, um Menschen so nahe an Jesus heranzuführen, dass Gott ihnen „das Herz auftun“ kann.
Und könnte diese „fehlende Qualifikation“ nun genau daher rühren, dass die Beziehung dieser Mitarbeiter zu ihrem Herrn und Meister lediglich auf einem „Placebo-Glauben“ beruht?
***
Nun trösten wir uns vielleicht mit dem Gedanken: „Ja, mag schon sein. Aber es gibt doch auch bei uns immer noch etliche Gemeinden, die durchaus wachsen. Also kann man doch nicht von fehlendem« Gemeindewachstum sprechen! Wir könnten höchstens beklagen, dass es eben zu wenige« wachsende Gemeinden gibt!“
Das klingt auf den ersten Blick tatsächlich tröstlich. Und es stimmt: Es gibt durchaus auch in unserem Umfeld noch Gemeinden, die wachsen. Darüber freuen wir Christen uns natürlich, und ich freue mich selbstverständlich mit!
Aber trotzdem erlaube ich mir den Luxus, auch hier etwas genauer hinzusehen. Als Pastor mit Schwerpunkt „Gemeindeaufbau und -entwicklung“ scheint mir das ohnehin unerlässlich zu sein.
Um den Unterschied zwischen wachsenden und stagnierenden oder schrumpfenden Gemeinden zu erkennen, liegt es nahe, einfach mal die Gemeinden zu vergleichen, und zwar anhand der Frage: „Was haben wachsende Gemeinden, was denjenigen ohne Wachstum fehlt?“ oder „Wo liegt der Unterschied, der offenbar das Wachstum ausmacht?“
Damit lassen sich einige immer wiederkehrende typische Faktoren erkennen, die offensichtlich bei uns den „Erfolg“ in Form von Gemeindewachstum ausmachen. Beispielsweise die folgenden:
Wachstum durch Hochglanz-Ambiente:
Durch aufwendige Bühnenshows mit rhetorisch gekonnter Moderation, in modern gestylten Gemeindehauskomplexen inklusive hochwertiger technischer Ausstattung, unterstützt durch professionelle Social-Media-Auftritte und flankiert von gezielten Werbemethoden zu jedem Anlass können vor allem größere Gemeinden erfolgreich Publikum anlocken. Kommt dazu, dass deren Mitglieder auch durchaus motiviert in solche Gemeinden einladen, denn sie können (zu recht) stolz sein auf das, was „ihre“ Gemeinde anzubieten hat.
Um es gleich vorwegzunehmen: Ich bin ein penetranter Verfechter von Qualität und Seriosität bei uns Christen, und das muss sich selbstverständlich in unseren Gemeinde-Auftritten widerspiegeln. Deswegen mag ich „gute“ Gottesdienste und sie dürfen durchaus auch aufwendig gestaltet werden. Außerdem: Qualität und Seriosität steht nicht nur großen, sondern auch kleineren Gemeinden gut an, sofern dies Ausdruck einer angemessenen Atmosphäre für den „Herrn und König“ - der laut unserm Verständnis ja persönlich anwesend ist! - darstellt sowie auch die aufmerksame Gastgeber-Liebe zu unseren Gästen widerspiegelt. Deswegen freue ich mich über schöne und ansprechende Gemeindeveranstaltungen! Diese dürfen zur Ehre Gottes auch durchaus aufwendig sein – das nötige Kleingeld dazu ist hierzulande ja reichlich vorhanden.
Aber: Dass in unserer Gesellschaft, die jedes Wochenende hochstehende und anspruchsvolle kulturelle Anlässe zu Hauf besuchen kann und tägliche Fernsehunterhaltung auf höchstem Niveau mit brillanten Entertainern gewohnt ist, eine Gemeinde punkten kann, die ebenfalls ein dementsprechendes Programm und Ambiente anbietet, könnte durchaus auch ein soziologisch generierter und nicht ein „geistlich gewirkter“ Erfolg sein. Hier stellt sich also die Frage: Ist Gemeindewachstum dank Hochglanz-Ausstrahlung geistgewirkt oder ganz einfach kulturrelevant und damit als erwartbare menschliche Honorierung erklärbar?
Wachstum durch brillante Verkündiger
Dieser Aspekt des Gemeindewachstums ist zumeist eng mit dem eben geschilderten „Wachstum durch Hochglanz-Ambiente“ verwandt. Auch in unseren Gemeinden ist zuweilen beobachtbar, dass sich Menschen offensichtlich durch außergewöhnlich begabte Verkündiger anlocken lassen, deren Bühnenpräsenz sowohl optisch wie auch rhetorisch genau auf den Gusto unserer unterhaltungsverwöhnten Mitmenschen abgestimmt ist. Manche dieser Kanzelrhetoriker verstehen es perfekt, durch Ausstrahlung und Überzeugungskraft zu punkten und sich dadurch einen stetig zunehmenden Bekanntheitsgrad zu erarbeiten. In deren Kielwasser entsteht dann oft so etwas wie eine „Fangemeinde“, die voll und ganz auf „ihren“ Prediger ausgerichtet ist.
Und der Erfolg gibt diesen Verkündigern dann scheinbar recht! Selbst wenn der Inhalt ihrer Verkündigung nicht wirklich biblisch fundiert und die vermittelten Botschaften keinen geistlichen Tiefgang aufweisen sollten: Wer wagt schon Kritik zu üben, wenn die Massen strömen?
Hiervon sind auch wir Evangelikalen nicht gefeit!
In den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts predigte ein gewisser Peter Wenz in Stuttgart derart erfolgreich, dass viele Christen von weither anreisten, um ihn zu hören. Es entwickelte sich daraus nach und nach eine große Gemeinde, die jahrzehntelang und teilweise bis heute von der Person und Ausstrahlung dieses Verkündigers begeistert war und ist.
Seine Bühnenpräsenz in Kombination mit seiner damals ziemlich aufsehenerregenden Art des Predigens war durchaus faszinierend. Wen kümmerte es da, dass dieser Peter Wenz in jungen Jahren ganz offen ein „Heilungsevangelium“ auf der Basis der Behauptung „Wenn du recht glaubst, wirst Du niemals krank!“ predigte (heute hat er sich meines Wissens allerdings von dieser Theologie weitgehend distanziert)?
Ich konnte mir damals, als junger Pastor, noch keinen richtigen Reim darauf machen, warum dieser Verkündiger trotz inhaltlich sehr fragwürdiger Botschaft einen solchen Zulauf hatte. War das darauf basierende Wachstum seiner Gemeinde etwa doch ein Nachweis von Gottes Segen?
Heute sehe ich das etwas nüchterner, nachdem ich verstanden habe, dass ein brillanter Redner bei guter Vermarktung in unserer Kultur stets die Chance hat, Menschen in großer Zahl anzulocken. Sowohl in der medialen Unterhaltungskultur wie auch in frommen Kreisen, und zwar nach denselben vermarktungstechnischen Kriterien und Prinzipien.
Wem eine solche überdurchschnittliche Rede-Begabung gegeben ist, der kann und soll als Verkündiger des Evangeliums diese innerhalb seines geistlichen Dienstes auch einsetzen. Allerdings funktioniert es genauso auch ohne „geistlich“! Und wenn sich dann Erfolg einstellt und allabendlich Massen an Zuhörern den Saal stürmen, die ihm allesamt auch noch vollmundig „Vollmacht“ attestieren – wer mag dann noch widersprechen?
Gegenbeispiel: In meiner Gemeinde gab es einen geistlich gereiften Mitarbeiter, der – meines Erachtens zu Recht! - bei jedermann großen Respekt und Anerkennung genoss. Allerdings hatte er das Handicap, dass er beim Reden etwas stotterte und sich deshalb für Predigten nicht zur Verfügung stellen wollte.
Aus beruflichen Gründen - er war Beamter - musste er dann wegziehen. Seine neue Gemeinde, in der er schon bald in den Leitungskreis berufen wurde, bat ihn, eine kleine Tochtergemeinde in einer ländlichen Gegend zu betreuen. Es handelte sich um eine Dorfgemeinde, die in sich teilweise zerstritten war; die wenigen noch engagierten Mitarbeiter hatten die Hoffnung auf ein Überleben ihrer Gemeinde schon ziemlich aufgegeben.
Der Mitarbeiter nahm diese Aufgabe ernst und widmete sich, zusammen mit seiner Frau, vorbildlich und engagiert dieser kleinen Gemeinde; er führte insbesondere viele Gespräche und baute Gesprächskreise auf, in denen wieder Vertrauen zueinander wachsen konnte. Und er begann nun doch zu predigen. Und siehe da: Jedermann kam ausgesprochen gerne zu den Predigten dieses „Stotterers“ ohne Redebegabung! Aber er hatte geistlich viel mitzuteilen, und genau das war seinen Zuhörern wichtig! Ihr Glaube wuchs stetig durch seine Verkündigungsdienste.
Ganz offensichtlich war es nicht seine Brillanz auf der Kanzel oder seine ausgefeilten Predigt- und Vortragstechniken, die seine Verkündigung „erfolgreich“ machten. Aber die Gemeinde festigte sich, erhielt neuen Mut und riskierte bald auch wieder Auftritte in der Öffentlichkeit. Und sogar ein kleines Wachstum stellte sich ein, durchaus ungewöhnlich für eine sehr überschaubare dörfliche Gemeinde.
Und nun vergleiche ich den Erfolg dieses „unbegabten“ Verkündigers mit dem Erfolg von Rednern der Kategorie „junger Peter Wenz“. Nur bei einem der beiden bin ich mir sicher, eindeutig das Wirken des Heiligen Geistes und den offensichtlichen Segen Gottes darin erkennen zu können! Nur bei einem von beiden könnte man deshalb von „vollmächtiger Verkündigung“ sprechen, allerdings wurde ausschließlich immer der andere mit dieser vermeintlich geistlichen Auszeichnung geadelt.
Wenn man nun die Wachstumsfaktoren „Hochglanz-Ambiente“ und „brillante Verkündiger“ zusammennimmt, weil sie bei uns oft Hand in Hand gehen, und diese Art der Gottesdienste mit denen der ersten Gemeinden, wie sie uns biblisch überliefert wurden, vergleicht, dann fällt sofort ins Auge, dass damals die Verkündiger durchaus nicht durch stylische Optik und professionellen Auftritt zu glänzen brauchten.
Wenn beispielsweise bei einer Predigt von Paulus in Troas sogar Zuhörer einschlafen und aus dem Fenster fallen konnten (Apostelgeschichte 20,7-9), dann deutet das durchaus nicht auf packende Performance und ausgefeilte Rhetorik eines Apostels hin.
Derselbe Paulus evangelisierte laut Eigendarstellung auch bei den Korinthern „nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit“, sondern „in Schwachheit und mit Furcht und großem Zittern“ und seine Predigten „geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweis des Geistes und der Kraft!“ (1. Korinther 2,1-4). Sein Ziel dabei war, dass der Glaube der Korinther „nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft!“ (1. Korinther 2,5), wie er abschließend erklärt.
Paulus lässt in diesem Statement durchblicken, dass es durchaus auch möglich wäre, dass reine „Menschenweisheit“ eine Form von Glauben bewirken kann. Eine Glaubensform allerdings, die Paulus rundweg ablehnt. Vermutlich aus gutem Grund, denn es dürfte sich bei diesem Glauben dann wohl um einen „Placebo-Glauben“ handeln …
Wachstum durch Massenanziehung:
Zuweilen wachsen natürlich auch kleinere Gemeinden, wenn sie Wert auf gepflegtes und seriöses Auftreten legen. Aber zumeist gilt eben doch: Je größer eine Gemeinde ist, oder genauer gesagt: Je besser deren Sonntags-Gottesdienste besucht werden (was durchaus nicht dasselbe ist!), desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr Leute dazu stoßen.
Warum?
1.) Masse zieht an: „Wenn alle hingehen, muss da wohl was Interessantes sein!“;
2.) groß wirkt seriös und weniger klüngelhaft oder sektiererisch: „So viele können doch wohl nicht irren!“;
3.) je größer der vorhandene Pool an Gemeindegliedern ist, desto mehr begabte Mitarbeiter für eine hochwertige Programmgestaltung und -darbietung lassen sich finden;
4.) bei größeren Gemeinden kann mehr Geld zusammengelegt werden für aufwendigere Technik, Raumgestaltung oder auch Werbung.
Dass schlichte Größe durchaus ihre eigene Anziehungskraft besitzt, könnte schon bei der ersten Gemeinde in Jerusalemer durchaus ein Faktor gewesen sein. Immerhin startete diese Gemeinde aufsehenerregend allein schon durch ihre Masse: Quasi „über Nacht“ formierte sich eine Gemeinschaft von gleich mal rund dreitausend Gläubigen (Apostelgeschichte 2,41), zu denen dann Gott noch „täglich hinzufügte“ (Apostelgeschichte 2,47), so dass schon wenige Tage später „die Zahl der Männer auf fünftausend stieg“ (Apostelgeschichte 4,4); anschließend „wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten“ durch die Wundertaten der Apostel dann noch weiter an, so dass uns die Bibel ausdrücklich von „einer Menge Männer und Frauen“ (Apostelgeschichte 5,14) berichtet.
„Massenanziehung“ als Gemeindewachstumsfaktor gabs also vermutlich schon zu biblischen Zeiten. Aber ist Massenanziehung nicht ein simples gruppendynamisches und damit erneut kein genuin geistliches Geschehen?
Die beiden bisher genannten Wachstumsermöglicher „Professionalität“ und „Massenanziehung“ können natürlich durchaus auch echte geistliche Erweckungen sinnvoll unterstützen. Man muss diese Faktoren nicht unbedingt negativ bewerten. Sie sind beispielsweise derzeit im deutschsprachigen Raum typische wachstumsfördernde Stärken von „ICF“-Gemeinden, wobei dann dort zuweilen auch die beiden nächsten, leider eher negativen Faktoren, ebenfalls beobachtbar sind.
Wachstum durch geweckte Emotionen:
Dieser Wachstumsfaktor ist überwiegend in Gemeinden mit sogenanntem „charismatischem“ Frömmigkeitsstil beobachtbar, wenn sich deren Gottesdienste nicht nur warmherzig und einladend präsentieren, sondern – vor allem im sogenannten „Lobpreis