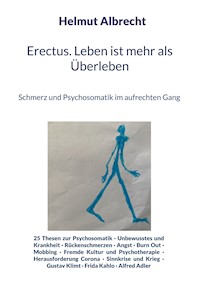
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der aufrechte Gang ist für den Menschen Auszeichnung und Bürde zugleich. Selbst bei hervorragenden Repräsentanten der Kultur wie Alfred Adler, Frida Kahlo und Gustav Klimt liegen Triumph und Tragik nahe beieinander. Rückenschmerzen sind das markanteste Symptom für das Auf und Ab im aufrechten Gang. Sie treten nicht zufällig häufig mit pathologischer Angst, Depressionen und Burn Out auf. Wir wollen im Leben mehr als Überleben und Symptomfreiheit. Wir sehnen uns nach Erfüllung, Selbststeigerung und Sinn. Sind unsere psychosomatischen Symptome der Preis dafür, wenn wir an unsere Grenzen kommen? Wir benötigen Mut, Hoffnung und Humor um den Weg weiter im aufrechten Gang zu bewältigen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Bedeutung unbewußter Prozesse in der Entstehung, Behandlung und Heilung von Krankheit
Angst als Krankheit und „Katastrophenreaktion“ des Organismus und seiner Existenz
Rückenschmerzen - Bandscheibenvorfall oder Krankheit des aufrechten Ganges?
Was ist Fibromyalgie? Leiben wörtlich genommen oder: der Körper als Hofnarr?
Mobbing – die leise alltägliche Gewalt. Mit einer Analyse von Robert Musils „Die Verwirrungen des Zöglings Törless“
Begegnung mit fremder Kultur als Herausforderung für die Psychotherapie
Für Ideale brennen und ausbrennen - Alfred Adler als Pionier der Psychosomatik, Führungsgestalt und Patient im Burn Out
Gustav Klimt – Kunst, Erotik und Erfolg als Selbsttherapie - mit einem Beitrag zur Psychosomatik des Schlaganfalls
Verkörperung im Schönen – Leben und Werk Frida Kahlos als Herausforderung für die Schmerztherapie
Leben ist mehr als Überleben. Die Corona-Krise überwinden
Imperialer Krieg und Sinnvernichtung im Kielwasser der Pandemie
25 Thesen zur Psychosomatik und Psychotherapie - Lernen sein eigener Arzt zu werden
Anmerkungen und Literatur
Aber die Neigung, Wahrheit und Wissen psychologisch zu verstehen, sie mit Psychologie gleichzusetzen, psychologischen Wahrheitswillen als den Willen zur Wahrheit überhaupt und Psychologie als Wahrheit im eigentlichsten und tapfersten Sinn des Wortes zu empfinden – diese Neigung...ist mir geblieben, und sie bildet eine Vorbedingung der Aufgeschlossenheit für die seelische Naturwissenschaft, die den Namen „Psychoanalyse“ trägt.
Thomas Mann1
Die Bedeutung unbewußter Prozesse in der Entstehung, Behandlung und Heilung von Krankheit
Beiträge der Psychoanalyse und ihrer Weiterentwicklungen zum Verstehen des Menschen in der Medizin und Psychotherapie
Anthropologie ist die Lehre vom Menschen. Zu ihr tragen die Philosophie sowie alle Wissenschaften vom Menschen bei. Ihr zentrales Interesse gilt der Frage: „Was ist der Mensch?“. Dem medizinischen Forschen und der ärztlichen Praxis liegt explizit oder meist implizit, d.h. nicht systematisch ausformuliert und nicht bewusst reflektiert, ein vor allem an den Naturwissenschaften und der Biologie orientiertes Grundverständnis vom Menschen zugrunde, das Erkennen, Behandeln und Therapie von Krankheiten entscheidend prägt.
Sigmund Freuds konsequente Anwendung seiner Erkenntnisse in der Behandlung der Hysterien und der Neurosen ist bis heute irreversible Herausforderung für die Medizin geblieben, ihre eingeschränkte Sichtweise durch eine dem Menschen und seiner Existenz und Daseinsform angemessene Anthropologie zu ergänzen.
Krankengeschichten wie Novellen
Freuds Krankengeschichten erinnerten ihn an Novellen, er erkannte das Narrativ, die Erzählung in einem Universum von Bedeutungen in Kultur und Sprache als entscheidende Faktoren im Heilungsprozeß, eingebettet in menschliche Beziehung in der Therapie. Der Körper gilt zwar als ein Stück Natur, er ist aber von Bedeutsamkeit und Geschichte durchdrungen, die menschliche Person ist geprägt von Kultur und Zivilisation. Zugleich ist das Selbstverständnis vom souveränen Ich erschüttert durch die Macht dominanter unbewusster Prozesse, die unser Denken, Fühlen, Entscheiden und Handeln bestimmen2.
An der Wiege der Tiefenpsychologie steht das für die Medizin des 19. Jahrhunderts ungelöste Problem der Hysterien. Um ihre adäquate Heilmethode, die Psychotherapie, zu entdecken bedurfte es einer Bereitschaft, den Menschen umfassend zu erkennen, die über das Biologische oder das Modell vom „Menschen als Maschine“ hinausgeht und das Geistige und Soziale berücksichtigt. Sigmund Freud war ein umfassend gebildeter Geist, geschult an Weltliteratur und Philosophie.
Sigmund Freud etabliert mit der Tiefenpsychologie eine philosophische Psychologie und Medizin. Mit zunehmendem Alter aber äußert er zunehmende Skepsis am vorrangigen Wert der Psychoanalyse als Methode der Krankenbehandlung und sieht ihre Zukunft vor allem in ihrer Bedeutung für die Kulturkritik und das grundsätzliche Verstehen des Menschen. Trotz dieser Selbsteinschätzung ist aber unstrittig, dass die moderne psychosomatische Medizin Freuds bahnbrechenden Erkenntnissen ihre Existenz verdankt: über die Macht traumatischer Beziehungserfahrungen, die verheerenden Wirkungen erzieherischer Gewalt, von sexuellem Missbrauch, pathologischen Verdrängungen, Sexualproblemen, unbewältigten Affekten wie Angst und Wut, von Neurosen und Depressionen als Krankheitsauslöser oder -verursacher, über Träume als sinnvolle Botschaften und die Macht der Gefühle und des Triebhaften über die Vernunft.
Das Emotionale in der psychotherapeutischen und der Arzt-Patient-Beziehung
Als Konsequenz für die Therapie ergibt sich daraus, im scheinbar rationalen Betrieb der medizinischen Versorgung und nicht nur in der Psychotherapie die Beziehungsdynamik und die Gefühle zwischen Arzt und Patient ausreichend zu beachten, sie zugleich als Risiken und Chancen des Heilungsprozesses zu begreifen, im Zusammenwirken von Übertragung, Gegenübertragung und Widerstand und, in Ausweitung und Abwandlung dieser Konzeption, im reflektierten Agieren zwischen Arzt und Patient als Realpersonen im „Hier und Jetzt“3.
Selbst nachdem viele von Freuds Erkenntnissen im Laufe von Jahrzehnten konstruktive Wandlungen und Korrekturen erfahren haben, wird der originale Fundus seiner Lehre und seiner Beobachtungen immer wieder erneut zum Gegenstand von Besinnung und Überprüfung, zuletzt im Lichte der Ergebnisse aktueller neurowissenschaftlicher Forschung4. Dennoch: die allgemeine Durchdringung des ärztlichen Wirkens mit der medizinischen und philosophischen Anthropologie der Tiefenpsychologie steckt immer noch in den Anfängen.
Medizinische Anthropologie steht nicht notwendig im Gegensatz zu den technischen Errungenschaften der Medizin und der somatischen Behandlungsmethoden, sie beleuchtet vielmehr den kommunikativen, sprachlichen, kulturellen Kontext, dem sie verpflichtet sind, und erweitert das naturwissenschaftlich und biologisch geprägte Menschenbild, eine Bereicherung für Diagnostik und Therapie.
Die menschlichen Beziehungen sind bestimmt durch ein Zusammenspiel von einerseits machtvollen zerstörerischen und andererseits starken nach Vereinigung und Verbindung strebenden Kräften, von Freud in Anlehnung an die antike Philosophie im ersteren Fall Destrudo und im letzteren Eros genannt. Angewandt auf die Dynamiken in der medizinischen Diagnostik und Therapie bedeutet das, anzuerkennen, dass auch in der nüchternen Welt der Medizin ständig starke Affekte, Leidenschaften, Wünsche, Ängste und Hoffnungen am Werk sind, die positiv genutzt werden können oder aber destruktiv wirken können.
Rivalitäten, Prestige- und Machtkämpfe spielen in die Beziehungen zwischen Arzt und Patient hinein, manchmal auch sexuelle Begierden, selbst wenn der professionelle Anspruch sie ausgeschlossen wissen will5. Die intime Situation der körperlichen Untersuchung ist Bedrängungen durch das Allzumenschliche ausgesetzt, das bewusst gewollte Bemühen um Heilung oder Hilfestellung kann durch Gefühle der Überlegenheit oder Unterlegenheit, durch Scham- und Schulderleben, Ekel, Anziehung und Abwehr empfindlich beeinträchtigt werden.
Der Organismus als sozial und kulturell überformter Körper
Die Körper, mit denen der Arzt es zu tun hat, sind sozialisiert, kulturell überformt, „begeistigt“ durch Erziehung, Lebensgeschichte und Kultur und funktionieren nicht als bloß physiologisch-anatomische Gebilde oder rein biologische Organismen. Jede medizinische Behandlungs- oder Untersuchungssituation ist auch ein komplexer zwischenmenschlicher Prozess. Kenntnis der biografischen Anamnese und des psychischen Status können auch bei Erkrankungen mit schweren Organschädigungen in Krisensituationen dem Krankheitsverlauf entscheidende Wendungen geben. Krankheit, ob dominant psychisch oder somatisch, wird erst vollständig erkannt und adäquat behandelt, wenn sie auch im Kontext von Lebenszusammenhang und Persönlichkeit untersucht ist.
Damit medizinische Diagnostik und Therapie optimal zielführend und problemorientiert eingesetzt werden können, müssen diese - meist unbewusst - wirksamen Kräfte erkannt werden. Die Effizienz von Diagnostik und Therapie ist gefährdet, wenn deren Anwendung nicht in den Rahmen einer tragfähigen Arzt-Patient-Beziehung eingebettet ist.
Eine Vielzahl chronischer Krankheitsverläufe, vor allem in der Schmerztherapie und in der Diagnostik und Therapie funktioneller Organerkrankungen, sind iatrogen bedingt, die Folge somatisch fixierter Wiederholungsdiagnostik, unreflektierter, unbewusst affektiv gesteuerter Operationsindikationen und dem Festhalten an medikamentösen Therapien, deren Wirkungslosigkeit im konkreten Einzelfall sich bereits bald nach Beginn herausstellte. Dieser „Wiederholungszwang“ ist gespeist aus Motiven unbewusster Konstellationen in der Arzt-Patient-Beziehung, er führt dazu, dass im Sinne Mephistos in Goethes „Faust“ „Vernunft zu Unsinn und Wohltat zur Plage" sich verkehren.
Richtige Erkenntnisse über die Natur des Menschen und das Menschenbild in der Medizin sind keine abgehobenen Probleme, sie sind nützlich für Diagnostik und Therapie in der Medizin. Es gibt, so der Sozialpsychologe Kurt Lewin, nichts praktischeres, als eine gute Theorie. Erst eine dem Dasein des Menschen gemäße Anthropologie ermöglicht den vollständigen Blick auf die konkrete Behandlungs- und Therapiesituation: es ist etwas völlig Anderes, ob ich einen Menschen als Maschine mit einem Defekt auffasse, als „höheres Säugetier“, als „Objekt“ ärztlicher Maßnahmen oder als menschliches Gegenüber, mit dem ich in Dialog treten muss, um ihn zur Gänze, als biologische und geistige Existenz, zu verstehen und ihn in seiner Situation als Kranken zu erreichen 6 . Der Arzt, der die Komplexität der zwischenmenschlichen Begegnung unterschätzt, läuft Gefahr, sich lediglich auf kranke Organe zu konzentrieren und den Lebens- und Personkontext des Krankseins als seine wesentliche Bedingung zu übersehen. Die medizinische Theorie und Praxis benötigt eine Anthropologie, die dem ärztlichen Handeln zusätzliche Orientierung und Sicherheit gibt. Die ständige Überprüfung von Behandlung und Diagnostik auf diese anthropologischen Grundannahmen hin bietet außerdem einen Schutz gegen das Eindringen abergläubischer und unwissenschaftlicher Konzepte in die Medizin.
Im Folgenden werden einige Konzepte Freuds vorgestellt, die auch heute noch für das Krankheitsverständnis und das ärztliche Handeln nützlich, ja unverzichtbar sind.
Das Unbewusste im Krankheitsgeschehen als verborgene zielgerichtete Kraft
Mit der Erkenntnis des Unbewussten kann auch das Krankheitsgeschehen als weit mehr denn als Naturereignis verstanden werden, aus heutiger Sicht noch wesentlich umfänglicher, als Freud das selbst formulierte. Das Unbewusste lässt zwar primär den Organismus erkranken, wenn es zu seiner Motivation passt: zur Schuldentlastung, Selbstbestrafung, Selbstzerstörung, zu masochistischer oder indirekt sadististischer Lustbefriedigung, es instrumentalisiert oder gestaltet die Krankheit aber auch, um soziale Ziele zu erzwingen, wenn dem Ich die Möglichkeiten fehlen, diese durch soziale Kompetenz zu erreichen, zur Sicherung von Aufmerksamkeit, Liebe, Anerkennung und Macht, als Entscheidungsersatz, zur Entlastung von Lebensaufgaben, oder als Ersatz für Weltbezüge, Sinn, Wertverankerung und Lebensinhalt7.
Das Unbewusste ist im Biologischen verwurzelt, waltet unsublimiert und triebhaft gemäß dem Lustprinzip, ist aber sinnvoll, zielgerichtet, sprachmächtig und verkörpert die Zwitterstellung des Menschen als Kultur- und Naturwesen. Nicht nur die Aktualexistenz, die gesamte Lebensgeschichte ist bedeutungsschwer in der Semantik und Dynamik des Unbewussten präsent, das zusätzlich Idealbildungen und verinnerlichte Normen des Kollektivs beinhaltet.
Das Unbewusste nach Freud ist ein schwieriger Begriff, und nicht, entgegen anderer Positionen in der Diskussion darüber, mit dem „Subjekt“ gleich zu setzen8.
Freud wendet sich gegen die Vorstellung eines einheitlichen menschlichen Subjektes, Jacques Lacan in seiner radikalen Rückwendung zu Freud hält sogar an dem Bild fest, dass das Subjekt „über einem Abgrund“ steht, Psychoanalyse ist deshalb weit mehr als ein „Ich-Training“9. Am Ausbruch von Krankheiten als psychische Krisen sind Ich-ferne Verdrängungen beteiligt, die Identität, Handlungsfähigkeit und Wertorientierungen erschüttern. Es handelt sich um Einflüsse, die der Steuerungsfähigkeit der Person weitgehend entzogen sind und mit einer Eigendynamik die Existenz dominieren und eben deshalb über die somatische hinaus eine spezielle psychotherapeutische Hilfe benötigen. Es kann sich dabei um Begehren, um Wünsche handeln, die nicht in das eigene Selbstbild integrierbar sind, um trennende und aggressive oder sexuelle Affekte, die rigoros unterdrückt, um unlösbare innere Widersprüche und Konflikte oder um Verletzlichkeiten und Misserfolge in Beziehungen und beruflichen Projekten, die als Schwäche und Bedrohung des Selbstgefühls abgewehrt werden, insbesondere bei fragil kompensierten Persönlichkeitsstörungen mit narzisstischen Krisen.
Krankheit stellt sich in Situationen innerlich erlebter oder äußerer Bedrängnis und Ausweglosigkeit ein. Ist sie aber eine Schöpfung des Subjekts oder ist sie nicht vielmehr eine weitere Bedrohung infolge seines Scheiterns? Wenn sie dennoch eine „Schöpfung“ ist, ist sie eine Leistung des „Subjekts“, oder die einer anderen, komplexeren Dynamik, die weit darüber hinausgeht? Die humanistisch-poetische Vorstellung der Krankheit als Schöpfung der Person hat die Kehrseite der moralisierenden Bewertung: erkrankt man wirklich nur dann, wenn man sich gegen „notwendige Lebensvollzüge stemmt“ oder „gegen die Vernunft lebt“? Erkrankt man, weil man „versagt“, aus „sittlicher Verfehlung“10? Der Problematik wird auch nicht mehr gerecht, wenn man dem Kranken „zugute hält, dass sein ethisches Manko nicht größer als das unsrige“ ist11. Dass der Kranke für die Krankheit als „Schöpfung des Subjekts“ „Verantwortung übernehmen“ soll, gerät unter den Verdacht der Abwehr von Wahrheiten durch Moralisieren und vordergründige Willensakte im Sinne eines Sich-Zusammenreißens, In-sich-gehens, das aber situativ bedingt gar nicht möglich ist, somit das „Versagen“ weiter verschlimmert. Idelogiekritisch ist anzumerken, ob nicht V. v. Weizsäcker mit seiner Hypothese von der Krankheit als „Schöpfung des Subjekts“ eigentlich „Gott“ als Schöpfer von Krankheiten des „verfehlenden, „sündigen“ Individuums“ in die Medizin einführt12.
Dabei sollte aber nicht übersehen werden, dass die Idee von der Krankheit als Schöpfung des Subjekts auch unter nicht religiösen Prämissen in der Tiefenpsychologie vorkommt, wie zum Beispiel in der Individualpsychologie A. Adlers, mit moralisierenden Tendenzen. Mit der Auffassung von Krankheit als Folge sittlicher Verfehlung, wenn auch, wie bei A. Adler, gemildert durch eine Philosophie des „Als-ob“, begibt man sich in das Kielwasser einer potenziell voluntaristischen Psychologie, die einem unbewussten Geschehen eine Bewusstseinsnähe unterstellt, die es erlaubt, Krankheit als Schuld oder (moralisches) Versagen zu interpretieren, das durch besondere Willensakte beseitigt werden könnte. Das bestärkt Schuld- und Schamgefühle und die Selbstverurteilung mancher Kranker als Versager oder Ängste, als „eingebildete Kranke“ oder „Simulanten“ hingestellt zu werden. Der Weg zu einem tieferen Verstehen eines möglicherweise psychosomatisch verwurzelten Krankseins wird damit blockiert, wie zum Beispiel einer zugrundeliegenden potenziell selbstschädigenden Charakterproblematik und Beziehungsdynamik, einer Persönlichkeitsstörung, oder Folge erheblicher früher Traumatisierung.
Die Macht des Verdrängten als Krankheitsfaktor
In dem Versuch, Freuds Begriff des Unbewußten auf das Subjekt zu reduzieren, oder diesen gar in einen normativen Begriff der Person, als „ein Ich, das in Du- und Wir-Beziehungen lebt“ 13, aufzulösen, wird die Wirkmächtigkeit unerledigter Verdrängungen verharmlost und die Illusion der Allmächtigkeit des Guten und der willentlichen Machbarkeit durch Vernunft bedient..
Auch das als Person begriffene vernunft- und wertbezogene „Subjekt“, das sich den Grenzen seiner Souveränität verschließt, selbst im Geiste sogenannter höherer Werte oder Moral, ist anfällig für krankheitsfördernde Verdrängungen und Illusionen, bleibt mit dem Allzumenschlichen bei sich selbst und bei Anderen unausgesöhnt, was gewöhnlich Verbitterung, Einengung und Verschlossenheit, prekäres psychisches Gleichgewicht mit Anfälligkeit für narzisstische Krisen und psychosomatische Erkrankungen zur Folge hat14.
Freuds Verständnis des Unbewussten ist belastend und entlastend zugleich, indem die Grenzen unseres Ich und unserer Souveränität daran deutlich werden: mit dem Verweis auf eine mächtige psychosomatisch wirksame, zielgerichtet gestaltende Kraft in uns, die nicht durch einfache Willensentscheidungen beliebig beeinflusst werden kann, aber im Unterschied zum naturhaften Ablauf von Krankheit mit unserer Persönlichkeit im Zusammenhang steht, wenn auch im Verborgenen, weitgehend unverstanden und unerkannt.
Krankheit als libidinöses Phänomen
Krankheit steht im Zusammenhang mit gehemmter oder fehlgesteuerter leidenschaftlicher Lebensenergie, der von Freud so genannten „Libido“. Diese ist normalerweise lustvoll auf Beziehungen, Können und Expansion konzentriert mit einem gesunden Maß an narzisstischer Selbstliebe.
Beschädigter Narzissmus, fehlende Selbstachtung und Liebe zu sich selbst, erhöhen das Risiko zu erkranken, ebenso wie ein Mangel an Liebesfähigkeit durch belastende Beziehungsschicksale, die es verhinderten oder erschwerten, in sich „gute Repräsentanzen“ von Bezugspersonen aufzubauen, die ausreichend „libidinös besetzt“ sind. Fehlen diese Strukturen innerhalb der Persönlichkeit, wird der Narzissmus kompensatorisch aufgebläht und extrem verletzlich im Sinne narzisstisch gestörter Persönlichkeiten. Diese können durchaus sehr leistungsfähig, auch genial sein, aber auch kriminell und verwahrlost. Allen gemeinsam ist die erhöhte Anfälligkeit für Krankheit in narzisstischen Krisen, aber auch umgekehrt für stärkere narzisstische Krisen bei Krankheit. Die Libido regrediert zu extremer Selbstbezogenheit. Krankheit kann sowohl repräsentativ für eine narzisstische Krise auftreten, als auch eine solche auslösen. Dabei wird ein Großteil an Leidenschaft und Interesse für die Außenwelt, an „Libido“, verzweifelt vom beschädigten Selbst gleichsam aufgesogen. Kränkeln und Krankheit können dergestalt ein prekäres Selbstgefühl für einige Zeit auf eingeschränktem Niveau stabilisieren und eine narzisstische Katastrophe abwehren, nicht nur bei primär narzisstisch Gestörten.
Sämtliche pathologische Charakterentwicklungen mit Zwängen, Angstneurosen oder Depressionen oder Strukturstörungen des Ich und des Selbst sind für erhöhte Krankheitsbereitschaft mitverantwortlich. Man weiß heute, dass bei frühen Traumatisierungen durch Gewalt, körperliche Misshandlung oder sexuelle Übergriffe ein zehnfach erhöhtes Risiko besteht, als Erwachsener an chronischen Schmerzen oder anderen schweren Somatisierungsstörungen zu erkranken.
Prägung des Leiblichen in der psychosexuellen Entwicklung
Kern der Sexualtheorie Freuds ist, dass diese Hemmungen und Schädigungen durch prägende Erlebnisse in bedeutsamen, stark libidinös besetzten Beziehungen am Leitfaden des Leibes, an Mund, After, Genitalregion, Haut, in Zusammenhang mit Essen, Verdauung, Sexualität, Berührungen, entstanden sind, in Auseinandersetzung mit den diesen Organsystemen korrespondierenden frühen oralen, analen oder phallischen Triebregungen.
Bei gelungener Reife in der psychosexuellen Entwicklung sind diese Teilstrebungen der genitalen Stufe unter- und eingeordnet. Die Genitalität ist gekennzeichnet durch Orgasmusfähigkeit in befriedigenden sexuellen Partnerbeziehungen, im Sinne des umfassenderen impliziten Verständnis Freuds von Sexualität aber auch durch ein Reifestadium der Persönlichkeit, das neben Liebes-, auch Arbeits- und Genussfähigkeit sowie Kulturfähigkeit mit einschließt.
Gelingt die Reifung nicht, dominieren prägenitalen Fixierungen auf frühe Entwicklungsstadien der psychosexuellen Entwicklung, auf orale, anale, phallisch-narzißtische, die sich ungebührlich aufblähen und sich in pervertierten oder gehemmten Sexual- und Organfunktionen, sowie in eingeschränkter sozialer und kultureller Kompetenz, in Beziehungs- und Arbeitsstörungen manifestieren.
Der Bewältigung des Ödipuskomplexes im 3. bis 5. Lebensjahr und in abgewandelter Form in der Pubertät kommt im Reifungsprozess eine Schlüsselfunktion zu. In der Psychoanalyse ist der Ödipuskomplex die Hauptbezugsachse der Psychopathologie und der normalen Entwicklung. Das Kind muss in diesem Entwicklungsstadium lernen, seine leidenschaftliche begehrliche Fixierung auf den andersgeschlechtlichen Elternteil aufzugeben und die Rivalität zum gleichgeschlechtlichen abzubauen, sich stattdessen mit letzterem identifizieren und mit ihm kooperieren, was von der Psychoanalyse als Kern der Gewissensbildung und Geburt der ethischen Persönlichkeit angesehen wird. Diese „Triangulierung“ im Beziehungsgeschehen ist Voraussetzung für das, was A. Adler in seiner sozialen Individualpsychologie als Steigerung des Sozialinteresses durch Überwindung der Familie bezeichnet und die Daseinsanalyse als Befreiung zur Weltoffenheit15.
Für die Psychosomatik ist eine weitere Problematik im Ödipuskomplex und den prägenitalen Fixierungen hervorzuheben, die Ambivalenz. Die Liebes- und feindseligen Gefühle und Wünsche treten gemeinsam auf, werden aber zunächst durch Abwehrmechanismen wie z. B. die Spaltung scheinbar neutralisiert. „Gut“ und „Böse“ können nicht auf die gleiche Person bezogen und in einem selbst nicht nebeneinander bestehend ertragen werden und sind auf unterschiedliche Personen projiziert.
Das Symptom als Sprache des Körpers
Das Unvermögen, die Spaltungen in Gut und Böse als Abwehr der Ambivalenz aufzugeben und beide in das eigene Selbstbild zu integrieren, spielt in Somatisierungsstörungen eine wesentliche Rolle. Die unerträgliche Ambivalenz wird durch Abspaltung einer Seite verdrängt, aber das Verdrängte kehrt als Körpersymptomatik wieder. Diese wird als personfern erlebt, als reines Naturgeschehen, wie zu einem nicht zugehörig, unterstützt durch Affektisolierung, der Verdrängung von Gefühlen als besonderer Form der Neutralisierung von Erinnerungen und Gedanken im persönlichen Erleben. Die Fixierung auf „reine körperliche Diagnostik“ ist unablässig um entsprechende „Beweise“ für eine körperliche Ursache der Beschwerden bemüht.
Für die Medizinische Anthropologie und ihr Menschenbild hoch bedeutsam ist, dass die psychische und geistige Entwicklung einschließlich der des Gewissens, der Idealbildungen und Wertorientierung am Leib stattfindet, in komplexen, leidenschaftlichen, stark affektiven, teilweise traumatischen, libidinösen zwischenmenschlichen Beziehungen, deren Erinnerungsspuren in allen Organfunktionen präsent sind, d. h. dass Charakter und Persönlichkeit und Körper eine Einheit bilden, ein gemeinsames Unbewusstes. Gefühle, Gedanken, Träume, Entscheidungen und Handlungen sind immer auch psychosomatische Phänomene. Die psychosexuelle Reifung ist im Wesentlichen eine „psychosomatische“, Liebe und Hass, Lob und Tadel, Anerkennung und Enttäuschung sind dem Leib libidinös fixiert eingeprägt.
Die Behauptung einer Spezifität psychischer Konflikte, prägenitaler Fixierungen oder Triebverdrängungen für die Ausprägung bestimmter Symptome ist mit recht als sehr spekulativ und kaum beweisbar kritisiert worden. Der Begriff der „Symptomwahl“ ist dennoch nicht unberechtigt, erfasst er doch eine verborgene Vernunft, eine zielgerichtete, unbewusste, gestaltende Kraft im Kranksein, nämlich die geistige und soziale Dimension von Krankheitsbereitschaften. Bei diesem Problem eröffnet der phänomenologische Zugang der Daseinsanalyse oder existenzieller Deutungen ein umfassenderes Verstehen mit gesteigertem therapeutischem Nutzen. In existenziellem Sinn entsprechen bestimmten Organmanifestationen bestimmte Formen des Weltbezuges im Dasein. Der Verdauung, der Atmung, der Bewegung, den Sinnesfunktionen entsprechen Bereiche des Daseinsvollzuges 16 . Der Sinn der Krankheit wird nicht reduktionistisch oder spekulativ aus Triebverdrängungen, Abwehrmechanismen oder persönlichen intrapsychischen Konflikten abgeleitet, vielmehr erschließt sich im phänomenologischen Vernehmen des Therapeuten die Symptomatik als spezifisch gehemmter Daseinsvollzug, als blockierter oder eingeengter Weltbezug, mit einem impliziten Verweis auf Entwicklungsmöglichkeiten, die in vorausspringender Fürsorge in der Therapie thematisiert werden.
Jenseits des Lustprinzips: Sublimierung - die gezähmte Kraft der Affekte im Narrativ
Die Psychoanalyse wurde seit ihrer Entstehung durch mindestens 50 weitere Verfahren ergänzt, die sich entweder direkt aus ihr weiterentwickelten oder von ihr inspiriert wurden. Die Grundpfeiler mit Bedeutung der Kindheit und der Lebensgeschichte für die Krankheitsentstehung, der Macht der Sexualität und des Unbewussten, der Traumdeutung, der Macht der Affekte, der Bedeutung komplexer Gefühlsprozesse im Therapiegeschehen in Übertragung und Gegenübertragung, im Widerstand sind fragmentarisch oder in unterschiedlicher Wertung in den meisten Verfahren der Psychotherapie präsent.
Die gelungene therapeutische Beziehung ist die Basis für Selbstvertrauen und für die Fähigkeit, die mit der Krankheit einhergehende narzisstische Krise zu überwinden und die erschütterten menschlichen Bindungen und Weltbezüge neu aufzubauen.
Psychotherapie ist eine anspruchsvolle und schwierige Kulturleistung für Patient wie Arzt und Therapeut. Vom Patienten wird rückhaltlose Offenheit in der Mitteilung seiner Probleme verlangt, vom Therapeuten vorurteilsfreies Verstehen und vorausspringende Fürsorge für den Patienten und Schutz des professionellen Rahmens, unter Verzicht des Auslebens von Machtambitionen oder sexuellen Begierden. Das erfordert das Vermögen, Verführungen in der intimen Situation standhalten zu können.
Die Kulturleistung, die in der Therapie für den Analytiker vorausgesetzt und für den Patienten als Ziel angestrebt wird, hat Freud unter dem etwas rätselhaften Begriff der Sublimierung beschrieben. Es handelt sich um einen ethischen Begriff und meint u.a. die Fähigkeit, auf unmittelbare triebhafte Befriedigungen zu verzichten, respektive sie zugunsten von Kulturleistungen aufzuschieben oder gar darin aufgehen zu lassen. Sublimierung ist ein Können der Person, aber jenseits von konventioneller Moral, mit einem Gefühl für Maß, orientiert an Leibvernunft, aber ohne Lebensverneinung und triebfeindliches Moralisieren. Sie ermöglicht Selbstachtung durch Selbstüberwindung und -beherrschung, Geduld, Frustrationstoleranz und die Fähigkeit, mit Affekten umzugehen.
Die Moses-Statue des Michelangelo
Besonders anschaulich wird das Wesen der Sublimierung in Freuds Studie über die Moses - Statue des Michelangelo. Sie zeigt den über den Götzendienst des Volkes Israel im Tanz um das Golden Kalb aufgebrachten Moses im Zustand „äußerster Affektbeherrschung“. Er trägt die steinernen Gesetzestafeln bei sich, die er dem Volk übergeben will, und nur dadurch, dass er seinen Zorn beherrschen kann, gelingt es ihm gerade noch, die Gesetzestafeln festzuhalten, die ihm im Affekt zu entgleiten drohen. Die gleiche Hand greift in den Bart, die Stellung der Finger verrät den Ansatz dazu, wütend an den Barthaaren zu reißen, die Handlung bleibt aber unvollendet, wird sublimiert in verhaltener Heftigkeit, die sich in einem durchdringenden Kraulen des Barthaares erschöpft.
Nicht Askese und Triebverdrängung an sich konstituieren die Sublimierung, sondern das Vermögen, starke Affekte zu beherrschen, sich ihrer Kraft bedienen zu können, sie umzulenken, aufzusparen und in Kulturleistung münden zu lassen. Verdrängung, Verleugnung oder Abspaltung haben lediglich eine Verarmung des Ich zur Folge. Dergestalt strukturierte und steuerbare „Libido“ ermöglicht eine am Leib orientierte Vernunft, die vielleicht die Voraussetzung jeglicher bedeutender Kulturleistung ist17.
Die Kunst, die Macht des Eros als schöpferische Vernunft zu beleben, sie lehr- und lernbar zu machen und in den Dienst der Überwindung von Krankheiten und Lebenskrisen zu stellen, ist die Antwort der Psychoanalyse auf die Tragik der conditio humana, deren Gratwanderung zwischen Krankheit, Tod und Vergänglichkeit auf dem Weg zu den herausragenden Zeugnissen der Kultur von S. Freud erkannt wird.
S. Freud in seiner poetischen Sachlichkeit erläutert die Sublimierung als eine „Anwendung von Triebhaftem auf ein anderes Gebiet, in dem sozial wertvollere Leistungen möglich sind“. Unsere Neurosen und andere Fehlhaltungen, unsere Prägungen durch die Zeit, in der wir leben, alle Schwächen und sogar Primitivismen an uns sind wertvolles Rohmaterial für unsere Persönlichkeitsentwicklung und der Kulturarbeit überhaupt. Vielleicht gibt ein Aphorismus F. Nietzsches am prägnantesten dieses Ethos der Psychoanalyse wieder, in dem er bemerkt, dass mitunter „die herrlichsten Farben aus niedrigen, ja verachteten Stoffen gewonnen sind.“18
Angst ist der Schwindel der Freiheit.
Sören Kierkegaard19
Angst als Krankheit und „Katastrophenreaktion“ des Organismus und seiner Existenz
Die Aktualität der holistische Konzeption Kurt Goldsteins (1878 – 1965) für die Psychosomatik
Die Angsterkrankungen in all ihren Erscheinungsformen, einschließlich der Panikattacken, zählen zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Umso bemerkenswerter ist es, dass sie nach wie vor Ärzte und Psychotherapeuten vor erhebliche Behandlungsprobleme stellen20. Die Zahl der Behandlungsabbrüche, Rezidive und Chronifizierungen ist hoch, besonders hervorzuheben ist die Somatisierungstendenz mit verborgener Angst in Äquivalenten körperlichern Symptome21. Angstzustände manifestieren sich häufig als körperliche Funktionsstörungen, Sinnesbeeinträchtigungen oder hypochondrische organbezogene Ängste. In den meisten Fällen liegt Komorbidität vor: mit Depressionen, funktionellen Herz-Kreislauf- oder Magen-Darm-Erkrankungen und vor allem mit Schmerzzuständen22. Frustrane Behandlungsversuche mit Tranquillizern oder Analgetica haben ein hohes Suchtpotenzial, einschließlich der „Selbstheilungsversuche“ mit Alkohol oder anderen Drogen. Ein Spezialfall liegt mit Angstzuständen bei Psychosen, hirnorganischen Erkrankungen oder Sucht vor, sowie bei hohem Fieber, Infektionen, endokrinologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Hyperthyreose oder anderen schweren akuten körperlichen Ereignissen23.
Die Angst im menschlichen Dasein
Das Problem mit der Angst ist auch, dass sie nicht primär krankhaft ist, vielmehr zur „Grundmelodie“ unserer menschlichen Existenz dazu gehört. Unsere Zukunft ist ungewiss, Tod und Sterben überschatten unsere Gegenwart und Zukunft24. Aber die Todesangst im Bewusstsein unserer Sterblichkeit ist nicht nur die Angst davor, dass unser Leben enden wird, sondern auch wie es enden wird. Als Woody Allen gefragt wurde, ob er Angst vor dem Tod hätte, antwortete er, Angst vor dem Tod hätte er keine, wenn er nur nicht sterben müsste. Gemeinschaft und zwischenmenschliche Beziehungen als Mit-Sein sind einerseits entscheidend bei der Überwindung von Angst, sind aber zugleich auch potenzielle Quellen von Angst, speziell vor Verurteilung, Ausgrenzung, Missbilligung und Strafe: „die Hölle, das sind die Anderen“25.
In fast allen Weltreligionen spielt die Verleugnung des Todes eine zentrale Rolle, als Unsterblichkeit der Seele oder als Seelenwanderung, und auch in politischen Ideologien und Bewegungen, vom Faschismus –viva la muerte, es lebe der Tod-, zu Kamikaze bis Al Kaida. Die sozialpsychologische Betrachtung zeigt aber auch, wie mit Terror und gleichzeitiger Heiligung und Pseudo-Sinngebung des Todes mittels kollektiver Verdrängung mit der Angst, Politik gemacht und Herrschaft ausgeübt wird. Die chiliastischen und nativistischen Bewegungen in den Regionen der zerbrechenden Kolonialreiche, von den Indianern Nord-Amerikas, über die Mau-Mau im Kongo bis zu den Taliban zeigen die enge Zusammengehörigkeit von sozialer und kultureller Entwurzelung, Zerstörung kollektiver Identität und gewachsener Sinnstrukturen auf der einen Seite und gesteigerter bis enthemmter Aggressions- und Gewaltbereitschaft mit den bekannten Massakern gegen die als die vermeintlichen oder tatsächlichen Feinde konkretisierten Gruppen26. Ein ähnlicher Mechanismus bahnt auch die Bereitschaft am Amoklauf, als selbstzerstörerische Vernichtungsaktion gegen eine Welt, die unbewältigbare Ängste auslöst27.
Das ängstliche Gestimmtsein als Weltbezug zeigt sich in Träumen, Ausdrucksphänomenen und Gefühlsschwankungen als ubiquitäres Phänomen, und hat nicht zuletzt als Signalangst, die in Situationen der Gefahr bis zur drohenden Vernichtung auftritt, eine grundlegende Funktion zur Sicherung des Überlebens. Ein zuwenig an Angst kann ebenso krankhaft sein wie ein zuviel, und auf bedeutsame Persönlichkeitsstörungen hinweisen28.
Es ist eine Binsenweisheit, dass die Angstbereitschaft und die Fähigkeit der Angstüberwindung von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein können. Dabei spielen genetische Dispositionen und intrauterine Einflüsse eine Rolle29, die gesamte Sozialisation und Lebensgeschichte, „Beziehungsschicksale“, traumatische Erlebnisse, familiäres Milieu, aktuelle Krisensituationen, körperliche Verfassung mit spezieller Krankheitsanamnese, Medikamente, Drogen, das kulturelle Umfeld, die soziale Verwurzelung und die gesamte existenzielle Situation mit Arbeitsleben, Beziehungen, Chancen und Bedrohungen, Freiheiten, Bedrängnissen oder Verlusten.
Pathologische und gesunde Angst
Trotz aller unterschiedlichen Theorien zur Angst besteht Konsens darin, wann Angst als pathologisch einzustufen ist, nämlich wenn die Angst zu einer anhaltenden erheblichen Einschränkung der Handlungsfähigkeit und Wahrnehmung führt und zu einem eingeengten Kreisen des Lebens um die Angst, meistens mit massiven körperlichen, vegetativen Beschwerden. Es gibt keine Angsterkrankung, die sich nicht auch im Somatischen manifestiert. Auf der anderen Seite gibt es komplexe körperliche Syndrome, die als Angsterkrankung oder Panikattacke einzuordnen sind, ohne ein entsprechend erlebtes subjektives Angstgefühl.
Seit Sigmund Freuds erster Darstellung der Angstneurose 1895 30 hat nicht nur die Psychoanalyse eine Vielzahl unterschiedlicher Angsttheorien formuliert, beinahe jede psychotherapeutische oder psychiatrische Schule entwickelte eine spezielle Theorie der Angst als Krankheit, je nach ihrem Menschenbild, dem anthropologischen Grundverständnis und ihren therapeutischen Möglichkeiten.
In unserem Zusammenhang sollen die Angstattacken und ihre Äquivalenzphänomene im Mittelpunkt des Interesses stehen, wie sie in der klinischen Notfallsituation nach wie vor eine erhebliche Herausforderung für Übertragung, Widerstand und insbesondere die Gegenübertragung im therapeutischen Team darstellen. Häufig liegt eine Komorbidität mit chronischen Schmerzerkrankungen vor, mit Schmerzattacken, Dys- und Parästhesien und vegetativen Störungen. Bei 10 bis 20% aller chronischen Schmerzpatienten mit Angstzuständen und schweren Depressionen mit Anpassungsstörungen (vor allem von Frauen) finden sich erhebliche psychophysische Traumatisierungen in der Früh- oder Spätanamnese wie sexueller Missbrauch, Psychoterror, Gewalterfahrungen und Mobbing. Durch somatische Fixierungen als Ausdruck konkretistischer Abwehr ist die Introspektion für die Angstproblematik erheblich eingeschränkt, durch Gegenübertragungsphänomene wie Wut, Ärger, Ohnmacht oder Angst bei Ärzten und Therapeuten der empathische und reflektierende Umgang mit dem Patienten erschwert. Die dabei provozierten Machtkämpfe mit dem Patienten verführen zu Radikallösungen mit Medikamenten unter Umgehung der Beziehungssituation oder zu Therapieabbruch, therapeutisch Erreichtes wird dadurch gefährdet oder zunichte gemacht31.
Hinzu kommen iatrogene Angsterkrankungen. Eine differenzierte, beruflich selbstbewusst verankerte 60-jährige Patientin hatte vor zehn Jahren von ihren behandelnden Ärzten die Auskunft bekommen, dass sie damit rechnen müsse, aufgrund ihrer im Röntgenbild als schwer eingestuften degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule „irgendwann“ auf den Rollstuhl angewiesen zu sein, bei den cervikalen Bandscheibenvorfällen bestünde zudem die Gefahr einer Schädigung des Rückenmarks mit Querschnittslähmung. Die Patientin mit einem ausgeprägten Autonomie-Ideal leidet seitdem an Alpträumen und Schlafstörungen mit nächtlichen Panikattacken. Eine Verschlimmerung trat ein, nachdem kürzlich die Mutter an den Folgen des dritten Schlaganfalles im Seniorenheim verstorben war.
Ich tanze so schnell ich kann
Eine weitere Problematik gelangt mit dem Buch „Ich tanze so schnell ich kann“ von Barbara Gordon ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit 32





























