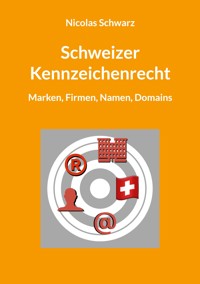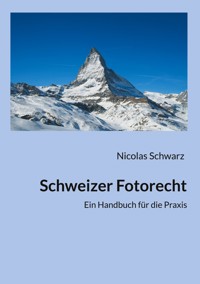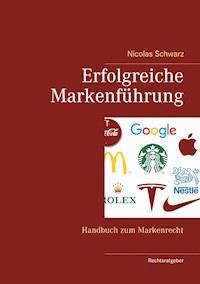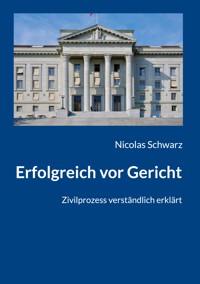
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch bringt Rechtsanwalt Nicolas Schwarz seine umfassende Erfahrung von über 25 Jahren als Gerichtsmitarbeiter und Prozessanwalt auf den Punkt. Das Werk vermittelt praxisnah, wie Ansprüche in einem Zivilprozess in der Schweiz erfolgreich durchgesetzt und Rechte gewahrt werden. Es erklärt leicht verständlich die Hintergründe und Abläufe eines Zivilprozesses, beleuchtet die Arbeitsweise von Gerichten und Anwälten und bietet zahlreiche Beispiele sowie praktische Tipps. Ob Sie als juristischer Laie einen Zivilprozess anstreben oder als Beklagter in einen verwickelt sind - dieses Buch hilft Ihnen, die Regeln und Strategien eines Zivilverfahrens zu verstehen. Es richtet sich sowohl an Privatpersonen, die einen Prozess ohne anwaltliche Vertretung führen möchten, als auch an Mandanten, die die Vorgehensweise ihres Anwalts besser nachvollziehen wollen. Zudem bietet es Jurastudenten wertvolle Einblicke in die Praxis und erweitert das theoretische Wissen um reale Fallbeispiele. Die dritte, vollständig überarbeitete Auflage enthält alle Neuerungen der Zivilprozessordnung, die zum 1. Januar 2025 in Kraft getreten sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Der Autor praktiziert als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Zürich und berät und vertritt Klienten vor allen Gerichten der Deutschschweiz. Bevor er 2000 das Anwaltspatent erlangt hat, war er als Gerichtsschreiber an einem zürcherischen Bezirksgericht tätig und studierte in Zürich und Chicago Rechtswissenschaft.
Dieses Buch ist auch als gedrucktes Buch erhältlich.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Vorwort
1.2 Zivilprozess
1.3 Rechtsquellen
1.4 Die verschiedenen Konflikttypen
2. Gerichte
2.1 Richter
2.2 Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Ausstand
2.3 Gerichtsorganisation
2.4 Verfahrensgrundsätze
Wo kein Kläger, da kein Richter
Rechtliches Gehör
Öffentlichkeitsprinzip
Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz
Richterliche Fragepflicht
Rechtsanwendung von Amtes wegen
3. Parteien und Anwälte
3.1 Parteien
Kläger und Beklagter
Mehrere Parteien
Verbandsklagen
Sammelklagen
3.2 Rechtsanwälte
Ausbildung
Anwaltsgeheimnis
Anwaltsregister und Aufsicht
Berufsregeln und Haftung
In welchen Fällen ein Anwalt angezeigt ist
Spezialisierung
Mandat mit dem Anwalt und Vollmacht
4. Vor dem Prozess
4.1 Einschätzen der Rechtslage
Prozesse vermeiden
Rechtsberatung
4.2 Klagefristen
4.3 Verjährung
4.4 Informationsbeschaffung
Zusammentragen der Unterlagen
Auskunftsrecht nach Datenschutzgesetz
Beschaffung von Unterlagen erst im Prozess
Strafanzeige
4.5 Solvenz der Gegenpartei
5. Prozesseinleitung
5.1 Örtliche Zuständigkeit
Gesetzliche Gerichtsstände
Gerichtsstandsvereinbarung, zwingende Gerichtsstände
Privates Schiedsgericht
Einrede der Unzuständigkeit, Einlassung
Internationale Verhältnisse
5.2 Schlichtungsverfahren
Zuerst schlichten, dann richten
Kein Schlichtungsverfahren
Verzicht auf das Schlichtungsverfahren
Schlichtungsbehörde
Rechtshängigkeit
Ablauf des Schlichtungsverfahrens
Schlichtungsgesuch
Schlichtungsverhandlung
Abschluss des Schlichtungsverfahrens
5.3 Mediation
6. Ordentliches Hauptverfahren
6.1 Verfahrensarten
6.2 Streitwert
6.3 Sachliche Zuständigkeit
6.4 Klage
Rechtsbegehren
So überzeugen Sie das Gericht
Klagearten
Klagenhäufung
Unbezifferte Forderungsklage
6.5 Gerichtskostenvorschuss
6.6 Prozessvoraussetzungen
6.7 Nichteintreten
6.8 Klageantwort
6.9 Widerklage und Verrechnung im Prozess
6.10 Hauptverhandlung
Zweiter Schriftenwechsel (Replik und Duplik)
Durchführung der Hauptverhandlung
Neue Tatsachen und Beweismittel
Klageänderung
6.11 Beweisverfahren und Stellungnahme zum Beweisergebnis
6.12 Prozesserledigung ohne Entscheid
Klagerückzug
Vergleich
6.13 Entscheid
7. Vereinfachtes, summarisches und weitere Verfahren
7.1 Vereinfachtes Verfahren
Anwendungsbereich
Ablauf
7.2 Summarisches Verfahren
Anwendungsbereich
Ablauf
7.3 Besondere familienrechtliche Verfahren
Scheidung auf gemeinsames Begehren
Scheidungsklage
8. Eingaben, Fristen, Verhandlungen
8.1 Vorladungen und Prozessleitung
8.2 Zustellungen
Zustellungen per Briefpost oder Bote
Elektronische Zustellungen und Zustellplattformen
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
8.3 Verfahrenssprache
8.4 Eingaben an das Gericht und Fristen
8.5 Verhandlungen, Protokoll
9. Prozesskosten
9.1 Anwaltskosten
9.2 Gerichtskosten
Gerichtskostenvorschuss
Höhe und Aufteilung der Gerichtskosten
Kostenlose Verfahren
Teilklage
Parteientschädigung
Best und worst Case
Spezielle Kostenregelungen
Kosten bei einem Vergleich
Kosten bei Rückzug oder Nichteintreten
Kosten im Rechtsmittelverfahren
Fazit
9.3 Unentgeltliche Prozessführung
9.4 Prozessfinanzierung
9.5 Rechtsschutzversicherungen
9.6 Betreibungskosten
10. Beweisrecht
10.1 Gegenstand des Beweises
10.2 Beweislast
10.3 Freie Beweiswürdigung
10.4 Rechtswidrig beschaffte Beweise
10.5 Zeitpunkt der Beweisabnahme
10.6 Art der Beweismittel
Urkunden
Zeugenbefragung
Parteibefragung und Beweisaussage
Augenschein
Gutachten
Schriftliche Auskunft
11. Rechtsmittel
11.1 Rechtsmittelbelehrung
11.2 Kantonale Rechtsmittel
Einleitung
Berufung
Beschwerde
Revision
Erläuterung und Berichtigung
11.3 Bundesrechtsmittel
Das Bundesgericht
Beschwerde in Zivilsachen
Subsidiäre Verfassungsbeschwerde
11.4 Beschwerde an den EGMR in Strassburg
12. Vollstreckung
12.1 Keine Überwachung durch das Gericht
12.2 Betreibungsverfahren
Konkursverfahren
Betreibung oder Schlichtungsgesuch?
13. Anhang
Inhaltsübersicht ZPO
1. Einleitung
1.1 Vorwort
Die Frage wer Recht hat, beantwortet das sogenannte materielle Recht, nämlich Gesetze wie etwa das Zivilgesetzbuch oder das Obligationenrecht. Wer Recht bekommt, beantwortet das formelle Recht – in Zivilprozessen die Zivilprozessordnung (ZPO). Der Volksmund sagt, dass Recht haben und Recht bekommen nicht dasselbe ist. Das trifft leider tatsächlich zu. Es ist möglich, dass jemand Recht hat, aber seinen Standpunkt im Prozess falsch vorträgt, nicht die richtigen Beweismittel beantragt oder eine Frist verpasst. Dies kann zur Folge haben, dass die Klage abgewiesen wird und der Kläger somit kein Recht bekommt – obwohl er eigentlich im Recht wäre.
Dieses Buch soll Ihnen helfen, die Spielregeln eines Zivilprozesses besser zu verstehen. Das Buch richtet sich aber nicht nur an Laien, welche einen Prozess alleine, d.h. ohne Anwalt, führen möchten, sondern auch an Klienten von Anwälten, die mehr über die Hintergründe der Prozessvertretung erfahren möchten, um die Vorschläge, Strategien und Handlungen ihres Anwalts besser verstehen zu können. Schliesslich bietet dieses Buch auch Studenten der Rechtswissenschaft einen praxisorientierten Einblick in die Materie.
Dieses Buch kann aber niemals die langjährige Ausbildung und Erfahrung eines Prozessanwalts ersetzen. Das Zivilprozessrecht ist eine komplexe Materie. Ich habe versucht, diese möglichst einfach und verständlich darzustellen. Oftmals gibt es zu den dargestellten Grundsätzen aber Ausnahmen, auf welche aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht hingewiesen werden konnte.
Aus demselben Grund habe ich mich auf die männlichen Formen beschränkt. Wenn von Richter und Kläger etc. die Rede ist, ist natürlich auch die Richterin und Klägerin etc. gemeint.
Wichtig: Dieses Buch ist im Verlauf des Jahres 2024 erschienen. Gewisse Änderungen der ZPO treten aber erst am 1. Januar 2025 in Kraft. Ich habe das Buch kompromisslos nach den ab 2025 geltenden Regeln geschrieben, ohne dies jeweils zu vermerken. Auf die bis Ende 2024 geltenden Regelungen wird nicht eingegangen. Dies bedeutet, dass das Buch bis Ende 2024 nicht uneingeschränkt Gültigkeit hat. Auch die im Anhang abgedruckte ZPO ist selbstverständlich die ab 2025 geltende neue Fassung. Es ist aber in der ZPO jeweils mit Fussnoten vermerkt, wenn eine Bestimmung geändert worden ist, so dass Sie die Änderungen per 1. Januar 2025 identifizieren können. Im Anhang finden Sie eine tabellarische Zusammenstellung des Inhalts der ZPO mit Verweisen auf die verschiedenen Kapitel dieses Buches.
1.2 Zivilprozess
In diesem Buch ist immer vom Zivilprozess die Rede. In einem Zivilprozess stehen sich Privatpersonen (natürliche Personen) und/oder juristische Personen (Gesellschaften, Vereine, Stiftungen) gegenüber.
Dagegen ist in einem Strafprozess der Staat in der Person des Staatsanwalts der Ankläger auf der einen und der Angeklagte auf der anderen Seite. Strafprozesse werden nach eigenen Spielregeln geführt, welche in der Strafprozessordnung (StPO) festgehalten sind. Diese gilt ebenfalls schweizweit. Strafprozesse werden in diesem Buch nicht behandelt. Die meisten Zivilgerichte auf kantonaler Ebene und auch das Bundesgericht amten auch als Strafgerichte.
Dasselbe gilt für Verwaltungsverfahren. Hier steht eine Privatperson oder juristische Person einer Verwaltungsbehörde (Gemeinde, Kanton oder Bund) gegenüber. Es wird beispielsweise um Baubewilligungen oder Aufenthaltsbewilligungen für Ausländer gestritten. Je nachdem, ob Verwaltungsprozesse auf kantonaler Ebene oder Bundesebene geführt werden, sind verschiedene Verfahrensgesetze anwendbar. Für Verwaltungsverfahren sind besondere Gerichte zuständig wie z.B. das Sozialversicherungsgericht, das kantonale Verwaltungsgericht, das Baurekursgericht oder das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen.
1.3 Rechtsquellen
Alle Bundesgesetze (und übrigens auch Staatsverträge) können Sie auf der Webseite des Bundes gratis als pdf-Dokument herunterladen.
Weiterführende Links
fedlex.admin.ch (Bundesgesetze)
Im Zivilprozessrecht ist natürlich vor allem die ZPO wichtig. Die ZPO ist im Anhang abgedruckt. In diesem Buch werden aber auch andere Bundesgesetze und die Bundesverfassung erwähnt, wobei jeweils folgende Kürzel verwendet werden:
BGG
Bundesgerichtsgesetz
BV
Bundesverfassung
BGFA
Anwaltsgesetz
DSG
Datenschutzgesetz
IPRG
Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
OR
Obligationenrecht
SchKG
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
StGB
Strafgesetzbuch
ZGB
Zivilgesetzbuch
Sie werden noch sehen, dass die Organisation der Gerichte und die Höhe der Gerichtskosten kantonal geregelt sind. Deshalb spielen im Zivilprozess auch kantonale Gesetze eine gewisse Rolle. Jeder Kanton hat etwa ein Gerichtsorganisationsgesetz.
Weiterführende Links
Die kantonalen Gesetze finden sie auf der Webseite des jeweiligen Kantons (Autokennzeichen des Kantons und die Endung .ch).
1.4 Die verschiedenen Konflikttypen
Bei Zivilprozessen geht es um die Austragung von Konflikten. In meiner Berufspraxis als Rechtsanwalt erlebe ich immer wieder, dass Personen unterschiedlich mit Konflikten umgehen. Das hat dann natürlich auch Einfluss auf die zu wählende Prozessstrategie. Die Ökonomen Kenneth Thomas und Ralph Kilmann unterscheiden fünf Strategien der Konfliktbewältigung. Sie ordnen diese in einer Matrix an, welche Durchsetzungsstärke und Kooperationswillen unterscheidet. Welchem Typ entsprechen Sie?
1. Konkurrenz
Die Parteien verfolgen stur ihre eigenen Ziele. Eine Kooperation oder Konfliktbewältigung suchen sie nicht. Jede Partei ist der Ansicht, im Recht zu sein und verfolgt ihre eigenen Interessen, aber keine Partei klagt.
2. Vermeidung
Die Parteien wollen um jeden Preis einen Streit vermeiden. Sie scheuen eine Auseinandersetzung und verfolgen weder die eigenen Belange noch diejenigen der Gegenseite. Beide Parteien verhalten sich passiv. Zu einem Prozess kommt es nicht. Der Konflikt wird aber auch nicht gelöst und schwelt weiter („Lose-Lose“).
3. Kompromiss
Die Parteien verhandeln (gerichtlich oder aussergerichtlich) und finden eine für beide Seiten akzeptable Lösung. Das ist der klassische Ansatz des Schlichtungsverfahrens bzw. eines sogenannten Vergleichs.
4. Kooperation
Die Parteien versuchen von Anfang an, ein Problem gemeinsam zu bewältigen und finden eine Lösung („Win-Win“), mit welcher beide zufrieden sind. Hier kommt es gar nicht erst zu einer Auseinandersetzung vor Gericht.
5. Nachgeben
Eine Partei gibt klein bei, um den Ausbruch des Konflikts zu vermeiden. Sie opfert damit ihre eigenen Interessen. Prozessual gesehen trifft dies dann zu, wenn die beklagte Partei die Klage anerkennt, damit das Verfahren möglichst rasch wieder beendet wird („Lose-Win“).
2. Gerichte
2.1 Richter
Richter müssen nicht unbedingt Rechtswissenschaften studiert haben. Es gibt immer noch vereinzelt Gerichte, an welchen Laienrichter (d.h. Richter ohne juristische Ausbildung) tätig sind. Immer mehr Kantone schreiben aber inzwischen vor, dass nur Richter werden kann, wer über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften verfügt. An Gerichten sind neben den Richtern aber immer auch sogenannte Gerichtsschreiber tätig, welche Rechtswissenschaften studiert haben und die getroffenen Entscheide redigieren und rechtlich begründen.
Richter der unteren Instanzen werden in der Regel vom Volk für vier oder sechs Jahre (also nicht etwa auf Lebenszeit wie zum Beispiel am Supreme Court in den USA) gewählt. Bei den höheren kantonalen Gerichten und dem Bundesgericht werden die Richter vom jeweiligen Parlament gewählt. Richter sind oft Mitglied einer politischen Partei und werden von dieser Partei zur Wahl vorgeschlagen bzw. aufgestellt. Als Gegenleistung müssen die Richter, sofern sie dann auch gewählt werden, einen Teil ihres Einkommens ihrer Partei abgeben. Oft einigen sich die Parteien auf die Aufteilung der Richterstellen, so dass es – beim Fehlen von Gegenkandidaten – zu einer sogenannten „stillen Wahl“ kommt.
Die Zugehörigkeit der Richter zu einer politischen Partei ist nicht unproblematisch. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Richter in der Regel über der politischen Weltanschauung ihrer Partei stehen und nur dem Recht verpflichtet sind. Ein Richter muss seinen Entscheid natürlich immer auch rechtlich begründen können.
2.2 Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Ausstand
Bereits die BV hält in Art. 30 Abs. 1 fest, dass jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, Anspruch auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht hat.
„Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.“
Die Unabhängigkeit der Gerichte ist ein wichtiges Merkmal für einen Rechtsstaat. Dieser Grundsatz ist daher auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) enthalten.
Der sogenannte Ausstand von Richtern ist in Art. 47 ff. ZPO geregelt. Wenn diese Unabhängigkeit bzw. Unparteilichkeit tangiert ist, muss ein Richter von sich aus in den Ausstand treten, d.h. er darf einen Fall nicht bearbeiten. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Richter befangen ist. Die Gründe sind in Art. 47 ZPO aufgezählt, wie z.B.:
ein persönliches Interesse am Ausgang der Streitigkeit,
der Richter ist mit der Streitsache vorbefasst, d.h. er war in der gleichen Sache bereits einmal tätig,
Freundschaft oder Verwandtschaft mit einer am Prozess beteiligten Partei.
Falls der betroffene Richter nicht von selbst in den Ausstand tritt (Art. 48 ZPO), kann eine der Parteien ein Ausstandsgesuch stellen (Art. 49 ZPO) – dann muss das Gericht über den Ausstand entscheiden (Art. 50 ZPO, der betroffene Richter darf dabei natürlich nicht mitwirken). Der Name der urteilenden Richter wird den Parteien zu Beginn des Prozesses bekannt gegeben. Wichtig ist, dass Sie ein Ausstandsgesuch sofort stellen, nachdem Sie von einem möglichen Ausstandsgrund erfahren haben. Sie können nicht erst dann den Ausstand verlangen, nachdem ein unliebsames Urteil gefällt worden ist!
Wird der Ausstandsgrund jedoch erst entdeckt, nachdem bereits ein Urteil gefällt worden ist, kann eine Revision des Urteils verlangt werden (Art. 51 Abs. 3 ZPO, siehe 11. Kapitel).
2.3 Gerichtsorganisation
Die Gerichtsorganisation ist Sache der Kantone (Art. 3 ZPO). Die Gerichte sind daher in jedem Kanton unterschiedlich organisiert und zusammengesetzt und haben zum Teil unterschiedliche Bezeichnungen.
Art. 75 Abs. 2 BGG schreibt vor, dass jeder Kanton zwei Instanzen vorsehen muss (die Schlichtungsbehörde bzw. der Friedensrichter wird nicht als Instanz mitgezählt):
Die
unteren kantonalen Gerichte
: Bezirksgericht, Amtsgericht, Regionalgericht, Kreisgericht. In grösseren Kantonen hat es mehrere untere Gerichte, kleinere Kantone haben nur ein unteres Gericht, welches dann oft als Kantonsgericht bezeichnet wird.
Neben den ordentlichen unteren Gerichten kennen viele Kantone noch erstinstanzliche
Spezial- oder Fachgerichte
, welche nur in einem bestimmten Rechtsgebiet tätig sind, nämlich Arbeitsgerichte und Mietgerichte. Der Vorteil dieser Gerichte liegt auf der Hand: Sie verfügen über mehr Spezialkenntnisse und können daher Streitigkeiten kompetenter und schneller entscheiden.
Weiterführende Links
Wenn Sie mehr über die Gerichtsorganisation in Ihrem Kanton erfahren möchten, rufen Sie die Webseite Ihres Kantons auf (Autokennzeichen des Kantons und die Endung .ch) und klicken auf bzw. suchen dort nach „Gerichte“.
Die
oberen kantonalen Gerichte
: Kantonsgericht (nicht zu verwechseln mit dem unteren kantonalen Gericht in kleineren Kantonen), Obergericht, Appellationsgericht.
Zum Grundsatz der zwei kantonalen Instanzen gibt es aber drei wichtige Ausnahmen:
1. Die ZPO sieht in Art. 5 vor, dass bei einzelnen Streitigkeiten vor allem im Gebiet des Wirtschaftsrechts (geistiges Eigentum, Kartellrecht, Firmenrecht, unlauterer Wettbewerb) nur eine einzige kantonale Instanz (nämlich die obere) zur Verfügung steht.
2. In vermögensrechtlichen Streitigkeiten kann der Kläger mit Zustimmung des Beklagten direkt an das obere kantonale Gericht gelangen, sofern der Streitwert mindestens CHF 100’000 beträgt (Art. 8 ZPO).
3. Sodann gibt die ZPO den Kantonen in Art. 6 die Befugnis, Handelsgerichte vorzusehen. Die Kantone Aargau, Bern, St. Gallen und Zürich haben davon Gebrauch gemacht. Ist in diesen Kantonen die Zuständigkeit des Handelsgerichts gegeben, entscheidet es als einzige kantonale Instanz.
Zuständig ist das Handelsgericht, wenn es um eine handelsrechtliche Streitigkeit geht. Eine solche liegt nach Art. 6 Abs. 2 ZPO vor, wenn drei Voraussetzungen gegeben sind:
der Streitwert beträgt mindestens CHF 30’000,
die Parteien sind im Handelsregister eingetragen und
es handelt sich nicht um eine arbeits- oder mietrechtliche Streitigkeit (dann wäre das Arbeitsgericht oder das Mietgericht zuständig).
Ist nur die beklagte Partei im Handelsregister eingetragen, sind aber die ersten beiden Voraussetzungen erfüllt, so hat der Kläger die Wahl zwischen dem Handelsgericht und dem unteren kantonalen Gericht (Art. 6 Abs. 3 ZPO).
Weiterführende Links
zefix.ch (Abfrage Handelsregister)
Am Handelsgericht wirken Fachrichter mit, welche nur nebenamtlich tätig sind und in ihrem Hauptberuf der Branche angehören, um welche sich der Rechtsstreit dreht.
Die Urteile des oberen kantonalen Gerichts bzw. des Handelsgerichts können nur noch von einer Bundesinstanz, nämlich dem Bundesgericht in Lausanne, überprüft werden. In diesen Fällen entscheidet somit nur eine einzige kantonale Instanz mit der Konsequenz, dass insgesamt nur eine Rechtsmittelinstanz zur Verfügung steht.
2.4 Verfahrensgrundsätze
Wo kein Kläger, da kein Richter
Im Zivilprozessrecht gilt der Grundsatz, dass diejenige Partei, welche von einer anderen Partei etwas will und dazu die Hilfe des Gerichts in Anspruch nehmen will, selbst aktiv werden muss, indem sie eine Klage einreicht. Ein Zivilgericht leitet ein Verfahren niemals von sich aus ein.
Rechtliches Gehör
Rechtliches Gehör bedeutet, dass das Gericht den Parteien die Gelegenheit geben muss, sich ausreichend zur Sache äussern zu können. Das rechtliche Gehör wird bereits durch die BV garantiert (Art. 29 Abs. 2):
„Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.“
Das rechtliche Gehör ist auch in Art. 53 ZPO geregelt. Es umfasst insbesondere folgende Rechte der Parteien:
Recht auf Anhörung
Recht, sich zu äussern, sogenanntes Replikrecht
Recht auf Akteneinsicht (z.B. des Protokolls, welches von Gerichtsverhandlungen erstellt wird)
Die Parteien müssen jedoch dabei die Spielregeln eines Zivilprozesses beachten und beispielsweise die vorgegebenen Fristen einhalten.
Öffentlichkeitsprinzip
Das Öffentlichkeitsprinzip ist ein wichtiger Grundsatz in einem Rechtsstaat. Es ist in Art. 54 ZPO geregelt und wird bereits in der BV garantiert, Art. 30 Abs. 3:
„Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.“
Die Arbeit der Gerichte muss überprüfbar sein, es soll keine Geheimjustiz geben.
Gerichtsverhandlungen sind also grundsätzlich öffentlich. Es ist daher denkbar, dass beispielsweise Jurastudenten, Medienvertreter oder gar eine ganze Schulklasse einer Gerichtsverhandlung beiwohnen. Die Justizberichterstattung in den Medien unterliegt aber Einschränkungen. Beispielsweise dürfen die Namen der beteiligten Parteien nicht ohne weiteres offengelegt werden. Fotos oder Filmaufnahmen dürfen im Gerichtssaal nicht gemacht werden.
Auch die Parteien selbst dürfen Personen an die Gerichtsverhandlung mitbringen. Potenzielle Zeugen sollten jedoch nicht an eine Verhandlung mitgenommen werden, da diese vom Gericht später allenfalls noch befragt werden und bei einer vorherigen Teilnahme an der Verhandlung als befangen gelten und nicht mehr als Zeugen in Frage kommen.
Die Öffentlichkeit kann ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn es das öffentliche Interesse oder das schutzwürdige Interesse einer beteiligten Person erfordert. Gewisse Verhandlungen und Verfahren sind grundsätzlich nicht öffentlich:
familienrechtliche Verfahren (Art. 54 Abs. 3 ZPO)
Schlichtungsverhandlungen (Art. 203 Abs. 3 ZPO)
Vergleichsverhandlungen (Die Bemühungen des Gerichts, zwischen den Parteien zu vermitteln, gelten nach der Rechtsprechung nicht als Gerichtsverhandlung und unterstehen daher nicht dem Öffentlichkeitsprinzip.)
Auch die Gerichtsurteile werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Viele Urteile können heutzutage im Internet abgerufen werden. Selbstverständlich sind diese Urteile aber vollständig anonymisiert, so dass ein Rückschluss auf die beteiligten Parteien nicht möglich ist. Wichtige Urteile (sogenannte Leitentscheide) werden auch in juristischen Zeitschriften abgedruckt, welche Ende Jahr zu einem Buch gebunden werden können. Die Sammlung der Leitentscheide des Bundesgerichts nennt sich beispielsweise „BGE“. Solche Leitentscheide haben den Vorteil, dass ihnen eine Zusammenfassung vorangestellt ist (die sogenannte „Regeste“). Andere Urteile verfügen über keine solche Zusammenfassung. Dank Hilfsmittel der künstlichen Intelligenz (KI) lassen sich diese aber zusammenfassen, so dass ohne viel Zeitverlust festgestellt werden kann, ob der Entscheid hilfreich ist oder nicht. Nützliche Dienste leistet KI auch bei der Übersetzung von Urteilen aus Kantonen mit der Amtssprache Französisch oder Italienisch.
Weiterführende Links
bger.ch → Rechtsprechung (Bundesgerichtsentscheide)
Leider sind die Urteilsdatenbanken im Internet nicht sehr laienfreundlich ausgestaltet. Ohne Übung und Erfahrung ist es aufgrund der Vielzahl der Entscheide sehr schwierig, im Internet den passenden Entscheid zu finden. In der von mir verwendeten juristischen Recherche-Datenbank waren beispielsweise im September 2024 über 299’000 Entscheide enthalten.
Urteile, vor allem diejenigen des Bundesgerichts, haben eine herausragende Bedeutung. Sie werden darum auch Leitentscheide genannt. Nur aufgrund des Gesetzestexts allein lässt sich ein Rechtsfall oft nicht entscheiden, da Gesetze sehr allgemein gehalten und abstrakt gefasst sind und zwangsläufig Fragen offen lassen. Es kommt auch oft vor, dass ein Gericht eine Frage entscheiden muss, welche im Gesetz gar nicht geregelt ist. Art. 1 ZGB sieht für diese Fälle vor:
„Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde. Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.“
Um sich einen Überblick zur Rechtsprechung zu einer bestimmten Frage zu verschaffen, muss man aber nicht unbedingt Dutzende von Urteilen heraussuchen und lesen. Zu jedem wichtigen Gesetz gibt es Gesetzeskommentare, welche die Rechtsprechung zu jedem einzelnen Gesetzesartikel zusammenfassen. Solche Kommentare haben in der täglichen Arbeit eines Anwalts einen wichtigen Stellenwert. Nach Konsultation eines Kommentars muss dann nur noch überprüft werden, ob seit dessen Erscheinen wichtige Gerichtsurteile gefällt wurden. Auch die Rechtsratgeber für Laien (Beobachter, K-Tipp, Saldo) weisen oft auf die einschlägige Gerichtspraxis bzw. auf bedeutende Gerichtsurteile hin.
Falls Sie die Möglichkeit erhalten, ein Urteil zu lesen, ist dies eine gute Möglichkeit zu sehen, wie in der Justiz gearbeitet wird. Oft sind Urteile spannend zu lesen, weil nicht von Beginn weg klar ist, wie eine Frage entschieden wird. Im Gegensatz zu einem Krimi erfolgt die Auflösung aber nicht ganz am Schluss. Mit zunehmender Lektüre kristallisiert sich die Lösung immer mehr heraus.
So ist ein Gerichtsurteil aufgebaut
Am Anfang werden die entscheidenden Richter, die Verfahrensnummer und die Parteien genannt sowie ein Stichwort, worum es überhaupt geht (z.B. „Forderung“). Juristen nennen diesen
Urteilskopf
„Rubrum“.
Zuerst stellt das Gericht fest, dass die
Prozessvoraussetzungen
erfüllt sind (z.B. Fristen, Zuständigkeit etc. – mehr dazu später).
Dann gibt das Gericht die
Prozessgeschichte
wieder, d.h. wann die Rechtsschriften eingereicht wurden und wann Verhandlungen stattgefunden haben.
Als nächstes kümmert sich das Gericht um den
Sachverhalt
. Es gibt die Standpunkte von Kläger und Beklagtem wieder und stellt dann klar, welcher Sichtweise das Gericht folgt (basierend auf dem, was die beweisbelastete Partei beweisen konnte und was nicht – mehr dazu im
10. Kapitel
).
Schliesslich wendet das Gericht das Recht auf den von ihm festgestellten Sachverhalt an. Dieser Teil des Urteils nennt man „
Erwägungen
“.
Am Schluss werden die
Urteilssprüche
aufgeführt. Man nennt das auch das „
Dispositiv
“. Darin hält das Gericht fest, ob die Klage gutgeheissen, teilweise gutgeheissen oder abgewiesen wird. Weiter hält das Gericht fest, welche Partei die Kosten zu tragen hat und welche Möglichkeiten bestehen, gegen das Urteil ein Rechtsmittel einzulegen. Im Dispositiv wird auch festgehalten, wer eine Kopie des Urteils erhält. Je nach Streitgegenstand kann es sein, dass das Urteil auch Ämtern (z.B. Handelsregisteramt oder Grundbuchamt) oder dem Amtsblatt zur Veröffentlichung zugestellt wird.
Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz
Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen (der Fachbegriff hierzu heisst „substanziieren“) und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO).
Diese Pflicht trifft vor allem den Kläger, der ja das Klagefundament liefern muss. Die Rolle des Beklagten besteht vor allem darin, die Behauptungen des Klägers zu widerlegen bzw. zu bestreiten. Im 6. Kapitel werden wir sehen, dass der Beklagte aber auch selbst eine Gegenklage (Widerklage) erheben kann.
In der Regel berücksichtigt das Gericht zur Entscheidfindung nur, was von den Parteien vorgetragen wurde (= Dispositionsgrundsatz), d.h. das Gericht stellt keine eigenen Nachforschungen und Abklärungen an. Das Gericht nimmt insbesondere auch nur Beweise ab, welche von einer der Parteien auch tatsächlich angeboten bzw. verlangt worden sind. Darum ist es äusserst wichtig, dem Gericht alles Wesentliche mitzuteilen und die Beweismittel vollständig zu benennen.
In gewissen Rechtsgebieten sieht Art. 247 ZPO jedoch vor, dass das Gericht auch eigene Nachforschungen anstellen und Beweise von sich aus erheben kann (= Untersuchungsgrundsatz):
nach dem Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann
in gewissen Streitigkeiten betreffend die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen
im Arbeitsrecht (bis zu einem Streitwert von CHF 30’000)
Kinderbelange (Art. 296 Abs. 1 ZPO)
Richterliche Fragepflicht
Ist das Vorbringen einer Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig, so gibt ihr das Gericht durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung (Art. 56 ZPO). Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Partei nicht anwaltlich vertreten ist. Wird nämlich eine Partei von einem Rechtsanwalt vertreten, ist das Gericht bei der Ausübung dieser Fragepflicht sehr zurückhaltend.
Die richterliche Fragepflicht ist eine juristische Gratwanderung. Das Gericht darf durch die Ausübung der Fragepflicht der betreffenden Partei keinesfalls helfen, denn das Gericht muss ja immer unparteiisch bleiben.
Rechtsanwendung von Amtes wegen
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Dies bedeutet, dass die Parteien dem Gericht nur Tatsachen vortragen müssen. Die Anwendung der richtigen rechtlichen Bestimmungen auf die sich stellenden Rechtsfragen ist Sache des Gerichts.
Die Parteien dürfen das Gericht aber freiwillig auf die anwendbaren Gesetzesbestimmungen und einschlägige Gerichtsurteile hinweisen. Bei anwaltlich vertretenen Parteien und bei komplexen Rechtsfragen sind rechtliche Ausführungen daher üblich. Das Gericht ist aber natürlich nicht an die von den Parteien geäusserte Rechtsauffassung gebunden.
3. Parteien und Anwälte
3.1 Parteien
Kläger und Beklagter
Die Parteien im Zivilprozess nennt man Kläger und Beklagter. Im summarischen Verfahren (siehe 7. Kapitel) ist auch von Gesuchsteller und Gesuchsgegner die Rede. Bei einer Scheidung auf gemeinsames Begehren spricht man bei beiden Parteien nur von Gesuchstellern. Bei Rechtsmitteln spricht man dann von Berufungskläger und Berufungsbeklagtem bzw. von Beschwerdeführer und Beschwerdegegner. Sprechen Sie in einem Zivilprozess nie vom „Angeklagten“, denn dieser Begriff gehört ins Strafprozessrecht.
Als Parteien können natürliche oder juristische Personen (AG, GmbH, Genossenschaft, Stiftung, Verein) auftreten. Juristische Personen werden im Prozess durch ihre Organe vertreten (z.B. Gesellschafter, Verwaltungsrat, Geschäftsführer etc.).
Bestimmungen im materiellen Recht (ZGB und OR) sehen vor, dass z.B. Auch Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften und Stockwerkeigentümergemeinschaften als Parteien auftreten können, obwohl diese eigentlich keine eigene Rechtspersönlichkeit haben.
Es ist sehr wichtig vor Einleitung eines Prozesses sicherzustellen, dass auch die richtige Partei eingeklagt wird. Klagt man nämlich die falsche Partei ein, wird die Klage vom Gericht kostenpflichtig abgewiesen (= fehlende Passivlegitimation). Selbstverständlich muss auch die richtige Person klagen, d.h. die Person, welcher die eingeklagten Rechte auch zustehen. Klagt die falsche Person, kommt es ebenfalls zur kostenpflichtigen Abweisung der Klage (= fehlende Aktivlegitimation).
Die ZPO sieht in Art. 73 ff. auch die mögliche Beteiligung von Dritten im Prozess vor (Intervention, Streitverkündung). Dies ist relativ selten und wird in diesem Buch daher nicht abgehandelt.
Mehrere Parteien
Es ist möglich, dass sowohl auf der Kläger- als auch auf der Beklagtenseite mehrere Personen auftreten. Man spricht dann von Streitgenossen bzw. einer Streitgenossenschaft (Art. 70 ff. ZPO).
Beispiele
Ein solidarisch haftendes Ehepaar
mehrere Miterben bei einer Erbteilung
Mitglieder einer Stockwerkeigentümergemeinschaft
Mitglieder einer Wohngemeinschaft, welche den Mietvertrag gemeinsam unterschrieben haben
Gesellschaften, welche sich in einem Konsortium (einfache Gesellschaft) zusammengeschlossen haben
Verbandsklagen
In bestimmten, vom Gesetz genannten Fällen ist es möglich, dass ein Verband in eigenem Namen für seine Mitglieder klagen kann (Art. 89 ZPO). Man spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten „Verbandsklagen“. Beispiele:
Gewerkschaften können sich für ihre Mitglieder wehren, wenn das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann vom Arbeitgeber verletzt wurde.
Nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb haben Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie Konsumentenschutzorganisationen ein Recht zur Verbandsklage.
Sammelklagen
Sammelklagen, wie wir sie aus den USA kennen, gibt es in der Schweiz noch nicht. Ist eine Vielzahl von Personen geschädigt (z.B. durch ein fehlerhaftes Produkt oder Medikament), muss nach geltendem Recht grundsätzlich jede Person ihre Rechtsansprüche individuell vor Gericht geltend machen. Eine Bündelung der Interessen und Ressourcen ist nur sehr begrenzt möglich (indem sich beispielsweise die betroffenen Parteien alle vom gleichen Anwalt vertreten lassen).
Dem würde mit einem Sammelklagerecht Abhilfe geschaffen. Der Bundesrat hat 2018 im Rahmen einer Überarbeitung der ZPO die Einführung eines solchen Rechts auch in der Schweiz vorgeschlagen. Es zeigte sich jedoch, dass die Frage stark umstritten ist, weshalb der Bundesrat entschieden hat, die Sammelklage auszuklammern. Diese wird nun erst wieder sehr viel später aufs politische Parkett kommen. Ob das Sammelklagerecht eines Tages eingeführt wird, ist derzeit noch völlig offen.
Der Dieselgate-Skandal
Der Dieselgate-Skandal, der im September 2015 öffentlich bekannt wurde, drehte sich um betrügerische Praktiken von Volkswagen und einigen seiner Tochterunternehmen im Zusammenhang mit der Manipulation von Abgaswerten bei Diesel-Fahrzeugen. VW hatte eine Software in die Motorsteuerung seiner Dieselautos eingebaut, die erkannte, wenn das Fahrzeug auf einem Prüfstand getestet wurde, und dann die Abgasreinigung aktiviert oder optimiert. Im normalen Fahrbetrieb wurden jedoch wesentlich höhere Schadstoffemissionen erzeugt, als die gesetzlichen Vorschriften erlaubten. Rund elf Millionen Fahrzeuge weltweit waren von dieser Manipulation betroffen. Der Skandal führte zu erheblichen finanziellen Verlusten für VW, juristischen Auseinandersetzungen, Rückrufen und einem Vertrauensverlust der Konsumenten in die Automobilindustrie.
Im Zuge des Dieselgate-Skandals wurden in verschiedenen Ländern Sammelklagen gegen VW und andere beteiligte Unternehmen eingereicht. Die Kläger in diesen Sammelklagen argumentierten in der Regel, dass sie durch den Kauf von betroffenen Fahrzeugen finanziellen Schaden erlitten hätten, da die Autos aufgrund der Manipulationen einen geringeren Wiederverkaufswert hatten und möglicherweise auch höhere Betriebskosten verursachten. In vielen Fällen kam es daraufhin zu Vergleichen, d.h. die Sammelkläger erhielten finanzielle Entschädigungen.
Ein solches Vorgehen war in der Schweiz nicht möglich. Die Stiftung für Konsumentenschutz versuchte zwar, im Namen von mehreren Klägern am Handelsgericht des Kantons Zürich eine Klage anzustrengen, was jedoch aufgrund der fehlenden gesetzlichen Grundlage für eine Sammelklage scheiterte.
3.2 Rechtsanwälte
Ausbildung
Die Zulassung, als Rechtsanwalt tätig zu sein (= Anwaltspatent), erhält nur, wer folgende Voraussetzungen erfüllt (Art. 7 und 8 BGFA):
ein abgeschlossenes Rechtsstudium,
ein absolviertes Praktikum am Gericht oder in einer Anwaltskanzlei,
Bestehen der staatlichen Anwaltsprüfung
tadelloser Leumund
keine Verlustscheine
Die Anwaltsprüfung wird nicht an einer Universität abgelegt sondern in der Regel vor dem obersten Gericht des jeweiligen Kantons.
In gewissen Kantonen werden Anwälte auch Fürsprecher oder Advokaten genannt. Diese Berufsbezeichnungen sind gleichwertig. In gewissen Kantonen können Anwälte auch als Notare tätig sein und damit Beurkundungen und Beglaubigungen vornehmen.
Nicht mit einem Anwalt zu verwechseln sind folgende Personen:
Rechtsagenten
, welche in einigen Kantonen (namentlich St. Gallen) bestehen. Ein Rechtsagent muss nicht studiert haben und darf nur in einfacheren Verfahren vor Gericht auftreten.
Substituten
sind Mitarbeiter in einer Anwaltskanzlei, welche Recht studiert haben und dort ein Praktikum absolvieren, nach dessen Abschluss sie die Anwaltsprüfung absolvieren können.
Als
Juristen
bezeichnet man Berufsleute mit abgeschlossenem Rechtsstudium aber ohne Anwaltspatent. Wer Recht studiert hat, ist somit nicht automatisch auch Rechtsanwalt.
Anwaltsgeheimnis
Ein Rechtsanwalt ist zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann ans Anwaltsgeheimnis (auch Berufsgeheimnis genannt) gebunden (Art. 13 BGFA). Sie können sich einem Anwalt daher bedingungslos anvertrauen. Ein Anwalt darf ohne Zustimmung seines Klienten keine Informationen preisgeben, auch nicht gegenüber Behörden. Das Anwaltsgeheimnis ist so streng gefasst, dass ein Anwalt nicht einmal darüber Auskunft geben darf, ob überhaupt ein Mandat mit einer bestimmten Person besteht oder nicht. Wenn ein Anwalt offenes Honorar von seinem Klienten eintreiben muss, muss er diesen in der Regel zuerst auffordern, ihn vom Anwaltsgeheimnis zu entbinden. Weigert sich der Klient, kann sich der Anwalt von der Aufsichtsbehörde vom Anwaltsgeheimnis entbinden lassen, damit er seine Honorarforderung auf dem Rechtsweg durchsetzen kann.
Eine Verletzung des Anwaltsgeheimnisses wird streng geahndet und kann nach Art. 320 StGB mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.
Anwaltsregister und Aufsicht
Anwälte haben in den meisten Verfahren das Monopol, vor Gericht als Rechtsvertreter aufzutreten (Anwaltsmonopol, Art. 68 Abs. 2 ZPO). Treuhänder und Juristen von Rechtsschutzversicherungen dürfen beispielsweise nicht als Parteivertreter vor Gericht auftreten. Anwälte unterliegen dafür aber einer strengen Aufsicht. In jedem Kanton gibt es eine Aufsichtsbehörde (Art. 14 BGFA), welche einen Anwalt sanktionieren kann, der gegen die Berufsregeln (siehe nächsten Abschnitt) verstossen hat. Im schlimmsten Fall droht eine Sperre oder sogar der Entzug des Anwaltspatents (Art. 17 BGFA). Dem Monopol unterliegt aber nur das Auftreten vor Gericht. Nicht monopolisiert ist die Rechtsberatung, welche auch von Nicht-Anwälten erbracht werden kann.
Damit ein Anwalt vor Gericht auftreten kann, muss er im kantonalen Anwaltsregister eingetragen sein. Dieses Register ist öffentlich. Schweizer Anwälte dürfen grundsätzlich vor allen Schweizer Gerichten auftreten. Die Tätigkeit eines Anwalts ist somit nicht auf den Kanton beschränkt, in dessen Register er eingetragen ist.
Weiterführende Links
sav-fsa.ch → Anwaltsrecht → Anwaltsregister (Links zu den kantonalen Anwaltsregistern)
Berufsregeln und Haftung
Die Berufsegeln der Anwälte sind in Art. 12 BGFA enthalten. Die wichtigsten Berufsregeln sind:
Anwälte üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. Die Sorgfaltspflichten, denen ein Anwalt untersteht, sind sehr streng geregelt. Ein Anwalt haftet für jedes Verschulden, auch für leichte Fahrlässigkeit.
Anwälte üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus.
Anwälte meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klienten und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen. Anwälte müssen insbesondere Mandate ablehnen, wenn sie die Gegenpartei schon einmal vertreten haben. Falls ein Mandat zwischen Ihnen und einem Anwalt zustande kommt, bedeutet dies umgekehrt, dass der Anwalt auch nach Beendigung des Mandats keine Fälle mit Ihnen als Gegenpartei annehmen darf.
Anwälte dürfen nur zurückhaltend Werbung treiben.
Anwälte haben eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen, die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken pro Jahr betragen.
Anwälte sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen (siehe
9. Kapitel
).
Anwälte bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem eigenen Vermögen auf. Deshalb führen Anwälte ein separates Bankkonto, welches nur für Klientengelder bestimmt ist (sogenanntes Klientengelderkonto).
Anwälte klären ihre Klienten bei Übernahme des Mandates über die Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars. Mehr zum Anwaltshonorar erfahren Sie im
9. Kapitel
.
In welchen Fällen ein Anwalt angezeigt ist
In der Schweiz gibt es keinen Anwaltszwang. Selbst vor dem höchsten Schweizer Gericht, dem Bundesgericht, kann eine Partei auch ohne Rechtsvertreter auftreten. Jede Partei kann sich aber in einem Prozess von einem Anwalt vertreten lassen (Art. 68 Abs. 1 ZPO). Aufgrund des Anwaltsmonopols ist die Vertretung durch Nicht-Anwälte in den meisten Verfahren unzulässig.
In der Regel kann eine Partei nicht verpflichtet werden, einen Anwalt zu beauftragen. Eine Ausnahme dazu ergibt sich jedoch aus Art. 69 Abs. 1 ZPO: Ist eine Partei offensichtlich nicht imstande, den Prozess selbst zu führen, so kann das Gericht sie auffordern, einen Vertreter zu beauftragen. Leistet die Partei innert der angesetzten Frist keine Folge, so bestellt ihr das Gericht eine Vertretung.
Die Erfahrung zeigt, dass eine Vertretung durch einen Anwalt vor allem in folgenden Situationen sinnvoll ist:
Jemand fühlt sich in einer Streitigkeit überfordert.
Die Gegenpartei ist anwaltlich vertreten.
Der Streitwert beträgt mehr als CHF 10’000.
Die Gegenpartei ist mächtig (z.B. Banken, Versicherungen, Medien).
Das Urteil hat über lange Zeit Bestand (z.B. Unterhaltsbeiträge in Scheidungsverfahren).
Bei komplexem Sachverhalt oder komplizierten rechtlichen Verhältnissen.
Bei vorsorglichen Massnahmen und allgemein, wenn es sehr schnell gehen soll.
In Prozessen vor Handelsgerichten.
In Rechtsmittelverfahren.
Bei Streitwerten unter CHF 10’000 lohnt sich der Beizug eines Anwalts zumindest finanziell nicht, weil dann in der Regel die Parteientschädigung nicht ausreicht, welche die verlierende Partei der obsiegenden Partei an die Anwaltskosten bezahlen muss, um die tatsächlich entstandenen Kosten zu decken. Falls Sie über eine Rechtsschutzversicherung verfügen und der Streit gedeckt ist, spielen diese Überlegungen allerdings keine Rolle. Mehr zu den Anwaltskosten erfahren Sie im 9 Kapitel.
Weiterführende Links
sav-fsa.ch → Anwaltssuche (Mitgliederverzeichnis Schweizerischer Anwaltsverband)
Achten Sie bei der Auswahl eines Anwalts darauf, dass er dem Anwaltsverband angehört. Anwälte, welche mehrfach gegen die Berufsregeln verstossen haben („schwarze Schafe“), werden von den Verbänden in der Regel ausgeschlossen.
Spezialisierung
Anwälte haben in der Regel vier bis fünf bevorzugte Tätigkeitsgebiete bzw. Spezialisierungen. Kein Anwalt kann in allen Rechtsgebieten versiert sein. In den Anwaltsverzeichnissen bzw. auf der Homepage von Anwaltskanzleien werden daher oft Rechtsgebiete angegeben, in welchen ein Anwalt bevorzugt tätig ist. Umgekehrt kann es aber von Vorteil sein, wenn ein Anwalt in mehreren Rechtsgebieten tätig ist. Er sieht dann Ihren Fall vielleicht ganzheitlicher und denkt vernetzter.
In der Regel sind folgende Rechtsgebiete relevant (es werden nur Rechtsgebiete berücksichtigt, welche Gegenstand eines Zivilprozesses bilden können):
Familie und Kind
: Ehe- und Konkubinatsrecht, Scheidungsrecht, Kindesrecht, Erwachsenenschutzrecht
Beruf und Vorsorge
: Arbeitsrecht, Personalvorsorgerecht
Wohnen und Bauen, Immobilien
: Miet- und Pachtrecht, Werkvertrags- und Auftragsrecht, Sachenrecht
Verträge und Konsumentenschutz
: Allgemeines Vertragsrecht, Kaufvertragsrecht, Handelsrecht, Reiserecht, Arztrecht
Erbfragen und Nachfolgeregelung
: Erbrecht, Nachlassrecht, Stiftungsrecht
Kapitalanlage und Vermögen
: Bankenrecht, Wertpapierrecht
Haftpflicht und Versicherung
: Haftpflichtrecht, Privatversicherungsrecht, Produkthaftpflichtrecht, Transportrecht
Unternehmen gründen und führen
: Gesellschafts- und Firmenrecht, Vertragsrecht, Beurkundungsrecht
Schutz von Ideen und Konzepten
: Immaterialgüterrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Werberecht, Lizenzrecht, Wettbewerbsrecht
Inkasso und Schuldbetreibung
: Betreibungs- und Konkursrecht, Vollstreckungsrecht
Fachanwalt
In fünf Rechtsgebieten des Zivilrechts besteht für Anwälte die Möglichkeit, einen Fachanwalts-Titel zu erwerben:
Arbeitsrecht
Bau- und Immobilienrecht
Mietrecht
Erbrecht
Familienrecht
Haftpflicht- und Versicherungsrecht