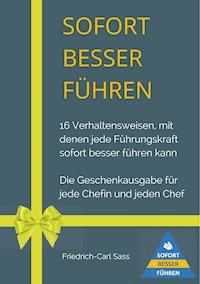Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sie sind Führungskraft und wollen Ihre Gespräche mit Mitarbeitern erfolgreicher gestalten? Lesen Sie weiter! Nach einer kompakten, leicht zugängliche Darstellung der theoretischen Grundlagen, finden Sie praxisorientierte Gesprächsanleitungen zu 32 verschiedenen Gesprächsanlässen, u.a.: Anerkennung, Beurteilung, Delegation, Demotivation, Erfolglosigkeit, Ermahnung, Feedback, Gehalts- oder Eingruppierungsgespräch, Intervention, Jahresgespräch, Konflikt unter Mitarbeiter, Statusgespräch („Jour fixe“), Zielvereinbarung. Danach erfahren Sie, wie Sie mit Ihrer Webcam Ihre Gesprächstechnik gezielt trainieren und anstehende Mitarbeitergespräche vorbereiten können. Praxisorientiertes Arbeitsmaterial steht ergänzend zum Download im Web zur Verfügung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Gebrauchsanweisung für das Buch
Die Rolle der Mitarbeitergespräche in einem systematischen Verständnis von Führung
Erdgeschoss: Beziehungsmanagement
Erster Stock: Direkte Steuerung
Zweiter Stock: Indirekte Steuerung durch punktuelle Regeln und Pläne
Dritter Stock: Indirekte Steuerung durch Geschäftsprozesse
Vierter Stock: Führen über Ziele
Fünfter Stock: Führen mit Visionen
Sechster Stock: Führen durch Werte
Die richtige Einstellung finden
Menschen haben ihren eigenen Kopf
Eigene Ängste beherrschen
Umgehen mit den Ängsten der Mitarbeiter
Wohlwollendes Interesse an der Person des Mitarbeiters
Gesprächstechnische Grundlagen
Kommunikation als Führungskraft
Positive Handlungssprache
Feedback geben
Mitarbeiter (und andere Menschen) überzeugen
Umgehen mit Einwänden
Umgehen mit Vorwänden und Ausreden
Killerphrasen
Durch Fragen führen
Die drei Gesprächsebenen
Gesprächsvorbereitung
Rahmenbedingungen
Gesprächsziele bestimmen
Einwände vorhersehen
Den richtigen Gesprächsstil wählen
Gute Fragen finden
Gesprächsablauf
Gesprächseröffnung
Verhandlungsphase
Gesprächsabschluss
Dokumentation
Gesprächssteuerung
Sachliche Klärung
Beziehungsklärung
Aktionen und Commitments
Mentale Blockaden überwinden
Kurzanleitung für 32 verschiedene Arten von Mitarbeitergesprächen
Abmahnung
Abstimmung (einmalig)
Anerkennung
Anleitung
Anweisung
Begrüßung
Beistand
Beschwerde
Beurteilung
Delegation
Demotivation
Erfolglosigkeit
Ermahnung
Ermunterung
Eskalation
Feedback für die Führungskraft
Feedback für den Mitarbeiter
Gehalt oder Eingruppierung
Intervention
Intrige (gegen Sie)
Jahresgespräch
Konflikt unter Mitarbeitern
Kündigung
Personalentwicklungsgespräch
Psychische Störung, Abhängigkeiten
Regeln aufzeigen
Schlechte Nachricht
Statusgespräch, periodisches (»Jour fixe«)
Verabschiedung
Veränderungen
Zielvereinbarung oder Zielvorgabe, operativ
Zielvereinbarung, jährlich
Training mit der Webcam
Wie Sie die Webcam nutzen
Wie Sie mit der Webcam trainieren
Übungsaufgaben
Möglichkeiten und Grenzen
Literaturempfehlungen
Was Sie noch tun können
In eigener Sache
Personen- und Sachregister
Einleitung
Dieses Buch ist für Führungskräfte, die ihre Gesprächskommunikation mit Mitarbeitern erfolgreicher gestalten wollen. Projektleiter, die ohne hierarchische Weisungsbefugnis führen, sind ebenfalls willkommen. Anfänger in der Führungsrolle werden viel mitnehmen, hoffe ich. Für führungserfahrene Jahrgänge will die Schrift eine Ressource für gezielte Erweiterungen des eigenen Repertoires sein. Beide Zielgruppen finden im zweiten Teil Material zum anlassbezogenen Nachschlagen.
Herausforderung Mitarbeitergespräch
Was ist für Sie die Herausforderung bei Mitarbeitergesprächen?
Oft erleben Führungskräfte es als herausfordernd, Mitarbeiter zu bewegen, eine zu erledigende Aufgabe zu verstehen, aktiv mitzudenken und den Job dann intelligent, selbstständig und zügig umzusetzen. Viele Chefs loben wenig und manchen fällt es schwer, Kritik auszusprechen. Zur Führungsaufgabe gehört, Mitarbeitern nicht realisierbare Wünsche abzuschlagen oder ihnen unerfreuliche Nachrichten zu überbringen. Fähige und selbstbewusste Mitarbeiter haben Ansprüche an die Kommunikationsqualität ihrer Chefs. Die Sichtweisen und Argumente, die sie im Gespräch vortragen, sind vielfältig und für die Führungskräfte oft überraschend. Sie können den Chef herauskehren, aber wie weit kommen Sie damit? Wirklich gute und effektive Mitarbeitergespräche sind und bleiben auch für langjährig erfahrene Führungskräfte eine Herausforderung.
Einiges davon wurzelt in der je eigenen Persönlichkeit. Introvertierte Führungskräfte müssen einen Weg finden, mit Mitarbeitern ausreichend dicht zu kommunizieren und ihre Vorstellungen unmissverständlich deutlich zu machen. Extrovertierte Menschen müssen lernen zuzuhören und anderen Raum zu geben. Sachorientierte Kollegen müssen lernen den menschlichen Seiten des Lebens Aufmerksamkeit zu schenken, ohne ihre Stärken zu verleugnen und bei eher beziehungsorientierten Menschen ist es genau umgekehrt. Die Spontanen müssen lernen zu planen und sich vorzubereiten und Führungskräfte, die gewohnt sind, alles sorgfältig zu organisieren, müssen lernen auf unvorhergesehene Äußerungen ihrer Mitarbeiter im Gespräch einzugehen. Manche Chefs finden es schwierig, Leistungen und Erfolge ihrer Mitarbeiter anzuerkennen. Anderen fällt es schwer, persönliche Kritik zu äußern oder einen Mitarbeiter in einer heiklen Situation nachdrücklich zu befragen.
Auch die individuellen Mitarbeiter selber können sich als Herausforderungen erweisen. Manche Mitarbeiter haben unrealistische Vorstellungen von ihren Aufgaben und Fähigkeiten oder überzogene Gehaltsvorstellungen, inakzeptable Umgangsformen mit Kunden und Kollegen oder hätten gerne an Ihrer Stelle die Führungsaufgabe übernommen. Andere Mitarbeiter reagieren mit »Killerphrasen« auf Ihre Ideen oder üben sich in Ausreden und »Ja, aber...«-Spielen.
Auch die gesprächstechnischen Herausforderungen machen vielen Führungskräften zu schaffen:
Die richtigen Gesprächsziele bestimmen
Erwartungen an Verhalten und Aktionen der Mitarbeiter klar formulieren
Einwände erkennen und adäquat behandeln
Vorwände (
»
Ausreden«) erkennen und ausräumen
Fragen stellen
Den passenden Gesprächsstil wählen und bei Bedarf wechseln
Was immer für Sie die Herausforderung ist bei Mitarbeitergesprächen: Es gibt viele Wege, das eigene Repertoire zu erweitern. Und nur die wenigsten können für sich in Anspruch nehmen, damit schon »fertig« zu sein. Auch Sie können mit einer überschaubaren Investition an Zeit und Übung Ihren persönlichen Wirkungsgrad im Gespräch mit Mitarbeitern ausbauen! Dabei wird Ihnen dieses Buch behilflich sein.
Gebrauchsanweisung für das Buch
Wie kann man aus einem Buch lernen, erfolgreichere Mitarbeitergespräche zu führen? Machen Sie Ihren Arbeitsplatz als Führungskraft zu einem Ort beschleunigten Lernens! Dabei will diese Schrift Sie unterstützen.
Im ersten Teil finden Sie eine knappe und allgemeinverständliche Darstellung der theoretischen Grundlagen, verbunden mit vielen Hinweisen zur praktischen Umsetzung. Es gibt keine Praxis ohne Theorie, aber es gibt Leute, denen die Theorie, die ihr Handeln leitet, nicht bewusst ist. Deshalb empfehle ich Ihnen hier mit der Lektüre zu beginnen. Später können Sie vor allem die praxisrelevanten Hinweise in den einzelnen Kapiteln gezielt nachschlagen. Es soll aber nicht bei der Theorie bleiben. Sie finden in allen Kapiteln Aufgaben und Übungen, die Ihnen ermöglichen, sich intensiver mit dem Stoff und Ihrer eigenen Situation am Arbeitsplatz auseinanderzusetzen.
Der zweite Teil des Buches ist als alphabetisches Nachschlagwerk angelegt. Zur Vor- und Nachbereitung von Gesprächen können Sie dort gezielt nachschlagen und erhalten konkrete Hinweise zur Gesprächsvorbereitung und Durchführung.
Im dritten Teil finden Sie eine Anleitung zum aktiven Training und zur konkreten Gesprächsvorbereitung mit Hilfe Ihrer Webcam.
Beigefügt habe ich eine kleine Auswahl weiterführender Literaturhinweise und einen Personen- und Sachindex.
Arbeitsmaterialien, die im Text referenziert wurden, finden Sie zum Download auf der Website:
www.top-managementberatung.de/buch-erfolgreiche-mitarbeitergespraeche .
Meine Vita und Kontaktdaten befinden sich direkt vor dem Anhang. Ich freue mich über Ihr Feedback!
Und nun wünsche ich Ihnen Spaß bei der Lektüre und ganz viel Erfolg für Ihre Mitarbeitergespräche!
Köln, April 2015
Friedrich-Carl Sass
Die Rolle der Mitarbeitergespräche in einem systematischen Verständnis von Führung
Sie als Führungskraft interessieren sich vor allem dafür, was Ihre Mitarbeiter zur Aufgabenerledigung und zum Arbeitserfolg beitragen. Das ist letzten Endes, wofür Sie verantwortlich sind. Um Ihre Mitarbeiter zum Erfolg zu führen, stehen Ihnen diverse Führungsinstrumente und -techniken zur Verfügung. Da diese unterschiedlichen Logiken folgen, macht es Sinn, wenn Sie sich Ihr Führungsinstrumentarium als ein mehrstöckiges Gebäude vorstellen. Jedes Stockwerk erzeugt einen anderen Aspekt von Führung. Jedes hat seine spezifischen Erfordernisse und trägt auf seine Weise zu erfolgreichen Mitarbeitergesprächen bei (vgl. Abbildung).
Erdgeschoss: Beziehungsmanagement
Als Führungskraft sind Sie der primäre Ansprechpartner des Mitarbeiters für seine Beziehung zum Unternehmen. Dafür stehen Ihnen entsprechende Gesprächsformate zur Verfügung. Das beginnt bei der Begrüßung, wenn ein Mitarbeiter in Ihre Organisationseinheit eintritt. In vielen Organisationen sind strukturierte Jahresgespräche zur Beziehungspflege üblich. In tariffreien Organisationen sind individuelle Gehaltsgespräche erforderlich, im Tarifbereich steht die tarifliche Eingruppierung der Mitarbeiter im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es kann passieren, dass ein Mitarbeiter sich bei Ihnen beschweren möchte. Damit haben wir einige erste Anlässe von Mitarbeitergesprächen identifiziert.
Erster Stock: Direkte Steuerung
Die direkte Steuerung von Mitarbeitern besteht im Erteilen von Anweisungen, weiter in Interventionen mit dem Ziel einer Verhaltensänderung, sowie in direktem Feedback zur Umsetzung dieser Steuerungsimpulse, z.B. »Schon ganz gut, jetzt bitte noch etwas mehr nach links…«. Die direkte Steuerung ist in ihren Möglichkeiten begrenzt, z.B. ist Ihre persönliche Präsenz erforderlich. Im Führungsalltag haben die verschiedenen Techniken der indirekten Steuerung in den zurückliegenden Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen. Für viele Chefs »alter Schule« war und ist das eine schwierige Umstellung. Deshalb konzentrieren sich Managementgurus und –Trainer auf die Vermittlung der indirekten Steuerungstechniken. Doch auch wenn sie heute viel zurückhaltender eingesetzt wird: Die direkte Steuerung ist nicht tot. Als Chef benötigen Sie weiterhin die Fähigkeit, hier und jetzt eine Anweisung zu erteilen oder zu intervenieren, um einen Fehler zu verhüten. Und Sie müssen in der Lage sein, zu dem was Sie bei der direkten Steuerung erleben, Feedback zu geben. Damit haben wir drei weitere Gesprächsanforderungen identifiziert, die Sie im Praxisteil des Buches wieder finden.
Zweiter Stock: Indirekte Steuerung durch punktuelle Regeln und Pläne
Die einfachste Form der indirekten Steuerung bilden punktuelle Regeln und Pläne. Die Delegation von Aufgaben an Mitarbeiter zur eigenverantwortlichen Umsetzung gehört hier hin, ebenso das Aufzeigen von Regeln. Die Regeln und Pläne sollen auch dann handlungsleitend sein, wenn derjenige, der sie beschließt oder genehmigt, nicht anwesend ist. Leider funktioniert das nicht immer. Deshalb muss, wer Regeln erlässt, sie auch durchsetzen. Hierzu dient die Intervention, die Ermahnung und in hartnäckigen Fällen die Abmahnung. Punktuelle Regeln und Pläne sind das bevorzugte Jagdrevier der zentralen Organisationseinheiten (Controlling, Revision, Organisation, Personal usw.). Machen Sie als operative Führungskraft durchdachten und sparsamen Gebrauch davon!
Dritter Stock: Indirekte Steuerung durch Geschäftsprozesse
Eine höhere Stufe indirekter Steuerung bildet das Arbeiten mit Geschäftsprozessen. Ein Geschäftsprozess ist ein idealtypisches Abbild eines realen oder geplanten Arbeitsablaufs. Eine Abfolge der vorgesehenen Arbeitsschritte wird festgelegt und den involvierten Mitarbeitern werden jeweils Arbeitsschritte zugeordnet, so dass sich alles in einander fügt um das gewünschte Arbeitsresultat zu erzeugen. Im Unterschied zur »wissenschaftlichen Arbeitsorganisation« Frederick Taylors sowie der daran anschließenden Fließbandarbeit, müssen die Einzelaktivitäten eines Geschäftsprozesses nicht bis auf die Ebene jeder Handbewegung geplant sein. Sie können für sich durchaus komplex und anspruchsvoll bleiben.
Ein Beispiel hierfür sind Service-Hotlines. Die Aufgabe, mit leidgeprüften Kunden adäquat zu kommunizieren, lässt sich auf kein Script reduzieren. Sie erfordert kommunikatives Geschick im Umgang mit der konkreten Situation. Viele Organisationen versäumen es, zum Leidwesen der Kunden, die Lösungskompetenz ihrer Hotline-Mitarbeiter zu nutzen, indem sie ihnen zu geringe Entscheidungskompetenzen zuweisen. Frederick Taylor lässt grüßen.
Geschäftsprozesse haben den Vorteil, dass man erfolgreiche, ganzheitliche und zielorientierte Vorgehensweisen in organisierter Arbeitsteilung wieder und wieder anwendet. Die rigorose Treue zum einmal definierten Vorgehen gibt Anlass zu der Hoffnung, dass in effizienter Weise ein Arbeitsresultat von gleicher, hoher Qualität erzielt wird. Der Prozess kann beobachtet und gemessen werden. Man kann iterative Prozessverbesserungen durchführen oder ihn beizeiten durch einen anderen Prozess ersetzen. In beiden Fällen kommt es zu Veränderungen und dabei kommt die »unsichtbare Rückseite« zum Vorschein: Damit ein Geschäftsprozess wie geplant ablaufen kann, muss gewährleistet sein, dass die betrauten Mitarbeiter die wesentlichen Aktivitäten regelmäßig erfolgreich durchzuführen vermögen. Das erfordert spezifisches Wissen und spezifische Fähigkeiten, oft in Verbindung mit der eingesetzten Technologie, die ich Job-Kompetenzen nenne. Wenn der Geschäftsprozess oder die Technologie geändert wird, muss die Änderung auf der Ebene der Job-Kompetenzen von den Mitarbeitern mitvollzogen werden, sonst wird die Veränderung scheitern. Betriebliche Verbesserungsmöglichkeiten werden meist in technologischen Fortschritten und Prozessverbesserungen gesucht. Alternativ kann man der Frage nachgehen, in wie weit die Job-Kompetenzen der Mitarbeiter auf einem optimalen Stand sind und hier Verbesserungen anstreben. Hierbei ist Feedback für den Mitarbeiter durch nichts zu ersetzen. Wer im direkten Kontakt mit Leistungsempfängern ist (Kunden, Patienten usw.), erhält auch von dort direktes Feedback. Erfahrene Kollegen geben hilfreiches Feedback. Für die Führungskräfte ist das Feedback der Mitarbeiter instruktiv.
Führungstechnisch bringen Geschäftsprozesse die Arbeit in geregelter, oft automatisierter Weise zum Mitarbeiter, was die Führungskraft von dispositiven Aufgaben entlastet. Die sich öffnende Welt der Job-Kompetenzen schafft eine neue Führungsaufgabe: Das Zusammenwirken von Geschäftsprozessen und Job-Kompetenzen zu verfolgen und die Mitarbeiter bei der Entwicklung ihrer individuellen Job-Kompetenzen zu begleiten. Das ist Thema eines Personalentwicklungsgesprächs, das Bestandteil des oben schon identifizierten Jahresgesprächs sein kann. Weitere Führungsgespräche stehen bei Veränderungen an.
Vierter Stock: Führen über Ziele
Indirekte Steuerung, im Unterschied zur direkten Steuerung, beginnt mit dem Führen über Ziele. Ziele werden dem Mitarbeiter vorgegeben oder verbindliche Vereinbarungen über die Ziele ausgehandelt, die er im Anschluss in eigenverantwortlichem Handeln anstrebt. Führen über Ziele wird in vielen Unternehmen in Form von Jahreszielvereinbarungen praktiziert. Nach meiner Ansicht noch wichtiger ist das Führen über Ziele im operativen Tagesgeschäft. Der Mitarbeiter operiert im Tagesgeschäft eigenständig und stimmt sich über Ziele und Vorgehensweisen und bei unerwarteten Schwierigkeiten fortlaufend in verabredeter Weise mit der Führungskraft ab. Das entspricht der heutigen betrieblichen Realität in vielen Unternehmen. In Bereichen mit hochqualifizierten und eigenverantwortlich tätigen Mitarbeitern, etwa im Vertrieb oder im Projektgeschäft ist das Führen über Ziele alternativlos. Die Führungskraft ist verantwortlich, dass die mit den verschiedenen Mitarbeitern vereinbarten Ziele zusammen passen und in Summe zum Erfolg der geführten Organisationseinheit führen. Gesprächstechnisch sind beim Führen über Ziele jährliche Zielvereinbarungen zu treffen, regelmäßige Statusgespräche zu führen, mit operativen Zielvereinbarungen oder Zielvorgaben und bei akuten Schwierigkeiten sind Eskalationen zu meistern.
Auch Projekte werden über Ziele geführt. Die Projektziele sind für das Projektteam handlungsleitend. Die damit verbundenen Teamprozesse und ihre Steuerung sind nicht Thema dieser Schrift. Für die Führung einzelner Mitarbeiter einschließlich des Projektleiters über individuelle Ziele sind die zielbezogenen Gesprächsformate im Praxisteil des Buchs direkt anwendbar.
Fünfter Stock: Führen mit Visionen
Auf den bisher besprochenen Stockwerken gestaltet sich die Führungsbeziehung als ein Prozess von Geben und Nehmen zwischen dem Mitarbeiter und dem von der Führungskraft repräsentierten Unternehmen. Dies wird in der Literatur passend als transaktionale Führung1 bezeichnet. Auf den beiden obersten Stockwerken geht es um das Führen mit Visionen und Werten. Das ist keine Frage des Gebens und Nehmens. Gemeinsame Visionen und Werte können einer Organisation enorme Glaubwürdigkeit nach außen verschaffen und gleichzeitig ihre vorhandene eigene Energie so bündeln, dass Aktionen äußerst effektiv sind. Das Commitment zu Visionen und Werten kann man nicht auf dem Arbeitsmarkt kaufen. Die Entscheider und Führungskräfte einer Organisation können durch visionäre und wertorientierte Führung dazu einladen. Es hängt auch von den Mitarbeitern ab, wie bereitwillig sie sich Visionen und Werte zu eigen machen und sie aktiv mitgestalten. Mit Bezug auf diesen Prozess spricht man von transformativer Führung2.
Führen mit Visionen geht also mehr als einen Schritt über das Führen über Ziele hinaus. Was ist eine Vision? Darunter verstehe ich eine durchdachte Vorstellung von einem anzustrebenden zukünftigen Zustand. Menschen besitzen die Fähigkeit, Visionen zu teilen. Ja, Visionen wirken ausgesprochen magnetisch und einladend. Sie ermöglichen es vielen Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, eine gemeinsame Blickrichtung aufzunehmen und ihre Kräfte auf die Erreichung eines gemeinsamen Ziels auszurichten. So kann das einzelne menschliche Individuum zu einem Vorhaben beitragen, dessen Umfang über die eigenen Kräfte und dessen Bedeutung über die individuelle Existenz hinausragt. Damit eine Vision handlungsleitend wirken kann, muss sie klar und durchdacht sein. Ist das gelungen, lassen sich die anfallenden Entscheidungen des Tagesgeschäfts vom Standpunkt des angestrebten Zielzustands, der Vision, beurteilen. Und das vermögen im Tagesgeschäft dazu »ermächtigte«, eigenverantwortlich handelnde Mitarbeiter.
Wie entsteht eine Vision? Als Führungskraft spielen Sie in ihrem Umfeld eine aktive, treibende Rolle. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter, vor allem die Leistungsträger, unbedingt in den Prozess mit ein. Viele unterschiedlich »tickende« Hirne verstehen genauer und vielseitiger, worum es geht. Gemeinsam finden Sie die entscheidenden Ansatzpunkte. Eine gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern erarbeitete Vision findet in der Umsetzung den erforderlichen Rückhalt. Ist die Vision von Ihnen allein entwickelt, wird sie nur zu schnell und ohne dass Sie es bemerken, insgeheim als unausgereifte »fixe Idee des Chefs« gehandelt.
Visionäre Führungskräfte können einen Zielzustand imaginieren und in buchstäblich mitreißender Weise kommunizieren. Diese Fähigkeit nutzen sie auch im Einzelgespräch, um Unterstützung für ihre Vision zu sammeln. Aus der Vision lassen sich Ziele und Maßnahmen ableiten und führungstechnisch wie beim Führen über Ziele behandeln. Dabei ist Führung über Visionen für Führungskräfte wie Mitarbeiter anspruchsvoller. Letzten Endes zählt nicht die Erreichung statischer individueller Ziele, sondern oberstes Bewertungskriterium ist der Beitrag zur Verwirklichung der Vision.
Verfügen Sie über eine Vision, was Sie in den nächsten zwei bis drei Jahren in Ihrem Verantwortungsbereich erreichen wollen? Die Erarbeitung einer Vision ist nicht Thema dieses Buches. Sie sollten sich aber bewusst machen, über welches visionäre Kapital Sie verfügen. Denn eine Vision hat magnetische Kraft, sie zieht die Mitarbeiter in Ihr Kielwasser und macht Vieles einfacher im Mitarbeitergespräch.
Aufgabe: Über welches visionäre Kapital verfügen Sie aktuell?
Wie haben Sie Ihre aktuellen Aufgaben durchdrungen, um positive Verbesserungen in den nächsten Jahren zu gestalten? Bitte nehmen Sie Papier und Stift und notieren Antworten auf folgende Fragen:
Welche Verbesserungen der in Ihrem Verantwortungsbereich erstellten Produkte oder Dienstleistungen wollen Sie erzielen, die von Ihren Leistungsabnehmern (externe und interne Kunden, Patienten, Lernende usw.) als vorteilhaft erlebt würden?
Welche Leistungsabnehmer wollen Sie in Zukunft bedienen?
Sehen Sie Chancen, mit dem Leistungsvermögen Ihres Verantwortungsbereichs neue Zielgruppen zu erschließen?
Macht es Sinn, sich auf bestimmte Bedürfnisse Ihrer bisherigen Zielgruppen zu fokussieren?
Wie wollen Sie Ihre Botschaft der Zielgruppe vermitteln?
Welche Verbesserungen wünschen Sie sich in Bezug auf die Mitarbeiter? Anzahl, Qualifikation, Motivation, Befähigungen, Arbeitszeiten und Entgeltregelungen – bedenken Sie, was wichtig ist, um den Erfolg zu gestalten.
Welche Verbesserungen der Geschäftsprozesse wollen Sie erzielen? Prozessqualität, Materialverbrauch, Durchlauf- und Lieferzeiten, Personaleinsatzplanung, Risikomanagement – es gibt eine Menge Optimierungspotential.
Welche zusätzlichen Vorteile wollen Sie Ihrer Gesamtorganisation erschließen? Gesteigerte Umsätze, Ergebnisbeiträge oder Kostensenkungen sind immer willkommen.
Können Sie andere Teile Ihrer Organisation mit Ihrem Knowhow unterstützen? Welche sonstigen qualitativen Leistungen können Sie anbieten?
Zum Schluss nehmen Sie bitte eine erste Einzelbewertung Ihrer visionären Ideen vor. Wäre die Verwirklichung von geringem bis mittleren, oder mehr von mittlerem bis hohem Wert? Alle Ideen mit mittlerem bis hohem Wert zählen drei Punkte. Bei den übrigen Ideen fragen Sie ergänzend, ob der Aufwand für die Verwirklichung eher gering bis mittel oder mittel bis hoch wäre. Ideen mit geringem bis mittlerem Nutzen und Aufwand zählen einen Punkt. Die übrigen Ideen weisen ein ungünstiges Aufwand/Nutzen-Verhältnis auf - eher geringer Nutzen, eher hoher Aufwand - und werden nicht mitgezählt. Wie viele Punkte haben Sie erreicht?
Unter 10 Punkte Entweder sind Sie noch neu in der Aufgabe oder visionäres Führen ist nicht Ihre Stärke. Jedenfalls ist Ihr visionäres Kapital derzeit nicht sehr ausgeprägt.
10 bis 20 Punkte Ihr visionäres Kapital ist vielversprechend und noch ausbaufähig. Wenn Ihre Ideen gut sind, und Sie sich hartnäckig dahinterklemmen, dann werden Sie damit einiges erreichen.
Mehr als 20 Punkte Sie sind mit visionärem Kapital gut ausgestattet. Konzentrieren Sie sich auf die vielversprechendsten Verbesserungen und nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor!
Sechster Stock: Führen durch Werte
Die höchste Ebene der Führung ist die über Werte. Man kann Werte verbalisieren, ihre glaubwürdigsten Manifestationen finden sich aber im Handeln. Wertorientierungen offenbaren sich im Umgang mit bestimmten Gruppen, etwa den Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Kreditgebern oder der Öffentlichkeit. Diese Gruppen stehen in einer Beziehung zum Unternehmen und besitzen Anspruch auf bestimmte Leistungen. Sie haben ein berechtigtes Eigeninteresse an Entwicklung und Wohlergehen des Unternehmens und werden deshalb als Stake Holder bezeichnet. Die Managementliteratur zurückliegender Jahrzehnte3 sah den pfleglichen Umgang mit ihnen als Grundlage nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgs. Eine Koalition von Finanzmarktakteuren, Managementexperten für Kurzzeitoptimierung und praxisfernen Wirtschaftswissenschaftlern vertrat nicht ohne Wirkung in den letzten Jahrzehnten den Standpunkt, die Daseinsberechtigung von Unternehmen erschöpfe sich im Erzielen von Gewinn. Das einzig legitime Ziel unternehmerischen Handelns sei die (kurzfristige) Steigerung des Unternehmenswerts (»Shareholder Value«). Im Rückblick wird klarer, dass diese Theorie, die viele erfolgreiche Unternehmer nie teilten, in einem Zusammenhang mit den Exzessen der Finanzmärkte zu sehen ist. Inzwischen lebt das Stake Holder Management wieder auf4. Stabile Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Geldgebern usw. bilden für Handlungsmöglichkeiten und Chancen essentielle Ressourcen des Unternehmens. Nachhaltig erfolgreiches Wirtschaften orientiert sich an Werten, in denen die Interessen der Stake Holder angemessene Berücksichtigung finden. »Konvergente ökonomische, soziale und politische Kräfte fordern den Unternehmen ab, ihre Mitarbeiter, Kunden und die Gemeinschaft besser zu behandeln. Die Leute erwarten, dass die Unternehmen, die in ihrem Leben eine Rolle spielen, gutartige Zeitgenossen sind«, so die amerikanische Ökonomin und Beraterin Laurie Bassi 5.
Welche Werte zählen in Ihrer Organisation? Welche Bedeutung wird den verschiedenen Gruppen von Stake Holdern zugesprochen? Welche Bedeutung zeigt sich in Ihrem Verantwortungsbereich? Welche Verpflichtungen ergeben sich für Sie und Ihre Mitarbeiter, die für Sie unter keinen Umständen zur Diskussion stehen? Wenn Sie in der Lage sind, Wertorientierungen in klare und überzeugende Worte zu fassen und glaubwürdig vorzuleben, erleichtern Sie es Ihren Mitarbeitern, Entscheidungen zu treffen. Klare Wertorientierungen sind ein wirksamer Faktor, der Ihre Mitarbeitergespräche vereinfachen wird.
1 Siehe zum Beispiel: Bass, B. M. & Avolio, B., Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership, Thousand Oaks, 1994
2 ebenda
3 „Selbst die größte Organisation ist unwirklich verglichen mit der Wirklichkeit der Umgebung, in der sie existiert. Genauer gesagt, gibt es keine Resultate innerhalb der Organisation. Alle Resultate werden außerhalb erzielt. Die einzigen geschäftlichen Resultate werden zum Beispiel durch einen Kunden produziert, der die Kosten und Mühen des Unternehmens in Umsatz und Profit verwandelt durch seine Bereitschaft, sein Einkaufsbudget gegen die Produkte und Dienste des Unternehmens zu tauschen.“ (s.14) „Eine Organisation ist ein Organ der Gesellschaft und erfüllt ihren Zweck durch den Beitrag, den sie für ihre äußere Umgebung leistet.“ (S. 16) Drucker, Peter F., The Effective Executive, London 1967, Übersetzung der Zitate durch den Autor.
4 Zum Beispiel in der wissens- und kompetenzbasierten Unternehmenstheorie, vgl. Moldaschl, Manfred und Stehr. Nico, Eine kurze Geschichte der Wissensökonomie, in: dies., Wissensökonomie und Innovation, Marburg 2010
5 Laurie Bassi, Good Company, San Francisco 2011, S. ix, deutsche Übersetzung des Zitats durch den Autor.
Die richtige Einstellung finden
Menschen haben ihren eigenen Kopf
Wir Menschen haben unseren eigenen Kopf. Alles, was wir bewusst anfangen, muss dort hindurch, denn nur vermittels unserer eigenen Vorstellungen können wir unser Handeln aktiv steuern. Der prinzipielle Eigensinn der Menschen ist für Führungskräfte eine Herausforderung. Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter etwas Bestimmtes tun oder lassen. Warum, zum <҉҉҉> machen die es einfach nicht? Trotz vermeintlicher hierarchischer Macht haben viele Chefs ihre Not, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dorthin zu leiten, wo sie hin sollen. Da Sie den Eigensinn Ihrer Mitarbeiter weder verbieten noch abschaffen können, selbst wenn Sie es wollten, müssen Sie einen Weg finden, damit positiv umzugehen. Den Eigensinn der Mitarbeiter hinnehmen, ja, respektieren und trotzdem zum Ziel kommen, geht das? Aber ja, natürlich geht das. Lassen Sie uns dafür den menschlichen Eigensinn genauer verstehen anhand der Begriffe Motivation, mentales Modell und Lösungskompetenz.
Motivation
Wieso haben Sie sich für den Job zu entschieden, den Sie ausüben? Was bedeutet Ihnen Ihre tägliche Arbeit, über die Tatsache hinaus, dass man Geld verdienen muss? Macht Ihnen Ihre Arbeit Freude oder gar Spaß? Wie wichtig ist für Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen? Was sind Sie bereit zu geben für Ihren Erfolg im Job? Besitzen Sie Ehrgeiz für einen nächsten beruflichen Entwicklungsschritt? Und wie steht es um Ihre persönliche Balance zwischen Beruf und Familie, Freunden und Hobbies? Gibt es in Ihrem Privatleben derzeit Ereignisse oder Aufgaben, die einen beträchtlichen Teil Ihrer Energie aufzehren? Etwa der Verlust eines nahen Angehörigen, ein Pflegefall, oder eine schmerzhafte Trennung? Leiden Sie an körperlichem Verschleiß im Arbeitsprozess oder an einer Krankheit, die Ihre Arbeitsfähigkeit einschränkt? Auf diese und ähnliche Fragen haben verschiedene Menschen verschiedene Antworten. Wenn Sie wissen, welches die Antworten Ihrer Mitarbeiter sind, wissen Sie schon einiges über deren Motivation am Arbeitsplatz. Auch das, was die Mitarbeiter dort erleben, hat Auswirkungen auf ihre Motivation. Erfolgserlebnisse, Anerkennung und produktive Beziehungen mit Chefs und Kollegen sind positive Motivatoren. Leistungsfähige Mitarbeiter erleben Eigenverantwortung als motivierend. Der direkte Kontakt mit Leistungsempfängern wie Kunden, Patienten oder Lernenden kann motivierend erlebt werden. Ausgesprochene Demotivatoren sind anhaltende Über- oder Unterforderung, ein negatives Betriebsklima sowie als inadäquat erlebtes Führungsverhalten des direkten Chefs oder des Top-Managements.
Die Motivation Ihrer Mitarbeiter ist eine komplexe, individuell geprägte und sich beständig verändernde Angelegenheit. Einflussfaktoren, die direkt am Arbeitsplatz verwurzelt sind, liegen in Ihrem Einflussbereich. Aus anderen Einflüssen, wie dem Lebenskonzept eines Mitarbeiters oder seinen privaten und gesundheitlichen Umständen, können Sie nur gemeinsam mit ihm das jeweils Beste machen.
Mentale Modelle6
Die meisten Handlungen steuern wir unbewusst mittels eingespielter Routinen, über die wir nicht mehr bewusst nachdenken. Menschen, die das Fahrradfahren beherrschen, können nicht ohne weiteres beschreiben, wie sie es schaffen, zwischen der rechten und der linken Seite die Balance zu halten. Sie fahren sogar Kurven, ohne vom Fahrrad zu fallen. Offensichtlich ist die Steuerungsleistung nicht trivial, sie erfolgt unbewusst anhand von angeeigneten Handlungsroutinen, die als mentale Modelle bezeichnet werden. Mentale Modelle sind Verwandte unserer Gewohnheiten. Sie geben uns die Sicherheit, über eine erfolgversprechende Vorgehensweise zu verfügen, um unsere Kräfte zielgerichtet einzusetzen und das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Mentale Modelle spielen am Arbeitsplatz eine Rolle. Knowhow – auf Deutsch: gewusst wie – mag theoretisches Wissen erfordern. Im Kern ist es aber das in Form von mentalen Modellen individuell gespeicherte Handlungswissen, aus dem sich berufliches Knowhow konstituiert. Die Aneignung mentaler Modelle kann durch Ausprobieren, Nachahmen oder gezielte Anleitung geschehen. Es ist immer ein unumgänglicher individueller Lernprozess, für den es keine Abkürzung gibt. Ausgeprägte individuelle Unterschiede beim Arbeitserfolg bei scheinbar vergleichbaren Voraussetzungen beruhen meist auf einer unterschiedlichen Aneignung mentaler Modelle für die konkreten Arbeitsaufgaben. Dies schlägt sich in der allgemeinen Sicherheit, Zielstrebigkeit und Geschwindigkeit der Bearbeitung sowie unterschiedlicher Ausführungsqualität im Detail nieder. Die mentalen Modelle prägen das Erleben Ihrer Mitarbeiter davon, was sie können und wie sie es können. Verbesserte Arbeitsabläufe erfordern nicht nur gutwillige Veränderungsbereitschaft, sondern die Aneignung neuer oder verfeinerter mentaler Modelle, was Mühe und Zeit erfordert. Die mentalen Modelle prägen also auf unsichtbare Weise die unterschiedlichen inneren Vorstellungen, die sich Ihre Mitarbeiter von ihren Aufgaben machen. Sie sind eine Komponente des Eigensinns.
Lösungskompetenz
Mentale Modelle helfen enorm bei der Lösung von wiederkehrenden Aufgaben. Aber auch für die Suche nach einem uns bisher unbekannten Lösungsweg sind wir ausgestattet. Wir können uns erkundigen, wie andere in ähnlichen Situationen agieren oder durch eigene Überlegungen und Experimente einen neuen Lösungsweg erkunden. Menschen, die häufig neue Lösungen finden müssen, entwickeln auch dafür mentale Modelle. Man spricht dann von Lösungskompetenz. Wenn Menschen mit geringer Lösungskompetenz mit Anforderungen konfrontiert werden, für die sie keine mentalen Modelle verfügbar haben, löst das Unsicherheit aus. »Wie soll das gehen?« Manche Menschen glauben dann: »Das geht nicht«, was so viel heißt wie »Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll und ob es überhaupt machbar ist«. Kann etwas Schlimmes passieren, wenn es nicht gleich klappt? Unter Erfolgsdruck wird aus Unsicherheit schnell Angst. Die kann helfen, unsere Kampf- oder Fluchtreflexe zu mobilisieren. Bei der Aneignung neuer mentaler Modelle wirkt sie blockierend.
Grundsätzlich sind Menschen in der Lage, Probleme zu lösen. Das gilt besonders für Probleme auf ihrem erlernten Fachgebiet. Wenn sie dennoch geringe Lösungskompetenz an den Tag legen, ist das eine Art bescheidener Trainingszustand, der prinzipiell behebbar ist. Bisweilen trifft man auf die hartnäckige Weigerung, an aktiven Problemlösungen teilzunehmen. Das kann eine Art von Lebenskonzept sein (»Ich bin blöd«). Oder es ist eine zur Gewohnheit gewordene Reaktion auf einen Chef, der auf »Mikromanagement« versessen ist. Nach dem Motto: »Wenn der Chef schon alles am besten weiß, dann soll er mir auch genau sagen, was ich machen soll«. Die Lösungskompetenz Ihrer Mitarbeiter kann durch Übung entwickelt werden. Hier und jetzt müssen Sie die Leute aber nehmen wie sie sind.
Eigene Ängste beherrschen
Für Mitarbeiter ist es schwer vorstellbar: Viele Führungskräfte werden in ihren Mitarbeitergesprächen von Ängsten behindert. Sie scheuen sich, an Mitarbeiter Anforderungen zu stellen oder Konflikte anzugehen. Was befürchten sie?
Angst, die Sympathie der Mitarbeiter zu verlieren
Eine häufige Angst ist, die Sympathie der Mitarbeiter zu verlieren. Darüber hinaus möchte man nicht gerne als »harter Hund« unter den Mitarbeitern im Hause gesehen werden.
Diese Angst ist unbegründet. Mitarbeiter wissen, dass Führungskräfte es nicht allen Recht machen können. Sie erwarten sogar, dass der Chef oder die Chefin in der Lage ist, dort wo es im Interesse des »Ganzen« erforderlich ist, einzelnen Kollegen Grenzen zu setzen und bestimmte Leistungen einzufordern. Führungskräfte, die dabei einknicken, verlieren die Achtung ihrer Mitarbeiter. Anspruchsvolle Chefs haben eine magnetische Anziehung auf leistungsfreudige Mitarbeiter. Umgekehrt ziehen schwache Chefs schwache Mitarbeiter an. Nach einigen Jahren ist das Team ein Spiegelbild der Führungskraft – diese Aussage ist als »Biotoptheorie« bekannt.
Angst, den Mitarbeiter zu verlieren
Viele befürchten, dass ein Mitarbeiter sich einen anderen Job sucht, sobald er sich kritisiert oder in seinen Freiheiten eingeschränkt fühlt. Deshalb scheuen sie sich, korrigierend einzugreifen oder Konfliktthemen direkt anzusprechen. Diese Angst ist in der Regel nicht realistisch. Der Wechsel des Arbeitgebers ist für einen Arbeitnehmer mit Anstrengungen und Risiken verbunden. Wenn die Beziehung ansonsten in Ordnung ist, wird kein gescheiter Mensch wegen eines korrigierenden Hinweises der Führungskraft gleich die Flucht ergreifen. Umgekehrt bewirkt das Wegschauen der Führungskraft etwas. »Wer duldet, legitimiert«, sagt mein Kollege Peter Schabacker. Wenn eine Führungskraft das gleiche Verhalten, das sie heute duldet, morgen beanstandet, wird der Mitarbeiter sagen: »Das mache ich doch die ganze Zeit schon so. Sie haben nie was gesagt. Warum jetzt auf einmal?« Und diese Frage ist berechtigt! Durch die Duldung hatte die Führungskraft das Verhalten des Mitarbeiters legitimiert. Nun ist der Aufwand an Führungsenergie entsprechend höher, doch noch korrigierend einzugreifen.
Wenn Mitarbeiter gewohnt sind, über eigene Fehler mit der Führungskraft offen und konstruktiv zu kommunizieren, braucht sich die Führungskraft solche Sorgen nicht machen. Solche Gewohnheiten in der Führungsbeziehung entstehen nicht durch Zufall. Es beginnt damit, dass die Führungskraft in kleinen Fragen Konsequenz zeigt und zugleich eine konstruktive Fehlerkultur vorlebt.
Angst, im Konfliktfall alleine dazustehen
Manche sind sich nicht sicher, ob im Falle eines eskalierenden Konflikts mit einem Mitarbeiter ihr eigener Chef und die Geschäftsleitung hinter ihnen stehen.
Dort, wo zu solchen Sorgen realer Anlass besteht, ist das eine berechtigte Angst. Wenn der direkte Chef bzw. die Chefin in der Führungsrolle ein Versager ist, ist es mit Risiken verbunden, konsequent zu führen. Es gibt verschiedene taktische Varianten, damit umzugehen, die aber alle nicht wirklich befriedigen.
Feedback ist besser als ungewisse Ängste
Die angesprochenen Ängste beruhen zu Teilen auf Nichtwissen über die aktuellen Wahrnehmungen und Haltungen anderer. Manche Beunruhigung können Sie vermeiden, wenn Sie es sich zur Gewohnheit machen, die Haltungen der Anderen im Gespräch zu erkunden und sich Feedback geben zu lassen. Wenn ein Konflikt mit einem Mitarbeiter zu eskalieren droht, involvieren Sie proaktiv Ihre Führungskraft, die Personalabteilung und den Betriebsrat und hören sich an, was die Ihnen empfehlen. Sie wissen dann, wie Sie wahrgenommen werden. Die Ungewissheiten werden dadurch ausgeräumt oder reduzieren sich auf ein erträgliches Maß.
Umgehen mit den Ängsten der Mitarbeiter
Haben Ihre Mitarbeiter Angst vor Ihnen? Die meisten Chefs werden diese Frage verneinen. Mitarbeiter haben heutzutage Rechte und brauchen sich von ungeschickten oder anmaßenden Chefs keineswegs alles gefallen lassen. Manchmal sind es gerade die Chefs, die insgeheim vor Konflikten mit als »schwierig« erlebten Mitarbeitern Angst haben.
Doch aus Mitarbeitersicht stellt sich die Sache anders dar. Im Erleben des Mitarbeiters ist der Chef ein ungleicher und latent gefährlicher Gesprächspartner. Er kann unbequeme Anweisungen geben oder Entscheidungen treffen, die die eigenen Vorstellungen durchkreuzen. Bei wichtigen persönlichen Anliegen wie Gehaltserhöhungen und Beförderungen ist die Unterstützung des Chefs unabdingbar. Wer steht bei der nächsten Umorganisation auf der Kündigungsliste? Für die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes gilt in der Wirtschaft eine gute Beziehung zum Chef als vorteilhaft. Besonnene Mitarbeiter behandeln die Beziehung zum Chef mit Sorgfalt und hoher Priorität und lassen im Gespräch mit ihm Vorsicht walten.