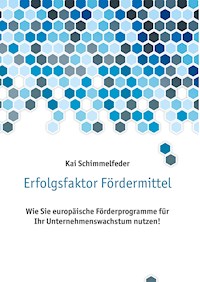
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die meisten kleinen, mittleren und mittelständischen Unternehmen haben das Problem, dass sie sich nicht mit den öffentlichen Förderprogrammen, Zuschüssen und Subventionen auskennen. Dadurch verpassen diese Unternehmen die finanziellen und wirtschaftlichen Vorteile und können weniger Geschäftschancen umsetzen. Das führt dazu, dass die Umsatzrenditen und Ertragsrenditen auf Dauer zu gering sind, um den Veränderungen und Ansprüchen der Zukunft gerecht zu werden. Meine Mission ist es, den kleinen, mittleren und mittelständischen Unternehmen den Zugang und die Nutzung zu den über 5.100 öffentlichen Förderprogrammen einfacher, schneller und verständlicher zu ermöglichen, um damit mehr Geschäftschancen umzusetzen. Die wirtschaftlichen und finanziellen Vorteile aus den Investitions-, Innovations-, Projekt-, Regional-, Tilgungs- und Zinszuschüssen (geschenktes Geld vom Staat bzw. Finanzmittel, die nicht rückzahlpflichtig sind), den Bürgschaftsbanken mit ihren ergänzenden Sicherheitenstellungen und Kombiprogrammen, den Förderkrediten für verschiedenste Investitionen, den mittelständischen Beteiligungsgesellschaften, den Eigenkapitalergänzungsprogrammen und den Sonderförderprogrammen, sind durch diese Mission für die Unternehmen und Startups bzw. Gründungen durchsichtiger und klarer nutzbar. Die Co-Finanzierung notwendiger oder strategischer Unternehmensinvestitionen mit öffentlichen Förderprogrammen führt zu mehr Unternehmenserfolg und Zukunftssicherheit. Mit mehr Wissen und mehr Handlungskompetenz in den Unternehmen zu den finanziellen und wirtschaftlichen Vorteilen der öffentlichen Förderung, werden mehr Geschäftschancen ermöglicht und umgesetzt. Damit ergibt sich eine verbesserte Zukunft für Unternehmen, sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze und eine wirtschaftlich stabilere Gemeinschaft in Deutschland. Grundsätzlich basiert die Förderung unter anderem auf dem Paragraf 12 des StabG (Stabilitäts- und Wachstumsgesetz). Dieser erläutert die öffentliche Förderung wie folgt und hat zum Ziel: "Die Erhaltung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen, der Anpassung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen an neue Bedingungen und der Förderung des Produktivitätsfortschritts und des Wachstums von Betrieben oder Wirtschaftszweigen, insbesondere durch Entwicklung neuer Produktionsmethoden und -richtungen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Entscheider in Unternehmen, die nutzbare öffentliche Förderpramme nicht im Unternehmen einsetzen, schaden dem Unternehmen!“
Kai Schimmelfeder
Das Werk ist für alle geschlechtlichen Typen geschrieben. Sollte ein Typ bevorzugt genannt sein, so ist dies rein zufällig und ohne Bewertung der unterschiedlichen Typen.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
*Der Inhalt ersetzt keine individuelle Beratung, oder erhebt Anspruch auf Vollständigkeit der Notwendigkeiten zum Thema. Nutzen Sie Spezialisten aus den Bereichen, Steuer, Recht, Wirtschaft.
Dankean alle, die an diesem Buch mitgewirkt haben.
Inhaltsverzeichnis:
1.
VORWORT, BUCHAUFBAU UND IDEE
1.1 VORWORT
1.2 FEHLER BEI DER BEANTRAGUNG
1.3 BUCHAUFBAU UND IDEE
2.
WIRTSCHAFTLICHE AUSGANGSLAGE KMU
2.1 IST-LAGE IM MITTELSTAND
2.2 WER NICHT INVESTIERT, FÄNGT AN ZU STERBEN
2.3 MITTELSTAND-LIQUIDITÄT
3.
FÖRDERUNG: FALSCH ODER RICHTIG
3.1 DER BEGRIFF FÖRDERMITTEL?
3.2 MEINE HAUSBANK HAT ALLE FÖRDERMITTEL?
3.3 FÖRDERMITTEL SIND BILLIGE KREDITE?
3.4 FÖRDERMITTEL SIND KOMPLIZIERT?
3.5 FÖRDERMITTEL UND HOLDING?
3.6 DE-MINIMIS IST EIN FÖRDERMITTEL?
3.7 FÖRDERMITTEL AUSLANDSINVESTITIONEN?
3.8 HAFTUNGSFREISTELLUNG?
3.9 SCHWACHE UNTERNEHMEN & FÖRDERUNG?
3.10 UNTERNEHMEN IN SCHWIERIGKEITEN?
3.11 UMSCHULDUNG DURCH FÖRDERUNG?
3.12 BEI PROJEKTENDE GIBT ES FÖRDERUNG?
3.13 ÄLTERE UNTERNEHMEN & FÖRDERUNG?
3.14 FÖRDERUNG NUR FÜR HIGH-TECH?
3.15 FÖRDERMITTEL SIND NUR FINANZMITTEL?
4.
VORTEILE UND NUTZEN ÖFFENTLICHER FÖRDERUNG
4.1 VORTEIL: FÖRDERKREDIT
4.2 VORTEIL: ZUSCHUSS
4.3 VORTEIL: HAFTUNGSFREISTELLUNG
4.4 VORTEIL: TILGUNGSFREIHEIT
4.5 VORTEIL: BÜRGSCHAFT
4.6 VORTEIL: BETEILIGUNGSKAPITAL
4.7 VORTEIL: EU-FÖRDERUNG KMU
5.
MIT FÖRDERPROGRAMMEN ERFOLGREICHER
5.1 PRAXISFALL: INVESTITIONEN
5.2 PRAXISFALL: TILGUNGSFREIHEIT
5.3 PRAXISFALL: INNOVATIONSZUSCHUSS
5.4 PRAXISFALL: REGIONALZUSCHUSS/GRW
5.5 PRAXISFALL: GROßES UNTERNEHMEN
5.6 PRAXISFALL: STANDORTENTSCHEIDUNG
5.7 PRAXISFALL: HIGH-TECH
5.8 PRAXISFALL: UMWELT - ZUSCHUSS
6.
UNTERNEHMERISCHE FREIHEIT – FÖRDERIMPULSE
6.1 STÄRKERE (EIGEN-) KAPITALAUSSTATTUNG - FÜR IHR UNTERNEHMEN
6.2 MEHR CHANCEN AM MARKT HABEN
6.3 MEHR BESSERE BONITÄT
6.4 BESSERES RATING (BASEL 2, BASEL 3, UND FOLGENDE)
6.5 MEHR LIQUIDITÄT, UM GESCHÄFTSCHANCEN ZU NUTZEN
6.6 MEHR UND WEITREICHENDE PLANBARKEIT SCHAFFEN
6.7 STABILER UNTERNEHMENSAUFBAU
6.8 BESSERE KARRIERECHANCEN
6.9 IHRE UNTERNEHMENSZUKUNFT UND PRIVATE FREIHEIT
6.10 IHRE UNTERNEHMERISCHE FREIHEIT NOCH MEHR GESTALTEN
6.11 IHRE UNTERNEHMERISCHE FREIHEIT BESSER GENIEßEN!
7.
GRUNDLAGEN ÖFFENTLICHER FÖRDERUNG
7.1 FÖRDERBANKEN & FÖRDERINSTITUTE
7.2 VERSTÄNDIGUNG ZWEI
7.3 WAS IST WAS IM FÖRDERMITTEL-DSCHUNGEL
7.4 LANDESFÖRDERINSTITUT
7.5 FÖRDERUNG DURCH MINISTERIEN
7.6 EU-FÖRDERUNG
7.7 FÖRDERORGANISATIONEN
7.8 WER KANN GEFÖRDERT WERDEN?
7.9 DE-MINIMIS VERORDNUNG
7.10 AGVO – ALLGEMEINE GRUPPENFREISTELLUNG
7.11 MAßNAHMENBEGINN: FEHLER VERMEIDEN
7.12 RGZS-RISIKOGERECHTES ZINSSYSTEM
7.13 HAFTUNG DES ANTRAGSTELLERS
8.
FÖRDERPROJEKT
8.1 FÖRDERPROJEKT: WAS IST DAS?
8.2 FÖRDERFÄHIGE KOSTEN?
8.3 FÖRDERPROJEKT: ANTRAGSKONZEPT
8.4 FINANZIERUNGSGRUNDLAGEN
8.5 CONTROLLING FÖRDERPROJEKT
9.
EU-FINANZHILFEN UND FÖRDERMITTEL
10.
WENN ES UNTERNEHMEN SCHLECHT GEHT…
11.
FÖRDERPROGRAMME FINDEN UND NUTZEN
11.1 FÖRDERFÄHIGE KOSTEN?
12.
CHECKLISTE BENÖTIGTER DATEN UND UNTERLAGEN
13.
CHECKLISTE F&E-SELBSTTEST
14.
FÖRDERMITTELBERATER: DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN
15.
QUELLE: FÖRDERORGANISATIONEN
16.
QUELLE: FÖRDERINSTITUTE
17.
QUELLE: BÜRGSCHAFTSBANKEN
18.
QUELLE: MITTELSTÄNDISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN
19.
QUELLEN: GESETZE, RICHTLINIEN, …
20.
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
21.
LISTE ERGÄNZENDER LITERATURHINWEISE
22.
KAI SCHIMMELFEDER
22.1 Profil
22.2 Vita
22.3 Newsletter, YouTube und mehr
22.4 In Kontakt bleiben mit Kai Schimmelfeder
22.5 Vortragsthemen
22.6 Auszeichnung: TOP 100 SPEAKER
22.7 Auszeichnung: Weltrekord Speaker-Slam
22.8 Auszeichnung: Redner-Lexikon
22.9 Auszeichnung: TOP EMPFEHLUNG 2019
22.10 Auszeichnung: TOP DIENSTLEISTER 2019
22.11 Auszeichnung: TOP EMPFEHLUNG 2018
22.12 Auszeichnung: TOP DIENSTLEISTER 2018
22.13 Auszeichnung: TOP EMPFEHLUNG 2017
22.14 Auszeichnung: TOP DIENSTLEISTER 2017
22.15 Auszeichnung: ICEM
22.16 Auszeichnung: Zertifizierter Sachverständiger
22.17 Auszeichnung: Geprüfter Sachverständiger 2019
22.18 Auszeichnung: Geprüfter Gutachter 2018
22.19 Auszeichnung: Geprüfter Gutachter 2017
22.20 Auszeichnung: Geprüfter Gutachter 2016
22.21 Auszeichnung: Geprüfter Gutachter 2015
22.22 Auszeichnung: TOP CONSULTANT 2016
22.23 Auszeichnung: TOP CONSULTANT 2014/15
22.24 Auszeichnung: Mittelstandsbotschafter
22.25 Berater und Dozent der Offensive Mittelstand
22.26 Buchempfehlung: Das L.O.C.-Prinzip
22.27 Buchempfehlung: Unternehmenskauf
22.28 Buchempfehlung: Digitalisierung
22.29 Referenzen
23.
FEDER CONSULTING
23.1 Profil feder consulting
23.2 Deutschland, Europa und die Welt
23.3 Problemlöser feder consulting
23.4 Startpaket öffentliche Förderung
23.5 Vortrag Erfolgsfaktor Fördermittel
1 Vorwort, Buchaufbau und Idee
1.1 VORWORT
Die meisten kleinen, mittleren und mittelständischen Unternehmen haben das Problem, dass sie sich nicht mit öffentlichen Förderprogrammen, Zuschüssen und Subventionen auskennen. Dadurch verpassen diese Unternehmen finanzielle und wirtschaftliche Vorteile und können weniger Geschäftschancen umsetzen.
Das wiederum führt dazu, dass die Umsatzrenditen und Ertragsrenditen auf Dauer zu gering sind, um den Veränderungen und Ansprüchen der Zukunft gerecht zu werden.
Meine Mission ist es, kleinen, mittleren und mittelständischen Unternehmen den Zugang und die Nutzung zu über 5.100 öffentlichen Förderprogrammen einfacher, schneller und verständlicher zu ermöglichen, um damit mehr Geschäftschancen und Wachstum umzusetzen.
Die wirtschaftlichen und finanziellen Vorteile aus den Investitions-, Innovations-, Projekt-, Regional-, Tilgungs- und Zinszuschüssen ("geschenktes Geld vom Staat" bzw. Finanzmittel, die nicht rückzahlpflichtig sind), Bürgschaftsbanken mit ihren ergänzenden Sicherheitenstellungen und Kombiprogrammen, den Förderkrediten für verschiedenste Investitionen, den mittelständischen Beteiligungsgesellschaften, den Eigenkapitalergänzungsprogrammen und den Sonderförderprogrammen, sind durch diese Mission für die Unternehmen und Startups bzw. Gründungen durchsichtiger und klarer nutzbar.
Die Co-Finanzierung notwendiger oder strategischer Unternehmensinvestitionen mit öffentlichen Förderprogrammen führt zu mehr Unternehmenserfolg und Zukunftssicherheit.
Mit mehr Wissen, und mehr Handlungskompetenz in den Unternehmen zu finanziellen, und wirtschaftlichen Vorteilen der öffentlichen Förderung, werden mehr Geschäftschancen ermöglicht und umgesetzt. Daraus ergibt sich eine verbesserte Zukunft für Unternehmen, sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze, und eine wirtschaftlich stabilere Unternehmenslandschaft in Deutschland.
Grundsätzlich basiert die Förderung für Unternehmen unter anderem auf dem Paragraf 12 des StabG (Stabilitäts- und Wachstumsgesetz). Dieser erläutert die öffentliche Förderung wie folgt und hat zum Ziel: „Die Erhaltung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen, der Anpassung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen an neue Bedingungen, und der Förderung des Produktivitätsfortschritts, und des Wachstums von Betrieben oder Wirtschaftszweigen, insbesondere durch Entwicklung neuer Produktionsmethoden und -richtungen.
Ergänzend bzw. weitere Grundlage ist der §23 Bundeshaushaltsordnung (BHO), §104a Grundgesetz, sowie EU-Richtlinien, Verordnungen (z.B.: Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des europäischen Parlaments und des Rates) und Gesetze aus Deutschland und der Europäischen Union. Mehr rechtliche Grundlagen sind am Ende dieses Buches im Kapitel „Richtlinien, Gesetze, Verordnungen“
1.2 FEHLER BEI DER BEANTRAGUNG
Die nachfolgenden Gründe sind aus der täglichen Praxis entnommen, und stellen so oder in ähnlicher Form ca. 99% aller Gründe für Fehler bei der Beantragung. Was wiederum zeigt, dass dieses Thema aufgrund seiner Komplexität wahrscheinlich viele verschreckt, entnervt aufgeben oder verzweifeln lässt. Leider geht das vielen Unternehmern so. Selbst die Beauftragten für Fördermittel und Zuschüsse in Brüssel sind über die Förderlandschaft nicht glücklich, wenn es um den „Dschungel“ zum Thema Fördermittel und Zuschüsse geht.
Checkliste: Fehler bei der Beantragung von öffentlichen Förderprogrammen
Fehlerprüfung
Ich wusste nicht, dass ich einen Antrag stellen kann
Ich kenne mich nicht aus, - gehe aber davon aus, dass es sich sowieso nicht lohnt!
Ich weiß, dass es Fördermittel für mich gibt, aber ich hatte noch keine Zeit mich darum zu kümmern!
Mein Antrag liegt noch in meiner Schreibtischschublade und ich habe „Aufschieberitis"
Ich habe die Frist für die Fördermittelbeantragung bzw. Zuschussbeantragung verschlafen
Ich war davon ausgegangen, alles richtig beantragt zu haben, aber jetzt habe ich erst mal keine Zusage bekommen, weil der Antrag fehlerhaft und/oder unvollständig ist!
Ich habe meinen Antrag an die falsche Stelle gesendet
Meine Bank sagt, dass ich ein besseres Angebot von der Bank bekommen kann!
Checkliste: Fehler bei der Beantragung von öffentlichen Förderprogrammen
1.3 BUCHAUFBAU UND IDEE
Ich habe dieses Buch aus praktischer Sicht und zur praktischen Nutzung geschrieben. Der Aufbau des Buches wurde so gewählt, dass schnell erkennbar ist, welche Chancen und Möglichkeiten Unternehmen haben, wenn öffentliche Förderprogramme genutzt werden.
Das Buch bietet den größten Nutzen für Unternehmer bzw. Unternehmen, Inhaber und Entscheidungsträger, die unternehmerische Investitionen mit öffentlichen Förderprogrammen co-finanzieren wollen. Damit werden unter anderem vorhandene Liquiditätsmittel geschützt, bzw. können mehr Geschäftschancen umgesetzt werden. Das wiederum führt zu einer besseren Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und das wiederum schützt und schafft Arbeitsplätze.
Regelmäßig werden über 50% der notwendigen Investitionen in Unternehmen nicht in die Umsetzung gebracht, da benötigte Finanzmittel fehlen bzw. diese in anderen Projekten und Themen gebunden sind.
Hinzu kommen Millionen von Ideen in Unternehmen für neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Geschäftsideen, die zu 90% (!) scheitern, bzw. gar nicht erst an den Start kommen, weil die dafür notwendigen Finanzmittel fehlen, bzw. nicht vorhanden sind, bzw. der Zugang zu den notwendigen Finanzierungen erschwert ist.
Gerade Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen, - also Unternehmen aus dem klassischen Mittelstand, - die sich nicht mit dem Finanzmarkt und den Finanzmöglichkeiten oder der Konzernfinanzierung, oder der Finanzierungsmöglichkeiten von Aktiengesellschaften auskennen, - haben durch die staatlich gewollte und regulierte Finanzierung mit öffentlichen Förderprogrammen, die meisten finanziellen und wirtschaftlichen Vorteile.
Kapitel zwei:
In Kapitel zwei lesen Sie Fakten zu den betriebswirtschaftlichen Parametern des Mittelstandes in Deutschland. Die Renditen in Unternehmen sind zu schwach, um sich auf notwendige Zukunftsprojekte einlassen zu können. Viele Investitionen sind nicht möglich, weil die Liquidität auf Dauer zu gering ist. Auch wenn es in vielen Medien Positives zur Mittelstandsentwicklung zu hören und zu lesen gibt, zeigen die Finanzkennzahlen oftmals ein anderes Bild und sind wesentlich zu verbessern. Diese Ausgangslage verdeutlicht den Handlungsbedarf der Unternehmenslenker.
Ohne ausreichende Liquidität kann z.B. keine Innovation vorangetrieben werden.
Kapitel drei:
In Kapitel drei nehme ich Sie mit in den „Fördermittel-Dschungel“ bzw. die Irrungen und Wirrungen, die hier und da aus Halbwahrheiten, und Unkenntnissen rund um das Thema der öffentlichen Förderprogramme bestehen. Viele Menschen haben dies und das gehört, sind dabei aber nicht in die Details der Fördermittelberatung eingestiegen. Anstatt professionell an die Richtlinien und Verordnungen und Gesetze und Bestimmungen heranzugehen werden eigene Deutungen und Inhalte in die Öffentlichkeit gebracht und verfestigen sich dort hartnäckig. Das Kopieren und Verbreiten der Irrtümer aus Webseiten und anderen Veröffentlichungen steigert dann noch den Verbreitungsgrad und steigert auch den Grad der Fehlinformationen. Damit steigert sich die Möglichkeit und Häufigkeit an gravierenden Fehlinformationen für Unternehmen, die sich mit dem Thema der öffentlichen Förderung auseinandersetzen.
Viele Berater, sogar „Fördermittelberater“ glauben, mit oberflächigem Wissen, und ein wenig „googeln“ zum Thema „Wo und was gibt es an Fördermitteln“, kann man sich als „Experte“ darstellen. Das hierbei Haftungstatbestände wirken, und grob fahrlässig „beraten“ wird – blenden viele „Berater“ aus, oder wissen es gar nicht.
Ich selbst muss immer wieder als Gutachter bei Rechtsstreitigkeiten zwischen „Beratern“ und „Unternehmen“ feststellen, wieviel lückenhaftes Fördermittelwissen, und fehlendes Wissen zu Subventionen im Allgemeinen bei „Beratern“ vorliegt. Die finanziellen Schäden für die Unternehmen, die mit solchen „Beratern“ zusammengearbeitet haben, sind oftmals erheblich und im Verhältnis zu dem eigentlich gewünschten Förderergebnis erschreckend.
Kapitel vier:
In Kapitel vier lesen Sie die grundsätzlichen Vorteile der öffentlichen Förderprogramme. Hier sind die Tilgungsfreiheit, die verschiedenen Zuschüsse, die Beteiligungsmöglichkeiten, die Haftungsfreistellung, die Förderkredite und auch die Bürgschaften erläutert. Je nachdem, wie Sie Ihr Projekt aufbauen, können Sie unterschiedliche Vorteile nutzen.
Kapitel fünf:
Um den Mehrwert und den Nutzen aus den öffentlichen Förderprogrammen schnell zu erkennen und zu „ziehen“, sind im fünften Kapitel Praxisbeispiele aus dem Berateralltag dargestellt und erläutert. Diese Praxisbeispiele zeigen auf, welche detaillierten finanziellen Vorteile durch die richtige Nutzung der öffentlichen Förderprogramme in Unternehmen möglich sind. Damit einher gehen Unternehmenswertsteigerungen, und die Steigerung der Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Unternehmens.
In diesem Kapitel können Sie erste Ableitungen für Ihre Zukunft vornehmen und sich „ausmalen“, welche Vorteile Ihre Investitionsvorhaben schaffen, wenn Sie öffentliche Förderprogramme nutzen.
Kapitel sechs:
Dieses Kapitel ist eine Reise in Ihre Zukunft: Unternehmerische Freiheit durch die Nutzung der öffentlichen Förderprogrammen. In elf Schritten bzw. mit elf Vorteilen, können Sie Ihre unternehmerische Zukunft „neu“ gestalten. Der Weg, der hier aufgezeigt wird, kann über mehrere Jahre gehen und führt am Ende zur Möglichkeit eines Lebens in zeitlicher und finanzieller Freiheit
Kapitel sieben:
In Kapitel sieben erfahren Sie die Grundlagen der öffentlichen Förderung: Was bedeutet Subvention und Finanzhilfe, wer kann Anträge stellen, was ist die Verständigung zwei, welche Förderorganisationen gibt es, was ist der Maßnahmenbeginn, wie geht EU-Förderung, welche Förderorganisationen gibt es in Deutschland und der Europäischen Union, was ist de-minimis, was bedeutet für Sie das RGZS und was hat es mit der AGVO auf sich.
Kapitel acht:
In Kapitel acht sehen wir uns „das Förderprojekt“ an. Was sind förderfähige Kosten, welche Phasen gibt es in der Antragstellung, wie baut sich ein Antragskonzept auf, welche Finanzierungstruktur kann genutzt werden und wie sieht das Controlling im Projekt aus.
Kapitel neun:
In Kapitel neun lesen Sie das wichtigste zur EU-Förderung. Welche Budgets sind vorhanden, wie sind diese verteilt, wo kommen die Finanzmittel her, wer bezahlt was und welche Fördermöglichkeiten bestehen für Sie.
Kapitel zehn:
In Kapitel zehn erfahren Sie mehr zum Thema „Wenn es Unternehmen schlecht geht – was ist dann mit Förderprogrammen?“. Viele Fördermittelberater kennen sich in diesem speziellen Bereich für Fördermöglichkeiten nicht aus bzw. ist es so umfangreich in der Beratung, dass ich Ihnen hier die grundsätzlichen Möglichkeiten dargestellt habe. Sie lesen dort auch Auszüge der Richtlinie, welche die Förderung von Unternehmen in der Krise ermöglicht.
Kapitel elf:
In Kapitel elf sehen Sie die Liste der benötigten Daten, die nötig sind, um einen ersten Fördermittel-Check durchzuführen. Sie können einen ersten Fördermittel-Check auch gerne bei uns auf www.federconsulting.com durchführen lassen.
Kapitel zwölf:
In Kapitel zwölf sind die ergänzenden Unterlagen aufgelistet, die benötigt werden, um die meisten Förderanträge zu erstellen, bzw. sind das die Daten, die sie zur Verfügung stellen müssten, wenn es in die Beantragung geht.
Kapitel dreizehn:
In Kapitel dreizehn ist der F&U-Selbsttest dargestellt, damit Sie bei Projekten mit innovativem Ansatz ein erstes Ergebnis zu ihrem Projekt bekommen.
Kapitel vierzehn:
In Kapitel vierzehn wird erläutert, auf was Sie achten sollten, wenn Sie einen Fördermittelberater beauftragen. Gerne werden wir natürlich für Sie tätig, aber Sie werden nach diesem Kapitel auf jeden Fall wichtige, grundsätzliche Auswahlkriterien für Fördermittelberater wissen.
Kapitel fünfzehn:
In Kapitel fünfzehn erhalten sie einen Überblick über die Förderorganisationen und deren Adressen
Kapitel sechzehn:
In Kapitel sechzehn erhalten Sie die Kontaktdaten zu noch mehr Förderinstituten.
Kapitel siebzehn:
Das Kapitel siebzehn umfasst den Arbeitsbereich der Bürgschaftsbanken.
Kapitel achtzehn:
In Kapitel achtzehn bekommen Sie die Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften und Adressen
Kapitel neunzehn:
Das Kapitel neunzehn widmet sich den Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen, die es in der Fördermittelberatung und den Projekten braucht.
Kapitel zwanzig:
In Kapitel zwanzig erfahren Sie mehr über die gängigen Abkürzungen im „Fördermittel-Dschungel“.
Kapitel einundzwanzig führt weitere Literaturhinweise für Sie mit und in Kapitel zweiundzwanzig lesen Sie mehr zu mir und dem Thema Fördermittelberatung.
2 Wirtschaftliche Ausgangslage KMU
2.1 IST-LAGE IM MITTELSTAND
Bild: Kai Schimmelfeder, www.kaischimmelfeder.de
Bei den oben genannten Ergebniszahlen stellt sich die Frage: „Wie soll bzw. wie kann ein Unternehmen bei weniger als 100.000 Euro Gewinn vor Steuer noch Liquidität vorhalten, um neue Produkte, Innovationen, bzw. neue Dienstleistungen, etc. zu entwickeln?“ Vor der Entwicklung und vor dem Wachstum von Unternehmen, steht immer die Investition in das Neue! Ohne Rentabilität keine Liquidität und ohne Liquidität keine Chance neue „Dinge“ in die Umsetzung zu führen!
Die Umsatzverteilung in den unterschiedlichen Größen der Unternehmen gliedert sich dabei wie folgt:
86,5% der Unternehmen erzielen einen Umsatz bis zu einer Million Euro
6,10% der Unternehmen erzielen einen Umsatz zwischen einer und zwei Millionen Euro
5,2% der Unternehmen erzielen einen Umsatz zwischen zwei und zehn Millionen Euro
2,01% der Unternehmen erzielen einen Umsatz zwischen 10 und fünfzig Millionen Euro
0,19% der Unternehmen erzielen einen Umsatz von über 50 Millionen Euro
Diagramm: Umsatzverteilung, Ableitung aus Quelle: Statisches Bundesamt 10.2018
Einen besonderen Blick muss hier auf die Größe der Unternehmen gelegt werden: Fast 3.3 Millionen Unternehmen von den 3.6 Millionen Unternehmen haben maximal 9 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte.
Damit einher geht auch immer ein Wachstumsproblem der Unternehmen. Bei einer Mitarbeiteranzahl von unter 10, ist es sehr schwierig und fast unmöglich ein neues Investitionsvorhaben allein und aus dem Stand umzusetzen. Gerade diese kleinen und auch mittleren Unternehmen sind in der Liquiditätsbeschaffung, und somit auch im Wachstum anderen, größeren Unternehmensgrößen im Nachteil.
Diagramm: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Bezug zu Anzahl der Unternehmen, Ableitung aus Quelle: Statistisches Bundesamt 10.2018
Zur Abrundung einer grundsätzlichen Betrachtung sehen wir uns hier die Umsatzrenditen der Unternehmen in Deutschland an: Hier sind die durchschnittlichen Umsatzrenditen in unterschiedlichen Branchen genannt:
Diagramm: Renditen unterschiedlicher Branchen, Ableitung aus Quelle: Statisches Bundesamt 10.2018
Eine Abhilfe dieser wachstumshemmenden Situationen kann hierbei eine intelligente Nutzung der öffentlichen Förderprogramme wie Förderkredite, Innovationszuschüsse, Investitionszuschüsse, Projektzuschüsse, Ausfallbürgschaften, mittelständischen Beteiligungen, Liquiditätshilfen, Eigenkapitalergänzungen, etc., sein (siehe hierzu besonders §12 StabG)
2.2 WER NICHT INVESTIERT, FÄNGT AN ZU STERBEN
„Es ist allgemein anerkannt, dass das Produktivitätswachstum erfolgreicher Wirtschaftszweige nicht dadurch bedingt ist, dass alle auf dem Markt tätigen Unternehmen einen Produktivitätszuwachs verzeichnen, sondern vielmehr darauf zurückzuführen ist, dass die effizienteren und technologisch fortgeschrittenen Unternehmen zulasten derer, die weniger effizient arbeiten oder veraltete Produkte anbieten, Wachstum erzielen.
Der Marktaustritt weniger effizienter Unternehmen versetzt ihre effizienteren Wettbewerber in die Lage, Wachstum zu erzielen und bringt Vermögenswerte auf den Markt zurück, wo sie einem produktiveren Einsatz zugeführt werden können.“
(Quelle: EU-Kommission, Leitlinien über Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen)
Die oben genannte Aussage ist ein Standpunkt, der seitens der EU-Kommission vertreten wird, und gleichzeitig folgendes klar machen sollte:
Ohne Investitionen bzw. ohne Liquidität ist:
keine Anpassung an den Markt und die Wettbewerber möglich,
ein Rückschritt bzw. ein Stillstand des Unternehmens vorprogrammiert,
der Marktanteilsverlust und Kundenverlust treten ein,
es folgt der Gewinnverlust und der Kostendruck schlägt in einem Unternehmen nachhaltig durch.
Die Mitarbeiter erfahren am eigenen „Leib“ die Nachlässigkeiten der Unternehmensführung und es kommt zu Kündigungen der besten Mitarbeiter und Führungskräfte.
Der Imageverlust des Unternehmens ist dann fast vorprogrammiert. Bei Inhabergeführten Unternehmen „trifft“ es den Unternehmer meist persönlich und geht häufig mit einer deutlichen Reduzierung der Lebensqualität einher.
Das lässt die Sinnfrage aufleben und noch mehr Energie des Unternehmers wird geradezu abgesaugt.
Die Möglichkeit einer Ausfallwahrscheinlichkeit wird damit deutlich erhöht und der Marktaustritt wäre die Folge!
Bild: Unternehmen haben immer Kapitalbedarf, Quelle: Kai Schimmelfeder
Merke: Unternehmen, die aus dem Markt austreten, scheitern oftmals an fehlender bzw. reduzierter Produktivität. Für eine bessere Produktivität benötigen Unternehmen Effizienz und technologischen Fortschritt. Dazu wiederum wird Kapital und somit Liquidität benötigt.
Gute bzw. hohe Liquidität bzw. liquide Mittel im Unternehmen, sind auch grundsätzlich ein Zeichen von guter Bonität. Bonität zeigt die Wahrscheinlichkeit von aktueller und zukünftiger Zahlungsfähigkeit.
Die Bonität, somit ein Ausdruck von Kreditwürdigkeit und damit eine Zuweisung in eine bestimmte 1-Jahres (Kredit-) Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen beeinflusst die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen! Für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen werden immer (finanzielle) Investitionen nötig sein. Investitionen zur Optimierung von Prozessen, von Produkten oder/und von Verfahren, verlangen unter anderem aber grundsätzlich erstmal die Fähigkeit des Unternehmens, überhaupt investieren zu können. Investieren können bedeutet hierbei ausreichend liquide Finanzmittel, bzw. genügend Liquidität im Unternehmen zur Verfügung zu haben. Ohne ausreichende Finanzmittel bzw. Investitionen ist die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens schwierig bzw. gefährdet, und die Fortführungswahrscheinlichkeit kann nicht mehr gewährleistet werden. Ohne Investitionen steigt dabei die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen nicht dauerhaft am Markt bestehen kann.
Um aber überhaupt investieren zu können brauchen Unternehmen Eigenkapital, und (oftmals) Fremdkapital oder andere Kapitalmittel (Beteiligungskapital, spezielle Fördermittel wie Zuschüsse und steuerliche Vergünstigungen, Förderkredite, o.ä.). Diese verschiedenen Kapitalquellen können aber nur „angezapft“ bzw. genutzt werden, wenn das Unternehmen eine Zukunft hat, oder eine Zukunftsplanung anhand von aussagekräftigen Unterlagen belegen kann. Damit ist gemeint, dass das Unternehmen dauerhaft überlebensfähig und wirtschaftlich erfolgreich sein muss. Erst wenn dies durch Unterlagen aus dem Unternehmen, wie z.B. Bilanzen, Gewinn und Verlustrechnung, Liquiditätsplanung, Investitionsplanung, Geschäftsplanung, etc. belegbar ist, werden Dritte in das Unternehmen neue oder zusätzliche Finanzmittel geben.
Um aber sein eigenes Kapital (Eigenkapital!) zu schützen und das Kapital von Dritten zu sichern (Fremdkapital, Mezzanine Kapital, o.ä.), muss ein Unternehmen Bonität haben, herstellen bzw. verbessern können.
Bonität versteht sich u.a. bei Förderkrediten (Kredite mit vergünstigten Zinsen oder auch Tilgungszuschüssen, Haftungsfreistellungen, Tilgungsfreien Jahren, o.ä.) als eine vorausberechnete 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit eines Unternehmens – wie bereits erläutert.
Je besser die Bonität (Kreditwürdigkeit bzw. hier die 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit) eines Unternehmens ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen den Markt durch Insolvenz, Liquidation, o.ä. verlassen wird bzw. verlässt, und dabei einen (Förder-) Kreditschaden und andere negative Positionen hinterlässt.
Je schlechter die Bonität eines Unternehmens ist, desto schlechter ist die Einstufung in die bankinternen Berechnungsmodelle zur 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens, und desto höher ist der Zins den das Unternehmen für (Fördermittel-) Kredite bezahlen muss. Ist die Bonität völlig unzureichend, bekommt ein Unternehmen eigentlich keinen (Fördermittel-) Kredit mehr!
Das Wort Bonität stammt vom lateinischen „bonitas“, und bedeutet „Vortrefflichkeit“.
Vortrefflichkeit bedeutet: exzellent, überragend, außergewöhnlich, erstklassig, ideal, perfekt, hochwertig, musterhaft, nacheifernswert, beispielgebend, fehlerlos, einwandfrei.
Eine Aussage bzw. die Bewertung und Einstufung der Bonität eines Unternehmens, ist somit ein Ausdruck über den Grad der Wertigkeit eines Unternehmens bezogen auf die 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit.
Ein Unternehmen mit geringer Bonität hat deswegen eine geringere Verlässlichkeit und ist damit weniger hochwertig bzw. weniger beispielgebend, bzw. nicht einwandfrei!
Ein Unternehmen mit sehr guter Bonität ist quasi ideal bzw. überragend in der Verlässlichkeit bei der Frage der Rückzahlung von (Förder-) Krediten.
Die Bonität ist also eine Aussage über die 1-Jahresausfallwahrschinlichkeit eines Unternehmens. Die Aussage dazu wird vor der Vergabe eines (Förder-) Kredites berechnet und ist mit der wichtigste Parameter, um (Förder-) Kredite zu erhalten
Es gibt dabei eine Bandbreite der Bonität von „nicht einwandfrei“ bis „überragend“.
Welche Auswirkung es hat, wenn ein Unternehmen „nicht einwandfrei“ eingestuft wird und wie ein Unternehmen bzw. die Finanzverantwortlichen die Bonität beeinflussen können, um auf der Bonitätsleiter weiter nach oben zu klettern (und damit eine „überragende Bonität“ erreichen), wird nachfolgend beleuchtet!
Wenn Sie tiefer in das Thema Kreditmanagement einsteigen wollen, dann empfehle ich Ihnen mein E-Book:
Wie Sie Kreditkündigungen für Ihr Unternehmen vermeiden, und so Ihre Zukunft sichern – Covenantsbruch verhindern
Erhältlich unter https://elopage.com/s/kaischimmelfeder
Autor Kai Schimmelfeder
Anzeichen dafür, dass ein Unternehmen in eine (Liquiditäts-) Krise „läuft“ oder sogar auf dem Weg der Insolvenz ist, sind oftmals schon Jahre vorab zu erkennen. Damit verschlechtert sich auch die Bonität und Investitionen können bzw. werden nicht mehr vorgenommen. Der Weg des Untergangs wird weiter beschritten – anstatt sich mit den (besseren) Förderprogrammen auf den Weg in Richtung (Erfolgs-)Gipfel zu machen.
Insolvenzen sind dabei nur die Spitze des Eisbergs, denn die Zahl der „Unternehmen in Schwierigkeiten“ ist wesentlich höher.
Die Medien bzw. die Beachtung der Öffentlichkeit ist fast immer „nur“ auf große Unternehmen gerichtet, die bereits in der Zahlungsunfähigkeit sind, oder öffentlich bekanntgeben, dass eine Zahlungsunfähigkeit „jetzt“ droht.
Daneben gibt es noch die Unternehmen, die die Liquiditätskrise und somit eine Veränderung der Bonität und somit die Veränderung der 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit „früh“ erkannt haben und versuchen gegenzusteuern. Diese Unternehmen befinden sich oft noch am Anfang der Liquiditätskrise und leiten (hoffentlich) die richtigen Maßnahmen ein, um wieder aus dieser Situation herauszukommen.
Bild: Verlauf von Unternehmenskrisen, Ableitung aus Quelle: IfUS, SRH Hochschule Heidelberg, IDW S6 n.F
Ein bedeutender Bereich ist der „Unentdeckte“. Das sind Unternehmen, die noch nicht erkannt haben, dass sie sich auf den Weg in eine Liquiditätskrise befinden. Hier wurde auch verkannt, dass sich die Bonität zunehmend verschlechtert.
Schlechte Bonität verringert die Möglichkeiten der öffentlichen Förderung.
Unternehmenslenker, die jetzt und somit frühzeitig eingreifen und noch in der Strategiekrise einen Wandel einleiten, schützen Ihre Bonität. Damit schützen sie auch das Unternehmen vor einem möglichen Marktaustritt und damit wird eine Verfestigung der Marktposition erreicht. Das wiederum erhöht die Bonität und senkt das Risiko einer Verschlechterung des Ratings (Bewertung eines Unternehmens, um eine Bonitätsaussage treffen zu können). Dies wiederum hat positive Auswirkungen auf die Aussage zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.
Merke: Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Parametern Investition, Liquidität und Bonität (als 1-Jahresausfallwahrschinlichkeit) und schafft damit eine Aussage zur Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Je besser die drei Parameter ausgestaltet sind, desto geringer ist der Unternehmensuntergang. Weiterhin kann man sagen (siehe EU-Kommission), dass die effizienteren und technologisch fortgeschrittenen Unternehmen zulasten derer, die weniger effizient arbeiten oder veraltete Produkte anbieten, Wachstum erzielen. Um aber wiederum Wachstum zu erzielen, benötigen Unternehmen die Möglichkeit zu investieren. Für Investitionen benötigen Unternehmen eine gute Bonität (Ergebnis der 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit), - denn Investitionen benötigen Finanzmittel wie zum Beispiel Förderkredite (neben dem Eigenkapital) oder andere öffentliche Förderprogramme (Zuschüsse, etc.)
2.3 MITTELSTAND-LIQUIDITÄT
Der Begriff „Liquidität“ beschreibt die Fähigkeit Ihres Unternehmens, jederzeit, fristgerecht und vollständig die aktuellen und zukünftig fälligen Rechnungen bezahlen zu können. Unterschieden werden grundsätzlich die Finanzliquidität und die Liquidität, die in Ihrem Vermögen „steckt“. Letztere Vermögensliquidität ist eigentlich nur dann wertvoll für Ihr Unternehmen, wenn Sie bei Bedarf den Vermögensgegenstand wieder verkaufen und damit die Liquidität im Unternehmen erhöhen. Das passiert zum Beispiel, wenn Sie eine wenig genutzte Maschine aus Ihrem Unternehmen verkaufen und das Geld aus dem Verkauf ins Unternehmen fließt.
Ihre Liquidität kann als gut bezeichnet werden, wenn sie immer ohne Probleme alle Rechnungen innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele bezahlen können und auch absehbar ist, dass das so bleibt. Dazu brauchen Sie eine Liquiditätsplanung!
Um dem „gefühlten“ Eindruck der „guten“ Liquidität aber auch einen kaufmännischen Wert zuzuschreiben, werden verschiedene Liquiditätsgrade für die Liquidität im Unternehmen genutzt bzw. durch Berechnungen ermittelt:
Bei den nachfolgenden Formeln ist es wie folgt und soll Ihnen einen einfachen Überblick für den täglichen Gebrauch verschaffen: Wenn der Wert „Q“ höher „1“ ist, dann sind alle kurzfristigen Verbindlichkeiten durch Ihre Liquidität bezahlbar.
Einige Unternehmen haben bei der Liquidität 1. Grades oftmals ein Ergebniswert von über 1 – also der Wert „Q“ ist dann über „1“. Das bedeutet, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten bzw. fälligen Rechnungen geringer sind oder aktuell nicht fällig (kommt auf den Tag der Betrachtung an). Der Wert über „1“ zeigt einen Liquiditätsüberschuss an. Der Wert unter „1“ bedeutet, dass Sie weniger Liquidität haben als an fälligen Zahlungen hätte da sein müssen. Das kann bei dauerhaftem Wert unter „1“ bedeutet, dass Sie eine sich verfestigende Liquiditätskrise haben. Dazu aber im weiteren Verlauf mehr.
Die Liquidität 2. Grades sollte auf jeden Fall über „1“ liegen: Hier fassen Sie die aktuellen freien Zahlungsmittel (Liquidität) und die kurzfristigen Forderungen gegen Ihre Kunden in einem Wert zusammen. Das sind dann Ihre schon vorhandenen liquiden Mittel (Zahlungsmittel Z) und die fälligen Beträge der Forderungen, die Sie gegen Ihre Kunden haben. Also wird zusammengefasst: Ihre Liquidität und die Geldbeträge aus den Kundenrechnungen, die noch nicht auf Ihrem Konto sind.
Eine Bemerkung hierzu von mir: offene Forderungen, die älter als 45 Tage (nicht bezahlt) sind, sind „eigentlich“ nur die Hälfte wert. Wenn Sie sogar Forderungen gegen Ihre Kunden haben, die älter als 90 Tage sind, können Sie diese in einem Bankgespräch nur noch sehr schwer als werthaltig darstellen. Es gibt Ausnahmen – aber sehr selten.
Bedeutet: Je später ein Kunde zahlt, desto höher die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls!
Ganz offengesagt: Für alle Rechnungen, die Ihr Unternehmen noch nicht bezahlt bekommen hat, „spielen“ Sie die „Bank“. Sie finanzieren den Kunden vor!
Warum sollte zum Beispiel eine Bank ihnen (zusätzliche) Liquidität gewähren, wenn Sie selbst nicht dafür sorgen, dass Ihre Kunden schneller die Rechnungen bezahlen?
Liquidität 1. Grades (Q)
Zahlungsmittel (Z) ---------------------------------- kurzfristige Verbindlichkeiten (KV)
Liquidität 2. Grades (Q)
Zahlungsmittel (Z) + kurzfristige Forderungen (KF) ---------------------------------------------------------------- kurzfristige Verbindlichkeiten (KV)
Liquidität 3. Grades (Q)
Umlaufvermögen (UV) ---------------------------------------- kurzfristige Verbindlichkeiten (KV)
Tabelle: Liquiditätsgrade
Einfluss auf Ihre Liquiditätsplanung haben verschiedene Einflussfaktoren. Sie als Geschäftsführer oder Unternehmer sind in der Pflicht und Verantwortung die Einflussfaktoren zu bedenken und umfassend zu agieren. Hier ist immer weiterzudenken, als eigentlich üblich. Es dient Ihrer Unternehmenssicherung!
Auch die immer wieder zu erkennenden unsicheren Rahmenbedingungen sind bei der Liquiditätsplanung weitestgehend zu „berücksichtigen“.
In der Praxis und im Gespräch mit Unternehmern höre ich immer wieder die Frage „Wie soll ich das den planen?“, „Das weiß ich doch heute noch nicht!“.
Bild: Einflussfaktoren im Thema Liquidität aus den Konjunkturzyklen, Quelle: VÖB
Und gerade das ist eine suboptimale Einstellung. Genau aus dieser Einstellung vieler Unternehmer sind Banken, oder Investoren, oder Förderbanken zögerlich. Wenn Sie als Unternehmer nicht umfassend planen, wie Ihre Liquidität ist und wird oder werden soll, UND dazu auch die Maßnahmen festlegen, dann kann es passieren, dass Sie böse überrascht werden. Dann zahlen Ihre Kunden später, die Bank gibt keine Überbrückung und andere Liquidität steht Ihnen nicht zur Verfügung.
Meine Frage an Sie: Was ist leichter: Sich „jetzt“ hinsetzen und planen und Maßnahmen einleiten und umsetzen, sodass immer genug Liquidität vorhanden ist?
Bild: Einflussfaktoren aufgrund unsicherer Rahmenbedingungen, Quelle: VÖB
Oder später sagen: „Wenn ich das gewusst hätte…“. Wir wissen alle nicht was morgen ist – aber wir müssen uns als Unternehmer soweit wie möglich dazu Gedanken machen. Dann müssen wir Maßnahmen einleiten, um das Unternehmen immer mit Liquidität versorgen zu können.
Um Sie aber nicht zu entmutigen, kann ich ihnen aus Erfahrung sagen: Finanz- und Wirtschaftskrisen haben Auswirkungen auf alle Unternehmen. Umso wichtiger ist für Sie als Unternehmer, dass Sie wissen, wo Sie stehen. Deswegen müssen Sie Ihre Liquiditätsplanung vorhalten. Nur dann können Sie verlässlich Entscheidungen treffen und Wachstumschancen ergreifen. Alle Unternehmenszahlen zusammen, sollten Ihnen eine Grundlage bieten, optimale Entscheidungen treffen zu können.





























