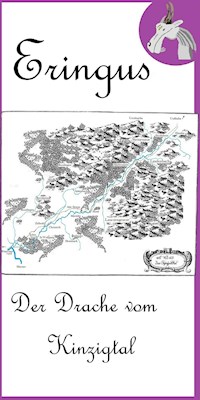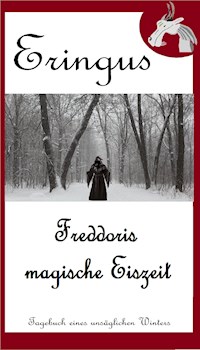
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Eringus
- Sprache: Deutsch
Das beschauliche Chynzychtal wird im Jahre 620 von dem Alben Freddori heimgesucht. Der Frühling hat noch nicht so recht begonnen, da überzieht der untote Magier die Welt mit einer magischen Eiszeit. Fortan verbreitet er Angst und Schrecken. Der ungewöhnliche Winter bringt Hunger und Elend über alle Bewohner. Zu bald schon sind die Vorräte der armen Bauern aufgebraucht. Die Menschen suchen Zuflucht im Kloster St. Wolfgang oder in der Zwergenfestung Steinenaue. Aber das Zusammenleben in großer Enge birgt hier wie dort auch enorme Schwierigkeiten. Die persönliche Not für Beata und Sigurd ist noch viel größer. Beatas Mutter, Magda, wurde auf ihrem Hof in Hosti von einem Mörder getötet. Der einzige Zeuge, der alte Halbling Frieder Knöterich, genannt Ob, ist sich letztlich gar nicht mehr so sicher, wen er da gesehen hat. Und Zwergenkönig Sigurd in der Festung bangt um seinen Thron. Da gibt es so eine sonderbare Prophezeiung. Zu allem Überfluss ist es dem Alben gelungen, Eringus, den Drachen, mit einem Überraschungsangriff gefangen zu setzen. Zusammen mit der Traumfee Jade, die versehentlich mit ihm gefangen wurde, sucht er nun den Weg in die Freiheit. Wird es ihnen gelingen oder muss doch wieder, wie vor über 800 Jahren, der Zwergengott Gabbro eingreifen? Woher sollte sonst Hilfe kommen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 713
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Seuring
Eringus - Freddoris magische Eiszeit
Tagebuch eines unsäglichen Winters
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Vorwort
Die letzten Jahre
Ein letzter Wille
Beata
Wahr gesagt?
Kleyberch – auf ewig geheimnisvoll und wundersam
Unwahr gesagt?
Ein großer Verlust
Schlimmer geht immer
Erste Maßnahmen
Das Tagebuch beginnt
Der Turmbau
Zum Ende des Winnemonats
Brachet
Heuert
Ernting
Scheiding bis Mitte Gilbhart
Ein Drache wird zum Tier
Eine unvergessliche Vermählung
Freddoris Freuden
Höchst edler Baumfäller
Wer ist denn Gilgoy ald Albitus ?
Eringus macht Schluss
Das neue Jahr
Zeit der Wunder
Impressum neobooks
Impressum
Texte und Umschlag: © Copyright by Rainer SeuringTitelbild: Collage auf der Basis des Bildes
Winter-Russia-City-Park von Pexels.com
Verlag: Rainer Seuring
Bulaustr.163450 [email protected]
www.derdracheeringus.jimdo.com
Für die Beratung bedanke ich mich bei den Fachleuten für Wetter und Natur, denen ich wesentliche Anregungen verdanke. Die magischen Kräfte des Alben aber waren stärker, als jegliche vernünftige Erklärung.
Vorwort
Heute werde ich Ihnen von einem unsäglich langen Winter von 300 Tagen berichten. Ich hör Sie schon rufen: „Das gab es doch gar nicht!“
Ihr Standpunkt ist nicht verkehrt und doch auch nicht richtig.
Natürlich stimmt es, dass kein Wissenschaftler von heute irgendwelche Anhaltspunkte dafür hat. Es war kein Vulkanausbruch, es war keine klimatische Störung, es war überhaupt nichts Natürliches, das solch einen Winter hervor gebracht hat.
Die Bäume von damals gibt es leider nicht mehr. In ihren Ringen hätte man den Beweis finden können. Die alten Dokumente geben auch nichts her. Keiner hat etwas verzeichnet; außer einem.
Schauen Sie doch einmal in Anton Pilgrams Untersuchungen über das Wahrscheinliche der Wetterkunde durch Vieljährige Beobachtungen oder lesen Sie auf Seite 154 in der Chronik der Seuchen in Verbindung mit den gleichzeitigen Vorgängen in der physischen Welt und in der Geschichte der Menschen von Friedrich Schnurrer. Sie beziehen sich auf Toaldo, der darüber schrieb. Mit diesem war eine meiner Vorfahrinnen näher bekannt, die ihm damals die ganzen Ereignisse berichtete. Und die muss es ja wissen, schließlich ist das das Wissen von Beata, der Urmutter von uns, den Drachenkindern. Sie hat es damals selbst erlebt.
Und weil dieser lange Winter nicht natürlich sondern magisch verursacht wurde, ist das heute nicht mehr nachweisbar.
Der Winter ist auf 620/621 n. Chr. datiert. Doch haben sich die Ereignisse schon lange zuvor angebahnt; nämlich bereits im Winter 618/619 n.Chr.
Aber lesen sie selbst.
Die letzten Jahre
Bevor die Geschichte erzählt wird, sei ein Blick in die Vergangenheit erlaubt. Es möchte vielleicht sein, der Zusammenhang ginge verloren.
Der Drache Eringus, Herr über das Chynzychtal vom Quell bis zur Mündung im Maynes, hat sein Problem bezüglich des Götterglaubens noch nicht lösen können. Die Begegnung mit dem Elben hat ihn zwar gezwungen, seine strikt verneinende Haltung aufzugeben, doch der logische Schluss daraus, dass es doch Götter geben muss, will ihm nicht gefallen. Seien es die jahrtausende alten Erfahrung seiner Vorfahren oder fehlende zwingende Beweise oder was auch immer. Irgendetwas sträubt sich in ihm zu sagen: Ja, Götter gibt es. Im Moment steht dem Drachen kein, in seinen Augen, kompetenter Gesprächspartner zur Verfügung. Also ist die Angelegenheit erst einmal zur Seite geschoben. Er hat Zeit und irgendwann wird ein weiteres Steinchen kommen, das er in das Mosaik des Wissens einbauen kann. Vielleicht sieht er dann klarer.
Seit Eringus durch Magda seine Herrschaft über das Flusstal zwischen Spechtshardt und Vogelsberch auch den hier lebenden Menschen deutlich gemacht hat, hat sich ein gewisses „normales“ Verhältnis entwickelt. Normal heißt: Man geht sich so gut es geht aus dem Weg. Die Menschen wissen um den Drachen und dass der Drache einem etwas tun kann, er aber bisher noch nichts gemacht hat und man nicht unbedingt zu ihm hin muss. Es hat sich aber auch ein Gefühl der Sicherheit entwickelt. Dieses Gefühl beruht aber wohl eher auf einem Missverständnis. Grundsätzlich hält sich Eringus aus den Angelegenheiten der Menschen heraus. Es kam allerdings sehr vereinzelt vor, dass er aus Neugier, während Streitigkeiten mit den Boiern im Spechtshardt, wohl versehentlich recht tief über die Menschen flog, was eben jene Boiern derart erschreckte, dass ihnen die Lust auf Streit verging. Aus Sicht der Menschen im Tal war dies natürlich sehr von Nutzen, obwohl für solch kriegerischen Beistand eher die Zwerge der Steinenaue zur Verfügung standen. Von denen später mehr.
Die Menschen, vor allem jene, die mit diesen Verhältnissen im Chynztal groß wurden, haben sich also an das Vorhandensein eines Drachen gewöhnt. Nicht oft wurde man seiner ansichtig, obwohl er doch 15 und einen halben Fuß hoch war. Zwischen den Baumriesen der damaligen Zeit war da aber immer noch gut, sich zu verstecken; auch bei solcher Größe. Kam man ihm dann doch einmal auf Rufweite nahe, so fiel man nicht mehr in Ohnmacht, so wie früher. Man grüßte artig ehrerbietig und ging seiner Wege. (Ein bedenkliches Gefühl, war wohl trotzdem immer mit dabei.)
Mit Halblingen und Zwergen kam man dann doch schon eher zurecht. Zwar konnte man nicht in die Dörfer der Halblinge, doch das sah man ein. Das Missverhältnis in den Größen zwang die Menschen einfach, draußen zu bleiben. Nur allzu leicht wäre an den kleinen Hütten der nur etwas über drei Fuß großen Wesen ein Schaden geschehen. Doch draußen auf dem Feld und im Wald sah man die Halben gerne. Immer gaben sie sachkundigen Rat. Stets gab es gute Ernten, wenn sich so ein kleiner Meistergärtner um Probleme kümmerte. Eifersüchtig wurden die Weisheiten der Halben im Chynzychtal gehütet. Die Erfolge in Ackerbau und Waldwirtschaft wollte man nicht mit anderen Bauern im weiteren Umland außerhalb des Tales teilen.
Auch mit den etwa einen Fuß größeren Zwergen gab es nur wenig Schwierigkeiten und falls doch, konnten die Zwerge solche Zwistigkeiten schnell beilegen. Sie waren halt die Stärkeren, aber davon machte man herzlich wenig Gebrauch. Dies war vom König verboten und man hielt sich daran, soweit möglich. Mancher Halbwüchsige unter den Menschen musste ab und an doch mal sein Mütchen kühlen. Blaue Flecke und schmerzende Knochen aber waren gute Lehrmeister. Das gab es sogar schon, als die Zwerge vor sehr langer Zeit noch von einem Großkönig regiert wurden und das gemeinsame Reich bis weit über den Wettergau hinaus reichte.
Untereinander hat sich bei den Menschen nichts geändert. Mord und Totschlag, Lug und Trug, Raub und Habgier waren nicht aus der Welt. Man kümmerte sich einen Dreck um die große Weltpolitik, das war Sache des Königs Chlothar II. Selbst die hier ansässigen Grafen hielten sich da möglichst heraus.
Graf Guntbert von Lanczengeseze verstarb ja leider schon im Jahre 601 an einer schweren Lungenerkrankung, die niemand zu heilen vermochte.
Von seinem Weib, der Gräfin Hildgard, ward seit der Flucht vor dem Scheiterhaufen nichts mehr vernommen. Zwar munkelt man, sie sei nach wie vor in der Nähe ihres Sohnes Hermann, doch gefunden hat man sie nicht. Vielleicht ist die vermeintliche Nähe doch wohl etwas weiter.
Graf Buodo ist leider auch nicht mehr unter den Lebenden. Verstorben ist er ohne fremdes Zutun, doch unter Umständen, die wenig ehrbar scheinen. Lästermäuler äußern hinter vorgehaltener Hand, er habe sich zu Tode gesoffen, weil er nach Guntberts Ableben für zweie trank. Ohnmächtig musste seine Familie diese Entwicklung mit ansehen. Sein Sohn hat das Erbe angetreten und obwohl dieser mit Hermann viel Zeit der Jugend verbrachte, herrscht nicht ein ähnliches Verhältnis, wie zwischen den Vätern. Die Beziehungen der jungen Grafen sind ein wenig eingeschlafen.
Hermann ist jetzt Herr auf Lanczengeseze. Sein Weib, eine ehemalige Küchenmagd aus Buodingen, hat ihm zwei Kinder geschenkt. Ein Mägdelein, noch zu Lebzeiten Guntberts, und einen Knaben zwei Jahre später. Dieser verstarb leider, bevor er noch ein Jahr alt war. Er hat des Nachts einfach aufgehört zu atmen. Danach hat es für die Gräfin nicht mehr sein sollen, ein Kind zu empfangen. Seit jener Zeit wird die Tochter von ihrem Vater sehr männlich erzogen und ihr ganzes Wesen hat mit der Zeit das Weibliche innen wie außen abgelegt.
Von örtlich größerer Bedeutung aber ist die Entwicklung Magdas zu nennen. Zusammen mit Karl, ihrem, von Zwergenkönig Sigurd angetrauten, Gemahl, hat sie sich zunächst auf dem kleinen Gut, das ihr von Hermann als Wiedergutmachung für erlittene Notzucht überlassen wurde, nieder gelassen. Schon im folgenden Jahr kamen die Zwillingsknaben Odo und Rudwin zur Welt. Es folgten Magnus und Markward drei Jahre später. Bis dahin konnten Karl und Magda ihr Vieh prächtig vermehren. Weil viele Menschen sich nicht in den Berg zu den Zwergen trauten, wickelte vornehmlich Magda die meisten Geschäfte für die Grafen und freien Bauern ab, die sich solch teure Anschaffungen leisten konnten. Die metallenen Ackergeräte waren begehrt, denn sie waren weitaus haltbarer als das, was die Menschen selbst herstellen konnten. Solchen Handel ließ sich Magda gut entlohnen. Ebenso vermittelte sie Gespräche mit den Halblingen, war sie doch, abgesehen von ihrer ersten Tochter Beata, die Einzige, die ein Halblingsdorf betreten konnte und durfte.
Auch aus den zunehmenden Händlerzügen auf der Straße zogen die Beiden großen Gewinn. Gerne hielt man Einkehr in Magdas Schenke oder nahm sogar Herberge des Nachts. Weit über die Grenzen des Chynzychtals schon reichte der gute Ruf, den sich Karl und Magda verdienten. Sie wurden so vermögend, dass sie weiteren Grund hinzu erwerben und nun eine ganze Hufe ihr Eigen nennen konnten. Vor zwei Jahren dann starb Karl bei einem Unfall. Eine grobe Unachtsamkeit beim Baumfällen kostete ihn das Leben. So lernte die kleine Methildis nie ihren Vater kennen, als sie vier Monate später das Licht der Welt erblickte. Mit Hilfe der großen Jungen konnte Magda ihr Gut erhalten. Not kannte die Familie nicht.
Auch wenn der Umgang mit Eringus im Laufe der Zeit stets geringer wurde, verblieb ihr doch der Ruf der Botschafterin, den sie sich einst in Lanczengeseze erworben hatte. Ihre Kinder gehen mit dem Drachen so um, wie alle anderen auch. Sie hören zwar gerne die Geschichten, die ihre Mutter von dieser Zeit zu erzählen weiß, doch eine besondere Beziehung zu Eringus entsteht dadurch nicht. Aber stolz sind sie alle auf ihre Mutter. Sie war und ist nun mal etwas Besonderes.
Natürlich sind die vergangenen Jahre nicht spurlos an ihr vorüber gegangen. Nicht nur die Schwangerschaften haben ihr Äußeres verändert, auch die schwere Arbeit trug ein gutes Stück dazu bei. Heute ist sie deutlich fülliger aber auch weiblicher als früher. Das Haar ist grau geworden, der Rücken macht zunehmend Probleme. Sie ist nicht mehr ganz so gewandt, doch wen wundert das. Trotzdem wagt es keiner, sich mit ihr anzulegen. Ihr Kampfstock ist ihr ständiger Begleiter und sie weiß ihn immer noch gut zu nutzen. Sogar einen Bären hat sie damit in die Flucht gejagt. Ein sehr derber Hieb auf die Schnauze war für das Tier so unangenehm, dass es lieber das Weite suchte. Kein Wunder, übt sie doch täglich, so wie es ihr von Melisande beigebracht worden ist. Schon viele Bäume hat sie mit ihrem Stock als vermeintliche Angreifer geschlagen. Und bei der Baumobsternte ist so ein langer Stab stets ein gutes Hilfsmittel. Der morgendliche Rundlauf um das Gut dauert zwar immer länger, doch wird Magda nicht müde, auch diese Übung täglich fort zu führen.
Beata ist auch etwas Besonderes für ihre Halbgeschwister. Nicht nur, weil sie von einem anderen Vater stammt und unter gewaltsamen Umständen gezeugt wurde. Nicht nur, weil sie von einem Drachen beatmet und ins Leben geholt oder weil sie von einer Zwergenamme gesäugt wurde, während Magda doch die weiteren Kinder später selbst stillen konnte. Und auch nicht nur, weil sie eigentlich immer nur ab und an zu Besuch kam und ansonsten dort lebte, wo sie gerade lernte. Nein, es war ihr ganzes Wesen, das sie vollständig verschieden machte. Doch das Wichtigste: Man hatte sich trotzdem lieb, denn ein innigliches Band der Zusammengehörigkeit erfüllte alle. Jeder Besuch von ihr war eine große Freude.
Wer an dieser Stelle auf gar keinen Fall vergessen werden darf ist Ob; Verzeihung Frieder. Für einen Halbling ist er jetzt schon als ein alter Mann zu bezeichnen. Tiefe Falten haben sich in sein wettergegerbtes Gesicht gegraben. Seine Zähne sind schlecht geworden, die Haare sind ausgefallen. Langsam werden die Augen trüb, doch der Geist ist wach geblieben. Seit Magda ihn damals aus seiner geistigen Umnachtung heraus geholt hat, hat er sein Lieblingswort >Ob< nur noch zum Spaß und stark betont benutzt. „Ob eine Amsel auch ein fliegender Fisch ist, gleich einer Ente?“, fragte er einmal in Anspielung auf die merkwürdigen Auslegungen der Fastenregeln der Mönche in St. Wolfgang. Dort vertrat man die Meinung, Vögel und Fische stünden gleich, denn sie wurden von Gott am gleichen Tag erschaffen. Also sei es erlaubt, zu Fastenzeiten nicht nur Fisch, sondern auch Geflügel zu verspeisen. „Ob ich mir eine Bestattung durch den Leichenschmaus sparen kann?“, war wohl die unmöglichste Frage, die er jemals stellte und letztens, als ihm wieder einmal schmerzlich sein Alter bewusst wurde, fragte er: „Ob für mich die Zeit langsamer verging, weil ich mich schneller bewegte?“. Bedauernd musste er nämlich einsehen, dass er Magda bei ihren Läufen nicht mehr begleiten konnte, wo es ihm doch früher ein Leichtes war, der Frau davon zu laufen.
Treulich hat er Magda und Karl in allen Lebenslagen beigestanden. Dank ihm waren die Ernten der beiden die Besten weit und breit. Mit seiner natürlichen Begabung hat er für jedes Pflänzlein ein glückliches Händchen. Für die Kinder war er allein schon durch seine körperliche Größe der Spielkamerad schlechthin und als diese größer wurden, übernahm er gerne die Rolle des Vertrauten und Freundes genauso gut wie er Lehrer sein konnte.
Zu seiner Familie im Dorf Lindenbach ist er nicht wieder zurückgekehrt. Nach der Teilung und der Gründung von Erlenbusch war allen klar, dass seine Aufgaben im Leben andernorts lägen. Irgendwie war der monatliche Zauber auch davon überzeugt, Frieder sei kein Mitglied der Gemeinde mehr und funktionierte weiterhin. Auch wenn er an dieser Zeremonie nicht mehr teilnahm. Natürlich war er öfters dort zu Besuch, auch wenn die Anlässe nicht immer fröhlich waren, wie bei der Beisetzung von Linda Malve, welche nur kurz nach ihrem Gatten Adalbert Eichenlaub verstarb.
Weitere besonders berichtenswerte Ereignisse gab es bei den Halblingen nicht. Das unscheinbarste, doch allgegenwärtigste Völkchen ging seiner ihm zugedachten Aufgabe nach und kümmerte sich nach wie vor äußerst liebevoll und verständig um Baum und Strauch, Kraut und Rübe. Allerdings waren die Arbeiten etwas umfangreicher geworden, benötigten die Bauern doch jede Menge Unterstützung und Belehrung, was Ackerbau und Waldwirtschaft anging. Ansonsten war ein Jahr wie das andere. In absoluter Regelmäßigkeit wurden die Monatsfeste gefeiert. Manch einer würde es als eintönig beschreiben, doch die Halben waren es zufrieden.
Bei den Zwergen war der schmerzlichste Verlust Melisande, die Mutter König Sigurds. Im letzten Winter ist sie noch vor dem Julfest friedlich eingeschlafen. In einer denkwürdigen Zeremonie wurde sie in der Familiengruft tief im Berg bestattet. Rombold Steinschloß war nun der Älteste in der Festung.
Die einschneidendste Veränderung hingegen war der Zuzug der Zwerge aus Kleyberch. Eringus hatte diese echten Überlebenden des großen Krieges ja rein zufällig bei einem Ausflug gefunden und kämpft seither damit, die Umstände des Überlebens in eine vernünftige Logik zu betten. Jade, die Traumfee, drängt ihn zwar bei jeder passenden Gelegenheit, dies als ein göttliches Werk und sich (also Eringus) als göttliches Werkzeug zu akzeptieren, da entsprechend einer Weissagung, wenn man dies so nennen will, die Zusammenführung der Zwerge geschah, aber so schnell ändert ein Drache nicht seinen Standpunkt. Nicht ohne absolut felsenfeste Beweise.
Wie zu erwarten war, wurden die Kleyberch-Zwerge allesamt tief getroffen als sie erfuhren, dass ein jeder von ihnen weit über 800 Jahre alt ist. Monate vor der großen Schlacht war die Festung Kleyberch Ziel eines Angriffs der Alben und ihrer Schergen. Keiner überlebte, außer ihnen. Sie fielen in einen geheimnisvollen Schlaf, aus dem sie erst im Jahre 591 wieder erwachten. Sie sehen sich bis heute nicht in der Lage, dies anders als mit göttlichem Wirken zu erklären. Gemeinsam mit den Zwergen der Steinenaue werden regelmäßig Dankesfeiern zu Ehren Gabbros, dem Zwergengott, abgehalten.
Bis der Umzug nach Steinenaue erfolgte, vergingen aber noch vier Jahre. Jahre, in denen der Kontakt zueinander immer mehr verstärkt wurde. Dankwart Hammerfest, der Anführer, kam immer öfters her, um sich und die anderen Zwerge mit dem Wissen der Neuzeit zu versorgen. Aufmerksam studierte man das Buch Utz wider die Alben und arbeitete das Geschehene nach und nach auf. Oft begleitete ihn sein „Findelkind“ Anschild Kleyberch, dem einzigen Zwerg, von dessen Herkunft keiner etwas wusste und den Dankwart unvermittelt vor dem tiefen Schlaf in den Arm gedrückt bekam. Dieser war nun ein stattlicher junger Mann von inzwischen 30 Jahren, der offensichtlich großen Gefallen an Prinzessin Carissima, König Sigurds Tochter, gefunden hat.
Es gab teilweise ganz gewaltige Unterschiede in der Lebensweise zwischen den Kleyberchern und den Steinenauern. Die Überlebenden lebten nach der Weise, wie sie vor über 800 Jahren üblich und vom Großkönig vorgeschrieben war. Viele Diskussionen wurden geführt, bei denen sich die Königsmutter Melisande stark auf die Seite der Kleybercher stellte. Sehr zum Leidwesen ihres Sohnes, welcher massiv die moderne Lebensweise verteidigte. Da die Kleybercher sich einfügen wollten, wurde so mancher Kompromiss zu ihrem Nachteil geschlossen. Diese Absprachen sollten aber nicht von langem Bestand sein.
Auch der Ortswechsel selbst zog sich leidlich in die Länge, schließlich ging es nicht nur darum, ein paar Gewänder zu packen und los zu stiefeln. Alles Großvieh musste die weite Strecke getrieben werden, während das Federvieh, in Käfige oder Körbe verladen, auf Wagen transportiert werden konnte. Die Vorräte, in Sack oder Kiste oder gebündelt, wurden auf gleiche Weise nach Steinenaue geschafft. Auch wenn es nur 145 Zwerge waren, die auf Wanderschaft gingen, so war der Tross trotzdem gewaltig und musste geteilt werden. Die schnelleren Wagen waren nach wenigen Tagen angekommen. Der Viehtrieb aber dauerte doch deutlich länger.
König Sigurd war selbst in Kleyberch dabei, als nach dem Auszug die Steinenauer ihre Neugier befriedigen und schauen mussten, wie man so in einer fast völlig zerstörten Festung hausen konnte. Das Erstaunen war groß als man erkannte, wie viel Platz durch Gabbros Vorsehung eingeräumt worden war. Doch die Überraschung der Kleybercher war noch weitaus größer, nachdem weitere ihnen unbekannte Hallen entdeckt und geöffnet werden konnten. Unter anderem fand man die Halle der Lehren und Historie, wie der Eingangstür entnommen werden konnte. Der Zugang war durch herabgestürzte Felsbrocken nur gering versperrt. Die Kleybercher waren sich absolut sicher, auch an dieser Stelle ihre Behausung erforscht und keinen Zugang gefunden zu haben. Die Geschehnisse in und um Kleyberch wurden immer geheimnisvoller. Die Freude über den Fund in der Halle war sehr groß. In Eisenbach, der Festung des letzten Großkönigs Manegold Schmiedehammer, befand sich die große Bibliothek der Zwerge, mit allen Büchern und Schriftrollen über die Vorgeschichte der Zwerge, ihrer Herkunft und Wanderschaften. Alles, was die Geschichtsschreiber festhalten sollten oder wollten, Regeln und Vorschriften und Gesetze, aber auch Rezepte und Handwerksgrundlagen. Die ältesten Aufzeichnungen waren sogar noch auf Stein gemeißelt. Diese waren allesamt durch die Explosion im großen Krieg verloren gegangen. Nun aber zeigte sich, dass eben jener Großkönig wohl viele Schreiberlinge eingesetzt hatte, um Abschriften fertigen zu lassen. Es fand sich auch das Buch der Weissagungen von Gilbret Steinschleifer, dem Seher von der Höch. All diese Bücher wurden damals nach Kleyberch geschafft, wo sie nun gefunden werden konnten. Warum ausgerechnet nach Kleyberch, einem der kleinsten Vorposten, und nicht in eine größere und sichere Zwergenburg ist unklar. Auch darin vermutet man Gabbros großen Plan für sein Volk. (Eringus hat darob nur den Kopf geschüttelt. Es ist allzu leicht, alles als göttliches Wirken zu bezeichnen, meint er. Man braucht nicht nach einem vernünftigen Grund suchen, um es zu erklären.)
Der Fund dieser Schriften führte jedoch dazu, dass die zuvor geschlossenen Kompromisse hinfällig waren. Nun lagen die klaren Verhaltensmaßgaben des letzten Großkönigs vor und diese Anordnungen behalten solange Gültigkeit, bis sie von einem anderen Großkönig aufgehoben werden. Sehr zu König Sigurds Missfallen fand sich unter anderem auch tatsächlich eine Vorschrift über körperlichen Ertüchtigungen, deren sich ein wehrfähiger Zwerg zu befleißigen hat. Die darin geschilderten Aufgaben waren noch deutlich höher in der Anforderung als das, was Melisande seinerzeit als Prüfung für Magda erfunden hatte. Nicht nur König Sigurd stöhnte. Es zeigte sich sehr schnell, dass die Kleybercher in kämpferischer Hinsicht den Zwergen der Steinenaue weit überlegen waren. Sie lebten nach diesen Vorschriften und waren deshalb im Vorteil. Es gab den einen oder anderen Steinenauer Zwerg, der sich wünschte, die Kleybercher wären nie auf der Bildfläche erschienen. Es war anstrengend, nach alten Vorschriften zu leben.
Bis heute wurden zwar noch einige Untersuchungen in Kleyberch vorgenommen, doch gefunden wurde nichts mehr.
Bei der Aufzeichnung der Kleybercher Zwerge in die Namenslisten der Steinenaue stellte sich heraus, dass in keinem Fall eine verwandtschaftliche Beziehung nachzuweisen ist. Dies hätte auch durchaus zu größten Komplikationen führen können. Man stelle sich vor, man stehe überraschender Weise vor demjenigen oder derjenigen, die vor Jahrhunderten die eigene Großmutter oder den Großvater gezeugt hätte und eben dieser Urahn wäre, wegen des langen Schlafes, dann auch noch jünger als man selbst. Ein schier unvorstellbares, aber absolut nicht unmögliches Ereignis. Doch, wie gesagt, man fand keinerlei familiäre Bande. Das hatte aber für Rombold Steinschloß die unangenehme Wirkung, dass er der Letzte seiner Familie blieb.
Zwischen 607 und 610 hatte König Sigurd mehr Vermählungen vorzunehmen, als die letzten 200 Jahre zusammen geschlossen worden waren. Das „frische Blut“, der Kleybercher wurde sehr gerne aufgenommen. Dabei machte der geringe Altersunterschied von über 800 Jahren keine Probleme, war diese Zeit doch verschlafen worden und weder Körper noch Geist gealtert.
Jetzt gilt es nur noch ein paar Worte über die kleine Traumfee Jade zu verlieren. Es ist wirklich nicht viel. Sie freut sich ihres Lebens, ist kein bisschen vernünftiger geworden und liebt es, Eringus mit allem, was mit Göttern zu tun hat, zu ärgern. Im Übrigen geht sie ihrer gegebenen Aufgabe nach und schenkt den Menschen hier und da schöne Träume. In letzter Zeit allerdings ist sie doch etwas stärker abgelenkt und nicht nur geistig abwesend. Sie ist schwirrig, wie sie selbst es nennt und sucht einen Partner zwecks Vermehrung. Nachdem sie aber bis dato noch keine andere Traumfee getroffen hat ist die Aussicht, eine männliche Variante dieses Völkchens zu finden, verschwindend gering. Das lässt sie aber nicht verzweifeln. Irgendwann wird schon einer kommen, meint sie.
Ein letzter Wille
Anfang des Jahres 619, kämpft sich eine dick vermummte Person zu Pferd durch den Tiefschnee auf der Straße gen Franconovurd. Mit jedem Schritt sackt das Tier bis weit über die Knöchel mit vernehmlich knirschendem Geräusch ein. Die Schnauze des Pferdes ist vereist, denn jedes Schnauben gefriert augenblicklich vor dem Maul. Aus den grauen tiefhängenden Wolken fällt immer noch Schnee in dicken Flocken. Außer dem Knirschen des Schnees hört man bestenfalls noch ab und an das Knacken der vereisten, unter der schweren Last tief hängenden Äste, wenn sich ein Batzen der weißen Pracht nicht mehr darauf halten kann und mit einem dumpfen Plumps mit dem Neuschnee vereint. Die Person muss schon geraume Zeit unterwegs sein, denn man könnte durchaus meinen, ein Schneemann säße auf dem Ross. Nur sehr langsam geht es voran.
Dort, wo sich der Weg nach Westen wendet, verließ man vor geraumer Zeit die Straße und bog in Richtung der alten Römerbrücke, die Eringus seinerzeit nicht zerstört hat. Doch so weit soll die Reise nicht gehen. Auf halbem Wege geben die dicht fallenden Schneeflocken den Blick auf ein Gehöft frei. Hoch liegt der Schnee auf den Dächern der Gebäude, obwohl die starke Neigung dies eigentlich verhindern sollte. Der nächtliche Frost ließ die Schneemassen fest frieren und der Neuschnee kann sich ungehindert darauf sammeln und festsetzen. Nur mäßig ist der Weg zwischen den Häusern frei gelegt. Hier, nahe dem Maynes, hat sich vor Jahren Ewic, der Franke, nieder gelassen. Diesseits des Flusses liegt der Flecken Ewicheim. Drüben, auf der anderen Flussseite befindet sich das große Anwesen mit der Siedlung, die den gleichen Namen trägt. Jetzt, im Winter, ist nur wenig Gesinde auf dieser Seite, um auf den Hof zu achten und das Vieh zu versorgen, das im Stall steht.
Als der Reiter auf das Hauptgebäude zureitet, öffnet sich die Tür und ein Knecht kommt heraus, beim Absteigen zu helfen. Steif gefroren rutscht die Person vom Rücken des Pferdes herab, klopft sich den Schnee ab, dankt knapp mit leiser Stimme für die Hilfe und huscht ins Haus.
Drinnen wartet bereits eine Magd, beim Entkleiden zu helfen. Aus den Gewändern schält sich eine junge Frau, mit auffällig kurz geschorenem, leicht dunkelrötlichem Haar. Das Einzige, das sie von ihrem Vater geerbt hat. Die restliche Erscheinung ist ganz die Mutter, wie man schon damals gerne zu behaupten pflegte. Als zuletzt der dicke Mantel aus gestauchter Wolle abgelegt ist, sagt die Magd:
„Es ist gut, dass ihr es noch rechtzeitig geschafft habt, junge Herrin. Wir befürchten, sie wird den Tag wohl nicht überleben. Sie bekommt kaum noch Luft und das Fieber lässt sich nicht mehr senken. Gar fürchterlich ist zu hören, was sie im Fieberwahn so spricht. Von Mord und Rache und all so weiter.“
„Was ihr auch hört, redet nicht darüber. Mag sein, einer versteht es falsch und schadet eurem Herrn. Wie schnell kommt dummes Gerede auf. Habt ihr verstanden?“, verlangt die junge Frau bestimmt.
„Jawohl, junge Herrin.“ Man sieht der Magd an, wie gerne sie solche spannenden Phantasien hätte weiter tratschen wollen. Doch fürchtet sie mehr noch die Strafe, die sie von ihrem Herren dann zu erwarten hätte. Man darf also hoffen, dass sie Stillschweigen bewahren wird.
„So will ich denn eilen zu hören, was sie noch auf dem Herzen hat.“, fährt die junge Frau fort. Nichts, oder richtiger gesagt, fast nichts an ihrer Gewandung zeugt von ihrem hohen Stande. Nur wenig Stickerei ziert die Ärmel. Der Kälte geschuldet kleidete sich damals der Herr gleich dem Knecht. Außer der Kochstelle in der Küche gab es meist nur noch ein Feuer in der Kammer, in der die Herrin sich aufzuhalten pflegte. Drinnen wie draußen musste man sich also vor der Kälte schützen. „Wartet hier, bis ich euch rufe.“
Danach verschwindet sie durch die Tür in einen angrenzenden Raum. Auch in dieser Kammer ist es fast so kalt wie im Freien. Auf dem Lager unter vielen dicken Decken sitzt eine eingefallene alte Frau mit schlohweißen Haaren, den Rücken mit Polstern gestützt, mehr als dass sie liegt. Strähnig hängen die verschwitzten Haare in das fiebrig glänzende Gesicht. Die Augen sind geschlossen und man möchte meinen, die Frau schlafe. Wenn dem der Fall war, so wird sie jetzt sehr unsanft durch einen fürchterlichen Hustanfall geweckt. Unfähig, sich unter den vielen Decken zu bewegen, muss die Alte das Ausgehustete wieder schlucken. Oftmals aber ist es wohl einfach nur auf der Decke gelandet, wie viele Flecken bezeugen. Langsam beruhigt sich der gebeutelte Körper wieder. Nur sehr flach atmete das Weib, denn jeder Luftzug bereitet schier unerträgliche Schmerzen. Nun bemerkt sie ihren Besuch und die junge Frau beeilte sich, näher heran zu treten. Sie weiß, dass ihre Großmutter nur noch flüstern kann. Mit Trauer und Mitleid muss sie erkennen, wie schnell ein Mensch mit solcher Krankheit verfallen kann. Dies ist nur noch ein Wrack statt der stolzen Frau von einst. Wie gerne hat sie den Erzählungen längst vergangener Tage gelauscht. Mit ihr gelitten wegen der Schmach, die ihr widerfahren war und an der ihr eigener Vater seinen Teil hatte. Zwar hat sie nie auch den Hass geteilt, den die Großmutter gegenüber der Frau hegt, die sie für schuldig an allem hält, doch fühlt sie wohl eine gewisse Wut. Wie konnte man sich nur so verhalten. Sicher war das eine Hexe, die allesamt nach ihrem Willen beeinflusste.
Das Flüstern der Alten beendete ihre Gedanken.
„Es ist gut, dass du gekommen bist.“
Schwer kommen die Worte über die Lippen. Bei jedem Atemzug rasselt die Lunge. Die junge Frau ist so dicht am Mund, dass sie das Geräusch wohl vernimmt.
„Ich habe zuhause gelogen, um hierher kommen zu können. Man glaubt mich bei den Mönchen.“
Automatisch flüstert sie auch, als würden laute Worte von ihr der Kranken weitere Schmerzen bereiten. Nur leicht legt sie die Hand auf die Brust der Großmutter, um sie gleich darauf wieder weg zu ziehen, weil erneuter Husten quält.
Als der Körper wieder zur Ruhe kommt, beginnt die Alte erneut.
„Lebt das Weib mit ihren Plagen noch auf meinem Grund?“
Die Enkelin weiß, von wem die Rede ist. Und antwortet: „Ja, seit eh und je.“
„So hat der Mistkerl seinen Auftrag nicht erfüllt. Verflucht soll er sein. Ich brauche deine Hilfe. Du musst mir etwas versprechen.“
„Ich tue, was in meiner Macht steht, wenn es dich erfreut, Großmutter.“
„Geh zur Truhe in der Ecke dort.“
Gehorsam wendet sich die junge Frau zur Truhe, doch als sie nach nur wenigen Schritten dort anlangt, ist das alte Weib wieder leicht eingeschlafen. Neugierig hebt sie den Deckel. Auf alten inzwischen schäbigen Gewändern liegt ein Pfeil. Aufmerksam prüft sie die Befiederung, die ihr völlig fremd ist. Ein derartiger Pfeil ist hier in der Gegend nicht gebräuchlich. Die Enkelin nimmt das Geschoss und tritt wieder zur Großmutter, die im Traum unverständlich vor sich hin brabbelt. Sanft weckte sie sie.
„Ich habe den Pfeil, Großmutter. Was ist damit?“
„Pfeil? Ach ja. Schon einmal gab ich einen Pfeil, dies Weib zu töten, deren Namen auszusprechen mir ein Gräuel ist. Aber ach, keine Kunde kam zu mir, die mich erfreut hätte. So musst du meinen letzten Willen erfüllen.“
Zu dem Rasseln in der Lunge kommt nun auch noch vor Erregung ein Pfeifen beim Atmen dazu. Der folgende Husten fördert neben Eiter jetzt auch schon hellrotes Blut hervor, das aus den Mundwinkeln läuft. Eiligst nimmt die junge Frau das nächstbeste Tuch, den Mund abzuwischen. Es ist schon lange nicht mehr sauber und angewidert wischt sie ihre Hand am Bettzeug ab.
„Du musst dies Weib für mich töten, sonst find ich im Tode keine Ruhe. Du musst es für mich tun. Versprich es mir.“
Das Flüstern ist deutlich drängend und fordernd.
„Aber Großmutter!“, versucht die junge Frau zu widersprechen, doch schon wieder wird die Alte vom Husten schier zerrissen. Mehr Blut kommt hervor, das nicht mehr weg gewischt wird. Es macht das eingefallene Gesicht zu einer widerlichen hässlichen Fratze.
„Du musst, versprich es!“
Mit aller Kraft, die noch im Körper steckt, sind diese Worte fast verzweifelt geschrien worden. Zumindest lag der Versuch dahinter. Die Schwäche und die fehlende Luft in der Lunge bringt aber nur ein drängendes halblautes Gurgeln hervor.
„Ich verspreche es, ich verspreche es.“, beschwichtigt die Enkelin. Völlig überfordert und verängstigt willigt sie ein. Es ist das erste Mal, dass sie beim Sterben eines alten Menschen dabei ist.
Noch ein kurzes Aufbäumen im letzten Husten und leblos fällt der Körper auf das Lager zurück. Das Gesicht im Krampf erstarrt, die Augen weit aufgerissen. Augenblicklich stürmt die Magd in das Zimmer, auch wenn man sie nicht gerufen hat. Nach kurzem Blick auf die Verstorbene zieht sie die oberste Decke über deren Gesicht, dessen weiteren Anblick der jungen Frau zu ersparen.
„Kommt, junge Herrin. Hier ist nichts mehr für euch zu tun. Eure Großmutter lebt nicht mehr.“
Es ist überaus schockierend, die letzten Momente der Großmutter und deren Todeskampf miterleben zu müssen. Bis ins Mark getroffen ist die Enkelin. Willig, weil immer noch in den letzten Augenblicken verhangen, lässt sich die junge Frau hinaus führen. Selbst als sie schon wieder auf ihrem Pferd sitzt, hallen noch die fordernden Worte der Großmutter in ihr nach: „Du musst …“
* * * * *
In dem darauf folgenden Frühjahr muss Beata feststellen, dass ihre Platzwahl für den Bau eines Hauses falsch ist. Das Schmelzwasser überspült weite Teile der Bule. Zusammen mit den Halblingen von Erlenbusch und den Zwergen trifft sie entsprechende Vorsorge, im nächsten Hochwasser nicht zu ersaufen.
Keiner kann zu dieser Zeit irgendwelche Geschehnisse mit jener schwarzen Gestalt in Verbindung bringen, die, noch weit im Osten, die Arme gen Himmel erhebt, um Eis und Schnee zu beschwören und sich dann gemächlich auf den Weg ins Chynzychtal macht. Die Zwerge sollen unendlich leiden dafür, dass sie sich anmaßten, ihm und seinen Genossen Einhalt geboten zu haben. Dieses Mal würde ihnen ihr Gott nicht helfen können. Er würde gar fürchterliche Rache nehmen und dabei seine tiefsten Gelüste befriedigen.
Beata
Beata ist in diesem Winter 18 Jahre alt geworden. Ihre körperliche Entwicklung verlief zunächst deutlich schneller, als bei normalen Menschen. Sie war ihrem Alter weit voraus, wenn man so sagen darf. Kaum dass sie ein Jahr alt war, konnte sie bereits laufen und sprechen und verfügte über einen über die Maßen wachen und verständigen Geist. Schon mit zwölf sah sie so aus, wie heute, eine sehr ansehnliche junge Frau. Seitdem scheint ihr Körper sich nicht weiter verändern zu wollen.
Sie ist fünf Fuß und eine Handspanne groß. Ihr Haar ist am Ansatz nachtschwarz, wird zu den Spitzen hin flammend rot und fällt halblang, ohne jegliche Welle darin, auf die Schulter. Es wächst nur noch sehr langsam, fast zwergisch langsam. Beata hat es zu einem Pferdeschwanz zusammen gefasst. Unter den schmalen Brauen blicken rehbraune Augen, an einer langen und dünnen Nase vorbei, äußerst aufmerksam ins Leben. Ebenmäßige Zähne hinter vollen Lippen strahlen bei jedem Lächeln aus dem schlanken, oval gestreckten Gesicht. Anders als ihre Mutter in diesem Alter ist Beata mehr als ausgiebig gerundet an Busen und Po, mit einer wespenartigen Taille. Trotzdem macht der körperliche Gesamteindruck deutlich, dass diese junge Frau vor Kraft nur so strotzt. Sie wiegt etwa 150 Pfund, doch ist man geneigt, sie leichter einzuschätzen. Ihre Stimme ist warm, mit einem leicht dunklen Ton.
Nachdem Beata von ihrer Zwergenamme entwöhnt war, lebte sie mit ihren Eltern auf dem kleinen Gut nahe Hosti. Mit großer Vorliebe war sie mit ihrer Mutter zusammen und beobachtete, was und wie diese etwas verrichtete. Schnell hatte sie erkannt, dass ihre Mutter mit ihren vielfältigeren Aufgaben ihr mehr zeigen konnte, als Karl. In der Regel dauerte es dann nicht lange und sie vollführte in kindlicher Weise spielerisch vergleichbare Tätigkeiten. Frieder half ihr ein wenig dabei und fertigte beispielsweise kleine Strohpüppchen und hölzerne Gerätschaften, mit denen Beata dann ihre Mutter nachahmte. Mit einem kleinen Hämmerchen schlug sie ebenso kleine Pfähle in die Erde, umspannte diese mit Gräsern und setzte in diese so geschaffenen Weiden Steine, die ihre Rinder oder Pferde darstellten. Für die Huteschweine, ebenfalls Steinchen, steckte sie kleine, noch mit Blättern behaftete Äste als Wald in den Boden. Was sie nach der Geburt ihrer Brüder Odo und Rudwin lernte, übte sie mit den Püppchen und konnte mit nicht einmal fünf Jahren bei der Versorgung ihrer weiteren Brüder Magnus und Markward das Geübte wohl anwenden.
Nach der Schneeschmelze im Jahre 606 erlaubte Magda Beata, zu den Zwergen zu gehen, um dort weiter zu lernen. Das Kind war schon in der Lage, die Aufgaben einer zehnjährigen auszuführen. Im Berg hatte sie dann endlich die Spielkameraden, die sie unter den Menschenkindern wegen ihrer sehr vorangeschrittenen Entwicklung nicht zu finden vermochte. Sie balgte sich mit den Zwergenjungs am Schmiedeamboss und Blasebalg genauso gerne, wie sie mit den Mädchen häusliche Arbeiten übte. Eine Haarpracht, wie viele junge Zwerginnen entwickeln, war ihr nicht vergönnt. Darum freute sie sich immer sehr, wenn sie ihre Freundinnen kämmen durfte. Bei der kämpferischen Ausbildung war sie natürlich gleich ihrer Mutter den Zwergen kräftemäßig unterlegen, doch was Gesteinskunde und andere Lehren anging, überflügelte sie ihre Mitschüler ohne Schwierigkeiten.
Im Alter von acht Jahren, kurz vor der Saatzeit, zog sie dann zu den Halblingen nach Lindenbach. Flora und Favna hätten an solch einer Schülerin ihre helle Freude gehabt. Alle Gewerke des Lebens erlernte sie so schnell wie sonst niemand. Zur Erweiterung ihres wachen Geistes führte sie lange und tiefgründige Gespräche mit Eringus, der ein ums andere Mal ob der klaren Logik des Kindes nur den Kopf schütteln konnte. So manche ihrer Fragen brachten sogar ihn an den Rand dessen, was er selbst wusste. So begannen sie dann, Probleme ausgiebigst und tiefschürfend zu erörtern und über Fragen zu philosophieren. Sie war eine eifrige Unterstützerin Jades, ging es um Götter und Glaubensangelegenheiten. Da sie aber auch keinerlei Beweise Für oder Wider hatte, versuchte der Drache fast ständig, derartige Diskussionen zu vermeiden. Zu seinem Leidwesen gelang dies aber nur sehr selten. Auch wenn die Fragen, die Eringus diesbezüglich selbst in sich trug, nicht geklärt werden konnten, war er, auch wenn er es niemals zugab, letztlich doch froh, eine so verständige Gesprächspartnerin zu haben. Es tat ihm gut, darüber zu reden. In ihrem letzten Disput beschloss Beata, in die Welt zu ziehen, um auch diese Fragen zu klären.
Aus diesem Grund und weil sie bei den Halblingen ihre Vorliebe für Kräuter und deren Wirkung entdeckt hatte, verließ Beata das Chynzychtal, als sie zwölf Jahre alt war. Sie umkreiste das alte Zwergenreich weiträumig und sprach mit vielen Menschen. Bei so manchem Heilkundigen oder Kräuterweib und in einigen Klöstern blieb sie, bis sie sich deren Wissen angeeignet hatte. Nachdem Beata bei den Zwergen deren Schrift gelernt hatte, lernte sie auch die Schrift und lateinische Sprache der Mönche und Nonnen. Sie beherrschte viele der Dialekte, die zu damaliger Zeit noch weitaus mehr waren, als heute.
Und während all dieser Lehrzeit lernte sie auch sich selbst immer mehr kennen. Schon lange hatte sie erkannt, dass sie sich von den Menschen unterschied. Sie lernte schneller, konnte anscheinend unbegrenzt Wissen behalten und entdeckte zwergische Züge an sich, wie zum Beispiel eben die sich nun verlangsamende körperliche Entwicklung. Sicherlich hing das mit der Muttermilch ihrer Zwergenamme zusammen. Daneben fand sie aber auch Fähigkeiten, deren Ursprung sie noch nicht klar zuordnen konnte. Zum Beispiel spürte sie die Anwesenheit von Menschen auf eine gewisse Entfernung, bevor sie derer ansichtig wurde. Und sie spürte deren Gefühle und konnte so erkennen, ohne wie Eringus Gedanken lesen zu können, ob diese sie belogen oder nicht. Sie hatte ein untrügliches Gespür für die Gefühle anderer. Auch hatte sie selbst wohl eine befriedende Ausstrahlung. Aggressive oder furchtsame Lebewesen, sei es Mensch oder Tier, wurden in ihrer Nähe immer schnell ruhig und friedlich. Auf ihrer Wanderung fand sie einstmals das Küken eines Aaren und es gelang ihr, das Kleine groß zu ziehen. Eine recht lange Zeit folgte ihr der Vogel aus freien Stücken, bevor er sich ein eigenes Revier suchte.
Zuletzt lernte Beata in St. Wolfgang bei den Mönchen, als sie vom Tode Karls erfuhr. Unverzüglich machte sie sich auf den Weg, um ihrer Mutter beizustehen. Gemeinsam mit ihren Geschwistern übernahm sie vorübergehend die Führung des Gutes und der Herberge mit Schänke. Nachdem sie alles geregelt fand machte sie sich auf den Weg, ein eigenes Heim zu gründen.
Inzwischen hat sie sich einen Namen als die größte Kräuter- und Heilkundige in der weitesten Umgebung gemacht. Selbst aus dem Boierischen kommen die Menschen, um von ihr Rat und Hilfe zu erhalten. Südöstlich von Erlenbusch und in gerader Linie östlich von St. Wolfgang hatte sie hinter dem ehemaligen römischen Grenzwall einen Ort gefunden, in den sie sich förmlich verliebte. In dem stellenweise recht sumpfigen namenlosen Gelände fanden sich Kräuter in großer Zahl und Vielfalt, dass sie unbedingt dort ihre Heimstatt nehmen musste. Fast augenblicklich wollte sie damit beginnen, eine Hütte zu errichten, doch auf den Rat der Halben in Erlenbusch hin, ließ sie die bevorstehende Winterzeit verstreichen. Welch kluger Rat, denn dies Gebiet wird liebend gern von den Wassern von Lache und Chynzych, die hier ein Gewirr von Gräben gezogen haben, überflutet und das von ihr erwählte Inselchen war wochenlang derart tief unter Wasser, dass an ein Wohnen dort überhaupt nicht zu denken war.
Davon lies sich Beata aber nicht unterkriegen und schon bald fand sie eine recht hoch liegende Halbinsel, die ihr gefiel. Das leise Plätschern der Chynz unterstrich die unbeschreibliche Ruhe, die hier herrschte.
Mit Hilfe der vereinten Zwerge aus Steinenaue und der Halben aus Erlenbusch wurde Beatas neue Heimstatt errichtet. Weiträumig wurde ein tiefer und breiter Graben gezogen, der aus der Halbinsel eine rechte Insel machte. Der Aushub wurde dazu genutzt, den Grund noch ein wenig mehr zu erhöhen. Gleichzeitig würden zukünftige starke Hochwasser von dem tiefen Flussbett besser abgeleitet.
Das große Haus, in dem Beata alles unterbringen kann, was sie benötigte, ist zusätzlich noch auf Pfähle gestellt, die tief in den Boden gerammt wurden. Das Haus ist mehr als geräumig und nach Art der Halblinge, also fast wie ein späteres Fachwerk, gebaut. Auf die, bei den Halblingen üblichen, Farben hat man, auf Beatas Bitten hin, verzichtet. Es soll unscheinbar im Wald stehen. Von der Brücke über den Graben führt ein Pfahlweg direkt zu dem, das Haus umlaufenden, Freisitz. Auf der Vorderseite befindet sich die Tür in der rechten Hälfte, während die Linke ein Fenster mit Klappläden hat, das von innen mit einem dicken Querbalken fest verschlossen werden kann. Um ausreichend Licht ins Haus zu bekommen, sind auf der Rückseite nochmals zwei Fenster und auf den längeren Seitenwänden sogar jeweils drei Fenster vorhanden. Trotzdem ist sogar bei hellstem Sonnenschein in der Hütte wegen der dicht belaubten Bäume meist ein geheimnisvolles Dämmerlicht. Weil das Haus hoch genug gebaut ist, gibt es noch einen Zwischenboden, den man innen über eine Leiter erreichen kann. Allerdings erstreckte sich dieser zusätzliche Boden nur über zwei Drittel der Grundfläche. Das vordere Drittel ist frei gelassen. Dort oben gibt es nur ein kleines rundes Fenster an jeder Seite.
Das Dach ist so weit als möglich herab gezogen, sodass auch der ganze Freisitz überdacht ist. Wer aber sehen will, was vor der Insel geschieht, muss sich deshalb bücken.
Für die empfindlichen Kräuter, die hier nicht schon von Natur aus wuchsen, wurde ein großer Garten auf der Insel angelegt und mit einer fast vier Fuß hohen Mauer eingefasst, damit auch hier das Hochwasser keinen Schaden anrichten kann. Saatgut hat sie reichlich von den Halblingen bekommen und auf ihrer Wanderung gesammelt. Mit viel Geschick gelang es Beata dann auch zum Beispiel die sehr empfindliche Alraune zu pflegen. Weil der Weg zu ihrem Haus durch oft sumpfiges Gelände führt, wurde nach römischem Vorbild ein Pfahlweg angelegt, wo eine normale Befestigung nicht ausreichend erschien. Trotzdem gab es Zeiten, in denen Beatas Reich nicht verlassen oder aufgesucht werden konnte. Wegen der vielen verbauten Pfähle und dem hoch aufgeschütteten Hügel pflegte man dieses Gebiet danach als Bule zu bezeichnen. Wer die Bule kennt weiß, wie hungrig des Sommers hier die sehr zahlreichen Stechfliegen sein können. Für die junge Frau war dies aber kein Problem. Es waren allerdings nicht nur die Kräuter, die dafür sorgten, dass ihre Insel nahezu frei von diesen Saugern war. Wohl durch die Zwergenmilch der Amme meiden sie die Fliegen gleich einem Zwerg.
Aufgrund all dieser Umstände nährte sich der Ruf Beatas, ein unheimliches Kräuterweib zu sein. Man suchte sie, wenn man sie brauchte, doch man mied sie, wo man nur konnte. Die Tatsache, dass sie sonderlich aller Siedlungen ihr Heim genommen hat, macht das nicht ein bisschen besser.
Was die Ernährung anbelangt, so findet Beata in der Bule einen reich gedeckten Tisch. Viele der Kräuter waren und sind natürlich nicht nur Heilmittel, sondern durchaus auch zum Verzehr in Salaten geeignet. Reichlich wilde Beeren, Pilze und Früchte gibt es und Fisch und Fleisch sind zum Greifen nahe. Hat sie wirklich einmal Lust auf Getreide für einen Brei oder zum Backen, besucht sie die Brüder im Kloster St. Wolfgang, welches ja nur eine kurze Strecke entfernt liegt.
Von den Kranken erhält sie nach erfolgreicher Heilung auch stets Nahrungsmittel, als Lohn für ihre Dienste. Es mangelt ihr an nichts.
* * * * *
Beata ist noch mit Einrichtungsarbeiten beschäftigt, als es eines Tages im Sommer 619 an ihrer Pforte klopft. Davor steht eine ebenfalls noch junge Frau mit besonderem Aussehen.
„Ich grüße euch, Beata.“, beginnt sie mit etwas piepsiger Stimme. „Ich bin auf der Suche nach euch.“
„So ist denn eure Suche beendet.“, erwidert Beata etwas ungehalten ob der Störung. „Wer seid ihr und was ist euer Begehr?“ Sie ist etwas mürrisch, weil die Fremde sie aus ihren Gedanken gerissen hat.
„Ich bin Steinschneiders Guda und möchte euch fragen, ob ihr vielleicht für eine helfende Hand Verwendung hättet.“, lautet die eingeschüchterte Antwort.
Erstaunt mustert Beata ihre Gegenüber von oben bis unten und zurück. Vor ihr steht eine junge Frau, gleich ihr ausgiebig gerundet, doch über der Hüfte nicht ganz so schlank. Sie ist etwa zwei Handspannen kleiner als Beata, wodurch der lange etwas höher angesetzte braune Pferdeschwanz noch um einiges länger wirkt.
Man trägt ihr Hilfe an. Ihr, dem unheimlichen Kräuterweib. Eigentlich braucht sie keine Hilfe. Die Arbeiten, die es zu verrichten gilt, bewältigt sie allein. Und sei es nicht heute, dann vielleicht morgen. Es gibt nichts Dringendes ihn ihrem Leben. Sie empfindet aber, dass da besondere Beweggründe existierten, warum diese Guda ausgerechnet bei ihr anklopft. Das sagte auch der Blick der grauen Augen über der Stupsnase im runden Gesicht.
„So tretet ein, auch wenn ich keiner Hilfe bedarf. Doch ihr interessiert mich.“
Damit tritt sie zur Seite und gibt den Weg in das Haus frei.
Schüchtern, nicht ängstlich, wie Beata spürt, geht Guda an ihr vorbei und blickt sich im Inneren neugierig um. Die Kochstelle befindet sich im vorderen Bereich, nicht unter dem Zwischenboden, damit ausreichend Luft bis zum Dach ist. In der Nähe der Feuerstelle steht ein Tisch mit zwei Hockern. Nach hinten sieht sie noch zwei Türen, von denen eine wohl zu einer Schlafkammer führt, denn eine Lagerstatt ist sonst nirgends zu sehen. Sicherlich ist oben, bei den zum Trocknen hängenden Kräutern, ebenfalls keine. Weil Guda weiß, dass Beata sehr wohl die Lebensweise der Zwerge kennt, vermutet sie (zu Recht) hinter der zweiten Tür den Abort. Die Chynz trägt ihren Teil dazu bei, den Unrat sofort zu beseitigen. An den Wänden stehen sehr viele Regale, gefüllt mit irdenen Krügen und Schüsseln, mit und ohne Deckel, und metallenen Töpfen und Gerätschaften.
Beata lässt Guda Zeit, sich umzusehen. Schließlich aber sagt sie:
„Nehmt Platz und erzählt, was genau euch zu mir führt. Ich spüre, dass es um mehr geht, als nur die Suche nach Arbeit und Auskommen. Und eine rechte Zwergin, wie euer Name glauben machen kann, seid ihr auch nicht.“
Überrascht und verlegen blickt Guda zu Boden und setzt sich. Dann hebt sie ihren Kopf, fasst allen Mut zusammen und erzählt:
„Ihr habt Recht, Beate, ich bin keine reine Zwergin; nur ein Teil von mir. Mein Vater ist Ulbert Steinschneider, ein Zwerg. Vor fast siebzehn Jahren nahm er Frascha, die Menschenfrau zu seinem Weib, die mich zwei Tage vor der Wintersonnwende des gleichen Jahres gebar. Gemeinsam lebten wir in einer Menschensiedlung, bis vorigen Jahres meine Mutter starb. Das ist halt das Problem zwischen Mensch und Zwerg. Die Lebensdauer der Menschen ist deutlich kürzer.
Nun hielt meinen Vater aber nichts mehr in der Siedlung und er nahm mich mit in den Berg. Ich habe es lange versucht, doch ich konnte im Berg nicht leben. Dafür ist zu viel Mensch in mir. Bei den Menschen in der Siedlung fühlte ich mich auch nicht wohl und so suchte ich schon bald nach einer Lösung. Da hörte ich von euch und dachte, bei euch möchte es vielleicht gehen. Sicher seid ihr niemand, der auf die Herkunft alleine schaut. Vielleicht fänd ich Unterkunft bei euch für treue und redliche Arbeit. Gleich, was es auch sei.“
Mit hoffnungsvollem Blick erwartet Guda eine Reaktion auf ihre Lebensgeschichte. Beatas Blick sagt ihr, dass sie bleiben kann. Oder hat sie sich getäuscht? Die Worte klingen anders.
„Dann lasst mal hören, was ihr glaubt, mir helfen zu können. Dann will ich gerne entscheiden, ob ich euch brauchen kann.“
„Ich kann euch alles abnehmen, was schwere, wirklich schwere Arbeit ist. Die Kräfte einer Zwergin hab ich wohl. Leider bin ich in feinen Dingen nicht so geschickt. Wohl auch mein Zwergenlos.“ Enttäuscht stellte Guda mit einem Blick auf ihre wenig zarten Hände fest, dass sie eigentlich nicht viel anbieten kann, daher ergänzte sie schnell eifrig: „Doch was ich nicht kann, das mag ich gerne von euch lernen.“
„Das will ich euch wohl glauben, Guda. Lernen können wir alle alles, wenn wir nur wollen.“
„Oh, ja, ich will lernen, Beata. Bitte lasst mich bei euch bleiben.“, bettelt die Halbzwergin. Dabei macht sie Anstalten, sich vor ihr nieder zu knien.
Lachend verhindert Beata dies, indem sie sie an den Händen fasst. „Wie werde ich eine Hilfesuchende abweisen, die am gleichen Tage wie ich geboren wurde. Bin ich doch nur zwei Jahre älter als du.“ Mit dem du sind die förmlichen Schranken gefallen. „Ich will es gerne mit dir versuchen.“
„Vielen vielen Dank!“, ruft Guda, umarmt Beata stürmisch und küsst sie voller Freude auf den Mund.
Von diesem unschicklichen Verhalten merkwürdig berührt, löst sich Beata aus der Umarmung. „Fürs Erste kannst du auf dem Zwischenboden dein Lager beziehen, wenn du magst. Wollene Decken sind genug da und ein Unterbett habe ich auch noch. Dann werden wir sehen, wie wir uns die Arbeit teilen werden.“
* * * * *
Im Lauf der Zeit zeigt sich, dass Guda tatsächlich nur für die groben Arbeiten und für gelegentliches Kochen taugt. Mit dem Gärtnerischen kann sie sich nicht anfreunden. Gefährliche Verwechslungen mit den Kräutern, wie beispielsweise Bärlauch mit Maiglöckchen, und bei Pilzen und Beeren sind fast an der Tagesordnung. Doch letztlich harmonisieren die zwei Frauen ganz hervorragend miteinander. Beide haben gefunden, was sie nicht suchten und sind es trotzdem mehr als zufrieden. Ihre Zuneigung zueinander wächst stetig. Inzwischen schlafen die beiden gemeinsam in der Kammer.
Junge Burschen, die meinen, sich eines dieser Weiber nehmen zu können, merken gar bald, wie wehrhaft Beata und Guda sind. Selbst ohne Waffe ist Beata nicht zu überwältigen und Guda, mit ihrem Zwergenblut steckt sowieso jeden Mensch in die Tasche.
Es dauert nicht lange und bereits im weiteren Umkreis ist bekannt, dass das Kräuterweib ein Zwergenweib zu sich genommen hat. Das muss mit Hexerei zu tun haben. Das ist widernatürlich. Genauso schnell haben die zwei Frauen ihren Spitznamen weg. Weil sie beide die Haare im Pferdeschwanz tragen sind sie nun die rote und die braune wilde Stute. Letztlich haben auch Beata und Guda davon erfahren. Sie haben darüber nur gelacht. Dass sie ins Gerede kommen, war von vornherein klar. Bis dato haben die zwei Frauen Glück, denn in ihrer Umgebung ist noch nichts geschehen, was das Volk vielleicht auf den bösen Blick oder andere schwarze Magie zurück führt. Allzu leicht kommen Menschen mit schlechtem Ruf dann in Gefahr, für ein Unglück verantwortlich gemacht zu werden. Ob sich das Pärchen gegen den aufgebrachten Mob durchsetzen könnte, ist fraglich.
Nur gut, dass niemand die familiäre Verbindung zu Magda in Hosti kennt. Der Ruf der Mutter sollte auf keinen Fall beschädigt werden.
* * * * *
Es ereignete sich folgende Anekdote:
Des Abends sitzen Beata und Guda gerne noch ein wenig auf dem Freigang vor dem Haus und gönnen sich den einen oder anderen Krug Bier, wobei Guda den Mönchsbräu, Beata aber den Zwergenbräu bevorzugt.
Nun wollte es das Geschick, dass beiden das Fässlein leer wurde und alsbald machten sich sowohl Zwerg als auch Mönch im Hochsommer auf den Weg, den Frauen Nachschub zu liefern. Weil der Zwerg mit seinem Ochsengespann eher los zog, traf man sich just auf der großen Straße.
„Wohin des Weges, Bruder?“, fragte der Zwerg.
„Zu Guda, die bei dem Kräuterweib in der Bule lebt.“, lautete die Antwort des Mönches, der seinen Karren mit einem Fass Bier hinter sich herzog. Der Schweiß lief ihm in Strömen das Gesicht hinab, denn auf diesem Wegesabschnitt gab es im Moment nicht ein kleines bisschen Schatten.
„So haben wir den gleichen Weg, Bruder. Lasst uns euren Karren und das Fass zu dem meinen hinten aufladen. Ich nehme euch gerne mit. Was sollt ihr euch so plagen in der Hitze heute.“
Gesagt, getan. Und unter lustigem Plaudern über dies und jenes zogen die Beiden ihrem Ziel entgegen, als plötzlich dem Mönch einfiel:
„Hält der Pfahlweg zum Kräuterweib überhaupt das große Gewicht des Karrens und seiner Ladung? Mich deucht, es möchte zu groß sein.“
„Wäre der Pfahlweg Menschenwerk, wäre euer Einwand wohl berechtigt, doch haben wir Zwerge diesen Weg gebaut. Der wird schon halten. Als damals die Hütte errichtet wurde, wurden ganz andere Gewichte darüber hinweg geschafft und nie gab es Grund zur Sorge. Seid ganz beruhigt.“
So ganz beruhigt war der Mönch davon aber nicht und auch der Zwerg war sich seiner Sache nicht mehr ganz so sicher, wie seine Rede klang. Nachdenklich ruhig setzte man die Reise fort. Als man dann am Pfahlweg anlangte, hielt der Zwerg das Gefährt an, stieg vom Kutschbock und betrat den hölzernen Weg, der gerade breit genug war, ein Fuhrwerk zu tragen. Mit festem stampfendem Tritt schritt der Zwerg voraus und wand sich dann dem Mönch zu.
„Seht her, Bruder!“, rief er und sprang dann mehrmals in die Luft um laut krachend mit seinen Stiefeln wieder auf dem Weg zu landen. Nichts passierte. „Das hält noch sehr viel mehr, als nur den Wagen und uns.“ Voller Stolz blickte der Zwerg zum Mönch hinauf.
Damit kehrte er wieder zurück und setzte sich auf den Bock. Mit zufriedener Miene trieb er den Ochsen an und rumpelnd rollte das Gefährt weiter. Nur noch wenig vom Ziel entfernt, als der Weg über einen Wasserarm führte, knackte es vernehmlich bedenklich. Augenblicklich hieß der Zwerg den Ochsen stehen zu bleiben, um nicht durch das Gerumpel der Holzräder sein Gehör zu beeinträchtigen. „Hörtet ihr auch etwas, Bruder?“
Zu einer Antwort aber kam es nicht mehr, denn nun krachte es gar fürchterlich und Mann und Fuhre stürzten seitlich weg und landeten im Wasser, das zum Glück nicht sehr tief war. Beide Fässer geborsten. Triefend nass saßen die Lieferanten im Bach.
„Von wegen: Zwergenwerk – hält noch viel mehr.“, äußerte der Mönch abfällig.
Im vom Bier und Schlamm getrübten Wasser griff der Zwerg nach einem Pfahlstück, betrachtete es kurz und hielt es in die Höhe.
„Biberwerk!“
Seit dieser Zeit und bis auf den heutigen Tag hat der Wasserlauf den Namen Doppelbiergraben und die Umgebung Doppelbiersumpf.
Wahr gesagt?
Schon seit vielen Jahren treffen sich zwei in alten Schriften Forschende. Zum Einen ist dies der Zwerg Wilbalt Eisenbieger und zum anderen der Mönch Urban. Es ist auffällig geworden, dass sich aus den alten Schriften der beiden so unterschiedlichen Völker zutreffende Gemeinsamkeiten gelesen werden können.
Nachdem es dem Zwergen nicht gelungen ist, seine Meisterprüfung erfolgreich zu bestehen, hat er sich darauf verlegt, in einem Teilbereich als Berater für den Meister zu arbeiten. Jetzt kümmert er sich intensiv um Aussagen und Beziehungen zu anderen Völkern.
Nun darf man aber nicht davon ausgehen, dass in Zwergenbüchern zu lesen ist, was bei den Menschen passiert oder umgekehrt. Allerdings ließen sich Übereinstimmungen finden, ging es um Geschehnisse, die allgemein, also Mensch und Zwerg, betreffend waren. So zum Beispiel fanden sich Vorhersagen bezüglich des Erdbebens im Jahre 543, das überall spürbar war.
Bei seinen Bemühungen ist Wilbalt die Idee gekommen, Unterstützung bei den Menschen zu suchen. Allerdings sind die einzigen, verbindlichen Quellen bei den Mönchen zu suchen. Also ging er kurzerhand zum Kloster und bat um Einsicht in Schriften, die er zu finden hoffte. Dabei lernte er den Mönchen Urban kennen und schätzen.
Nachdem die letzte Zusammenkunft bei den Zwergen war, trifft man sich dieses Mal bei den Mönchen in St. Wolfgang. Üblicher Weise gibt es zunächst erst einmal eine herzliche Umarmung zur Begrüßung, worauf man sich des Bierfässchens bemächtigte und einen Humpen auf das gemeinsame Wohl trinkt. Dieses Ritual geht in dem heutigen Treffen gänzlich unter. Wilbalt sitzt bereits im Gästehaus des Klosters über einem sehr alten Buch, als Urban mit einer wohl nicht minder alten Schriftrolle unter dem Arm den Raum betritt.
„Dringende Neuigkeiten bring ich, Bruder Urban.“, ruft der Zwerg statt einer Begrüßung. Seine kastanienbraunen Haare fallen in leichten Wellen auf seine Schultern, um die er einen dünnen schwarzen Mantel trägt, der mit einer Hornspange gehalten wird. Darunter trägt er ein grünes Gewand und gleichfarbige Hosen, die in den bei Zwergen üblichen Stiefeln stecken. Der brustlange Vollbart liegt auf dem Mantel. Allerdings ist das Kinn gänzlich ohne Barthaar, weswegen die dadurch entstehenden zwei Teile des Bartes kunstfertig zusammengeflochten wurden. Über einer dicken Nase leuchten graue Augen.
Als Antwort bricht es auch aus dem Mönchen heraus: „Wir gehen schlimmen Zeiten entgegen.“ Er ist nicht minder aufgeregt, als der Zwerg. Das kahle Haupt des Mönchs wird von einem dunkelbraunen dichten Haarkranz umwunden. Eine lange Nase sticht zwischen grünen Augen und einem breiten Mund aus dem Gesicht hervor. Die Kutte wogt leicht um den schlanken Körper.
„Nun gut, als Gast sei dir der Vortritt gewährt, lieber Wilbalt.“, ergänzt er erzwungen ruhiger.
„Sieh hier, Bruder, was hier steht. Es ist aus den Weissagungen von Gilbret Steinschleifer, dem Seher von der Höch. Mertlin Felsbruch hat mich daran erinnert. Erstaunlich, was der Mann alles im Kopf hat. In meinen Augen hat er unseren alten Meister bereits bei weitem überflügelt.“
Eiligst ist der Mönch an den Tisch heran getreten. Der Zwerg zeigt auf die Stelle, die ihm so enorm wichtig erscheint. Er liest selbst lauter als nötig einen Absatz im Text, der da lautete:
Haben Zwerge vereint zwei eiskalte Winter erlebt,
die Welt dem fürchterlich Dritten zustrebt.
Es türmt sich das Eis, dem Herzen wird bang,
denn dieser Winter, er dauert sehr lang.
Bestätigend nickte Bruder Urban, schiebt seine Rolle Wilbalt zu und zeigt seinerseits auf einen Spruch, welcher besagt:
Ist die Bulla im zweiten Jahr tot,
bringt ein langer Winter viel Not.
Natürlich muss der Mönch den Text übersetzen. Bis heute fand sich noch kein Zwerg dazu bereit, Latein zu lernen.
„Ihr Menschen habt schon gar merkwürdige Art, Weissagungen zu verschlüsseln, bester Urban. Das musst du mir erklären. Das ist nicht so einfach, wie die Zwergensprüche.“
„Das ist sehr wahr. Deine Warnung ist leicht zu verstehen. Ihr Zwerge habt euch mit den Kleyberchern vereint und dies ist der zweite strenge Winter seit dem. Also wird der nächste Winter der Längste von allen werden.
Die Sprüche in unseren alten Schriften sollen auch nicht von jedem verstanden werden. Nur das Volk unseres Gottes soll teilhaftig der Wahrheit werden. Darum die Verschlüsslungen. Aber gerne werde ich es dir verdeutlichen.
Vor wenigen Tagen hat uns die Nachricht erreicht, dass schon lange Papst Bonifatius V auf dem Heiligen Stuhl in Rom sitzt, nachdem im vorigen Jahr sein Vorgänger, Papst Adeodatus verstorben ist. Jener Papst Adeodatus aber war der Erste, der ein päpstliches Siegel, die Bulla, benutzte. Nun bist auch du in der Lage, den Spruch zu deuten.“
„Ja, nun wohl. Im nächsten Winter ist dieser Papst Adingsbums im zweiten Jahr tot. Darum wird der Winter dann sehr lange werden. Ich hätte nicht gedacht, dass zu gleicher Zeit auch du solch eine Warnung finden würdest. Vielmehr nahm ich an, du müsstest erst noch suchen.“
„Das wäre sicher auch von Nöten gewesen und ich zweifle, ich wäre fündig geworden. Doch fiel mir diese Schrift mehr durch Zufall in die Hände und ich möchte nicht unbedingt darüber sprechen. Ich werde bestimmt auch schon so genug Ärger deswegen bekommen. Da muss ich nicht noch herum Posaunen, woher ich dies habe.“, antwortete Urban nachdenklich.
„Sei es, wie es sei. Was machen wir mit unserem Wissen? Irgendetwas muss geschehen. Sicherlich ist diese Nachricht von enorm großer Wichtigkeit. Nicht umsonst findet sie sich bei euch wie bei uns.“
„Diese Frage ist meinesteils ziemlich leicht zu beantworten. Ich werde vor meinen König treten, ihm von unserer Entdeckung berichten und ihm empfehlen, die größten Vorräte aller Zeiten anzulegen.
Ich bin mir sicher, er wird auf der Stelle die notwendigen Anweisungen erteilen und auch unsere Freunde warnen. Wir Zwerge halten mit sowas nicht hinterm Berg, wenn du verstehst, was ich meine.“
„Oh doch, Wilbalt. Ich verstehe. Leider bin ich mir bei meinem Abt in dieser Hinsicht nicht so ganz sicher. Ich werde mir viel einfallen lassen müssen, um ihn zu beschwichtigen und zu überzeugen. Und ob er dann entsprechend handelt?“ Der Rest seiner Gedanken bleibt offen.
Zu guter Letzt nimmt man dann doch noch einen guten Schluck Bier zu sich und beendet mit der obligatorischen Umarmung die kürzeste Zusammenkunft, die jemals zwischen Beiden stattfand.
* * * * *
Wie vorher gesehen (was nicht sehr schwer war) hat König Sigurd tatsächlich Anweisung gegeben, all mögliche Anstrengungen zu unternehmen, die beste und größte Ernte aller Zeiten zu erzielen. Er lässt sogar neue zusätzliche Felder anlegen und so viel wie nur möglich an Saat ausbringen. Gleichzeitig schickt er Boten zu den Halblingen in Lindenbach und Erlenbusch und natürlich auch zu seiner lieben Magda. Gleichzeitig bietet er Lagerplatz in den Höhlen und Gängen der Festung an, falls vorhandene Scheunen und Lagerstätten nicht reichen mögen. Falls wirklich solch ein harter und langer Winter kommen würde, wäre die Zwergenfestung der sicherste Platz im ganzen Chynzychtal.
Die Halblinge ihrerseits verbreiten die Kunde in den anderen Dörfern der kleinen Gärtner weiter und so beginnt eine emsige Betriebsamkeit.