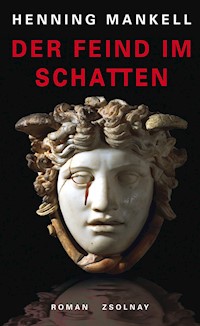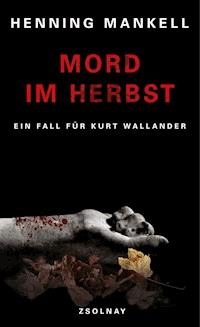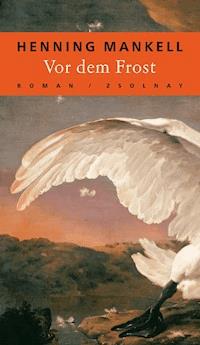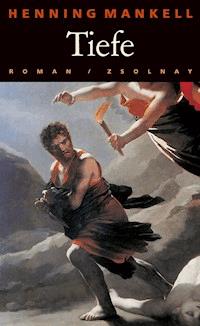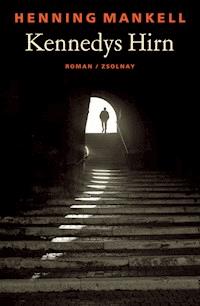Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schweden, Anfang 20. Jahrhundert: Die junge mittellose Hanna muss als älteste von fünf Geschwistern ihr Heimatland verlassen und kommt in die portugiesische Kolonie Mocambique. Sie wird dort ein Vermögen erben, ein Bordell leiten und einige Jahre später spurlos wieder verschwinden. Auf der Grundlage weniger überlieferter Dokumente hat Bestsellerautor Henning Mankell einen spannenden, farbenprächtigen Roman über eine außergewöhnliche Frau geschrieben, die ihren eigenen Weg zwischen den weißen Rassisten und der schwarzen Bevölkerung in Afrika finden muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Zsolnay E-Book
Henning Mankell
Erinnerung an
einen schmutzigen Engel
Roman
Aus dem Schwedischen von Verena Reichel
Paul Zsolnay Verlag
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Minnet av en smutsig ängel beim Leopard Förlag, Stockholm.
ISBN 978-3-552-05589-6
© Henning Mankell 2011
Published by agreement with Leopard Förlag, Stockholm, and Leonhardt & Høier Literary Agency A/S, Copenhagen.
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2012
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
www.henning-mankell.de
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhalt
PROLOG
Africa Hotel, Beira, 20027
TEIL I
Die Missionare verlassen das Schiff 13
TEIL II
Die Lagune des guten Todes 75
Teil III
Der Bandwurm im Maul des Schimpansen 145
TEIL IV
Das Verhalten des Schmetterlings
angesichts einer Übermacht227
EPILOG
Africa Hotel, Beira, 1906 337
Nachwort 347
Glossar 349
»Es gibt drei Arten von Menschen:
jene, die tot sind, jene, die leben, und jene,
die über die Meere segeln …«
PLATON
PROLOG
Africa Hotel, Beira,
2002
An einem Tag im kalten Juli 2002 hackte ein Mann namens José Paulo ein Loch in einen verrotteten Fußboden. Er suchte keinen Fluchtweg und auch kein Versteck. Er wollte einfach das morsche Parkett als Brennholz verwenden, da die afrikanische Kälte schlimmer war als seit vielen Jahren.
José Paulo war alleinstehend, hatte aber die Verantwortung für seine Schwester und ihre fünf Kinder übernommen, nachdem sein Schwager Emilio eines Morgens verschwunden war und nur ein Paar abgetretene Schuhe und unbezahlte Rechnungen hinterlassen hatte. Den größten Teil der Schulden hatte Emilio bei Donna Samima gemacht. Diese Dame betrieb in der Nähe des Fischereihafens eine illegale Kneipe, in der sie tontonto und selbstgebrautes Bier mit erstaunlich hohem Alkoholgehalt servierte.
Emilio hatte sich dem Trinken und dem Schwadronieren über ferne Zeiten gewidmet, als er in den südafrikanischen Goldminen Goldgräber war. Aber viele Leute behaupteten, er habe seinen Fuß noch nie nach Südafrika gesetzt, und einer geregelten Arbeit sei er erst recht nie im Leben nachgegangen.
Sein Verschwinden hatte man zwar nicht erwartet, aber es kam auch nicht völlig überraschend. Er war einfach in den stillen Stunden kurz vor Beginn der Morgendämmerung davongeschlichen, als alle schliefen.
Niemand wusste, wo er geblieben war. Es vermisste ihn wohl auch niemand besonders, nicht einmal seine eigene Familie. Ob Donna Samima ihn vermisste, konnte man nicht sagen, aber sie bestand darauf, dass die Rechnungen bezahlt würden.
Emilio, der Schwätzer und Trinker, hinterließ kaum eine Spur. Dass er jetzt weg war, machte eigentlich keinen Unterschied.
José Paulo wohnte mit der Familie seiner Schwester im Africa Hotel in Beira. Früher einmal, in einer Zeit, die jetzt fern und unbegreiflich erschien, galt es als eins der ersten Hotels im kolonialen Afrika. Man verglich es mit dem Hotel Victoria Falls an der Grenze zwischen Südrhodesien und Nordrhodesien, ehe diese Länder sich befreiten und die Namen Zimbabwe und Zambia annahmen.
Ins Africa Hotel kamen Weiße von weither, um zu heiraten, Jubiläen zu feiern oder um einfach nur zu zeigen, dass sie einer Aristokratie angehörten, die nicht an den Untergang ihres kolonialen Paradieses glaubte. Im Hotel wurden an den Sonntagnachmittagen Tanztees veranstaltet, Swing- und Tangowettbewerbe, und viele Gäste ließen sich vor dem großen Entree fotografieren.
Doch der koloniale Traum vom Paradies war ausgeträumt. Eines Tages flohen die Portugiesen aus ihren letzten Festungen. Das Africa Hotel begann zu verfallen, sobald die früheren Besitzer gegangen waren. Die verlassenen Zimmer und Suiten wurden von armen Afrikanern bevölkert, die ihre Habseligkeiten in ausgehöhlten Flügeln und Klavieren, in schwärzlichen Boudoirs und Badewannen unterbrachten. Die schönen Parkettböden wurden zu Brennholz für die kältesten Wintertage.
Schließlich wohnten mehrere tausend Menschen in dem, was einmal das Africa Hotel gewesen war.
An einem Tag im Juli hackte also José Paulo ein Loch und brach das Parkett auf. Im Zimmer war es eiskalt. Die einzige Wärmequelle bestand aus einer Eisenschale, in der die Bewohner über offenem Feuer ihr Essen zubereiteten. Ein Kaminrohr, das durch ein zerschlagenes und notdürftig abgedichtetes Fenster hinausragte, leitete den Rauch ab.
Das halb vermoderte Parkett hatte schon begonnen, von seiner düsteren Vergänglichkeit zu stinken. José glaubte, darunter würde eine tote Ratte liegen und ihren Verwesungsgeruch verbreiten. Aber das Einzige, was er fand, war ein Notizbuch, ein kleines, in Kalbsleder gebundenes Heft.
Er buchstabierte sich mühsam durch einen eigentümlichen Namen auf dem schwarzen Einband.
Hanna Lundmark.
Unter dem Namen stand eine Jahreszahl: 1905.
Aber was in dem Buch geschrieben stand, konnte er nicht deuten. Er kannte die Sprache nicht, und er wandte sich an den alten Afanastasio von Zimmer 212, der als weiser Mann galt: In seiner Jugend hatte er auf einer verlassenen Straße außerhalb von Chimoio eine Begegnung mit zwei hungrigen Löwen überlebt.
Aber nicht einmal Afanastasio konnte die Schrift deuten. Er fragte die alte Lucinda um Rat, die in der ehemaligen Rezeption hauste, aber auch sie wusste nicht, welche Sprache es war.
Afanastasio riet José Paulo, das Buch wegzuwerfen. »Es hat so lange unter dem Fußboden gelegen«, sagte er. »Jemand hat es in einer Zeit dort versteckt, als solche wie wir uns in diesem Gebäude nur als Kellner, Putzleute oder Kofferträger aufhalten konnten. Bestimmt enthält es eine unangenehme Geschichte. Verbrenn es, nimm es an einem richtig kalten Abend zum Heizen.«
José Paulo ging mit dem Buch wieder auf sein Zimmer. Aber er verbrannte es nicht, ohne eigentlich zu wissen, warum. Stattdessen fand er ein neues Versteck. Unter dem Fensterbrett gab es einen Hohlraum, in dem er sein mühsam verdientes Geld aufbewahrte. Jetzt ließ er die wenigen schmutzigen Geldscheine mit dem schwarzen Notizbuch den Platz teilen.
Er holte es nicht wieder hervor. Aber er vergaß es auch nicht.
TEIL I
Die Missionare verlassen
das Schiff
1
Wir schreiben das Jahr 1904. Eine erstickend heiße tropische Morgendämmerung.
In diesem fernen Jetzt dümpelt ein Dampfer unter schwedischer Flagge in der sanften Dünung. An Bord befinden sich einunddreißig Besatzungsleute, darunter eine Frau. Sie heißt Hanna Lundmark, geborene Renström, und arbeitet als Köchin an Bord.
Aber insgesamt hatten zweiunddreißig Personen die Reise nach Australien mit schwedischem Kernholz und Brettern für Saloonböden und die Wohnzimmer reicher Schafsfarmer angetreten.
Einer der Besatzungsmänner ist kürzlich verstorben. Er war Steuermann und mit Hanna verheiratet.
Er war jung und lebenslustig. Obwohl Kapitän Svartman ihn gewarnt hatte, ging er an Land, als sie in einem Wüstenhafen südlich von Suez Kohle bunkerten. Er fing sich ein tödliches Fieber ein, wie es an Afrikas Küsten grassiert.
Als er erkannte, dass er sterben würde, begann er vor Angst zu brüllen.
Zu keinem der Seeleute, die an seinem Sterbebett saßen, Kapitän Svartman und der Zimmermann Halvorsen, sagte er ein letztes Wort. Auch nicht zu Hanna, die nach einmonatiger Ehe Witwe werden sollte. Er starb schreiend und schließlich wimmernd vor Angst.
Er hieß Lars Johan Jakob Antonius Lundmark. Hanna betrauert ihn, fast besinnungslos von dem, was geschehen ist.
In der Morgendämmerung, am Tag nach seinem Tod, bewegt sich das Schiff kaum. Es hat beigedreht, da bald eine Seebestattung stattfinden wird. Kapitän Svartman will nicht warten. Sie haben kein Eis an Bord, um den Leichnam zu kühlen.
Hanna steht am Heck, einen Abfalleimer in der Hand. Sie ist klein und hochbusig, hat freundliche Augen. Ihre braunen Haare sind im Nacken zu einem strengen Knoten geschlungen.
Sie ist nicht schön. Aber auf merkwürdige Weise strahlt sie aus, dass sie ein durch und durch wahrhaftiger Mensch ist.
Hier und jetzt. Hier befindet sie sich. Auf dem Meer, an Bord eines Dampfers mit zwei Schornsteinen. Beladen mit Holz, unterwegs nach Australien. Heimathafen: Sundsvall.
Das Schiff heißt Lovisa. Es wurde in der Finnboda Werft in Stockholm gebaut. Aber der Heimathafen hat immer an der norrländischen Küste gelegen.
Zunächst gehörte es einer Reederei in Gävle, die nach fehlgeschlagenen Spekulationen in Konkurs ging. Dann wurde es nach Sundsvall verkauft. In Gävle hieß es Matilda, nach der Frau des Reeders, die mit ungeschickten Fingern Klavier spielte. Jetzt heißt es Lovisa, nach der jüngsten Tochter des neuen Reeders.
Einer der Teilhaber heißt Forsman. Er hat dafür gesorgt, dass Hanna Lundmark Arbeit an Bord bekam. Zu Hause bei Forsmans gibt es ein Klavier, aber niemand spielt darauf. Hingegen hört er zu, wenn der Klavierstimmer zu seinen regelmäßigen Besuchen kommt.
Jetzt ist Steuermann Lars Johan Jakob Antonius Lundmark an einem rasenden Fieber gestorben.
Es ist, als wäre die Dünung erstarrt. Das Schiff liegt da wie mit angehaltenem Atem.
So stelle ich mir den Tod vor, denkt Hanna Lundmark. Eine plötzliche Stille, unerwartet, die von nirgendwo herkommt. Der Tod ist wie der Wind. Ein rascher Wechsel nach Lee.
Ins Lee des Todes. Dann nichts mehr.
2
In diesem Moment überfällt Hanna eine Erinnerung.
An ihren Vater, an seine Stimme, die gegen Ende seines Lebens nur noch ein Flüstern war. Als verlangte er von ihr, alles, was er sagte, wie ein kostbares Geheimnis zu bewahren.
Ein schmutziger Engel. Das ist es, was du bist.
Das sagte er zu ihr, kurz bevor er starb. Es war, als wollte er ihr ein Geschenk machen, obwohl – oder gerade weil – er kaum etwas besaß.
Hanna Renström, meine Tochter, du bist ein Engel, ein schmutziger, aber dennoch ein Engel.
Woran erinnert sie sich eigentlich? Was genau waren seine Worte? Nannte er sie arm oder schmutzig? Überließ er es ihr, zu wählen? Jetzt, da sie den Moment heraufbeschwört, glaubt sie, er habe sie einen schmutzigen Engel genannt.
Die Erinnerung ist fern, verblasst. Hanna ist so weit weg von ihrem Vater und seinem Tod. Damals, ein einsames Haus am braunen kalten Wasser des Ljungans in einem stillen norrländischen Binnenland. Er starb zusammengekrümmt vor Schmerzen im ausziehbaren Bett in einer Küche, die die Wärme nicht halten konnte.
Er starb umgeben von Kälte, denkt sie. Die Kälte war streng im Januar 1899, als er aufhörte zu atmen.
Es sind mehr als fünf Jahre vergangen, jetzt haben wir Juni 1904.
Die Erinnerung an den Vater und seine Worte über den Engel verschwinden so rasch, wie sie gekommen sind. Nach wenigen Sekunden ist sie aus der Vergangenheit zurückgekehrt.
Sie weiß, dass man die bemerkenswertesten Reisen in der Innenwelt macht, wo weder Zeit noch Raum existieren.
Vielleicht wollte das Erinnerungsbild ihr helfen? Ihr ein Seil zuwerfen, damit sie über die Mauer der betäubenden Trauer klettern könnte?
Aber sie kann nicht fliehen. Das Schiff hat sich in eine unüberwindbare Festung verwandelt. Sie kommt nicht hinaus. Ihr Mann ist wirklich tot.
Der Tod: wie eine Kralle. Die sich weigert, ihren Griff zu lockern.
3
Der Druck in den Dampfkesseln ist gesenkt worden. Die Kolben in den Zylindern bewegen sich nicht mehr, die Maschine ruht. Hanna steht an der Reling mit ihrem Abfalleimer in der Hand, um ihn zu entleeren. Der Messjunge wollte ihn ihr abnehmen, aber sie hielt ihn fest, verteidigte ihn. Auch wenn sie an diesem Tag zusehen wird, wie ihr Mann in der Meerestiefe versinkt, eingenäht in Segeltuch, will sie ihre Pflichten nicht vernachlässigen.
Als sie von dem Eimer aufschaut, der mit Eierschalen gefüllt ist, schlägt ihr die Hitze ins Gesicht. Irgendwo im Dunst an Steuerbord liegt Afrika. Obwohl sie nicht die leiseste Andeutung von Land sehen kann, meint sie, den Geruch wahrzunehmen.
Er, der jetzt tot ist, hat ihr davon erzählt. Von dem dampfenden, fast ätzenden Geruch von Fäulnis, der sich überall in den Tropen findet.
Mehrere Reisen hat er schon gemacht, zu verschiedenen Zielen. Vieles hat er gelernt. Nur nicht das Wichtigste, das Überleben.
Diese Reise sollte er nicht vollenden. Er starb im Alter von vierundzwanzig Jahren.
Es ist, als hätte er sie warnen wollen, denkt Hanna. Aber sie weiß nicht, wovor.
Der Tote ist ohne Antwort.
Jemand stellt sich still an ihre Seite. Der engste Freund ihres Mannes an Bord, der norwegische Zimmermann Halvorsen. Ob er einen Vornamen hat, weiß sie nicht. Obwohl sie seit mehr als zwei Monaten zusammen auf dem Schiff sind. Er ist einfach nur Halvorsen, ein ernster Mann, von dem es heißt, er würde jedes Mal, wenn er nach ein paar Jahren auf See heim nach Brönnöysund kommt, auf die Knie fallen und bekehrt werden, um dann doch wieder anzuheuern, wenn sein Glaube ihn nicht länger trägt.
Er hat große Hände, aber sein Gesicht ist weich, fast weiblich. Der Stoppelbart scheint von jemandem, der ihm übel mitspielen wollte, aufgemalt worden zu sein.
»Ich habe verstanden, dass da etwas ist, wonach du fragen willst«, sagt er. Seine Stimme singt. Es klingt wie ein Summen, wenn er spricht.
»Die Tiefe«, sagt Hanna. »Wo wird Lundmarks Grab sein?«
Halvorsen schüttelt nachdenklich den Kopf. Plötzlich erinnert er sie an einen unruhigen Vogel, der auffliegen will.
Schweigend verlässt er sie. Aber sie weiß, dass er die Antwort für sie finden wird.
In welcher Tiefe wird das Grab liegen? Gibt es einen Meeresgrund, auf dem ihr Mann in dem zugenähten Segeltuch ruhen wird? Oder ist da nichts, eine Tiefe, die sich in alle Unendlichkeit fortsetzt?
Sie leert den Eimer, sieht die weißen Vögel im Sturzflug auf das Wasser hinabtauchen, um die Beute zu fangen, und wischt sich mit dem Handtuch, das sie an ihre Schürze geknotet hat, den Schweiß von der Stirn. Dann tut sie das Unvermeidliche. Sie schreit.
Einige Vögel, die sich in Erwartung der Leerung eines weiteren Abfalleimers vom Aufwind tragen lassen, legen die Flügel an und ziehen sich von dem Trauergeheul zurück, das sie wie Hagel trifft.
Der Messjunge Lars schaut erschrocken aus der Kombüse, in der Hand ein aufgeschlagenes Ei. Er sieht sie heimlich an, der Tod macht ihn verlegen.
Sie ahnt, was er denkt. Jetzt springt sie, jetzt verlässt sie uns, da die Trauer zu schwer zu ertragen ist.
Der Schrei ist von mehreren Leuten an Bord gehört worden. Zwei verschwitzte Jungmänner mit nacktem Oberkörper stellen sich neben die Kombüse und glotzen, genau dort, wo eine lange Trosse wie eine zusammengerollte Schlange liegt.
Hanna schüttelt den Kopf, beißt die Zähne zusammen und geht mit dem leeren Eimer in die Kombüse. Nein, sie wird nicht über die Reling klettern. Ihr Leben lang hat sie ausgeharrt, und das will sie auch weiterhin tun.
In der Kombüse schlägt ihr noch größere Hitze entgegen. Es ist so heiß wie bei den Heizern tief unten im Maschinenraum, das weiß sie, obwohl sie nie da unten war. Frauen in der Nähe von Dampfkesseln und Feuer bedeuten Unglück.
Für ältere Seeleute ist es überhaupt ein Unding, Frauen an Bord zu haben. Das bringt nicht nur Unheil, sondern auch Streit und Eifersucht unter den Männern. Als Forsman Hanna an Bord bringen wollte, war Kapitän Svartman trotzdem einverstanden. Der Kapitän hielt nicht viel von Aberglauben.
Hanna nimmt ein Ei und schlägt es an der Pfanne auf, die Schale wirft sie in den Eimer. Dreißig lebende Seeleute sollen ihr Frühstück bekommen. Sie versucht, nur an die Eier zu denken, nicht an die bevorstehende Bestattung. Sie ist als Köchin an Bord, daran hat sich durch den Tod ihres Mannes nichts geändert.
Es ist, wie es ist: Sie lebt. Aber Lundmark ist tot.
4
Halvorsen kommt und bittet sie, ihm zu folgen. Kapitän Svartman wartet.
»Wir werden die Tiefe ausloten«, sagt Halvorsen. »Reichen unsere Seile nicht, wählt der Kapitän einen anderen Platz.«
Sie brät vier Eier in der Pfanne fertig und folgt ihm. Ein plötzlicher Schwindel bringt sie ins Wanken. Aber sie stürzt nicht, sie hält sich noch aufrecht.
Kapitän Svartman stammt aus einer Familie mit einer langen ununterbrochenen Kette von Seeleuten, das weiß sie. Er ist sechzig, ein alter Mann. Ihm fehlt das letzte Glied am kleinen Finger einer Hand. Niemand weiß, ob es angeboren ist oder Folge eines Unfalls.
Zweimal ist er mit einem Segelschiff untergegangen. Einmal wurde er mit der Besatzung gerettet, das andere Mal überlebte außer ihm nur der Schiffshund, aber nach der Bergung legte das Tier sich hin und starb.
Hannas toter Mann war der Meinung, dass Kapitän Svartman eigentlich auch starb, zusammen mit dem Schiffshund. Nach der Katastrophe blieb der Kapitän viele Jahre an Land. Was genau er da tat, weiß niemand. Es heißt, er sei eine Zeitlang Schienenleger gewesen. Er habe dem Vortrupp angehört, den die staatliche Eisenbahn ausgeschickt hatte, um die Inlandsbahn abzustecken, über die sich der Schwedische Reichstag immer noch stritt.
Dann kehrte er plötzlich zur See zurück, jetzt als Kapitän eines Dampfschiffs. Er gehörte zu den wenigen Menschen, die der Seefahrt mit dem Verschwinden der Segelschiffe nicht den Laufpass gaben, sondern mit der neuen Zeit gingen.
Aber er sprach nie von den Jahren an Land, was er gearbeitet, was er gedacht hatte, nicht einmal davon, wo er gewohnt hatte.
Er spricht selten ein überflüssiges Wort und glaubt nicht an die Fähigkeit des Menschen zuzuhören. Auch glaubt er nicht an die Zuverlässigkeit des Meeres. Lavendelblaue Blumen stehen in Töpfen in seiner Kajüte. Nur er selbst darf sie gießen.
Jetzt wird der schweigsame Kapitän also die Tiefe bestimmen, in der einer seiner Steuermänner bestattet werden soll.
Kapitän Svartman verbeugt sich vor Hanna, als sie zu ihm kommt. Trotz der Wärme trägt er seine Uniform. Die Knöpfe sind geschlossen, das Hemd ist gebügelt.
Neben ihm steht Bootsmann Peltonen, ein Finne. Er hält ein Bleilot in der Hand, an einer langen, dünnen Leine befestigt.
Kapitän Svartman nickt. Peltonen wirft das Lot über Bord und lässt es sinken. Die Leine gleitet zwischen seinen Fingern hindurch. Ein schwarzes Band ist an einem bestimmten Punkt an der Leine befestigt.
»Hundert Meter«, sagt Peltonen.
Er spricht schrill. Seine Stimme hallt, springt über die Dünung davon.
Nach sieben schwarzen Bändern, 700 Metern, ist die Leine zu Ende. Das Bleilot hat den Grund noch nicht erreicht. Peltonen macht einen Knoten, der die Leine mit einer neuen Rolle verbindet. Auch hier sind alle hundert Meter schwarze Bänder befestigt.
Bei 1935 Metern erschlafft die Leine. Das Lot hat den Boden erreicht. Hanna hat ein Grabmaß für ihren Mann bekommen.
Peltonen holt die Leine ein, indem er sie um eine riesige Holzspule wickelt. Kapitän Svartman nimmt die Kapitänsmütze ab und wischt sich den Schweiß aus der Stirn. Dann schaut er auf die Uhr. Viertel vor sieben.
»Um neun«, sagt er zu Hanna. »Bevor die Hitze zu drückend wird.«
Sie geht in die Kajüte, die sie mit ihrem Mann geteilt hat. Die obere Koje war seine. Meist haben sie zusammen in der unteren gelegen. Jemand hat seine Bettwäsche entfernt.
Sie setzt sich auf den Rand ihrer eigenen Koje und schaut auf das Schott auf der anderen Seite der engen Kajüte. Sie muss sich jetzt zum Nachdenken zwingen.
Wie ist sie nur hier gelandet? Auf einem Schiff, das sich auf einem fremden Meer wiegt? Sie, die an einem Ort geboren ist, der unendlich weit vom Meer entfernt ist? Im Wasser des Ljungans gab es einen Kahn, das war alles. Sie durfte ihren Vater begleiten, wenn er zum Angeln hinausfuhr. Aber als sie sagte, sie wolle schwimmen lernen, da war sie sieben oder acht Jahre alt, erlaubte er es nicht. Das sei Zeitverschwendung. Baden könne sie am Ufer des Flusses. Wollte sie hinüber zur anderen Seite, gebe es ein Boot und eine Brücke.
Sie legt sich in die Koje und schließt die Augen. In der Erinnerung springt sie möglichst weit zurück, hinein in die Kindheit, wo die Schatten immer länger werden.
Dort kann sie vielleicht Schutz finden, bis der Augenblick gekommen ist, in dem ihr toter Mann im Meer verschwindet.
5
Die Kindheit: weit, weit da unten. Wie in der Tiefe einer Erdspalte.
Das war Hanna Lundmarks erste Erinnerung: Die Kälte, die an den Holzwänden zerrte, dicht neben ihrem Gesicht, wenn sie schlief. Sie wachte oft auf und fühlte, wie dünn die Schicht zwischen den angeklebten Zeitungen, die in dem Haus der Armut die Tapeten ersetzten, und der Kälte war, die sich durch das Holz zu nagen versuchte.
Im Frühling überholte ihr Vater das Haus, als wäre es ein Schiff auf der Werft, um es vor dem nächsten Wintereinbruch stark zu machen.
Die Kälte war ein Meer, das Haus ein Schiff, der Winter ein endloses Warten. Bis tief in den Herbst hinein dichtete er die morschen Spanten ab, bis der Frost kam. Da musste es gehen, wie es war. Das Haus wurde vom Stapel gelassen, und was noch durchlässig für die Kälte war, musste eben so bleiben.
Ihr Vater hieß Arthur Olaus Angus Renström. Er war Waldarbeiter, fällte Bäume für Iggesund und teilte das Zugpferd mit den Brüdern Salomonsson, die weiter unten am Fluss wohnten. Er schuftete für einen kargen Lohn, ohne zu wissen, ob der Lohn reichte oder nicht.
Hanna hatte ihren Vater als stark in Erinnerung, mit einem freundlichen Lächeln. Aber mitunter schwermütig und in Gedanken versunken, die sie nicht kannte. Vielleicht hatte er Trolle im Kopf, wenn er abwesend am Küchentisch saß, die Hände schwer im Schoß. Er war da in seinem Haus, bei seiner Familie, aber trotzdem nicht anwesend. Da lebte er in einer anderen Welt, wo die Steine zu Trollen wurden, die Rentierflechten zu Haaren, der Wind in den Kiefern zum Gemurmel von allen, die schon tot waren.
Er sprach oft von ihnen. Allen, die vorangegangen waren. Es erschreckte ihn, dass so wenige jetzt noch lebten und so unheimlich viele schon tot waren.
Es gab eine Krankheit, eine Epidemie, deren Namen alle Frauen kannten, die Schlägerkrankheit. Sie brach aus, wenn die Männer Alkohol im Leib hatten und alle schlugen, die in Reichweite waren, vor allem die Kinder und die Frauen, die sie schützen wollten. Freilich trank der Vater manchmal, wenn auch nicht oft. Aber er wurde nie gewalttätig. Deshalb sorgte sich seine Frau, Hannas Mutter, mehr um seine Schwermut als um den Branntwein. Wenn er trank, wurde er weinerlich und fing an, Choräle zu singen. Er, der sonst am liebsten alle Kirchen niedergebrannt und die Pastoren in den Wald gejagt hätte.
»Ohne Schuhe«, schrie er, wie Hanna sich erinnern konnte. »Pastoren ohne Schuhe bei der schlimmsten Kälte in den Wald. Dorthin sollte man sie jagen, in den Wald, barfuß.«
Die Großmutter, die in einem zugigen Häuschen unten am Rand des Funäsdalen wohnte, erschreckte Hanna zu Tode, wenn sie von ihrem verdammten Schwiegersohn sprach: Seine ganze Nachkommenschaft würde er mit seinem gottlosen Gerede in die Hölle schicken. Dort warteten Verbrühungen und Schwefel und entsetzliche glühende Kohlen unter den Fußsohlen. Ihre Großmutter war eine strafende und drohende Predigerin mit bösen Augen, die nicht zögerte, ihre Enkel so furchtbar zu erschrecken, dass sie zu weinen anfingen und nachts nicht schlafen konnten. Hanna betrachtete es als die größte aller Plagen, wenn sie ihre Mutter auf ihren regelmäßigen Besuchen bei der Großmutter begleiten musste.
Sie erinnerte sich auch an die ständige Wut der alten Frau, die ihrer Tochter nicht verzeihen konnte, diesen untauglichen Renström geheiratet zu haben, ihrer Warnung zum Trotz. Wie konnte es sein, dass sie sich Hals über Kopf in diesen Mann verliebte, der nicht einmal äußerlich etwas hermachte? Er war klein, hatte O-Beine und schon mit fünfundzwanzig eine Glatze. Außerdem hatte er finnisches Blut, letzten Endes stammte er aus den Finnenwäldern, tief drinnen in Värmland, wo Tag und Nacht nie richtig voneinander zu unterscheiden sind.
Warum hatte sie keinen Mann gewählt, der aus Hede oder Bruksvallarna oder von irgendwoher stammte, wo redliche Leute lebten?
Hannas Mutter hieß Elin. Sie duckte sich vor ihrer alten Mutter weg, widersprach ihr nie, ließ es in der Stille versickern. Hanna verstand, dass man jemanden lieben konnte, der einen schlecht behandelte, wie seltsam das auch war. So musste es sich mit der Großmutter und Elin verhalten.
Elin.
Das war doch ein Name, der nicht richtig zu ihrer Mutter passte. Jemand, der Elin hieß, sollte schlank sein, mit feiner Haut und Händen wie Milch, mit hellen Haaren, die über den Rücken hinabfielen. Aber Elin Wallén, die Renström heiratete, war kräftig gebaut, hatte mausbraune, strähnige Haare, eine große Nase und nicht besonders regelmäßige Zähne. Wenn sie lächelte, fragte man sich verwirrt, wohin ihre Zähne eigentlich strebten. Es war, als wollten sie aus dem Mund heraus und sich davonmachen. Elin Renström war wirklich keine schöne Frau. Und das wusste sie. Vielleicht war sie auch traurig darüber, dachte Hanna, als sie groß genug war, um sich ihrem eigenen Gesicht im gesprungenen Rasierspiegel des Vaters zu widmen.
Aber ihre Mutter war nicht verzagt. Sie hatte Kraft, die sie nicht verschwendete. Sie kompensierte ihr Aussehen damit, über die Reinlichkeit in der Familie zu wachen. In ihrem Haus, so morsch und kalt es auch war, sollten Fußboden und Decke und Wände sauber sein, genau wie die Kinder und der eigene Körper. Elin jagte Läuse, als stürmte sie gegen ein feindliches Bataillon an. Sie füllte und entleerte die Blechwanne, in der alle badeten, trug Wasser vom Fluss herauf, brachte es zum Kochen, schrubbte und spülte all die Wäsche, die sich in Haufen stapelte.
Die vier Kinder konnten auch verwundert sehen, wie sie ihren Mann behandelte, wenn er schmutzig und erschöpft aus dem Wald zurückkehrte. Sie wusch ihn mit Bewegungen, als sänge sie das Hohelied der Liebe. Und er schien ihre Hände zu genießen, die schrubbten und abtrockneten, die die gebogenen und dicken Nägel schnitten und die so fein rasierten, dass die Wangen glatt wurden wie bei einem Säugling.
Die Kälte war also Hanna Lundmarks erste Erinnerung an das Leben. Die Kälte und der Schnee, der schon Ende September fiel und seinen Griff erst Anfang Juni lockerte, wenn die letzten weißen Flecken endlich wegschmolzen.
Da war natürlich auch die Armut. Sie war keine Erinnerung, sondern der Raum, in dem sie sich während des Heranwachsens aufhielt. Und sie war es auch, die sie schließlich aus dem Haus am Fluss vertrieb.
Damals war Hanna siebzehn, ihr Vater war schon tot. Sie verbrachte ihr Leben damit, ihrer Mutter mit den Geschwistern zu helfen, da sie die Älteste war. Es war ärmlich, aber es gelang ihnen, die schlimmste Not fernzuhalten.
Bis zum Jahr 1903. Auf den Sommer folgte eine schwere und lang anhaltende Dürre, und dann kam ein früher Frost, der das vernichtete, was die Trockenheit noch nicht versengt hatte.
Damals änderte sich ihr Leben.
Der Horizont: früher weit fort. Jetzt kam er näher. Wie eine Drohung.
6
Auch wenn sie sich nicht erinnern wollte: Es war ein Tag, den sie nie vergessen konnte.
Mitte August, niedrige Wolken, ein früher Morgen. Hanna war mit ihrer Mutter unterwegs und betrachtete die Verwüstung. Die Dürre, das Versengte. Die Erde war eigentümlich still. Das Mehl, das sie noch hatten, würde kaum bis zum Advent reichen. Sie würden auch nicht genug Heu haben, um die einzige Kuh den Winter über zu füttern.
Als sie da über die toten Felder gingen, die an einem Hang hinunter zum Fluss lagen, sah Hanna ihre Mutter Elin zum ersten Mal weinen. In der langen Zeit, als ihr Vater auf dem Krankenbett gelegen hatte, bis er schließlich starb, hatte Elin nur die Augen geschlossen, blind gegenüber dem unausweichlichen Ende und der hoffnungslosen Einsamkeit. Aber sie hatte nicht geweint, nicht geschrien. Hanna hatte oft daran gedacht, wie Elin ihren Schmerz nach innen kehrte, wo es eine heimliche Kraft gab, die alle Qual besiegte.
Damals erkannten sie, wie nahe die Not jetzt gekommen war, und Elin sprach mit Hanna darüber, dass sie fortgehen müsse. Am Fluss gebe es keine Zukunft für sie. Sie müsse versuchen, an der Küste ihr Auskommen zu finden. Damals, als Elin und ihr Mann zum Flussufer gekommen waren und den ärmlichen Hof von einem Onkel übernommen hatten, da hätten sie keine Wahl gehabt. Es war 1883, nur sechzehn Jahre nach dem letzten großen Dürrejahr im Land. Wenn die Not jetzt wieder auf dem Weg sei, müsse Hanna fortgehen, solange noch Zeit war.
Sie standen am Waldrand, wo der stille Acker endete.
»Jagst du mich weg?«, fragte Hanna.
Elin strich sich über die Nase, wie sie es immer tat, wenn sie verlegen war.
»Ich bringe drei Kinder durch«, sagte sie, »aber nicht vier. Du bist erwachsen, du kannst fortgehen und es dir selbst und mir leichter machen. Ich will nur, dass du die Möglichkeit bekommst zu leben. Hier kannst du bestenfalls überleben, nicht mehr.«
»Was kann ich tun, wovon jemand unten an der Küste Nutzen hat?«
»Dasselbe, was du hier tust. Auf Kinder aufpassen, mit deinen Händen arbeiten. Mägde werden in den Städten immer gebraucht.«
»Wer sagt das?«
Sie hatte nicht widersprechen wollen. Aber Elin fasste es als Naseweisheit auf und packte sie fest am Arm.
»Ich sage das, und du kannst mir glauben, dass ich jedes Wort meine, das aus meinem Mund kommt. Ich tue es nicht, weil es mir Freude macht, sondern weil es sein muss.«
Sie ließ sie rasch los, als bereute sie alles.
Hanna verstand plötzlich, dass das, was ihre Mutter bestimmte, ihr sehr schwer fiel.
Diesen Augenblick vergaß sie nicht: Genau dort, am Rand der grimmigen Landschaft der Not, an der Seite ihrer Mutter, die zum ersten Mal weinte, wurde ihr bewusst, dass sie sie selbst war und niemand sonst.
Sie war Hanna und nicht austauschbar. Weder ihr Körper noch ihre Gedanken konnten von einem anderen Menschen ersetzt werden. Sie dachte auch, dass ihr verstorbener Vater genau wie sie gewesen war, ein nicht austauschbarer Mensch.
Ist es das, was es heißt, erwachsen zu werden? Sie wandte ihr Gesicht ab, damit ihre Mutter ihre Gedanken nicht lesen könnte. Die Unsicherheit der Kindheit gegen etwas anderes Unbekanntes einzutauschen? Zu wissen, dass es keine anderen Antworten gibt als die, die du selbst suchen und finden musst?
Sie kehrten zum Haus zurück, das sich in einem Wäldchen von spärlichen Birken und einem einzigen Ebereschenbaum duckte. Die Geschwister waren im Haus, obwohl es nicht herbstlich kalt war. Aber sie spielten weniger, wenn sie hungrig waren. Ihr Leben war ein einziges Warten auf Essen, nicht viel mehr.
Direkt vor der Tür blieben sie stehen, als hätte Elin beschlossen, ihre Tochter nie wieder einzulassen.
»In Sundsvall lebt mein Onkel Axel«, sagte sie. »Axel Andreas Wallén. Er arbeitet im Hafen. Er ist ein guter Mann, er und seine Frau Dora haben keine Kinder. Sie hatten zwei Jungen, aber beide starben, und dann bekamen sie keine mehr. Axel und Dora werden dir helfen. Sie werden dich nicht abweisen.«
»Ich will nicht wie eine Bettlerin dastehen«, sagte Hanna.
Die Ohrfeige kam ohne Vorwarnung. Später dachte Hanna, der Schlag hätte sie getroffen wie ein Raubvogel im Sturzflug, der auf ihre Wange gezielt hatte.
Vielleicht war es früher gelegentlich vorgekommen, aber dann aus Angst, dass Elin sie geschlagen hatte. Wenn Hanna allein an dem reißenden Frühlingsfluss gewesen war und es riskiert hatte, hineinzufallen und hinabgezogen zu werden. Aber jetzt hatte Elin sie aus Empörung geschlagen. Es war das erste Mal.
Die Ohrfeige wurde einer Erwachsenen von einer anderen Erwachsenen gegeben. Die verstehen würde, warum.
»Ich schicke meine Tochter nicht weg, damit sie eine Bettlerin wird«, sagte Elin erregt. »Ich will dein Bestes. Hier gibt es keine Zukunft für dich.«
Hannas Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. Nicht vor Schmerz, sie hatte schon Schlimmeres erlitten.
Die Ohrfeige war eine Bestätigung dessen, was sie gerade gedacht hatte: Jetzt war sie allein auf der Welt. Sie würde sich nach Osten begeben, zur Küste, und sie durfte sich nicht umdrehen. Was hinter ihr lag, würde versinken.
Es war früh im Herbst 1903. Hanna Renström war siebzehn Jahre alt und würde am 12. Dezember achtzehn werden.
Ein paar Monate später würde sie ihr Zuhause für immer verlassen.
7
Hanna dachte: Die Zeit der Märchen ist vorbei. Jetzt gelten die Erzählungen des Lebens.
Das verstand sie, als Elin ihr sagte, was sie erwartete: Es kam vor, dass Kaufleute von der Küste, die durch die Wintertäler zum Markt von Röros fuhren und dann wieder zurückkehrten, nicht den kürzesten Weg nahmen, entlang des Ljusnan und hinunter nach Kårböle. Einige fuhren nach Norden, nachdem sie wieder über die norwegische Grenze zurückgekommen waren, bogen über die Flatruet ab, wenn das Wetter es erlaubte, um Geschäfte in den Dörfern entlang des Ljungans zu machen.
Jonathan Forsman pflegte regelmäßig den Heimweg über die Dörfer nördlich der Flatruet zu nehmen.
»Er hat einen großen Schlitten«, sagte Elin. »Auf dem Rückweg ist er nie so stark beladen wie auf dem Hinweg nach Röros. Er gibt dir bestimmt einen Platz. Und er lässt dich in Ruhe. Er rührt dich nicht an.«
Hanna sah sie fragend an. Wie konnte Elin da so sicher sein? Hanna wusste, was sie im Leben erwartete, schließlich hatte auch sie Freundinnen zum Schwatzen gehabt. Nicht zuletzt die Sennerinnen, die ihr kichernd viele sonderbare Dinge erzählt hatten, manchmal auch mit kaum verhohlener Unruhe.
Hanna wusste, was es hieß, zu erröten, wusste, was plötzlich im Körper geschehen konnte, besonders abends, kurz vor dem Einschlafen.
Aber mehr war es nicht. Wie konnte Elin wissen, was während einer langen Schlittenfahrt zur fernen Küste geschah oder nicht geschah?
Sie fragte geradeheraus.
»Er ist bekehrt«, sagte Elin schlicht. »Vorher war er ein entsetzlicher Mann, wie die meisten von diesen Wolfsmännern mit ihren Schlitten. Aber seit er bekehrt ist, verhält er sich wie ein barmherziger Samariter. Er lässt dich mitfahren und wird dafür nicht einmal Bezahlung nehmen. Er wird dir einen seiner Pelze borgen, du wirst nicht frieren.«
Allerdings konnte Elin nicht sicher sein, ob er kam oder wann. Der übliche Zeitpunkt war irgendwann vor Weihnachten. Aber manchmal war er erst zu Neujahr gekommen. Oder war ganz ausgeblieben.
»Tot kann er natürlich auch sein«, sagte Elin.
Wenn ein Schlitten im Schneetreiben verschwand, wusste man nicht, ob es das Letzte war, was man von einem Menschen sah, sei er jung oder alt.
Hanna würde vom 12. Dezember an reisefertig sein. Jonathan Forsman hatte es immer eilig. Im Gegensatz zu Leuten, die alle Zeit der Welt hatten, war er bedeutend und lebte in großer Eile.
»Er kommt meist am Nachmittag«, sagte Elin. »Durch den Wald nach Süden, auf dem Schlittenweg, der dem Rand des Moors folgt und hinunter zur Flussfurche und den Tälern führt.«
Jeden Tag ging Hanna am Nachmittag, wenn die Dunkelheit hereinbrach, zum Schlittenweg und schaute zum Wald hin. Mitunter meinte sie eine ferne Pferdeschelle zu hören. Aber niemand kam. Die Tür des Waldes blieb geschlossen.
In der Zeit dieses unruhigen Wartens schlief sie schlecht, wachte oft auf, hatte wirre Träume, die sie erschreckten, ohne dass sie eigentlich wusste, warum. Oft waren ihre Träume nur weiß wie der Schnee, leer, lautlos.
Einen Traum hatte sie jedoch, der wiederkehrte und sie verfolgte: Sie lag mit zwei Geschwistern im Ausziehbett, mit dem jüngsten Sohn, Olaus, und der Schwester, die ihr im Alter am nächsten war, Vera, der Zwölfjährigen. Sie spürte die warmen Körper der Kinder, aber sie wusste, dass es unbekannte Kinder wären, wenn sie die Augen aufschlüge. Und in dem Augenblick, in dem sie sie sah, würden sie sterben.
Dann erwachte sie und begriff mit grenzenloser Erleichterung, dass es nur ein Traum war. Oft blieb sie dann wach liegen und schaute auf das blaue Mondlicht, das durch die niedrigen mit Eiskristallen überzogenen Fenster fiel. Mit der Hand betastete sie die Holzwand und das Zeitungspapier. Dicht neben ihr war die Kälte, die an dem alten Holz zog und zerrte.
Die Kälte ist wie ein Tier, dachte sie. Ein Tier, eingesperrt in seinen Verschlag. Ein Tier, das ins Freie will.
Der Traum bedeutete etwas, es musste etwas mit ihrer Reise zu tun haben. Was erwartete sie? Was würde von ihr verlangt werden? Sie fühlte sich linkisch, wenn sie sich Stadtmenschen vorstellte. Wäre ihr Vater noch am Leben, hätte er ihr davon erzählen und sie vorbereiten können. Er war einmal in Stockholm gewesen und auch in einer anderen großen und bemerkenswerten Stadt, die Arboga hieß. Er hätte ihr sagen können, dass sie keine Angst zu haben brauchte.
Elin stammte aus dem Funäsdalen und war noch nie woanders gewesen, hatte nur diese Reise nach Norden gemacht, zusammen mit dem Mann, den sie heiraten würde. Nun war sie es, die antworten musste, wenn Hanna mit ihren Fragen kam.
Aber Elins Antworten: stumm, karg. Es war so wenig, was sie wusste.
8
An einem Tag Anfang November, als Hanna und ihre Mutter mit Axt und Säge am Waldrand Brennholz sammelten, hatte sie nach dem Meer gefragt. Wie sah es aus? Strömte es wie der Fluss in einer Furche? Hat es die gleiche Farbe? War es überall so tief, dass man keinen Boden unter den Füßen hatte?
Elin hatte sich ans schmerzende Kreuz gefasst und sie lange angesehen, ehe sie antwortete.
»Ich weiß nicht«, sagte sie. »Das Meer ist wie ein großer See, glaube ich. Wellen gibt es wohl. Aber ob das Meer strömt, kann ich nicht beantworten.«
»Aber Renström muss doch davon erzählt haben. Er ist doch zur See gefahren, hat er gesagt.«
»Das ist vielleicht nicht ganz wahr. Was er sagte, hat oft nur in seinem Kopf stattgefunden. Aber über das Meer hat er nur gesagt, dass es groß ist.«
Elin bückte sich, um die Äste und Zweige einzusammeln, die sie gesägt und gehackt hatten. Aber Hanna wollte noch nicht aufgeben. Ein Kind hört auf zu fragen, wenn es spürt, dass es genug ist. Aber sie war jetzt erwachsen, sie durfte weiterfragen.
»Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet«, sagte sie. »Werde ich in einem Haus zusammen mit anderen wohnen? Werde ich mit jemandem das Bett teilen?«
Elin warf mit einer verbitterten Bewegung Äste in den Korb aus Birkenrinde.
»Du fragst zu viel«, sagte sie. »Ich kann nicht wissen, was dich erwartet. Aber hier erwartet dich nichts. Dort gibt es jedenfalls Menschen, die dir helfen können.«
»Ich will es ja nur wissen«, sagte Hanna.
»Frag jetzt nicht mehr«, sagte Elin. »Mir wird der Kopf schwer von all deinen Fragen. Ich habe keine Antworten.«
Sie kehrten schweigend zum Haus zurück, wo der dünne Rauch senkrecht in den blauen Himmel stieg. Olaus und Vera bewachten das Feuer. Aber Elin und Hanna entfernten sich immer nur so weit, dass sie auf einen großen Stein klettern und einen Blick auf den Schornstein werfen konnten, um zu sehen, ob das Feuer nicht erloschen war. Oder schlimmer: Ob es aus dem offenen Herd gelangt war und begonnen hatte, mit seinen Flammen um sich zu schlagen.
In den Nächten schneite es, jeder Morgen empfing sie mit Frost. Aber der wirklich schwere Schneefall, der nie weniger als drei Tage anhielt, war noch nicht über das westliche Fjäll geschlichen gekommen. Und Hanna wusste, ohne befahrbaren Schnee würde sich kein Schlitten durch den Wald von den Straßen weiter im Süden nähern.
Ein paar Tage später kam jedoch der Schnee. Wie fast immer kam er lautlos in der Nacht. Als Hanna aufstand, um im Herd Feuer zu machen, stand Elin an der Tür, die sie einen Spalt weit geöffnet hatte.
Sie stand regungslos, spähend. Draußen war der Boden weiß. Schneewehen hatten sich an den Wänden des Hauses gesammelt. Hanna sah Krähenspuren im Schnee, vielleicht auch Spuren von einer Maus und einem Hasen.
Es schneite ununterbrochen.
»Dieser Schnee wird liegen bleiben«, sagte Elin. »Jetzt ist es Winter. Kein nackter Boden vor dem Frühling, Ende Mai, Anfang Juni.«
Die ganze folgende Woche schneite es weiter. Die Kälte war zunächst nicht schlimm, nur ein paar Grad minus. Aber nach den Schneefällen klarte der Himmel auf, und die strenge Kälte schlug zu.
Sie hatten ein Thermometer, das Renström vor langer Zeit auf einem Markt gekauft hatte. Oder hatte er es beim Armdrücken oder Fingerhakeln gewonnen? Das Thermometer hatte eine Kerbe, damit man es an der Außenwand befestigen konnte. Es wurde sorgsam gehütet, denn es bestand die Gefahr, dass jemand unachtsam war und das kleine Rohr zerschlug, in dem das gefährliche Quecksilber eingesperrt war. Vorsichtig steckte Elin es in den Schnee hinter dem Haus, wo immer Schatten war. Drei Tage hintereinander waren es jetzt mehr als dreißig Grad unter null.
Während der kältesten Tage heizten sie ununterbrochen und sorgten dafür, dass die Kuh und die beiden Ziegen etwas zum Kauen bekamen. Sie selbst aßen von dem wenigen, was es gab. Sie setzten all ihre Kräfte dafür ein, die Kälte fernzuhalten. Jeder neue Minusgrad war, als würde eine weitere feindliche Truppe ihre Belagerung verstärken.
Hanna sah, dass Elin Angst hatte. Was würde geschehen, wenn etwas zerbrach? Ein Fenster? Eine Wand? Sie hatten nichts, wohin sie fliehen könnten, außer dem kleinen Viehstall, in dem die Tiere standen. Aber auch die froren, und man konnte dort kein Feuer machen.
Während dieser eiskalten Tage spürte Hanna, dass die Veränderung auch etwas anderes bedeuten könnte. Eine Öffnung in einem dunklen Hochwald, wo das Sonnenlicht plötzlich auf eine Lichtung fiel. Ein Leben, das besser werden könnte als dieses von feindlichen Armeen belagerte Dasein. Die Angst vor dem Unbekannten wurde auch zu einer Sehnsucht nach dem, was sie vielleicht erwartete. Jenseits der Wälder, der wogenden Bergrücken im Südosten.
Davon sagte sie jedoch nichts zu Elin. Sie schwieg über ihre unklare Sehnsucht.
9
Am 17. Dezember, nachmittags kurz nach halb drei, ertönte Schellenklang aus dem Wald. Es war Vera, die die Pferde hörte. Sie war bei den Hühnern, um nachzusehen, ob sie trotz der Kälte Eier gelegt hatten. Als sie sich mit leeren Händen durch den schmalen Pfad tastete, der in dem meterhohen Schnee freigeschaufelt worden war, hörte sie die Schellen. Elin und Hanna kamen heraus, als sie rief. Die schlimmste Kälte hatte jetzt nachgelassen, die Tage zuvor hatte es getaut, aber jetzt hatte sich über Nacht puderweißer Neuschnee auf die Schneekruste gelegt.
Das Schellengeräusch näherte sich, dann tauchte das schwarze Pferd wie ein Troll oder ein Bär am Waldrand auf. Der eingemummelte Kutscher straffte die Zügel und hielt genau vor dem Häuschen an, das eingebettet in Schnee und Elend dort lag.
Da hatte Elin schon die erlösenden Worte zu Hanna gesagt: »Es ist Jonathan Forsman.«
»Wie kannst du sicher sein?«
»Niemand hat ein so schwarzes Pferd wie er. Und so viele Pelze hat auch niemand an.«
Hanna sah, dass das stimmte, als der Mann aus dem Schlitten geklettert war und in das Häuschen kam. Er trug Pelze von Bär und Wolf, saß während der Fahrt auf Rentierfellen und hatte einen Rotfuchs um den Hals. Als er sich aus all diesen Pelzen schälte, aus denen Schnee und Schweiß tropften, war es, wie einen Mann auftreten zu sehen, der viel zu lange an einem Feuer gesessen hatte. Sein Gesicht war bärtig und rot, die verschwitzten Haare klebten an der Stirn. Aber Hanna erkannte sofort, dass Elin recht gehabt hatte. Der Mann, der sie vielleicht mitnehmen würde, war weder bedrohlich noch bösartig. Er war freundlich, setzte sich auf einen Schemel am Feuer und schenkte Elin ein Gesangbuch, das er in Röros gekauft hatte.
»Es ist auf Norwegisch«, sagte er. »Aber der Einband ist schön, echtes Leder, und die Schließen glänzen, wenn man sie sauber hält. Und du kannst wohl ohnehin nicht lesen, Elin Renström. Oder irre ich mich?«
»Ich buchstabiere mich durch«, sagte Elin. »Wenn man das lesen nennen kann, dann tu ich das.«
Erst abends, als die kleineren Kinder eingeschlafen waren, sprach Elin die Frage nach Hannas Reise an. Sie saßen am Feuer. Jonathan Forsman ließ seine großen Hände ruhen. Ehe die Geschwister eingeschlafen waren, hatte er mit seiner gesprungenen Stimme einen Choral vorgetragen. Hanna hatte noch nie einen Mann so singen hören. Der Pastor, der in Ljungdalen den Gottesdienst hielt, hatte eine piepsige Stimme. Es klang, als würde ihn jemand kneifen, wenn er einen Choral anstimmte. Aber hier war ein Mann, der so sang, dass sogar die Kälte in den Wänden zu verstummen schien.
Elin sagte, wie es war. Einige wenige Worte, mehr war nicht nötig.
»Kannst du Hanna mitnehmen?«, fragte sie. »Sie soll nach Sundsvall, wo Verwandte sich um sie kümmern werden.«
Jonathan Forsman hörte ihr nachdenklich zu. »Bist du sicher?«, fragte er.
»Warum sollte ich nicht sicher sein? Weshalb sollte ich zögern?«
»Ob die Verwandtschaft sie aufnimmt? Ist es die von Renströms Seite?«
»Von meiner, den Walléns. Wäre es die von Renströms, würde ich sie auf keinen Fall hinschicken.«
»Und sie wissen, dass sie kommt?«
»Nicht, dass es Hanna ist. Aber eins von den Kindern. Das haben wir gesagt, als wir uns gesprochen haben.«
Jonathan Forsman sah lange auf seine Hände hinab. »Wie lange ist das her?«, fragte er dann. »Dass ihr euch gesprochen habt?«
»Vier Jahre jetzt im Frühjahr.«
»Viel kann in so langer Zeit geschehen sein«, sagte Jonathan Forsman. »Aber ich werde sie mitnehmen. Dann können wir nur hoffen, dass es jemand da gibt, der sie haben will.«
»In vier Jahren können doch nicht alle gestorben sein«, sagte Elin bestimmt. »Wenn es da nicht eine tödliche Epidemie gegeben hat, die uns hier oben im Fjäll nicht erreicht hat.«
Jetzt fasste Jonathan Forsman Hanna zum ersten Mal ins Auge. »Wie alt bist du?«, fragte er.
»Ich bin gerade achtzehn geworden.«
Jonathan Forsman nickte. Er stellte keine weiteren Fragen. Das Feuer brannte.
In dieser Nacht schlief Jonathan Forsman auf dem Boden neben der Feuerstelle. Er lag auf seinen ausgebreiteten Pelzen und deckte sich nur mit den Rentierfellen zu. Das Pferd hatte im Stall Platz gefunden, zwischen Kuh und Ziegen gedrängt.
Hanna lag lange wach. Seit ihr Vater gestorben war, hatte kein Mann im Haus geschlafen. Jetzt war da wieder einer, der im Schlaf schnarchte und schnaufte.
Forsman schlief mit stöhnenden Atemzügen, als würde er eine schwere Bürde tragen.
Am nächsten Tag fielen einzelne Flocken vom Himmel. Das Quecksilber zeigte zwei Grad unter null. Morgens um kurz nach acht setzte Hanna sich mit ihren beiden Bündeln in den Schlitten. Sie hatte alles angezogen, was sie besaß, und Jonathan Forsman hüllte sie in noch mehr ein, so dass sie sich kaum rühren konnte.
Die Geschwister weinten, als sie sie zum Abschied umarmte, erst einzeln, dann alle zusammen.
Aber Elin gab sie nur die Hand. Es war, wie es war. Sie hatte beschlossen, sich nicht umzudrehen, wenn sie im Schlitten saß. Innerlich weinte sie, als Jonathan Forsman die Peitsche schnalzen ließ und das schwarze Pferd mit dem Schlitten losruckelte. Aber sie zeigte es nicht.
Sie dachte an ihren Vater. Es war, als stünde auch er da, neben Elin, und sähe, wie sie aufbrach.
Gerade in diesem Moment war er zurückgekehrt. Er wollte dabei sein.
Es war 1903, das Jahr, in dem wieder eine große Not über das nördliche Schweden hinwegzog.
10
Die Schlittenfahrt von Ljungdalen zur Küste würde fünf Tage dauern. Das hatte Jonathan Forsman zu Elin gesagt, fast als hätte er ein Versprechen gegeben.
»Länger nicht«, sagte er. »Der Schnee ist geführig, ich habe nicht viele Geschäfte, die uns aufhalten. Wir machen nur halt, um zu essen und zu schlafen. Wir folgen dem Fluss, biegen nach Norden ab und fahren durch den Hochwald direkt nach Sundsvall. Es dauert fünf Tage, nicht mehr.«
Aber die Schlittenfahrt sollte länger dauern. Schon am zweiten Tag, bevor sie überhaupt den Wald erreicht hatten, der die Grenze zwischen Jämtland und Härjedalen bildete, zog ein Schneesturm von Osten auf, den Jonathan Forsman nicht vorhergesehen hatte. Der Himmel war klar gewesen, der Tag kalt, der Schnee geführig. Aber plötzlich hatten die Wolken sich aufgetürmt. Sogar Antero, Forsmans schwarzes Pferd, begann unruhig zu werden.
Sie kehrten in einem Gasthof in Överhogdal ein. Hanna bekam einen Schlafplatz in einem Zimmer mit den Mägden der Pension. Aber beim Essen saß sie mit Jonathan Forsman am Tisch und wurde bedient wie er. Das war noch nie in ihrem Leben geschehen.
»Wir fahren morgen weiter«, sagte er, nachdem er ein Tischgebet gesprochen und darauf geachtet hatte, dass auch sie die Hände faltete.
Doch in dieser Nacht drehte der Wind nach Norden, und Forsman entschloss sich zum Bleiben. Der starke Wind und der Schneefall zogen nicht weiter. Sie blieben eingeschneit in dem grauen Gasthof. In weniger als vier Stunden fiel ein halber Meter Neuschnee, und der Sturm türmte die Schneewehen an einigen Stellen bis zum First des Hauses.
Erst am Nachmittag des vierzehnten Reisetages, gerade in der kurzen Dämmerung, kamen sie in Sundsvall an. Hanna hatte die Tage gezählt, aber nicht bedacht, dass an diesem Abend Silvester war. Am Tag darauf würde das Jahr 1904 beginnen.
Für Jonathan Forsman schien der Jahreswechsel bedeutungsvoll zu sein. Er trieb das Pferd an, da er vor Mitternacht in der Stadt sein wollte. Für Hanna war Silvester nie etwas Besonderes gewesen. Meistens hatte sie geschlafen, wenn das neue Jahr kam. Sie konnte sich nicht erinnern, dass der Jahreswechsel für ihren Vater und ihre Mutter ein Grund zum Feiern war.
Dass sie den Weihnachtsabend und den ersten Weihnachtstag gemeinsam verbracht hatten, bedeutete für Forsman wenig oder gar nichts. Es war der Jahreswechsel, der zählte.
Die lange Schlittenfahrt durch die Wälder und weiten Felder hatte unter Schweigen stattgefunden. Hin und wieder hatte Jonathan Forsman dem Pferd etwas zugerufen. Aber mit Hanna hatte er nicht gesprochen. Er saß wie eine Wand vor ihr im Schlitten.
An diesem letzten Reisetag war es jedoch anders. Er drehte den Kopf und rief ihr etwas zu, und sie schrie ihre Antworten laut heraus, damit er hören konnte, was sie sagte.
Jonathan Forsman sah etwas Heiliges im Jahreswechsel. »Gott hat ihn erschaffen, damit wir die Zeit bedenken, die hinter uns liegt, und die, die wartet«, rief er im Schlitten nach hinten.
Bevor er bekehrt worden war, hatte er sich an Silvester mit heidnischen Bräuchen beschäftigt. Er hatte Blei gegossen und versucht, in dem erstarrten Klumpen die Zukunft zu lesen. Auch hatte er sich nie dem neuen Jahr zu nähern gewagt, ohne sich ordentlich zu betrinken.
»Aber jetzt lebe ich im Licht«, rief er. »Es gibt nichts mehr, wovor ich mich fürchten würde.«
Die Stadt Sundsvall lag in Dunkelheit und Kälte, als sie ankamen. Forsman straffte schon am Stadtrand die Zügel. Was sich Hanna auch immer unter der Stadt vorgestellt hatte, sie konnte es jetzt nicht erkennen. Das meiste lag noch vor ihr, als sie sich aus den Pelzen schälte und aus dem Schlitten stieg.
Jonathan Forsmans Haus war aus Stein und hatte zwei mächtige Stockwerke. Als er die Zügel anzog, kamen viele Leute aus der Eingangstür und dem Hinterhaus. Antero wurde versorgt, der Schlitten weggezogen, was an Fellen und anderen Waren übrig war, wurde ins Haus getragen. Hanna war verwirrt von allem, was rings um sie her geschah, all diese fremden Menschen, die sie neugierig ansahen, manche offen, andere verstohlen. Sie war daran gewöhnt, unbekannte Menschen zu treffen. Manchmal war es ein Landstreicher gewesen, der sich am Fluss verirrt hatte, manchmal waren es Reisende oder Leute mit Äxten und Sägen aus dem Wald, die ihr Vater mit nach Hause gebracht hatte. Aber nie war es so wie jetzt, nie dieses Gewimmel von Unbekannten.
Forsman bemerkte ihre Verunsicherung und rief mit lauter Stimme, das Mädchen in seiner Gesellschaft heiße Hanna Renström und wolle Verwandte in Sundsvall besuchen. Aber für diese Nacht, die letzte des Jahres, sei sie unter seinem Dach willkommen.
Um Mitternacht hatte Forsman seine Familie und alle Angestellten versammelt, auch die Pferdeknechte und die Mägde. In dem großen Zimmer, das als »Saal« bezeichnet wurde, öffnete er ein Fenster weit und bat alle, still zu sein. Die Uhr der Kirche von Sundsvall schlug. Hanna sah, wie Forsman schweigend die Schläge zählte, während er blanke Augen bekam.
Zu ihrem Entsetzen war er tatsächlich kurz davor, in Tränen auszubrechen. Nie in ihrem früheren Leben hätte sie sich vorstellen können, dass ein erwachsener Mann weinen könnte. Ihre Kehle war wie zugeschnürt, sie verstand, dass wirklich etwas Wichtiges geschah, als das Glockengeläut, getragen von der Kälte, durch das offene Fenster hereindrang. Als die Glocken schließlich verstummt waren, stimmte Forsman einen Choral an, und alle, die versammelt waren, fielen ein, auch Hanna, wenn auch nur verstohlen.
In dieser Nacht schlief sie zusammen mit drei Mägden des großen Steinhauses in einem Zimmer. Sie teilte das Bett mit Berta, die in ihrem Alter war. Sie roch nicht ganz reinlich, und Hanna fürchtete, dass sie selbst nicht viel besser roch. Berta schubste sich zurecht, nahm den meisten Platz ein und vertraute Hanna düster an, sie müsse um fünf Uhr aufstehen, obwohl es der Neujahrstag war, der fast als Sonntag galt. Aber sie sollte Feuer machen und die Kachelöfen mit dem Holz heizen, das die Knechte hereintrugen.
Berta schlief bald ein. Aber Hanna lag wach und dachte, dass etwas fehlte. Es dauerte lange, bis sie darauf kam, was es war.
Es knackte nicht in den Steinmauern. Die Kälte drang nicht durch die Wände wie daheim im Holzhaus.
Und erst da, in dem Bett an der Steinwand, überfiel sie das Heimweh. Sie befand sich in einer fremden Welt, sie konnte nicht mehr die Hand ausstrecken und ihre Geschwister berühren oder die schweren Atemzüge von Elin hören.
Sie war weit fort, mitten in dem, was für sie ganz neu und unbekannt war.
Vorsichtig legte sie die Hand auf Bertas warmen Körper. Ihr fehlten die Geschwister, die sie früher immer umringt hatten. Sie war allein, und sie wusste nicht, wie sie mit der Leere umgehen sollte, die um sie her wuchs.
11
Am nächsten Tag beauftragte Forsman Jukka, den zuverlässigsten seiner Angestellten, mit Hanna ihre Verwandten zu suchen. Von Elin hatte er eine Adresse bekommen, aber sie war vage gewesen, und Sundsvall war keine Stadt, in der Straßen und Hausnummern immer stimmten.
Schlimmer war, dass Forsman, der alle in der Stadt zu kennen meinte, nichts von irgendwelchen Walléns gehört hatte. Das hatte er Elin jedoch nicht gesagt. Er hatte angenommen, sie wohnten vielleicht bei einem Sägewerk in der Nähe von Sundsvall.
Die Kälte hatte nachgelassen. Sie biss Hanna nicht mehr in die Haut wie während der langen Schlittenfahrt.
Forsman begleitete sie auf die Straße hinaus.
»Wenn du keine Familie findest, bringst du sie wieder zurück«, wies er Jukka an, der eingeschüchtert wirkte, unsicher gegenüber dem mächtigen Mann in seinem Pelz. Er war bestimmt schon sechzig Jahre alt, aber trotzdem ängstlich wie ein Kind, das Schläge fürchtet.
Das verstand Hanna nicht.
Sie gingen los, und bald war Jukka wie verwandelt. Jetzt spuckte er aus und lief breitbeinig, schubste Leute, die nicht aus dem Weg gingen, und schien über die schlecht geräumte Straße zu herrschen.
Im bleichen Winterlicht sah Hanna die Stadt. Mit jedem der großen Steinhäuser, an denen sie vorbeigingen, schienen zehn baufällige Hütten aus dem Boden geschossen zu sein. Wie Pilze, dachte sie. Während Steinhäuser essbare Pilze sind und in den Korb gelegt werden, sind die Holzhäuser nur etwas, was man zertritt.
Die Unruhe setzte ihr zu. Würde sie in die Stadt passen? Oder war sie jemand, der hier nie heimisch werden könnte?
Schließlich gab es auch das Meer zu entdecken. Da war ein Hafen, in dem große Schiffe lagen, einige mit Masten, andere mit schwarzen Schornsteinen. Aber das Wasser war nicht unendlich, wie ihr Vater gesagt hatte. Sie sah überall Land, nirgends ahnte sie offenes Wasser jenseits des Eises mit seinen Rinnen und Spalten.
Jukka trieb sie an, wenn sie stehenblieb. Er schien auch nicht mehr Zeit zu haben als sein Hausherr, dieselbe Eile.
Sie folgten dem vereisten Hafenbecken. Mehrmals wäre Hanna fast ausgerutscht und gefallen. Ihre Schuhe, die ein Flickschuster in Fjällnäs angefertigt hatte, waren für den eisglatten Straßenbelag nicht geeignet.
Sie kamen zu einer Ansammlung von Holzhütten, die einander zu umarmen schienen, um die Wärme zu halten.
Jukka blieb stehen und fragte einen Mann, der einen holzbeladenen Schlitten zog. Die Adresse? Wallén? Der stark hustende Mann, der eine große Brandwunde an der einen Wange hatte, wies in eine Richtung und versuchte zu erklären. Jukka drängte ihn ungeduldig, hob zum Dank die Hand an seine Pelzmütze, und sie gingen weiter.
»Hier kann kein Teufel sich zurechtfinden«, murmelte er in seiner singenden Sprache. »Hier findet sich keiner zurecht, aber ich glaube trotzdem, dass es hier ist.«
Er blieb vor einem zweistöckigen Holzhaus stehen, mit schrägem Dach, geflickten und abgedeckten Fenstern und einer Tür, die aus ihrem Rahmen herauszuragen schien. Jukka klopfte fest an die Tür. Sie wurde sofort von einer alten Frau geöffnet, die so dick in Schals eingemummelt war, dass Hanna nur Augen und Nase sehen konnte.
»Wallén«, sagte Jukka. »Wohnt eine Familie dieses Namens hier im Haus?«
Die Alte zuckte zusammen, als hätte er sie geschlagen. Dann sagte sie etwas, was er nicht verstand.
»Nimm den Schal ab, Alte«, schrie er. »Ich komme mit einer Nachricht von Kaufmann Jonathan Forsman. Er möchte wissen, ob hier jemand wohnt, der Wallén heißt. Und ich kann nicht verstehen, was du piepst, mit dem Mund hinter all deinen Lumpen!«
Die alte Frau zog den Schal weg, und Hanna sah, dass ihr Gesicht ausgemergelt war, als müsste sie häufig hungern.
»Die Familie Wallén«, wiederholte Jukka und zeigte unbeherrscht seine Ungeduld.
»Sie sind abgereist«, sagte die Alte.
»Was heißt das? In den Himmel oder in die Hölle abgereist? Antworte jetzt ordentlich, ehe ich die Geduld verliere.«
Die Alte zog sich bei dieser Drohung zurück, aber Jukka stellte seinen großen Stiefel zwischen Tür und Rahmen.
»Hier im Haus ist nur noch ein alter Mann«, sagte sie. »Sie haben ihn zurückgelassen. Wohin sie gefahren sind, weiß ich nicht.«
Jukka kaute auf seiner Unterlippe herum und versuchte sich zu entscheiden, was er sagen sollte.
»Wir müssen hineingehen und mit dem Alten reden«, sagte er schließlich. »Zeig uns, wo er wohnt!«
Die Alte führte sie eine Treppe hinauf. In den Türen standen bleiche Kinder und starrten die Fremden mit großen Augen an. Es roch säuerlich und herb, als würde das Haus nie gelüftet.
Sie gingen weiter, hinauf zum Speicher, wo die Alte schließlich an eine Tür klopfte und sich dann schnellstens davonmachte. Nachdem Jukka die Tür geöffnet hatte, schob er Hanna hinein.
»Rede jetzt mit der Verwandtschaft«, sagte er. »Entweder wirst du hier wohnen, oder du musst wieder mit nach Hause kommen.«
Die Einrichtung bestand aus einem Bett, einem Sprossenstuhl und einem gesprungenen Spiegel an einer Wand. Hanna erblickte ihr Gesicht darin, ein besorgtes Gesicht, das sie eigentlich nicht kannte. Dann schaute sie den Alten an, der im Bett lag und sie anstarrte, als wäre sie vom Himmel herabgestiegen.
Sie erinnerte sich an die Worte ihres Vaters, die er ihr zugeflüstert hatte. Über den schmutzigen Engel. Hatte er recht gehabt?