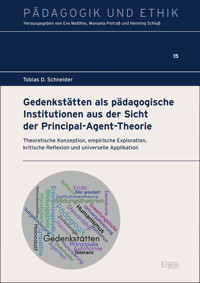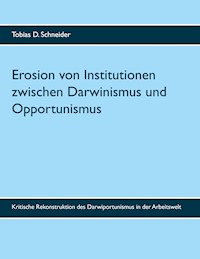
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sämtliche Institutionen (egal, ob Unternehmen, Parteien, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Familie, Erwerbsarbeit, nationale und multinationale Organisationen usw.) befinden sich immer mehr im Würgegriff zwischen darwinistischer Selektion und menschlichem Opportunismus. Die Wirkungsmechanismen des so genannten Darwiportunismus in Wirtschaft und Gesellschaft aufzudecken, ist das zentrale Ziel dieses Buches. Beschrieben wird u. a., wie das Phänomen des Darwiportunismus zur Erosion von Institutionen im Sinne sinkender Mitgliederzahlen, Image- und Vertrauensverlusten führt. Anhand der Ergebnisse empirischer Studien und machtanalytischer Überlegungen von Bourdieu zeigt der Autor auf, inwieweit verschiedene Beschäftigungsgruppen darwiportunistischen Tendenzen unterliegen. Entlang dieser Beschäftigungsgruppen (z. B. atypisch Beschäftigte, Führungsnachwuchskräfte, Top-Management) ergeben sich Ungleichheiten im Hinblick auf die darwinistische und opportunistische Komponente des Darwiportunismus. Auf Basis der Principal-Agent-Theorie und der damit verbundenen Hidden-Strategien werden außerdem opportunistische Verhaltensweisen (z. B. Job-Hopping, Korruption, Wirtschaftskriminalität) in Institutionen und ihre ungleiche Verteilung auf Beschäftigte in Institutionen dargestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Schriftenreihe des Kompetenzzentrums
für Unternehmensentwicklung und -beratung, KUBE e.V.
Bisher erschienene Werke:
Hauke, W.; Opitz, O. (2003): Mathematische Unternehmensplanung. 2. Auflage
Boes, S. (2004): Die Anwendung der Konzepte probabilistischer Bevölkerungsmodelle auf Prognosen für den Hochschulbereich
Pflaumer, P. (2004): Klausurtraining Deskriptive Statistik
Pflaumer, P. (2005): Klausurtraining Finanzmathematik
Schneider, D.; Amann, M. (2005): Benchmarking von Beratungsgesellschaften mit Success Resource Deployment – ein empirischer Vergleich von Accenture über BCG bis McKinsey aus Kundensicht
Hagenloch, T. (2007): Value Based Management und Discounted Cash Flow-Ansätze. Eine verfahrens- und aufgabenorientierte Einführung
Rauch, K. (2007): Steuern in der Sozialwirtschaft – Steuern und Gemeinnützigkeit
Hagenloch, T. (2009): Grundzüge der Entscheidungslehre
Kummer, S. (2009): SWOT-gestützte Analyse des Konzepts der Corporate Social Responsibility – Die soziale und ökologische Verantwortung der Unternehmen
Söhnchen, W. (2010): Operatives Controlling. Grundlagen und Instrumente
Hagenloch, T. (2010): Die Seminar- und Bachelorarbeit im Studium der Wirtschaftswissenschaften – Ein kompakter Ratgeber
Henning, S. (2013): Kosten und Leistungsrechnung, Grundlagen und praxisorientierte Anwendungsbeispiele aus der Betriebs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Bd. I: Betriebliches Rechnungswesen und klassische Kosten-/Leistungsrechnung
Hänle, M.; Schneider, D. (2014): Raum- und Immobilienmanagement – Fallstudien und Klausurtraining
Schneider, D. (2016): Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre – kompaktes Basiswissen. 2. Auflage
Schneider, D. (2016): Klausurtraining Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. 3. Auflage
Henning, S. (2017): Aufgaben zur Kosten- und Leistungsrechnung
Hagenloch, T.; Söhnchen, W. (2017): Strategisches Controlling und Kostenmanagement
Hagenloch, T. (2018) Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Theoretische Grundlagen, Rechnungswesen und Managementlehre. 2. Auflage
Schneider, D. (2018): Theoretische Grundlagen und Ansätze der Betriebswirtschaftslehre – Von Basiskonzepten über Theorieansätze zum neoklassischen Abgrund
Schneider, D. (2019): Unternehmensführung – Instrumente für das Management in der Postmoderne, Kompakte Studienausgabe. 3. Auflage
Schneider, D. (2019): Fallstudien- und Klausurtraining zur Unternehmensführung – Case Studies und Multiple-Choice-Aufgaben für Manager, Controller und Berater. 3. Auflage
Schneider, D. (2020): Produktivitätswüste Deutschland – Zombieland!? Produktivitätsmisere, Zombie-Wirtschaft und Zombie-Eliten
Schneider, T. D. (2020): Erosion von Institutionen zwischen Darwinismus und Opportunismus – Kritische Rekonstruktion des Darwiportunismus in der Arbeitswelt.
Vorwort
Darwinistische und opportunistische Tendenzen nehmen nicht nur Unternehmen, sondern sämtliche Institutionen in den Würgegriff. Der Darwiportunismus entfaltet eine schleichende Kraft, welche die Erosion von Institutionen befeuert. Seine subtilen Wirkungsmechanismen aufzudecken, ist das Ziel des vorliegenden Buches. Es handelt sich um eine kritisch-reflexive Analyse des seit rund 20 Jahren bekannten Phänomens des Darwiportunismus. Hierfür werden die zwei basalen Dimensionen – Darwinismus und Opportunismus – eingehend und anhand verschiedener Beschäftigungssegmente sowie u. a. aus der Perspektive des Principal-Agent-Ansatzes untersucht.
Als Grundlage für dieses Buch fungierte eine an der Professur für Soziologie mit der Berücksichtigung der Sozialkunde an der Universität Augsburg erstellte Masterarbeit. Sie wurde von Frau PD Dr. Carola Schmid betreut, der ich an dieser Stelle ganz herzlich danke. Mein Dank gilt ferner den Verantwortlichen des Kompetenzzentrums für Unternehmensentwicklung und -beratung (KUBE e. V.) für die Aufnahme dieses Buches in die KUBE-Schriftenreihe.
Kempten im September 2020
Tobias D. Schneider
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Institutionen und Darwiportunismus – Ziele und Procedere
Forschungslücken und daraus resultierende Zielsetzungen
Vorgehensweise und Aufbau
Institutionen in Zeiten des Darwiportunismus: vom Grundkonzept zum Institutionenkonzept
Darwiportunismus: Grundkonzept
Institutioneller Darwiportunismus: vom Unternehmenszum Institutionenkonzept – erste Annäherungen
Institutioneller Darwiportunismus: beispielhafte Auswahl
Institutionen im Würgegriff des Darwiportunismus: Darwinismus und Opportunismus
Darwinismus: Selektion und Erosion von Institutionen
1.1 Selektion und Erosion klassischer gesellschaftlicher Institutionen
1.2 Selektion und Erosion durch inter- und intrainstitutionelle Konkurrenz und Vermarktlichung
1.3 Selektion und Erosion der Beschäftigungsverhältnisse
1.4 Selektion und Erosion durch beschäftigungspolitische und intrainstitutionelle Kaskadeneffekte
Opportunismus: ein menschliches Verhaltensmuster in Institutionen
2.1 Opportunismus als zentrale Verhaltensannahme: Vieldimensionalität und heuristische Einordnungssystematik
2.2 Opportunismus und Principal-Agent-Ansatz: Informationsasymmetrien als Bezugspunkte
2.3 Opportunistisches Verhalten und Aktionsspielraum: Machtbezüge und Ungleichheitspotenziale
2.4 Opportunistische Potenzialnutzung: Machtmobilisierung, Ungleichheitswirkungen und der Verfall von Vorbildern
Rekonstruktion der institutionellen Darwiportunismusmatrix und die Produktion von Ungleichheit und anomischen Tendenzen
Rekurs: Institutionen, (Un-)Sicherheit, Freiheit und Spieler mit und ohne Stammplatzgarantie
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Darwiportunismusmatrix auf der Basis von Überlegungen von Scholz
Abb. 2: Entwicklung der Mitgliederzahlen deutscher Parteien
Abb. 3: Entwicklung der Mitgliederzahlen der DGB-Gewerkschaften
Abb. 4: Entwicklung der Mitgliederzahlen von Religionsgemeinschaften
Abb. 5: Entwicklung der Anzahl der Familien und Ehen
Abb. 6: Entwicklung der Haushalte
Abb. 7: Beschäftigungsverhältnisse zwischen „Markt“ und „Hierarchie“
Abb. 8: Entwicklung der atypischen Beschäftigung
Abb. 9: Positionierung von Beschäftigungsgruppen in einer Bedarfsflexibilitäts-Beschaffungsmarktrisiko-Matrix
Abb. 10: Beschäftigungssegmentspezifität von Selektionspotenzial und Selektionsfolgen
Abb. 11: Vereinfachte Systematik opportunistischen Verhaltens
Abb. 12: Dreidimensionalität des opportunistischen Verhaltens
Abb. 13: Beschäftigungssegmentspezifität von Opportunismuspotenzial und Potenzialnutzung
Abb. 14: Rekonstruierte institutionelle Darwiportunismusmatrix
I Institutionen und Darwiportunismus – Ziele und Procedere
1 Forschungslücken und daraus resultierende Zielsetzungen
Es gibt viele Ursachen für den Wandel von Institutionen. Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien, Globalisierung, gesellschaftliche und politische Veränderungen sowie Krisen und Terrorismus gehören dazu. Man denke in diesem Zusammenhang beispielsweise an die eher allmählich und langfristig ausgelegten Dezentralisierungs- und Reorganisationswirkungen moderner Informations- und Kommunikationstechnologien, die seit den 70er Jahren bis heute u. a. zur Hierarchieabflachung und Divisionalisierung in Unternehmen beitragen1; oder an den eher kurzfristigen und direkt ereignisbezogenen Auf- und Umbau von Institutionen und institutionellen Regelungen angesichts terroristischer Anschläge und Bedrohungen. In Deutschland mündeten sie beispielsweise nach dem Anschlag auf das olympische Dorf in München 1972 in der Gründung der GSG 9 (Grenzschutzgruppe) und der anschließenden Institutionalisierung und Weiterentwicklung verschiedener Organisationsformen und -regeln für die Terrorabwehr.2 Nach den Anschlägen auf das World-Trade-Center im Jahre 2001 in New York wurde in den USA der Aufbau des so genannten Heimatschutzministeriums in Verbindung mit zahlreichen zusätzlichen institutionellen Vorkehrungen auf US-amerikanischer und internationaler Ebene vorangetrieben.3 Und nach mehreren Anschlägen in Europa gab es Bestrebungen, die diversen Sicherheitsinstitutionen zu optimieren und europaweit zu koordinieren.4 Schließlich zeigt auch die aktuelle Corona-Krise, wie schnell und tiefgreifend Politik und Regierungen im Zusammenspiel mit den vielfältigen legislativen und exekutiven Einheiten in einem föderalen System institutionelle Regelungen auf- und abbauen sowie umsetzen und durchsetzen.5
Eine Ursache wurde bislang – wenn überhaupt – nur am Rande und insbesondere nicht explizit diskutiert, nämlich der Darwiportunismus als Kombination aus Darwinismus und Opportunismus. Dies mag einerseits daran liegen, dass es sich beim Darwiportunismus um ein eher subtiles und komplexes sowie nur sporadisch direkt sichtbares – deswegen jedoch nicht minder relevantes – Phänomen handelt. Andererseits liegt ein Grund sicherlich in der disziplinären Verortung des Darwiportunismus. Sowohl das Konzept als auch seine Vertreter – darunter vor allem Scholz als Hervorbringer und Hauptvertreter – sind im betriebswirtschaftlichen Kontext und dort im Personalmanagement zu verorten, weshalb bislang historische, soziologische oder gar institutionenanalytische Überlegungen dazu fehlen. Daneben mangelt es dem betriebswirtschaftlichen Schrifttum an einer kritisch-reflexiven Betrachtung, und wenn eine solche dennoch stattfindet, dann bleibt sie in aller Regel auf den betriebs- bzw. personalwirtschaftlichen Kontext beschränkt.
Mit einer Arbeit von Douglas North, einem am langfristigen Wandel interessierten Vertreter der Institutionenökonomie, gibt es zwar eine wirtschaftshistorische Publikation zur Entwicklung von Institutionen. So interessant seine historischen Darstellungen auch sein mögen, kritisch setzt er sich weder mit dem durch den Wandel (aus dem häufig „Erosion“ wird) einhergehenden (negativen) Konsequenzen auseinander, die sich für verschiedene gesellschaftliche Gruppen, für die in den Institutionen arbeitenden Menschen und/oder für die von institutionellen Reorganisationsprozessen Betroffene ergeben (können); noch thematisiert er in diesem Bezugsrahmen relevante Phänomene, die zum Beispiel durch Vermarktlichungstendenzen, durch Probleme für Beschäftigungsverhältnisse oder durch die zunehmende Subjektivierung in Institutionen sichtbar werden.
Obwohl Scholz und North als Hauptvertreter beider Bereiche der ökonomischen Disziplin zuzuordnen sind, fehlt es überdies bislang an einer Verbindung zwischen Darwiportunismus und der Entwicklung von Institutionen. Neben der unterschiedlichen intradisziplinären Verortung (Wirtschaftsgeschichte versus Personalmanagement im Rahmen der Ökonomie) dürfte dies auch an der zeitlichen Differenz der Hauptwerke von North und Scholz liegen.6 Wenn schon in den ökonomischen Subdisziplinen und damit intradisziplinär keine Bezüge bestehen, so ist es nicht überraschend, wenn bislang auch interdisziplinäre Verbindungen fehlen. Beispielsweise unterbleibt eine nach verschiedenen Beschäftigungssegmenten getrennte oder vor dem Hintergrund der institutionellen Pluralisierung vorangetriebene Analyse der Folgen des Darwiportunismus, obwohl sie gerade für arbeits- und industriesoziologische – wie auch diese auf der anderen Seite für personalwirtschaftliche – Themen von Bedeutung sein könnte.
Folglich setzt eine Zielsetzung der Arbeit auf einer eher abstrakten Ebene an der Verbindung von Phänomenen aus zwei Disziplinen an. Das im wirtschaftswissenschaftlichen und speziell im personalwirtschaftlichen Feld entwickelte Konzept des Darwiportunismus soll mit dem vor allem im arbeits- und industriesoziologischen Feld analysierten und diskutierten Themenspektrum des durch Wettbewerb, Ökonomisierung und Vermarktlichung gekennzeichneten Wandels von Institutionen und dessen Konsequenzen verknüpft werden. Die auf dieser übergeordneten Ebene anvisierte Hoffnung ist, aus einem derart (interdisziplinär) kombinierten Vorgehen gegenseitige Befruchtungen zu belegen und ergänzende, komplementäre sowie zusätzliche Aussagen deskriptiver, explikativer und prognostischer Art abzuleiten.
Auf einer eher operativen Ebene soll die Arbeit aufzeigen, wie das Konzept des Darwiportunismus, das Scholz nur auf Unternehmen bezog, nicht nur auf den traditionellen betriebswirtschaftlichen Gegenstandsbereich des Unternehmens und dort auf das Personalwesen, sondern allgemein auf sämtliche Institutionen übertragbar ist. Damit verbindet sich die Erwartung, dass ein derart konstruierter „institutioneller Darwiportunismus“ auch in der Lage sein müsste, Einsichten für den institutionellen Wandel und arbeits- und industriesoziologische Überlegungen zu liefern.
Außerdem soll die Arbeit verdeutlichen, dass sich unter dem Vorstellungsinhalt des Neologismus Darwiportunismus verschiedene Konzepte und Themen subsumieren lassen, die häufig weitgehend verteilt und zersplittert sowie isoliert voneinander untersucht und diskutiert werden. Das in der Arbeits- und Industriesoziologie behandelte Themenspektrum aus Wettbewerb, Selektion, Vermarktlichung, Ökonomisierung und (Reproduktion von) Ungleichheit7 bleibt bei Ökonomen (das gilt sowohl für North als auch für Scholz) in seiner reflexivkritischen Aufarbeitung völlig unbeleuchtet – obwohl deren Relevanz auch für betriebs- und personalwirtschaftliche Fragen (z. B. Arbeitszeit, Entgelt, Motivation, Organisation, Belegschaftssegmentierung) schon bei oberflächlicher Betrachtung auf der Hand liegen müsste. Ob eine Rechtfertigung dafür in einer disziplinbedingten Arbeitsteilung bzw. Abgrenzung, in interdisziplinären Berührungsängsten oder in der mangelnden thematischen Sensibilität zu suchen ist, sei hier dahingestellt. Umgekehrt bleibt die zweite Komponente des darwiportunistischen Konzepts, der Opportunismus, im oben skizzierten „arbeits- und industriesoziologischen Themenspektrum“ weitgehend unbehandelt.8 Damit geht nicht nur der Blick für eine wichtige Dimension verloren, die ihrerseits beispielsweise wieder zur Befeuerung von Wettbewerb, Selektion, Vermarktlichung, Ökonomisierung und Ungleichheit beiträgt und damit letztlich auf die darwinistische Dimension zurückwirkt. Sondern es besteht die Gefahr, das sich gegenseitige und dynamische Hochschaukeln von Darwinismus und Opportunismus zu unterschätzen. Ferner äußert sich opportunistisches Verhalten nicht nur in der von Vertretern des Darwiportunismus hauptsächlich diskutierten Form der Wahl von attraktiveren Arbeitgebern im Sinne von Exit-Entrance-Entscheidungen bzw. von Job-Hopping-Aktivitäten, sobald sich bessere Beschäftigungsoptionen ergeben, um seine individuellen Karriere-, Einkommens- und Lebensziele zu erreichen. Das Spektrum opportunistischen Verhaltens in Institutionen – aber auch in der Gesellschaft insgesamt – reicht beispielsweise von unlauterem Wettbewerb, Korruption, Vorteilnahme und Bestechung über die Dekonstruktion von Vorbildern bis zu Vertrauensverlusten. Ihre Berücksichtigung im Bezugsrahmen des Darwiportunismus ist ein weiteres Anliegen dieser Arbeit, um ihre Wirkungen auf den Wandel von Institutionen und damit auf das skizzierte Geflecht aus Wettbewerb und Selektion, Vermarktlichung und Ökonomisierung sowie Ungleichheit zu explizieren.
2 Vorgehensweise und Aufbau
Angesichts der Zielsetzungen der Arbeit ist in Kapitel II zunächst die Beschreibung des Grundkonzepts des Darwiportunismus erforderlich (Abschnitt 1). Um die Bedeutung des Darwiportunismus für den institutionellen Wandel aufzuzeigen, muss er anschließend aus dem engen betriebs- bzw. personalwirtschaftlichen Korsett herausgeführt und vom Unternehmens- zum Institutionenkonzept erweitert werden (Abschnitt 2 in Kapitel II). Aus Gründen der Unterfütterung und Verdeutlichung liefert schließlich Abschnitt 3 in Kapitel II darauf aufbauend anhand einiger Institutionen erste Beispiele für einen „institutionellen Darwiportunismus“.
Für eine konzeptionelle Rahmung und vertiefte Auseinandersetzung reicht jedoch eine derartige exemplarische Darstellung bei weitem nicht aus. Deshalb erfolgt im Hauptkapitel III eine jeweils tieferschürfende und separate Analyse der zwei zentralen Komponenten des institutionellen Darwiportunismus. Abschnitt 1 behandelt die selektierenden und erodierenden Wirkungen der darwinistischen Komponente. Die dort aufgezeigten institutionellen Erosionen sind durchaus als Belege für anomische Tendenzen zu interpretieren. Dies wird zunächst anhand klassischer gesellschaftlicher Institutionen aufgezeigt (Abschnitt 1.1). Wie Abschnitt 1.2 darstellt, pflanzen sie sich inter- und intrainstitutionell durch Konkurrenz und Vermarktlichung fort. Für die Ausgestaltung und den Wandel von Beschäftigungsverhältnissen bleibt dies nicht ohne Wirkungen (Abschnitt 1.3). Um das tradierte „Normalbeschäftigungsverhältnis“ ranken sich inzwischen vielfältige Beschäftigungssegmente, die neben den im Darwiportunismus im Mittelpunkt stehenden Führungs(nachwuchs-)kräften verschiedene atypische Beschäftigungsverhältnisse umfassen. Hinzu kommen Veränderungen hinsichtlich der Struktur, des Ablaufs und der Führungsmechanismen in den Institutionen von beschäftigungspolitischer Relevanz. Sie wirken sich intrainstitutionell kaskadenartig bis „hinunter“ auf den einzelnen Arbeitsplatz aus und ermöglichen bzw. fordern eine „Mobilisierung des ganzen Menschen“ im Sinne der Subjektivierung, die aktuell u. a. durch das Aufkommen der coronabedingten Home-Office-Arbeit zusätzlich befeuert werden könnte (Abschnitt 1.4).
Im Hauptkapitel III widmet sich dann Abschnitt 2 der zweiten Komponente des Darwiportunismus, dem Opportunismus. In der für die vorliegende Arbeit spezifischen Literatur aus dem industrie- und arbeitssoziologischen Kontext, der u. a. von der Vermarktlichung bis zur Reproduktion von Ungleichheit reicht (vgl. oben), wird der menschliche Opportunismus kaum thematisiert; und im Kontext des betriebs- und personalwirtschaftlich geprägten Darwiportunismus erfährt er lediglich rudimentäre Behandlung, weil er dort vor allem nur auf Exit-Entrance-Entscheidungen bzw. auf Job-Hopping-Muster von Führungs(nachwuchs-)kräften auf der Suche nach Gelegenheiten für bessere Berufs-, Karriere- und Verdienstchancen verengt wird. Opportunistisches Verhalten als menschliche Eigenschaft weist aber weit vielfältigere Dimensionen auf, die sich besonders dann als wirksam und relevant erweisen, wenn institutioneller Wandel in Erosion und Niedergang umzuschlagen droht. Insofern befasst sich Abschnitt 2.1 zunächst mit der Darstellung der vielfältigen Dimensionen des Opportunismus und Abschnitt 2.2 mit seinen Entstehungsursachen. Hierfür wird der so genannte Principal-Agent-Ansatz genutzt, der in Informationsasymmetrien und ihren Einflussgrößen die zentralen Bezugspunkte für opportunistische Aktionsspielräume sieht. Außerdem stellt sich insbesondere die – im Diskurs über Darwiportunismus und auch im Principal-Agent-Ansatz weitgehend ausgeblendete – Frage, ob und inwieweit für das Ausmaß opportunistischer Aktionsspielräume Macht und Ungleichheiten eine Rolle spielen (Abschnitt 2.3). Besonders dann, wenn – wie in dieser Arbeit – im Zuge der darwinistischen Komponente vorher unterschiedliche Beschäftigungssegmente in den Blick genommen wurden (Abschnitt 1.3), drängen sich zwangsläufig Machtfragen in Verbindung mit Ungleichheitswirkungen auf. Sie drängen sich aber nicht nur bei der Bestimmung opportunistischer Aktionsspielräume im Zuge einer „Potenzialfrage“ auf. Vielmehr macht Abschnitt 2.4 anhand von analytischen Überlegungen und empirischen Belegen offensichtlich, dass auch die Mobilisierung des opportunistischen Potenzials, also die „Potenzialnutzung“, ganz wesentliche beschäftigungssegmentspezifische Macht- und Ungleichheitsbezüge aufweist.
Die im Hauptkapitel III separat vorangetriebene Behandlung von „Darwinismus“ und „Opportunismus“ trägt dazu bei, das auf den betriebs- und personalwirtschaftlichen Fokus verengte Konzept des Darwiportunismus zu Gunsten eines „institutionellen Darwiportunismus“ zu überwinden und einer eher kritischen und reflexiven Analyse zu unterziehen. In Abschnitt 3 ermöglicht dies eine Rekonstruktion der Darwiportunismusmatrix, in der die insbesondere anhand der Beschäftigungssegmente aufgezeigten ungleichen Wirkungen in einer integrativen Zusammenschau unter Bezug auf das Konzept der Anomie dargestellt werden.
Die Arbeit schließt in Kapitel IV mit einem Rekurs. Er nimmt darwiportunistische Tendenzen in und für Institutionen in Verbindung mit den Beziehungen zwischen Freiheit und Sicherheit in den Blick und problematisiert noch einmal Macht- und Ungleichheitsfragen.
1 Vgl. z. B. Kieser und Kubicek (1992), S. 236-252 u. S. 349-364; Schmiede (2006).
2 Vgl. z. B. Geiger (2015); Hof (2015).
3 Vgl. z. B. Braml (2005); Kaim (2011).
4 Vgl. z. B. Hübner (2009).
5 Vgl. dazu im Überblick Lang und Holtermann (2020).
6 Die ersten und grundlegenden Arbeiten zum Darwiportunismus werden von Scholz ab dem Jahr 2000 publiziert (zum Hauptwerk vgl. Scholz (2003a); vgl. ferner die in Abschnitt 1 in Kapitel II zitierte Literatur). Zum Themenbereich des institutionellen Wandels vgl. North (1988) und (1992). Lediglich in seinem Hauptwerk zum Darwiportunismus gibt es bei Scholz (2003a), S. 160-164, einen – allerdings wenig für die Analyse des Darwiportunismus genutzten – Verweis auf die so genannte Principal-Agent-Theorie, die im (ökonomischen) Institutionalismus beispielsweise für Fragen der Entstehung von Informationsasymmetrien von Bedeutung ist (vgl. hierzu ausführlich Abschnitt 2.2 in Kapitel III, ab S. 89 dieser Arbeit).
7 Die Hintereinanderschaltung ist nicht zufällig, sondern offenbart nach Auffassung des Autors eine Art kausale Wirkungskette.
8 Selbstverständlich thematisiert die Arbeits- und Industriesoziologie den menschlichen Opportunismus, allerdings meist auf die Arbeitgeberseite und betriebswirtschaftliche Instrumente adressiert; vgl. z. B. Dörre und Holst (2009); Höpner und Waclawczyk (2012). Im „Handbuch Arbeitssoziologie“, das mehr als 1.000 Seiten umfasst, gibt es z. B. nur an sehr wenigen Stellen (vgl. Funder (2010), S. 527; Kädtler (2010), S. 635; Marrs (2010), S. 348) Kurzhinweise zum Opportunismus. Außerdem kam in keinem der ca. 60 Beiträge, die sich eher dem genannten „arbeits- und industriesoziologischen Themenspektrum“ zuordnen lassen und die im Literaturverzeichnis dieser Arbeit aufgelistet sind, das Wort „Opportunismus“ vor. Wie im Fortgang gezeigt wird, ist Opportunismus jedoch ein wichtiger Treiber, der die Komponenten der darwinistischen Dimension stimuliert (Wettbewerb, Selektion, Vermarktlichung usw.).
II Institutionen in Zeiten des Darwiportunismus: vom Grundkonzept zum Institutionenkonzept
1 Darwiportunismus: Grundkonzept
Das Konzept des Darwiportunismus geht auf Überlegungen von Scholz zurück, der sich als Professor für Personalmanagement an der Universität des Saarlandes u. a. dem Wandel der Arbeitswelt widmete.9 Durch das von ihm kreierte Portmanteauwort „Darwiportunismus“ bringt er die zwei zentralen Komponenten der so genannten „neuen Arbeitswelt“ zum Ausdruck: „Darwinismus“ einerseits und „Opportunismus“ andererseits. In seinem (zumindest im wirtschaftswissenschaftlichen Feld und der personalwirtschaftlichen Praxis) viel beachteten Werk mit dem Titel „Spieler ohne Stammplatzgarantie – Darwiportunismus in der neuen Arbeitswelt“ aus dem Jahr 2003 zeigt er ausführlich und mit zahlreichen Unternehmensbeispielen unterfüttert, wie steigender Wettbewerb auf der Seite von Unternehmen und Einstellungs- sowie Verhaltensveränderungen auf der Seite des Personals die Arbeitswelt nachhaltig beeinflussen und ihrerseits umgestalten bzw. verändern.
Auf der Basis der Dimensionen Darwinismus und Opportunismus lässt sich in Anlehnung an Scholz die so genannte Darwiportunismusmatrix mit den Kurzcharakterisierungen der vier Arbeitswelten aufspannen, wie sie Abbildung 1 zeigt.
Abb. 1: Darwiportunismusmatrix auf der Basis von Überlegungen von Scholz10
In der Darwiportunismusmatrix sind neben der in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehenden neuen Arbeitswelt im Sinne des Darwiportunismus noch drei weitere Arbeitswelten positioniert: „Gute alte Zeit“, „Kindergarten“ und „Feudalismus“. Bei der Matrix ist nicht davon auszugehen, dass es sich lediglich um ein statisches Strukturierungskonzept für die Einordnung von „Arbeitswelten“ handelt. Vielmehr soll die Dynamik aufgezeigt werden, mit der sich die reale Arbeitswelt – und damit im Sinne des Konzepts der „Basisinstitution“ letztlich die Bedingungen der Erwerbsarbeit – immer mehr nach rechts oben, also Richtung Darwiportunismus, entwickelt.11
„Organisationen sind darwinistisch und Mitarbeiter opportunistisch“.12 Der Hypothese, dass Unternehmen einem steigenden Wettbewerb unterliegen, ist durchaus zuzustimmen. Durch den schon in den 70er Jahren sich andeutenden Übergang von so genannten Verkäufer- zu Käufermärkten13, durch die schnellere Einebnung von Qualitäts- und sonstigen Differenzierungsvorteilen aufgrund der Reduktion von Entwicklungs- und Produktlebenszyklen14 und durch verbesserte (globale)
Markttransparenz aufgrund verbesserter Informations- und Kommunikationstechnologien und -dienste15 ergibt sich eine ständig ansteigende Wettbewerbsintensität. Hinzu kommt – u. a. durch den Fall des Eisernen Vorhangs und den Systemwandel der einstigen Planwirtschaften in kompetitive Marktwirtschaften ab ca. 1990 bedingt16 – eine verschärfte globale Konkurrenz, die mit dem vermehrten Aufkommen von Billiganbietern aus Niedriglohnländern und dem schrittweisen Wegfall von Handelsschranken verbunden war.17
Zeitlich in die gleiche Phase fällt mit der so genannten Lean Production eine neue Managementphilosophie,18 die für Unternehmen sowohl extern im Verhältnis zu Mitkonkurrenten als auch intern für die unternehmerischen Einheiten die Wettbewerbsintensität erhöhte.19 Die aus den japanischen Automobilunternehmen abgeleiteten Prinzipien der Lean-Philosophie übernahmen für viele Branchen sowie öffentliche bzw. staatliche Institutionen eine Vorbildfunktion.20 Die Anwendung von Lean-Prinzipien führte nicht nur zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, sondern sie trug auch zur Erhöhung der Wettbewerbsintensität in und zwischen Unternehmen bei. So führte das aus der Lean-Philosophie abgeleitete Primat der Senkung der Fertigungstiefe zum Outsourcing und zur Absenkung der Eigenerstellungsumfänge in Unternehmen. Dadurch rivalisieren die internen Produktionseinheiten im Zuge von Make-or-Buy-Entscheidungen des Managements zunehmend mit externen Zulieferern um Wertschöpfungsanteile und Beschäftigung. Die Lean-Prinzipien der Hierachieabflachung und der Delegation in Verbindung mit der Gruppenarbeit setzten eine Vermarktlichung und Ökonomisierung der internen Organisationsstrukturen in Gang, die auch in dieser Arbeit noch ausführlicher behandelt werden.21 Insgesamt steigt durch diese Entwicklungen der Selektionsdruck zwischen und innerhalb der Unternehmen.22 Es ist daher erklär- und nachvollziehbar, weshalb das Management von Unternehmen bei erhöhter Wettbewerbs- und Selektionsintensität sich – umso opportunistischer – auf die Suche nach Gelegenheiten macht, um sich (Wettbewerbs-) Vorteile zu verschaffen.
Andererseits erstreckt sich der steigende Selektionsdruck nicht nur auf die Konkurrenz zwischen Unternehmen, sondern auch auf die interne Seite von Unternehmen und damit letztlich auf die Beschäftigten. Betroffen sind davon die internen und organisatorisch-hierarchisch nachgelagerten Subeinheiten (z. B. Geschäftsfelder, Produktbereiche, Profit-Center, Abteilungen). Dadurch werden nicht nur in immer kürzeren Zyklen Reorganisationen der internen Strukturen nötig, was insbesondere im Zusammenhang mit der Vermarktlichung und Ökonomisierung von Institutionen noch von Interesse sein wird.23 Überdies ist es analog zu den oben aufgelisteten Mechanismen der Wettbewerbsausschaltung zwischen Unternehmen nachvollziehbar, dass (zwangsläufig) auf ähnliche Mechanismen im internen Wettbewerbsverhalten zurückgegriffen wird.24
Bereits diese Ausführungen zur darwinistischen Komponente zeigen den engen Bezug zum menschlichen Opportunismus, der durch Wettbewerb stimuliert werden kann. Wendet man den Blick explizit auf die opportunistische Komponente des Darwiportunismus, so ist darin ein menschliches Handlungsmuster mit durchaus normativen Ambitionen zu sehen – ganz nach dem Motto „nutze die Chancen“25. Und in Zeiten der Globalisierung sieht Scholz sogar „grenzenlose Chancen in einer grenzenlosen Welt“26, die es zu nutzen gilt. Der Fokus liegt dabei besonders auf der (opportunistischen) Nutzung von sich bietenden Berufs-, Karriere- und Verdienstchancen, die bei alternativen Arbeitgebern womöglich stärker ausgeprägt sein können, als dies bei einem aktuellen Arbeitgeber der Fall ist. Insofern konzentriert sich die oppor