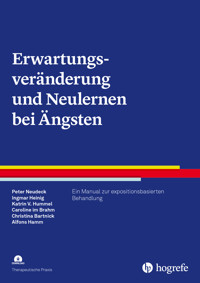
42,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Manual beschreibt eine Expositionsbehandlung, die übergreifend für verschiedene und auch komorbid vorliegende Angststörungen (Panikstörung, Agoraphobie, soziale Angst, multiple spezifische Phobien) geeignet ist. Das Vorgehen wurde in einer groß angelegten Studie mit über 700 Personen erfolgreich evaluiert. Das Manual greift dabei aktuelle Forschungsergebnisse zur Expositionsbehandlung auf und stützt sich insbesondere auf die Erkenntnisse zum inhibitorischen Lernen bei der Exposition. Demnach geht es in der Exposition nicht primär um das passive Aushalten von Angst mit dem Fokus auf den einsetzenden Habituationsprozess, sondern um die Förderung eines aktiven inhibitorischen Lernprozesses. Dieser veränderte Schwerpunkt führt zu einer neuen Fokussierung in der Expositionsbehandlung und zum Einsatz unterschiedlicher therapeutischer Techniken während der Exposition. Da die Maximierung und der Abfall von Ängsten für den Erfolg der Exposition keine entscheidende Rolle spielen, lautet die Botschaft für Therapeut*innen: "Keine Angst vor der Exposition! Gehen Sie den Weg in Ihrem eigenen Tempo!" Das Vorgehen bei der Vorbereitung und Durchführung der Exposition sowie der Rückfallprophylaxe wird praxisorientiert dargestellt und die einzelnen Behandlungsbausteine können flexibel eingesetzt werden. Darüber hinaus werden Strategien zur Optimierung des Extinktionslernens vorgestellt und ethische Fragen geklärt. Zahlreiche Arbeitsmaterialien unterstützen die Durchführung und können nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Peter Neudeck
Ingmar Heinig
Katrin V. Hummel
Caroline im Brahm
Christina Bartnick
Alfons Hamm
Erwartungsveränderung und Neulernen bei Ängsten
Ein Manual zur expositionsbasierten Behandlung
Prof. Dr. Peter Neudeck, geb. 1962. Studium der Psychologie in Mainz und Berlin. 1995 – 1997 Mitarbeiter der Christoph-Dornier Klinik in Münster. 1997 – 1998 Mitarbeiter der Salus Klinik Lindow. 1998 Promotion. 1999 Approbation zum Psychologischen Psychotherapeuten. Seit 2001 in eigener Praxis tätig, zunächst in Berlin, ab 2009 in Köln und ab 2022 in Köln und Düsseldorf. Lehrtherapeut und Supervisor. Honorarprofessur für Translationale Methoden der Verhaltenstherapie an der TU Chemnitz.
Dr. Ingmar Heinig, geb. 1986. 2006 – 2013 Studium der Psychologie in Dresden. 2013 – 2021 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Behaviorale Psychotherapie der TU Dresden. 2021 Promotion. Seit 2022 Mitarbeiter an der Professur für Klinische Psychologie und Behaviorale Neurowissenschaft der TU Dresden. 2020 Approbation zum Psychologischen Psychotherapeuten (Verhaltenstherapie), seitdem auch ambulant psychotherapeutisch tätig in Freital und Dresden.
Dr. Katrin V. Hummel, geb. 1984. 2004 – 2010 Studium der Psychologie in Dresden und Wien. 2010 – 2016 Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie). 2014 – 2022 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden. 2018 Anerkennung als Psychotraumatherapeutin (OPK) und Gruppentherapeutin. 2018 – 2021 Therapeutische Mitarbeiterin der Institutsambulanz der TU Dresden. 2024 Promotion. Seit 2022 in eigener Niederlassung in Dresden tätig.
M. Sc. Caroline im Brahm, geb. 1995. 2014 – 2017 Bachelorstudium in angewandter Psychologie an der Hochschule Fresenius in Köln. 2017 – 2020 Masterstudium in Psychologie an der Universität zu Köln. Seit 2021 in Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin an der Akademie für Verhaltenstherapie (AVT) in Köln. Seit 2021 Promotion.
Dr. Christina Bartnick, geb. 1983. 2003 – 2008 Studium der Psychologie in Bochum. 2012 Approbation zur Psychologischen Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie). 2012 – 2015 Promotionsstipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung. 2015 – 2019 Klinisches Projektmanagement der Multicenter-Studie PROTECT-AD. 2019 Promotion. 2019 – 2021 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Ruhr-Universität Bochum. 2021 – 2023 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie und -psychotherapie. Seit 2023 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit (DZPG), Bochum/Marburg.
Prof. Dr. Alfons Hamm, geb. 1954. 1975 – 1982 Studium der Psychologie in Gießen. 1982 – 1987 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Klinische Psychologie des Fachbereichs Psychologie der Justus-Liebig-Universität Gießen. 1987 Promotion. 1987 – 1988 Post Doc Research Fellow am Dept. of Clinical Psychology, University of Florida. 1988 – 1995 Hochschulassistent am Fachbereich Psychologie der Justus-Liebig-Universität Gießen. 1994 Habilitation. 1996 – 2000 Professor für Biologische und Allgemeine Psychologie, ab 2000 Professor für Biologische und Klinische Psychologie/Psychotherapie an der Universität Greifswald.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Sina-Franziska Mollenhauer, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3225-0; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3225-1)
ISBN 978-3-8017-3225-7
https://doi.org/10.1026/03225-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Die Inhalte dürfen nicht zur Entwicklung, zum Training und/oder zur Anreicherung von KI-Systemen, insbesondere von generativen KI-Systemen, verwendet werden. Das Verbot gilt nicht, soweit eine gesetzliche Ausnahme vorliegt.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
… die Panik beim Zahnarzt, die Panik beim Warten im Wartezimmer, die Panik der Briefträger, die Panik der Fußball Spieler, Panik der Zuschauer, die Panik auf einer Rolltreppe im August: Panik der offenen Türen, Panikwind in den dürren Sommerbäumen der Vorstadt, Panik des Ich kann das viel besser …
aus dem Gedicht „Rolltreppen im August“1 von Rolf Dieter Brinkmann (1975/1999)
In order to be optimally effective, ERP [exposure and response prevention] needs to help people learn safety in a way that it is strong enough to block out (or inhibit) the original fear — and this is where the term inhibitory learning gets its name.
Jonathan S. Abramowitz (2018)
Brinkmann, Rolf Dieter/Herausgegeben von Brinkmann, Maleen & Schmidt, Delf, Westwärts 1 & 2: Gedichte © 1975/1999, Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung.
Inhaltsverzeichnis
Zitat/e
Vorwort
Warum ein neues Manual zur Behandlung von Angststörungen?
Gebrauchsanweisung für das Arbeiten mit dem vorliegenden Manual
I Theoretischer Hintergrund
Kapitel 1: Grundlagen zur störungsübergreifenden Expositionsbehandlung von Angststörungen
1.1 Einleitung
1.2 Psychopathologie von Angststörungen – eine störungsübergreifende Perspektive
1.2.1 Furcht und Angst aus klinisch-diagnostischer Perspektive
1.2.2 Angststörungen aus emotionspsychologischer Perspektive – ein dimensionales ätiologisches Modell
1.3 Wirkmechanismen expositionsbasierter Therapie
1.3.1 Systematische Desensibilisierung und konditionierte Hemmung
1.3.2 Emotionsverarbeitungsmodell der Furcht von Foa und Kozak
1.3.3 Das Prinzip des Extinktionslernens – Wenn die erwartete Bedrohung nicht eintritt
1.3.4 Optimierungsstrategien der Exposition
1.4 Empirische Evaluation des Manuals
1.4.1 Design und Ablauf der Behandlungsstudie
1.4.2 Stichprobe
1.4.3 Ergebnisse der Evaluation
1.4.4 Schlussfolgerungen
II Expositionsbasierte Therapie – Lernen aus Erfahrung
Kapitel 2: Vorbereitung auf die Exposition
2.1 Einführung in das therapeutische Rational
2.1.1 Das Therapierational
2.1.2 Der Therapieprozess
2.1.3 Anpassung des Therapieprozesses
2.2 Vorbereitungsphase: Ziele und Überblick
2.3 Behandlungsbausteine in der Vorbereitungsphase
2.3.1 Baustein 1: Kontaktaufbau und Klärung von Rahmenbedingungen
2.3.2 Baustein 2: Psychoedukation zu Angst und Angststörungen
2.3.3 Baustein 3: Angstbezogene Lebenslinie
2.3.4 Baustein 4: Funktionale Diagnostik zur Erhebung der Inhalte der Furchtstruktur
2.3.5 Baustein 5: Befürchtungshierarchie
2.3.6 Baustein 6: Aufrechterhaltung der Angststörung durch Vermeidung
2.3.7 Baustein 7: Störungsmodell
2.3.8 Baustein 8: Ableitung des Rationals für Expositionsübungen
Kapitel 3: Durchführung der Expositionsübungen
3.1 Grundlagen zur Gestaltung und Durchführung von Exposition
3.2 Behandlungsbausteine in der Expositionsphase
3.2.1 Baustein 9: Vorbereitung der Einstiegsexpositionen
3.2.2 Baustein 10: Durchführung der ersten Einstiegsexposition
3.2.3 Baustein 11: Durchführung der zweiten Einstiegsexposition
3.2.4 Baustein 12: Zwischenbilanz
3.2.5 Baustein 13: Individuelle Expositionsübungen
3.3 Strategien zur Optimierung des Extinktionslernens
3.3.1 Basisstrategien
3.3.2 Enhancement-Strategien
3.4 Ethische Aspekte bei der Durchführung von Exposition
Kapitel 4: Stabilisierung und Rückfallprophylaxe
4.1 Grundlagen zur Rückfallprophylaxe nach dem inhibitorischen Lernmodell
4.2 Behandlungsbausteine in der Selbstmanagementphase
4.2.1 Baustein 14: Zusammenfassung des bisher Gelernten
4.2.2 Baustein 15: Restbefürchtungen und -symptome erfassen
4.2.3 Baustein 16: Rückfallprophylaxe
4.2.4 Baustein 17: Selbstgeleitete Übungen
4.2.5 Baustein 18: Auffrischungssitzungen mit Nachbesprechung der Übungen
4.2.6 Baustein 19: Abschluss
Literatur
Anhang A
Hinweise zu den Online-Materialien
Arbeits- und Informationsblätter
Anhang B
Liste mit Einstiegsexpositionen
|9|Vorwort
Warum ein neues Manual zur Behandlung von Angststörungen?
Im Jahr 2007 bildete sich mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung der bis dahin größte deutsche Forschungsverbund für Angststörungen. Er umfasste acht Universitätsambulanzen und führte seit seiner Gründung die im internationalen Vergleich umfangreichsten randomisierten Therapiestudien zu Expositionstherapie bei Angststörungen durch. Im Rahmen dieser Therapiestudien wurden in einem Zeitraum von fünf Jahren 493 Patientinnen und Patienten mit der Primärdiagnose Panikstörung und Agoraphobie in zwei randomisierten klinischen Studien behandelt. Das Behandlungsmanual für die erste klinische Studie wurde 2012 der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt (Lang, Helbig-Lang, Westphal, Gloster & Wittchen, 2012, 2018). In der ersten klinischen Studie wurden zwei Behandlungsvarianten durchgeführt: „Exposition mit Therapeutenbegleitung“ und „Expositionsvorbereitung ohne Therapeutenbegleitung in den Situationen“. Diese Behandlungsvarianten sind ebenso wie die Struktur der Behandlung und der Aufbau der einzelnen Sitzungen im Behandlungsmanual (Lang et al., 2012, 2018) ausführlich beschrieben. In der zweiten klinischen Studie wurde diese im Manual beschriebene Struktur und der Umfang der Behandlung beibehalten. Die Behandlungsvariante „Exposition mit Therapeutenbegleitung“ wurde genauso durchgeführt wie in der ersten klinischen Studie. Anstelle der „Expositionsvorbereitung ohne Therapeutenbegleitung in den Situationen“ wurde in der zweiten Studie jedoch eine intensivierte therapeutenbegleitete Exposition als Vergleichsbedingung eingeführt. In dieser Variante wurden die Patientinnen und Patienten während der Expositionsübungen durch den Therapeuten oder die Therapeutin angeleitet, noch zusätzlich Körpersymptome zu provozieren (z. B. durch Hyperventilationsübungen), um so die Furchtaktivierung bei den Teilnehmenden zu steigern und die Habituationsprozesse innerhalb und zwischen den Sitzungen zu optimieren. Die Gesamtergebnisse dieser klinischen Studien waren sehr ermutigend. Die Patientinnen und Patienten verbesserten sich in beiden Studien in allen primären Outcome-Variablen von Prä- zu Post- sowie zur Follow-up-Messung nach 6 Monaten statistisch signifikant aber auch klinisch bedeutsam mit Effektstärken von d = –0.9 bis –2.5.
Allerdings zeigten diese Daten auch, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Varianten der Expositionsübungen nur sehr marginal waren. Die Begleitung der Expositionsübungen durch die Therapeutin oder den Therapeuten führte zwar zu etwas besseren Effekten als die unbegleitete „Selbstexposition“ durch die Betroffenen, allerdings waren die Unterschiede klinisch nicht bedeutsam. Ähnliche Befunde ergaben sich auch hinsichtlich der Furchtaktivierung in der Exposition. Hier zeigten sich keine Unterschiede in der Effektivität der Therapie, unabhängig davon, ob zusätzlich Furcht während der Exposition aktiviert wurde oder nicht. Diese Befunde deuteten an, dass die bis dahin vorherrschende Vorstellung, dass Furchtaktivierung mit anschließender Habituation ein zentraler therapeutischer Veränderungsmechanismus der Expositionstherapie sei, nicht mit den Daten vereinbar war. Vielmehr waren diese Befunde in Einklang mit Erkenntnissen aus zwei neueren Entwicklungen der klinisch-psychologischen Forschung:
Die Entwicklung neuer störungsübergreifender Konzepte in der Psychopathologieforschung.
Die Einbeziehung neuer Erkenntnisse der Lernforschung mit entsprechenden Implikationen zum Verständnis der zentralen Veränderungsmechanismen der Expositionstherapie.
Aus diesen Gründen wurde innerhalb des Konsortiums ein an diese neuen Erkenntnisse angepasstes |10|neues Behandlungskonzept entwickelt und 2015 in einer großen, erneut vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten klinischen Studie (PROviding Tools for Effective Care and Treatment of Anxiety Disorders; PROTECT-AD) an 726 Patientinnen und Patienten mit Angststörungen in einem Zeitraum von vier Jahren (2015 – 2019) evaluiert2. Das hier vorgelegte Behandlungsmanual beschreibt das in dieser klinischen Studie evaluierte Behandlungskonzept, welches an insgesamt neun universitären und außeruniversitären Ausbildungs- und Forschungsambulanzen in Deutschland von geschulten und zertifizierten Behandlerinnen und Behandlern durchgeführt wurde. Die Integrität der manualisierten Behandlung wurde anhand von 350 über die Therapiesitzungen randomisierten Videomitschnitten von fünf unabhängigen Beobachterinnen und Beobachtern beurteilt.
Wir möchten mit der Veröffentlichung dieses Manuals ein praktisch anwendbares, in seiner Wirksamkeit überprüftes, effektives und – auch das ist wichtig – von Patientinnen und Patienten akzeptiertes und toleriertes Behandlungsprogramm vorlegen, welches für fast alle Patientinnen und Patienten mit Angststörungen (das Programm wurde nicht bei Personen mit generalisierten Angststörungen erprobt) unabhängig von der spezifischen kategorialen Diagnose angewandt werden kann. Ein zentraler Unterschied zu allen bisherigen Therapiemanualen zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Angststörungen besteht in einem völlig anderen Rational der Expositionsübungen. Wie in dem Zitat von Abramowitz (2018) eingangs schon angedeutet, geht es nicht um „Löschung“ einer ursprünglichen Lernerfahrung, sondern um einen aktiven inhibitorischen Lernprozess und die neue Erfahrung, dass die erwartete Bedrohung nicht eintritt. Ziel der Expositionsübungen ist daher nicht mehr, die möglichst maximale Furchtaktivierung mit einer anschließenden Habituation der Furcht zu erreichen, sondern eine an den individuellen Bedrohungserwartungen orientierte erfahrungsbasierte Erwartungsüberprüfung vorzunehmen. Ziel der in der Expositionsübung gemachten Erfahrungen ist nicht primär eine Angstreduktion, sondern eine Veränderung der Bedrohungserwartungen. Wir wissen aus der klinischen Studie, dass dieses Vorgehen sehr effektiv ist. Die Evaluationen der Daten zeigen, dass Betroffene kaum Nebenwirkungen berichten und dieses Vorgehen sehr gut annehmen (zur ausführlichen Darstellung dieser Ergebnisse vgl. Heinig, 2023). Wir hoffen, mit diesem Manual dazu beizutragen, dass sich die expositionsbasierte Therapie von Patientinnen und Patienten mit Angststörungen in der Praxis weiter durchsetzt, und somit die Versorgung dieser Personen in der Praxis nachhaltig verbessert wird.
Gebrauchsanweisung für das Arbeiten mit dem vorliegenden Manual
Das vorliegende Manual stellt einen Handlungsleitfaden für die expositionsbasierte Behandlung von Ängsten, störungsübergreifend und komorbide Störungen einschließend, vor. Das Vorgehen in der Praxis bezieht sich störungsübergreifend auf die zentralen Befürchtungen der Patientinnen und Patienten.
Die Autorinnen und Autoren arbeiten als Psychotherapeutinnen und -therapeuten und verfügen über eine Vielzahl von – teils jahrzehntelangen – Erfahrungen mit der Methode „Exposition“. An geeigneten Stellen ist diese Expertise in das Werk eingeflossen. Vor allem ergab sich aus der vielfältigen Erfahrung und dem Arbeiten mit den bewährten Behandlungsmanualen das Ziel, einen Behandlungsleitfaden zu erstellen, der einerseits sehr gut strukturiert ist, andererseits jedoch möglichst große Flexibilität erlaubt.
So soll der Einstieg in die Arbeit mit diesem Manual an jeder Stelle möglich sein, gleichzeitig ist jedoch eine Struktur im Aufbau der Behandlung und der Behandlungseinheiten erkennbar, die auch durch die – teils sinnfreien – Vorgaben der Kostenträger vorgegeben wird und sich am Vorgehen im ambulanten Setting einer Regelversorgung innerhalb der PT-Richtlinien orientiert.
Ambulante Richtlinien-Psychotherapie ist durch die Rahmenbedingungen (12, 24 oder 60 Behandlungseinheiten à 50 Min.) strukturiert. Wir wollten den Leserinnen und Lesern nicht auch die Inhalte der einzelnen Behandlungseinheiten in solch rigider Weise vorschreiben. So unterscheidet sich das vorliegende Manual von bereits auf dem Markt befindlichen, vor allem dadurch, dass die Inhalte von Behandlungs|11|komponenten (Psychoedukation, Vorbereitung auf die Exposition etc.), nicht jedoch die Inhalte einer Therapiesitzung beschrieben und vorgegeben werden.
Um Ihnen einen Überblick zu geben, in welcher Weise sich das Behandlungsmanual an den strukturellen Vorgaben der ambulanten Regelversorgung orientiert, haben wir dies in der folgenden Übersichtstabelle dargestellt. Je nach Störungsbild, Therapiezielen und Behandlungsfortschritt ist es möglich, dies entsprechend flexibel zu gestalten.
Psychotherapie ist zumeist ein Gespräch zweier Menschen und wenn man ein solches beobachtet, kann nur der geübte Blick die Einzelheiten, den Aufbau und die Struktur des Gesprächs dechiffrieren. Dies ist die „hohe Kunst“ der Psychotherapie; es wie ein Gespräch in freundlicher Atmosphäre aussehen zu lassen, während mit den Patienten effiziente Lösungen ihrer Probleme erarbeitet werden. Es darf jedoch auch einmal holprig zugehen und die Behandelnden dürfen auch einmal nicht wissen, was zu tun ist. Ein Behandlungsmanual kann und soll in solchen Momenten Sicherheit geben. Ohne ein entsprechendes Manual zumindest im Hintergrund der Behandlung zu haben, ist es so, als würde man mit dem Auto von Hamburg nach München fahren, ohne Tacho, ohne Tankanzeige und ohne Uhrzeit. Man kommt vielleicht an, aber man weiß nicht wie und eine Replikation (die Rückfahrt) unterliegt nicht der Kontrolle, sondern dem Zufall. In diesem Sinne kann das vorliegende Manual als Reiseführer durch eine expositionsbasierte Behandlung gebraucht werden. Bon Voyage!
Aufteilung der Inhalte auf 50-Minuten-Sitzungen (inkl. Sprechstunde und Probatorik)
50-Minuten-Sitzungen
S1
Erstgespräch (Verdachtsdiagnose Angststörung, Rahmenbedingungen)
S2
Klassifikatorische und dimensionale Diagnostik (inkl. Fragebögen)
S3
Diagnoserückmeldung und weiterführende Anamnese
P1
Psychoedukation zu Angst und Angststörungen
P2
Angstbezogene Lebenslinie
P3
Verhaltensanalyse/funktionale Diagnostik
P4
Verallgemeinerung der funktionalen Diagnostik
T1
Befürchtungshierarchie
T2
Aufrechterhaltung (Vermeidungskurven) und Rationalableitung
T3
Zusammenfassung als Störungsmodell und Vereinbarung der ersten Expositionsübung
T4
Start in die Exposition
T5
Exposition
Förderkennzeichen der Studie: (DRKS00008743) im deutschen Register für klinische Studien und (01EE1492A) im NIMH Protocol Registration System. Folgende Zentren haben an der Evaluationsstudie teilgenommen: Humboldt-Universität Berlin (L. Fehm, T. Fydrich, U. Lueken), Universität Bochum (J. Margraf, S. Schneider), Charité (A. Ströhle), Universität Dresden (I. Heinig, J. Hoyer, A. Pittig, U. Wittchen), Universität Greifswald (A. Hamm, J. Richter), Universitätsklinik Münster (K. Koelkebeck, V. Arolt), Ausbildungsambulanz AVT Köln (P. Neudeck), Universität Marburg (T. Kircher, W. Rief, B. Straube), Universität Würzburg (J. Deckert, P. Pauli).
|13|I Theoretischer Hintergrund
|15|Kapitel 1: Grundlagen zur störungsübergreifenden Expositionsbehandlung von Angststörungen
1.1 Einleitung
Das vorliegende Manual zur expositionsbasierten Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Angststörungen wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsverbundes (PROviding Tools for Effective Care and Treatment of Anxiety Disorders; PROTECT-AD) entwickelt und in einer Multicenterstudie an neun ambulanten Ausbildungs- und Forschungsambulanzen in Deutschland bei 726 Personen mit einer Angststörung als Primärdiagnose evaluiert. Auch Patientinnen und Patienten mit komorbiden Störungen wurden mit der manualisierten Therapie behandelt und in die klinische Studie eingeschlossen.
Die Notwendigkeit, über die bereits etablierten Manuale zur Expositionstherapie bei Angststörungen hinaus ein neues Behandlungsmanual zu entwickeln, ergab sich für das Konsortium aus zwei zentralen Gründen:
Die Entwicklung eines störungsübergreifenden Erklärungsmodells für die Psychopathologie defensiven Verhaltens, das die Entwicklung eines bei allen Angststörungen anwendbaren Behandlungsmanuals ermöglichte.
Neue Befunde, welche belegten, dass nicht Furchtaktivierung und Habituation, sondern Prozesse des Extinktionslernens als zentrale Veränderungsmechanismen der Expositionstherapie wirken.
Dies führte zu wichtigen prozeduralen Veränderungen in der Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung der Expositionsübungen, welche für die Praxis äußerst relevant sind und hoffentlich auch dazu beitragen, dass die Akzeptanz und die Durchführung von Expositionen in der Praxis deutlich zu nimmt.
1.2 Psychopathologie von Angststörungen – eine störungsübergreifende Perspektive
Die störungsübergreifende Behandlung von Angststörungen orientiert sich an einem dimensionalen psychologischen Modell, das im Kapitel 1.2.2 vorgestellt wird. Zur besseren Einordnung dieses dimensionalen Ansatzes in den klinischen Kontext soll im Kapitel 1.2.1 zunächst nochmals kurz auf die wichtigsten Kriterien der bisherigen kategorialen Diagnostik der Angststörungen nach DSM-5 eingegangen werden.
1.2.1 Furcht und Angst aus klinisch-diagnostischer Perspektive
Im ersten Satz der Einleitung der Sektion „Angststörungen“ definiert das DSM-5 Angststörungen als eine Gruppe von Störungen, welche durch exzessive Furcht und Angst, sowie den damit assoziierten Störungen im Verhalten gekennzeichnet sind (DSM-5, American Psychiatric Association [APA], 2013). Furcht wird dabei im DSM-5 als eine emotionale Reaktion gegenüber einer realen oder wahrgenommenen unmittelbaren Bedrohung definiert. Angst tritt dagegen bei Antizipation einer zukünftigen Bedrohung auf. Obwohl laut DSM-5 beide Gefühlszustände überlappen können, unterscheiden sie sich dennoch hinsichtlich ihrer berichteten Symptome.
Während Furcht häufiger von starker Erregung des autonomen Nervensystems, Gedanken unmittelbarer Bedrohung und Fluchttendenzen begleitet ist, |16|sind bei Angst häufig erhöhte allgemeine Muskelanspannung, Hypervigilanz gegenüber Anzeichen einer potenziellen Bedrohung sowie vorsichtiges Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten zu beobachten. In der kategorialen klinischen Diagnostik werden die Angststörungen dann unterteilt, je nachdem ob die Furcht oder Angst mehr oder weniger stark an spezifische Situationen gebunden ist und welche Situationen mit der Furcht bzw. Angst assoziiert sind.
Die Spezifischen Phobien zeigen dabei die stärkste Situationsspezifität und werden daher auch hinsichtlich der Auslöser der Furchtreaktionen in unterschiedliche diagnostische Kategorien unterteilt. Die Sozialen Ängste (der Begriff Soziale Phobie steht im DSM-5 nur noch in einer Klammer) betreffen ein größeres Cluster von sozialen Ereignissen, angefangen von Situationen, in denen man tatsächlich der Prüfung durch andere Personen ausgesetzt ist (z. B. bei mündlichen Prüfungen), bis hin zu einer eher generalisierten Form der sozialen Angst, bei der nahezu jede soziale Interaktion als potenzielle Gefahr einer Abwertung der eigenen Person interpretiert wird. Unter der Kategorie „Agoraphobie“ werden Furcht und Angst subsummiert, welche durch eine breitere Gruppe von Situationen ausgelöst werden. Ein Cluster betrifft Situationen, bei denen man eher das Gefühl hat, eingeschlossen zu sein und nicht wegzukommen (z. B. in öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrstühlen, Supermärkten, Kinos). Ein zweites Cluster umfasst Situationen, bei denen man im Falle eines Notfalls nicht schnell genug Hilfe herbeirufen kann. In diesem Fall ist übrigens die Quelle der Bedrohung nicht die Situation selbst (wie im Falle der Spinne bei einer Spezifischen Phobie), sondern die gefürchtete (häufig gemiedene) Situation liefert nur den Kontext, in dem die Bedrohung durch aufkommende oder stärker werdende Körpersymptome ausgelöst wird, denen eine fatale Konsequenz zugeschrieben wird (ich bekomme schlecht Luft, ich könnte ersticken, mir wird ganz schwindlig, ich könnte in Ohnmacht fallen etc.). Daher sind Agoraphobie und Panikstörung auch sehr häufig miteinander assoziiert, da 85 % aller unerwarteten Panikattacken außerhalb der häuslichen Umgebung auftreten, und zwar in Kontexten, welche typisch für agoraphobische Situationen sind (Johnson, Federici & Shekhar, 2014; Pané-Farré et al., 2014). Dennoch können Panikattacken auch zu einer Panikstörung mit starken Erwartungsängsten führen, welche nicht mit spezifischen Kontexten assoziiert sind. Bei einer generalisierten Angststörung steht die Angst vor potenziellen Bedrohungen durch eine Vielzahl von Ereignissen im Vordergrund.
Zwar sind die diagnostischen Kriterien für die Klassifikation der Störung der Patientinnen und Patienten in die einzelnen Kategorien im Laufe der verschiedenen Versionen der nosologischen Klassifikationssysteme immer weiter verfeinert worden, vor allem, um die Reliabilität der Diagnosen zu erhöhen, allerdings ist der Unterschied in der Symptomatik von Patientinnen und Patienten, welche der gleichen diagnostischen Kategorie zugeordnet werden, häufig größer als der zwischen Patientinnen und Patienten, welche unterschiedlichen diagnostischen Kategorien zugeordnet werden. So finden sich bei Menschen mit stark generalisierten sozialen Ängsten häufig auch depressive Symptome und Personen, welche die Diagnose einer depressiven Störung erhalten, weisen häufig große Ängste im Zusammenhang von sozialen Interaktionen auf. Dies ist möglicherweise auch ein Grund, weshalb störungsspezifische Manuale, welche eben häufig nur an einer genau definierten Patientengruppe evaluiert wurden, in der Praxis nicht so häufig und wenn, dann auch nicht routinemäßig zum Einsatz kommen. Zudem basieren die gängigen kategorialen Unterteilungen unterschiedlicher Angststörungsdiagnosen primär auf deskriptiven Merkmalen von Symptomberichten, um unterschiedliche ätiologische Perspektiven zu vermeiden.
Demgegenüber orientiert sich das vorliegende Behandlungsmanual an einem für alle Angststörungen gültigen dimensionalen psychologischen Modell und kann daher in der Praxis auch für alle Formen von Angststörungen angewandt werden. Zudem wurde die Wirksamkeit der hier vorgestellten manualisierten Therapie bei einem breiten Spektrum von Angstpatientinnen und -patienten evaluiert. Diese Patientinnen und Patienten wiesen – wie in der Praxis üblich – häufig auch eine oder mehrere komorbide Störungen auf (nicht nur in Form anderer Angststörungen, sondern auch komorbider depressiver Störungen) und litten durchschnittlich schon mehr als 14 Jahre unter der Störung (zur Beschreibung der klinischen Merkmale der 726 in der Studie untersuchten Patientinnen und Patienten vgl. Pittig et al., 2021). Die theoretische Perspektive des Manuals, die Ätiologie psychischer Störungen weniger kategorial, sondern eher anhand dimensionaler psychologischer Konstrukte zu verstehen, wurde auch im Projekt Research Domain Criteria (RDoC) des National Institutes of Mental Health (Insel, 2013; Kozak & Cuthbert, 2016) oder in der European Roadmap of Mental Health Research (ROAMER; Wittchen et al., 2014) vorgeschlagen.
|17|1.2.2 Angststörungen aus emotionspsychologischer Perspektive – ein dimensionales ätiologisches Modell
Aus der Perspektive der wissenschaftlichen Psychologie können Emotionen wie Furcht und Angst hinsichtlich ihrer Funktionalität als Handlungsdispositionen definiert werden, welche durch ein spezifisches Muster bedrohlicher Umgebungsbedingungen (in Form von sensorischen Reizen, Kontexten oder mentalen Prozessen) ausgelöst werden und als Konsequenz eine Abfolge von Verhaltensanpassungen in Gang setzen, um der Bedrohung möglichst effektiv etwas entgegenzusetzen (Adolphs, 2013; Lang & Bradley, 2010). Will man also Angststörungen aus Sicht der Verhaltenswissenschaften erklären, stehen nicht primär der berichtete Gefühlszustand oder die berichteten Symptome im Fokus. Vielmehr es geht um die Frage, wie bedrohungsrelevante Information enkodiert und welche defensiven Verhaltensanpassungen vorgenommen werden. Diese Perspektive ermöglicht eine translationale Analyse von Furcht- und Angstphänomenen (bei Menschen und bei Tieren) und ermöglicht eine Verknüpfung mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. In diesem Bereich gibt es inzwischen wichtige neue Befunde darüber, welche neuronalen Schaltkreise bei der Regulation von Angst- und Furcht beteiligt sind und wie sie miteinander interagieren.
Eine solche Herangehensweise ermöglicht sowohl ein besseres Verständnis der adaptiven aber auch der maladaptiven Antwort defensiver Reaktionssysteme auf wahrgenommene Bedrohung. Dabei ist ein zentraler Befund verschiedener Studien, dass defensives Verhalten dynamisch und dimensional organisiert ist und dass bei dieser dynamischen Verhaltensanpassung kognitive und emotionale Prozesse sehr eng miteinander interagieren.
In Abbildung 1 ist dieses dimensionale Modell defensiver Verhaltensweisen dargestellt (Hamm, 2020; Hamm & Richter, 2020, adaptiert an das Threat-Imminence-Modell von Fanselow & Lester 1988). Dieses Modell kann auch die Dynamik der verschiedenen Furcht- und Angstsymptome in verschiedenen Bedrohungsszenarien sehr gut beschreiben und erklären.
Aus der Tierforschung ist bekannt, dass defensive Verhaltensweisen und emotionale Erlebniszustände in Abhängigkeit der Nähe oder Unmittelbarkeit (imminence) der Bedrohung variieren (Blanchard & Blanchard, 1990; Fanselow, 1994). Die erste Stufe der Defensivkaskade wird eingeleitet, sobald der Organismus einen Kontext aufsucht, in dem er bereits früher in Kontakt mit der Bedrohung gekommen ist (aufgrund eigener Lernerfahrungen), es bei anderen erlebt hat (Modelllernen) oder davon gehört oder gelesen hat (Lernen durch Instruktion), die Bedrohung selbst aber noch nicht akut aufgetreten ist (pre-encounter defense). Der emotionale Erlebniszustand bei Erwartung einer Bedrohung von der weder bekannt ist, wann oder ob sie überhaupt auftritt, wird in der Emotionspsychologie (und im DSM-5) als Angst bezeichnet. Im klinischen Kontext spricht man in diesem Zusammenhang häufig von Erwartungsangst oder zentralen Befürchtungen (central concerns). Im Zustand dieser Erwartungsangst ist der Organismus hypervigilant gegenüber allen Umgebungsreizen. Die sensorischen Systeme steigern ihre Sensitivität, die Augenbewegungen nehmen zu, man zeigt Sicherheitsverhalten (z. B. einen gebührenden Sicherheitsabstand zur potenziellen Bedrohung).
Sobald der bedrohliche Reiz entdeckt wurde, sich aber noch in genügend großer raum-zeitlicher Distanz befindet, oder im Falle von bedrohlichen Körpersymptomen die Intensität der wahrgenommenen Symptome noch gering ist (post-encounter defense), kommt es zu erhöhter selektiver Aufmerksamkeit gegenüber dem Bedrohungsreiz und einer durch vorsichtige „Hab-Acht“-Stellung gekennzeichneten Bewegungslosigkeit. Der emotionale Erlebniszustand wird in diesem Fall als Furcht bezeichnet, die auch sofort wieder abflaut, wenn der Bedrohungsreiz verschwindet (dies ist anders bei der Angst, da der Bedrohungsreiz ja noch gar nicht aufgetreten ist).
Mit zunehmender Nähe (oder Unmittelbarkeit) der Bedrohung (z. B. die Fahrstuhltüren lassen sich nicht öffnen; Erstickungsgefühle stellen sich ein, der Schwindel wird immer stärker) werden stark automatisierte Fluchttendenzen aktiviert (circa-strike defense). In diesem Zustand kommt es zu einer starken Aktivierung des sympathischen Teils des autonomen Nervensystems, d. h. die Herzrate steigt an, der Mund wird trocken, in den Händen bildet sich „kalter“ Schweiß. Dieses autonome Muster dient der Vorbereitung für eine effektive Flucht – Cannon (1932) bezeichnete diese Verhaltensanpassung als Notfallreaktion – und kann hinsichtlich der emotionalen Erlebnisqualität am besten als Panik bezeichnet werden. In diesem Zustand sind die sensorischen Systeme in ihrer Empfindlichkeit gedämpft (die Schreckhaftigkeit ist reduziert, die Schmerzschwelle steigt). Da im Falle von Panikattacken die bedrohlichen Signale aus dem Körper kommen, ist eine Flucht nicht möglich, dennoch sind die Reaktionsprogramme in diesem Fall identisch. Aus der klinischen Praxis kennt man das Phänomen, dass Patientinnen oder Patienten in diesen „kritischen Gefühlszuständen“ häufig gar nicht ansprechbar sind. Dies liegt auch daran – dass die neuronalen Netzwerke, welche diese Reaktionsmuster steuern, sich auf der Ebene des Mittel- und Zwischenhirns (zentrales Höhlengrau, Hypothalamus) und des Hirnstamms befinden und daher sehr automatisiert ablaufen und infolgedessen willentlich auch nur schwer kontrollierbar sind (vgl. zur ausführlichen Diskussion der neuronalen Strukturen defensiven Verhaltens; Hamm, 2020; Mobbs et al., 2020).
Abbildung 1: Transdiagnostisches dimensionales Modell defensiven Verhaltens und Anwendungsbeispiele für verschiedene Angststörungen (Hamm, 2020; Hamm & Richter, 2020, adaptiert an das Threat-Imminence-Modell von Fanselow & Lester 1988). A) Transdiagnostisches dimensionales Modell defensiven Verhaltens. Nach diesem Modell verändert sich das defensive Verhalten (und die emotionale Erlebnisqualität) mit zunehmender Bedrohungsnähe bzw. -wahrscheinlichkeit. B) Anwendungsbeispiele dieses Modells für verschiedene Angststörungen. Entscheidend für die klinische Praxis ist, dass das funktional sehr beeinträchtigende passive Vermeidungsverhalten sehr früh in der defensiven Kaskade durch die Erwartungsangst im Sinne der Risikoeinschätzung des schlimmsten Szenarios („Fastangriff“) motiviert wird.
|19|Fallbeispiel: Dynamische Organisation defensiver Reaktionen
Weil Frau K., welche an einer starken Spinnenphobie leidet, heute allein zu Hause ist, muss sie selbst in den Keller gehen, um Kartoffeln zu holen. Sie weiß, dass sie früher im Keller häufiger fette Spinnen gesehen hat. Schon beim vorsichtigen Betreten des Kellers hat sie daher ausgeprägte Erwartungsangst (pre-encounter defense). Sie achtet daher auf jeden sich bewegenden Schatten an der Decke, inspiziert alle schwarzen Punkte an der Wand, sucht alle Ecken und Winkel ab und befindet sich in einer generellen Anspannung. Plötzlich entdeckt sie eine Spinne in der oberen rechten Ecke des Kellerraums (post-encounter defense). Sie bekommt feuchte Hände, sie merkt, dass ihr Puls steigt, als sie aus Versehen mit den Schultern eine herabhängende Wäscheleine berührt, springt sie schreckhaft zur Seite. Plötzlich setzt sich die Spinne in Bewegung und bewegt sich schnell in ihre Richtung (circa-strike). Schreiend rennt Frau K. die Treppe hoch, stößt sich noch den Kopf an der niedrigen Tür, spürt aber den Schmerz erst, als sie in der Küche in Sicherheit ist. Dieser starke Gefühlsausbruch ist ihr im Nachhinein sehr peinlich.
Das in Abbildung 1 skizzierte störungsübergreifende dimensionale ätiologische Modell kann auch helfen, die Mechanismen besser zu verstehen, welche dem funktional sehr beeinträchtigenden passiven Vermeidungsverhalten zugrunde liegen.
Im Fokus: Was motiviert das Vermeidungsverhalten?
In der Praxis wird in vielen Verhaltensanalysen zur funktionalen Erklärung des Vermeidungsverhaltens häufig nach wie vor auf das Angstreduktionsmodell von Mowrer (1947) und Miller (1948; 1951) zurückgegriffen. Nach diesem Modell motivieren intensive Furcht/Angst und Panikgefühle (und ihre vegetativen Begleiterscheinungen) das Vermeidungsverhalten, welches dann durch die eingetretene Reduktion der Furcht im Sinne einer negativen Verstärkung (Erleichterung durch das Nachlassen der Angstgefühle) aufrechterhalten bleibt. Daher wird als Ziel der Exposition häufig eine Aktualisierung der Angst mit einer gleichzeitigen Verhinderung des Vermeidungsverhaltens angestrebt, damit es dann während der Konfrontation zu einer Habituation der Furcht kommt. Je höher die aktualisierte Furcht, desto stärker die Habituation (dies ist zumindest die Idee beim flooding). Allerdings zeigen schon frühe Befunde von Solomon und Mitarbeitern, dass dieses Angstreduktionsmodell nicht für alle Formen des Vermeidungsverhaltens zutrifft (Solomon, Kamin, & Wynne, 1953; Solomon & Wynne, 1954). In ihren Studien konnten die Autoren zeigen, dass Hunde schon nach wenigen Durchgängen lernten, einen mit einem Lichtreiz assoziierten Schmerzreiz zu vermeiden. Wichtig an diesen Studien war, dass die Hunde dieses Vermeidungsverhalten über hundert Durchgänge aufrechterhielten, ohne die geringsten Anzeichen von Angst zu zeigen. Die Angstreduktion kann also nicht allein die Aufrechterhaltung des Vermeidungsverhaltens erklären. Neuere Daten im Humanbereich stützen diese These. In einer Studie in unserem Labor (Benke et al., 2018) sollten Personen durch einen immer stärker werdenden Atemwegswiderstand einatmen, wobei nach 180 Sekunden die Zufuhr von Atemluft komplett für 15 Sekunden unterbrochen wurde. Die Probanden konnten den Durchgang an jeder Stelle abbrechen und natürlich hatten sie auch die Möglichkeit den gesamten Versuch abzubrechen. Von den insgesamt 69 Probanden brachen 35 % (N = 24) der Probanden mehrere Durchgänge ab. In Übereinstimmung mit den Daten von Solomon und Mitarbeitern brachen die Probanden die Durchgänge mit zunehmender Anzahl immer früher ab. Was vielleicht noch wichtiger ist, während bei den ersten zwei Abbrüchen (initiale Vermeidung) noch sehr starke vegetative Anzeichen von Furcht auftraten, waren gegen Ende (bei regelmäßigem Abbruch) keine vegetativen Anzeichen von Furcht mehr vorhanden. Allerdings stieg die Erwartungsangst hinsichtlich der finalen Unterbrechung der Inspiration kontinuierlich an. Dies deckt sich mit klinischen Daten von Craske, Rapee und Barlow (1988), die zeigen konnten, dass bei Patientinnen und Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie nicht das Ausmaß der erlebten Furcht, sondern die Wahrscheinlichkeitseinschätzung, in einer bestimmten Situation eine Panikattacke zu bekommen, der beste Prädiktor für das Vermeidungsverhalten ist. Diese Befunde stützen das oben skizierte dynamische Modell defensiven Verhaltens. Vermeidungsverhalten – insbesondere das bei chronischen Angstpatientinnen und -patienten vorherrschende passive Vermeidungsverhalten – wird nicht durch starke Aktualisierung von Furcht, vor allem nicht durch starke vegetative Symptome der Furcht ausgelöst, sondern durch die Erwartung potenzieller Bedrohungen in einem bestimmten Kontext (z. B. eine Panikattacke in einem Supermarkt zu bekommen, oder der Gedanke ich könnte durch die Prüfung fallen) – im Modell als pre-encounter defense bezeichnet. Dies hat wichtige Implikationen für |20|die Wirkmechanismen der Expositionstherapie (vgl. Kap. 1.3) und die Vorbereitung und Durchführung der einzelnen Expositionsübungen (vgl. Kap. 3 und Kap. 4)





























