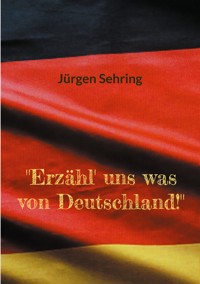
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Erzählung für diejenigen, die zwar schon immer wußten, daß Deutschland schon lange vor 1933 existiert hat, jedoch in unserer Geschichte für sich noch viele "böhmische Dörfer" entdeckt haben. Allerdings auch für solche, die möglicherweise gelernt haben, daß Deutsche Geschichte im Grunde erst mit der zwölfjährigen Herrschaft eines "böhmischen Gefreiten" beginnt. Besonders aber für alle geschichtsinteressierten Leute, die aus vielerlei Gründen dicke, umfangreiche und langatmige Bücher darüber nicht lesen wollen. Bei der Lektüre dieses Buches wird es aber niemandem erspart auch über die Gegenwart nachzudenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Sehring
„Erzähl‘ uns was von Deutschland!“
Das Buch führt uns - ohne ausschweifend zu werden - durch unsere circa zweitausendjährige Geschichte, beginnend in der römischen Zeit Germaniens und endend bei der Wiedervereinigung und ihren unmittelbaren Folgen. Dabei werden gelegentlich auch Bezüge zu unserer Gegenwart hergestellt. Außerdem beschäftigt sich das Buch ansatzweise mit dem dazu gehörigen geistig-moralischen Hintergrund der Entwicklung Deutschlands, nämlich dem Christentum und der Aufklärung, da über diese Themen oft nur noch sehr oberflächliches Wissen besteht. Die Rolle der Kirche wird in diesem Zusammenhang ebenfalls beleuchtet. Auch der Islam, der uns in Deutschland zwar erst seit einigen Jahrzehnten sehr nahegekommen ist, dafür aber unsere Gesellschaft heute umso mehr beschäftigt, wird hier in gleicher Weise thematisiert. Mit einigen Gedanken zu aktuellen Themen schließt das Buch. Der Autor scheut sich übrigens nicht, seine Sicht der Dinge gelegentlich darzulegen und Stellung zu beziehen.
Der Autor, Deutscher des Jahrgangs 1961 und damit für manche Menschen wohl ein „alter, weißer Mann“, hat zwar schon so manches opulente Werk zu geschichtlichen, kulturellen, politischen und sogar philosophischen und theologischen Themen gelesen, fand es aber immer genauso spannend, Geschichte und das Drumherum sozusagen hautnah zu erfassen. Interessante Bauwerke, geschichtsträchtige Orte und Städte sowie diverse Museen zu besuchen und von sachkundigen Menschen mehr als nur Zahlen, Daten und Fakten zu erfahren war für ihn stets inspirierend, aber auch die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Sichtweisen auf die vielerlei Geschehnisse der Vergangenheit. Es geht dem Autor nicht einfach nur um eine Zusammenfassung all dieser Dinge, sondern auch darum, aus der Geschichte etwas zu lernen und Denkanstöße für die Zukunft zu geben.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort: "
India Is Great"
Irgendwo muß man ja anfangen.
Einleitung:
„Was ist Wahrheit?“
Wenn Sie es wirklich wissen, können Sie gleich bei Kapitel 1 weiterlesen.
Kapitel 1:
Furor Teutonicus
Römerzeit, Völkerwanderung, Fränkisches Reich, Karl der Große und die Folgen der Reichsteilung
Wilde Zeiten: Eine Weltmacht zerfällt und unsere Ururahnen sammeln fleißig die Scherben auf. Wir sehen etliche Versuche diese irgendwie zusammenzukleben.
Einschub:
Das Christentum
Die Bibel, der christliche Glaube und die jüdische Vorgeschichte
Was ein Einödbauer nicht weiß und ein Seiltänzer uns fragt.
Kapitel 2:
Es war einmal …
Mittelalterliche Kaiserzeit 1: Ottonen und Salier
Es ist kein Märchen, obwohl ein böser Wolf darin vorkommt.
Kapitel 3:
Und wenn sie nicht gestorben sind …
Mittelalterliche Kaiserzeit 2: Die Staufer
Da es kein Märchen ist, gibt es auch kein Happy End für die Protagonisten, den Wolf ausgenommen.
Einschub:
Die Kirche
Entstehung und Sinn der Kirche, Gutes und Schlechtes, Kritik und Kritiker
Totgesagte leben manchmal doch länger, auch wenn es nicht allen gefällt.
Kapitel 4:
… dann leben sie noch heute
.
Ausgehendes Mittelalter und Neuzeit, die Reformation
Zaghafter Neustart, tolle Erfindungen und während andere beginnen die Welt gewaltsam unter sich aufzuteilen, zerreißen gewaltige Worte allmählich das Reich.
Kapitel 5:
Krieg und Frieden
Gegenreformation, der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen
Wir sehen einen gewaltigen Totentanz mit Auftakt, besichtigen einen Friedhof und schauen bei der Verteilung der Erbmasse eines Verblichenen zu. Die Erben geloben zwar, alles besser zu machen, tun es aber nicht wirklich.
Kapitel 6:
Preußens Glanz und Frankreichs Gloria
Der Aufstieg Preußens und die napoleonische Zeit
Auftritt eines neuen Stars im deutschen Konzertbetrieb, trotzdem geht es weiterhin drunter und drüber und am Ende singen wir das altbekannte, passende Lied: „O, du lieber Augustin, alles ist hin!“
Einschub:
Philosophie der Aufklärung
Kleiner Überblick, Auswirkungen, Bewertung
Denken ist nicht immer Glücksache, kann dann aber recht anstrengend werden.
Kapitel 7:
Per aspera ad astra
Napoleons Ende, Restauration, Revolution und die Einigungskriege
Wir nehmen an den Proben zu einem neuen deutschen Bühnenwerk teil. Nach dem üblichen Streit der Diven um die Rollenverteilung und Krach hinter den Kulissen kann sich endlich der Vorhang öffnen.
Kapitel 8:
Vom Einzug in Walhalla bis zur Götterdämmerung
Kaiserreich und Erster Weltkrieg
Wilhelminische Festspiele mit „Furioso Infernale“ zum Abschluß.
Kapitel 9:
„Es ist nichts Halbes, es ist nichts Ganzes.“
Die Weimarer Republik
Deutschstunde: Mitten im Aufsatz über Demokratie geht uns beim Schreiben der Worte „Einigkeit und Recht und Freiheit …“ die Tinte aus.
Kapitel 10:
Der Vogelschiß
Nationalsozialismus und Drittes Reich
Wohl doch eher ein verdammt großer Kuhfladen.
Kapitel 11:
„Zum Donnerwetter, wer scheißt denn da so lange?“
Der Zweite Weltkrieg
Wie immer: Nach der Großen Sause kommen unweigerlich die Verdauungsprobleme.
Kapitel 12:
„Herr Ober, die Rechnung!“
Das Erbe der Nazis und die Folgen des Größenwahns
Diese Rechnung hätte mancher gerne ohne den Wirt gemacht.
Kapitel 13:
„Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“
Nachkriegszeit, BRD und DDR
Wieder wilde Zeiten mit noch mehr Scherben: Wir räumen (fast) alles weg und machen (fast) alles neu, diesmal gleich in zwei Versionen.
Einschub:
Der Islam
Geschichte, Grundlagen, Erkenntnisse der Islamforschung, Kritik
Ein offensichtlich heißes Eisen, das aber angepackt werden muß. Wie können wir miteinander leben?
Kapitel 14:
Deutschland einig‘ Vaterland?
Die Wiedervereinigung und ihre Folgen, Ausblick
Man darf ja gerade dann träumen, wenn die Realität nicht traumhaft schön ist.
Schlußbemerkung:
Was ich noch zu sagen hätte
dauert keine Zigarette und kein letztes Glas im Sitzen
Recht frei nach Reinhard Mey.
Danksagung
Sicher üblich, hier aber alles andere als eine Pflichtübung.
Literaturverzeichnis
„India Is Great“
… stand auf dem hinten angebrachten Schild des bunt geschmückten Lastwagens, dem der Van unserer kleinen Reisegruppe schon eine ganze Weile auf dem Weg von Delhi nach Jaipur hinterherzuckeln mußte. Außerdem war da noch ein zweites Schild mit der Aufforderung, vor dem Überholen zu hupen. Ein in Indien eigentlich überflüssiger Hinweis. Bei der Betrachtung der oft museumsreifen Transporter, die bei uns größtenteils kaum über den TÜV kommen würden, und der Tatsache, daß auf den Straßen sich nicht nur Autos und Zweiräder, sondern alle nur denkbaren Verkehrsteilnehmer tummeln, muß man den Eindruck gewinnen, daß das einzige Kriterium, um am Straßenverkehr motorisiert teilnehmen zu dürfen, eine funktionierende Hupe ist. Erschwert wird das Fahren zusätzlich durch die sich völlig unbeeindruckt vom Verkehr auf den Straßen laufenden Kühe. Manche liegen auch einfach nur dort herum. Mittlerweile sind Lasten tragende Elefanten auf den Verkehrswegen selten geworden. Wahrscheinlich weil ein LKW ohne Benzin einfach nur stehen bleibt, wohingegen ein Elefant mit leerem Magen eher unwirsch reagiert.
Von der Hupe machte auch Mr. Singh, unser Fahrer, reichlich Gebrauch. Im Übrigen bugsierte er unseren kleinen Van durch das auch für uns Deutsche manchmal kaum vorstellbare Gewühl auf den Straßen, ohne sich einen Kratzer am Auto einzuhandeln. So wie es auf Kreuzungen großer Verkehrsadern in Indien zugeht, würden deutsche Autofahrer ziemlich sicher ein Massaker veranstalten oder einfach verzweifeln. Üblicherweise fahren Menschen ja um von hier nach dort zu kommen. Der Deutsche, so formulierte es Kurt Tucholsky einmal, fährt, um Recht zu haben. Sagen Sie nicht, daß das nicht stimmt! Jüngst lief ich in meiner Heimatstadt über einen gut fünf Meter breiten Gehweg, der sinnvollerweise zur Hälfte als Radweg ausgewiesen wurde. Ich schlenderte gemächlich und lief dabei auch ein paar Schritte auf dem Radweg der Straße zu, um sie zu überqueren. Es war weit und breit niemand da bis auf eine hinter mir herankommende ältere Dame auf dem Rad. Zum Vorbeifahren war auf der Fußgängerseite also wahrlich Platz genug. Trotzdem konnte Sie es sich nicht verkneifen, mich zurechtzuweisen: „Sie wissen schon, daß das der Radweg ist!“
Letztlich konnten wir dann den LKW doch noch überholen, unter Einsatz der Hupe natürlich. Vermutlich hatten wir dadurch den Fahrer aus seinen Träumen vom fernen Zuhause gerissen, vielleicht träumte er aber auch von Indiens Größe. Wie ich im Laufe unserer Reise feststellen konnte, war praktisch an allen Lastwagen dieses Schild hinten angebracht. Ein so unbefangen zur Schau gestelltes Bekenntnis zum eigenen Land sind wir hierzulande nicht gewohnt. Daher fiel mir das auf.
2016 gewann Donald Trump die Wahl zum US-Präsidenten mit dem Slogan: „Make America Great Again!“ Es schien, daß die Fähigkeit, außer China, Rußland oder Indien praktisch jedes Land auf dieser Erde ungestraft vermittels des eigenen Atomwaffenarsenals in die Steinzeit zurückbomben oder durch die gewaltige Finanz- und Wirtschaftsmacht ökonomisch strangulieren zu können, zumindest für Trumps Wählerschaft nicht mehr Größe genug war. Lange davor schon war in den USA die Menge der Menschen, die sich für derlei Fähigkeiten natürlich nichts kaufen konnten, stetig angestiegen. Der Unmut dieser „Abgehängten“ verhalf zunächst Obama zum Wahlsieg, der aber leider zu wenig bewirken konnte, dann für viele überraschend dem Außenseiter Trump. Inwieweit nun die Wirtschaft durch Trumps Eigenwilligkeiten nachhaltig gestärkt wurde und ob es den Leuten dann besserging, kann ich nicht sagen. Daß dieser dann aber binnen weniger Jahre die Demokratie im eigenen Land untergrub, die Spaltung der Gesellschaft bis hin zu Ausschreitungen befeuerte, sich mit Partnern und Verbündeten überwarf und die USA international zum Gespött machte, sprich das Geschäft Wladimir Putins und Xi Jingpings betrieb, und als Sahnehäubchen der amerikanischen Chaostage noch das Kapitol durch einen von ihm angefeuerten Mob demolieren ließ, fanden die Trumpisten offensichtlich „really great“. Nachdem Trump - für ihn völlig unverständlich – 2020 tatsächlich nicht mehr weitermachen durfte, versprach er seiner Anhängerschaft, die Bewegung weiterzuführen. Leider mit Erfolg, denn nach vier Jahren wildem Herumzetern hat er es tatsächlich noch einmal geschafft. So ziemlich alles, wofür die USA einmal standen, scheint er nun über den Haufen schmeißen zu wollen. Oder zeigen die USA jetzt einfach nur ihr wahres Gesicht? Man darf gespannt sein wohin das führen wird.
Nun neigen viele US-Amerikaner, unabhängig von ihren politischen Präferenzen, gerne dazu, ihr Land für alle sichtbar zu glorifizieren, was bei der Geschichte dieses Landes auch nicht immer nachvollziehbar ist. „Wissen ist Macht“, schrieb Joachim Fernau schon vor Jahrzehnten etwas boshaft in seinem Buch über die USA1, „aber Nichtwissen erleichtert das Leben ungemein und letzteres ist der berühmte American way of life.“ Leider grassiert auch hierzulande die Unkenntnis über unsere Geschichte und damit verbundene Themen seit langer Zeit. Das hat allerdings andere Gründe.
Hatte man uns nach dem letzten Krieg den leider meist zum Fanatismus mutierten Patriotismus gründlich ausgetrieben, galten im Westen offene Bekenntnisse zu Deutschland daher eher als obszön, während man im Osten nur auf das neue Deutschland sozialistischer Prägung stolz sein durfte, besser gesagt mußte. Entsprechend war auch der jeweilige Unterricht an den Schulen ausgerichtet und der Blick auf unsere Geschichte sehr verkürzt. Das war und ist für das Geschichtsverständnis jedenfalls nicht förderlich. Es kommt dazu, daß nun vermehrt Menschen mit nichtdeutscher Herkunft unter uns leben, die sich mit unserer Vergangenheit wohl kaum intensiv auseinandergesetzt haben dürften.
Mit diesem Buch möchte ich Lesern einen Einblick in unsere sicher sehr interessante Geschichte verschaffen, darstellen, was uns geprägt hat und was dieses Land in den letzten Jahrhunderten zum Guten, aber auch zum Schlechten für die Menschheit beigetragen hat. Vielleicht können wir alle so besser verstehen und lernen, unser Land zu schätzen oder es einfach „great“ zu finden, ohne Schaum vor dem Mund zu haben. Das könnte uns möglicherweise auch helfen, die Zukunft dieses Landes besser zu gestalten.
Es gibt natürlich auch wieder Leute, die propagieren, daß man stolz sein müßte Deutscher zu sein. Als ob das ein Verdienst wäre! Ich kann jedenfalls nichts dafür, als Deutscher geboren worden zu sein, freue mich aber trotzdem genauso über unsere gemeinsamen Erfolge oder die einzelner Landsleute, wie ich über Schwächen, Fehler und Niederlagen traurig bin.
Ich lade Sie nun zu einer hoffentlich kurzweiligen Reise durch unsere Geschichte ein. Für manchen mag das vielleicht einer „tour de force“ durch zweitausend Jahre gleichkommen, aber so schlimm wird es nicht. Wir wollen dabei allerdings auch Bezüge zu unserer Gegenwart nicht übersehen, zu welcher dann auch noch einiges zu sagen sein wird, und wir kommen auch nicht umhin, uns mit dem geistig-moralischen Hintergrund der Entwicklung Deutschlands ansatzweise auseinanderzusetzen. Für uns wie für ganz Europa war zunächst das Christentum, dann die Aufklärung und ihre Folgen durchaus prägend. Leider wissen viele heute über diese Dinge nur noch sehr oberflächlich Bescheid, wenn überhaupt, weswegen wir uns mit dem christlichen Glauben, der Kirche im allgemeinen und der Philosophie der Aufklärung auch kurz beschäftigen müssen. Ähnliches gilt übrigens auch für den Islam, der uns zwar erst vor einigen Jahrzehnten sehr nahegekommen ist, dafür aber unsere Gesellschaft heute umso mehr beschäftigt.
Bevor wir nun aber richtig loslegen können, müssen wir unbedingt noch einer für diese Themen wichtigen Frage nachgehen.
1 Halleluja – die Geschichte der USA
„Was ist Wahrheit?“2
… fragte vor etwa zweitausend Jahren Pontius Pilatus wohl mehr sich selbst als den von der jüdischen Priesterschaft vor ihn gebrachten Delinquenten, den diese des Aufruhrs gegen die römische Obrigkeit bezichtigt hatte. Der Angeklagte hatte ihm auf die Frage, ob er nun dieser selbsternannte König der Juden wäre, geantwortet, daß er durchaus ein König sei, dessen Reich aber nicht von dieser Welt sei. Aber er sei in eben jene gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Vermutlich hatte der römische Statthalter in Judäa schon so manchen Angeklagten, Kläger oder auch Zeugen befragt und mußte sich, wie es auch heute Polizisten, Staatsanwälten oder Richtern ergeht, aus vielerlei und sich manchmal widersprechenden Aussagen zu einem Sachverhalt letztlich ein Bild formen, was tatsächlich vorgefallen war. Vielleicht war Pilatus aber auch nicht nur einfach ein alter Haudegen, den man eben zur Befriedung einer für Unruhen bekannten Provinz des Imperiums abkommandiert hatte, sondern ein gebildeter Römer, der sich irgendwann etwas ausführlicher mit den damals bekannten griechischen Philosophen und diversen Religionen, die im Römischen Reich anzutreffen waren, befaßt hatte. Von daher war er möglicherweise wie wir heute sicher auch skeptisch gegenüber Menschen, die für sich beanspruchen, die Wahrheit schlechthin zu kennen. Am liebsten hätte er sich gar nicht mit dergleichen innerjüdischen Querelen befaßt, aber da die Priesterschaft drohte ihn beim Kaiser in Rom anzuschwärzen, mußte er halt etwas unternehmen.
Sie werden vermutlich schon erraten haben, wer der eingangs erwähnte Delinquent war: Jesus von Nazareth, der üblicherweise mit dem Beinamen Christus3 versehen wird. Bestimmt wissen Sie auch, wie die Sache ausging.
Jesus hatte sich selbst als den Weg, die Wahrheit und das Leben oder, in anderer Übersetzung, als den (einzigen) Weg, der zur Wahrheit und zum (ewigen) Leben führt, bezeichnet, also nicht die mosaischen Gesetze und ihre traditionellen Auslegungen, auch nicht eine bestimmte Philosophie oder wissenschaftliche Erkenntnis. Das konnte man nun glauben oder nicht beziehungsweise annehmen oder ablehnen. Für die Juden war es natürlich nicht hinnehmbar, geradezu ein Sakrileg, daß er diesen Anspruch erhoben hatte. Dafür sollte durch den römischen Statthalter die Todesstrafe verhängt werden, um das Thema so für die jüdische Priesterschaft endgültig zu erledigen. Deshalb versuchte man ja auch den eigentlich theologischen Streit zu einem „Aufruhr“ gegen die römische Obrigkeit zu machen.
Indem Jesus, als Gottessohn4, nun sich (und damit natürlich auch Gott) als eine für uns letztlich nicht zu durchdringende, absolute Wahrheit setzte, relativierte er im Grunde unsere menschlichen Wahrheiten. Unser Wissen bliebe demnach Stückwerk, wie es Paulus später einmal schrieb. Auf das Thema Christentum werden wir an anderer Stelle zwangsläufig noch einmal zurückkommen müssen. Aber auf der Suche nach Wahrheit spielt das im Römischen Reich und später darüber hinaus sich ausbreitende Christentum eine interessante Rolle. (Darüber schrieb der herausragende Theologe Joseph Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., in seinem 2007 erschienenen Buch „Gott und die Vernunft“5.) Da die Christen dem allem Existierenden zugrundeliegenden, wirklichen Gott huldigten und sich daher der Anbetung der diversen antiken Gottheiten, aber eben auch dem aufkommenden Gott-Kaiser-Kult verwehrten, wurden sie in ihrem Umfeld quasi als „Atheisten“ angesehen. (So auch die Juden, die allerdings, im Gegensatz zu den Christen damals, gegen die römische Besatzung rebellierten, was ja dann letztlich zur Vertreibung der Juden aus Israel führte und zur Umbenennung der Provinz in Palästina.)
Das Christentum entmythologisierte letztlich diese auf Machtpolitik oder Poesie basierenden Kulte und wurde so für die verschiedensten Völker im römischen Machtbereich, später auch darüber hinaus, zu der „religio vera“, oder etwas anders ausgedrückt: Aufklärung wurde Religion, die deswegen auch für Völker unterschiedlichster Kultur attraktiv werden konnte. Leider hat die Kirche, zumindest im Römischen Reich und den späteren europäischen Staaten, sehr bald den Weg zur Staatsreligion eingeschlagen, wurde selbst ein politischer Machtfaktor und versuchte spätestens im Mittelalter allzu oft aus Sorge, ihren Einfluß zu verlieren, überholte Anschauungen „mit Klauen und Zähnen“ gegen reformatorische Ansätze, aber auch gegen neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu verteidigen. Vergeblich, wie wir wissen. Es war die Folge davon, daß einerseits kirchliche Würdenträger ein mehr als fragliches Amtsverständnis entwickelt hatten und andererseits biblische Texte irgendwann wie wissenschaftliche Abhandlungen genutzt wurden und das dann daraus resultierende Weltverständnis als unumstößlich galt, weil es eben „Gottes Wort“ war. Auf diese Weise hatte die Kirche letztlich ohne Not das Ansehen verspielt, das sie eigentlich erhalten wollte.
Aber auch „die Wissenschaft“ hatte sich alsbald verrannt. (Eigentlich die Philosophie, denn Wissenschaftler sind eher noch religiös als moderne Philosophen.) Die ab dem 18. Jahrhundert oft verbreitete Gewißheit, daß man irgendwann einfach alles wissenschaftlich würde erklären können, stellte sich im Laufe der Zeit als Trugschluß, zumindest als eine angesichts der Größe und Komplexität des gesamten Kosmos für uns nicht erfüllbare Aufgabe heraus. Schon der große Philosoph Immanuel Kant war gedanklich zu dem gleichen Schluß gekommen wie die heutige evolutionäre Erkenntnistheorie, die auch biologische Aspekte mit einbezieht. Da wir alle Teil dieser stofflichen Welt oder biblisch ausgedrückt der Schöpfung sind, können wir, mit unseren fünf Sinnen schon gar nicht, mit Wissenschaft, Mathematik und allen technischen Hilfsmitteln, ja selbst mit unserer kühnsten Phantasie absolut nichts darüber sagen, was über eben diese stoffliche Welt mit all ihren vielleicht noch nicht einmal entdeckten oder errechneten Dimensionen hinausgeht. Wenn jetzt jemand sagt, es gibt nichts, was darüber hinausgeht, dann formuliert er einen Glaubenssatz ebenso wie derjenige, der sagt, daß es einen Gott und Schöpfer gibt. Und Ersterer wäre uns darüber hinaus immer noch die Erklärung schuldig, wie und warum die Welt in dieser Perfektion entstanden ist oder wie es sein kann, daß Stoffliches eben einfach schon immer existierte. Da sich das All nachweislich ausbreitet, ist es mit dem „schon immer“ ohnehin so eine Sache. Haben Sie sich vielleicht auch schon einmal gefragt, warum überhaupt irgendetwas existiert? Es gibt Fragen, auf die wir hier keine Antworten bekommen werden und Sachverhalte, die eben einfach sind, wie sie sind. Darüber hinaus bleibt alles Spekulation, im wissenschaftlichen Sinne, oder eben Glaubenssache.
Genauso unsinnig sind deshalb natürlich die sogenannten Gottesbeweise. Wäre Gott für uns irgendwie wissenschaftlich oder auch nur gedanklich (philosophisch) nachweisbar, wäre er ja Teil der Schöpfung und könnte deshalb logischerweise nicht ihr Schöpfer sein.
Was hat das jetzt alles mit dem Inhalt dieses Buches zu tun? Nun, wir sollten zum einen diese Gedanken im Hinterkopf behalten, wenn wir uns an geeigneter Stelle noch etwas näher mit Religionen und der Aufklärung beschäftigen werden. Dies ist deshalb nötig, weil unsere Geschichte, die europäische insgesamt, erheblich von beidem beeinflußt wurde. Was das Christentum betrifft, findet an unseren Schulen seit Jahrzehnten leider kaum noch fundierter Religionsunterricht statt. Durch oft subjektive Berichterstattung der Medien und reißerische Bücher oder Filme haben wir, bei aller berechtigter Kritik an Institutionen und Vertretern von Religionsgemeinschaften, oft nur noch Zerrbilder der Religionen selbst im Kopf. Hierbei geht es jetzt nicht einmal darum etwas zu glauben, sondern einfach um eine sachliche Darstellung und Wissensvermittlung.
Eingedenk der Tatsache, daß heute jeder gern seine eigene Sicht verabsolutiert und wir mit mehr oder minder „wahren“ Nachrichten von vielen Seiten förmlich bombardiert werden, möchte ich gleich denen den Wind aus den Segeln nehmen, die bei der Lektüre garantiert diesen oder jenen Aspekt vermissen, andere Bewertungen für zutreffender halten, mir diesen oder jenen Autor „dringend“ empfehlen möchten oder meinen, über mich aus einem dieser oder auch anderer Gründe verbal oder in Schriften herfallen zu müssen. Auch ich erhebe nicht den Anspruch alles zu wissen oder alles bis ins letzte Detail ergründet zu haben. Und natürlich gilt, was Georg Christoph Lichtenberg einmal so schön formulierte: Es gibt kein Ding, das man nicht besser machen könnte.
Ich hatte durchaus nicht vor, einen alles umfassenden Wälzer zu schreiben, den dann doch niemand liest. Alternativ einfach zusammenhanglos und unkommentiert Daten und Fakten aufzulisten, wäre letztlich nur scheinbar informativ, dafür aber bestimmt langweilig. Geschichte soll nicht das Gedächtnis beschweren, sondern den Verstand erleuchten, so drückte es einst Gotthold Ephraim Lessing aus. Das darf sicherlich auch ein wenig Spaß machen. Trotz ehrlich versuchter größtmöglicher Objektivität, man möge mir verzeihen, schreibe ich natürlich aus meiner und sicherlich als Deutscher eben oft aus deutscher Sicht über die Dinge, aber nicht aus „teutscher Sicht“, wohlgemerkt!
So, und jetzt kann es endlich losgehen!
2 Zitat aus dem Evangelium nach Johannes Kap.18, 38
3 griechische Übersetzung des aus dem Hebräischen abgeleiteten Messias, sprich der gottgesandte Erlöser
4 Diese tatsächlich aus den jüdischen Schriften entnommene Bezeichnung hat nichts mit der Bedeutung dieses Wortes in der Mythologie der Griechen oder Germanen gemein, wo Götter in Menschengestalt mit Frauen Kinder zeugten, sogenannte Halbgötter wie Herakles oder die Wälsungen.
5 Im Kapitel „Kann der Mensch die Wahrheit erkennen?“
1. Furor Teutonicus
Wir brauchen sicher nicht mit Adam und Eva anzufangen, was die deutsche Geschichte betrifft, vielleicht aber mit Wotan oder Siegfried und Brunhilde. Ja, auch die alten Germanen hatten ihre Götter und Helden, aber verglichen mit der griechischen Mythologie zum Beispiel war das alles vergleichsweise prosaisch, zumindest bevor sich Richard Wagner dieser Sagenwelt annahm (- das ist der mit den vierstündigen Opern in Bayreuth). Wir wollen uns doch lieber handfesteren Dingen zuwenden, werden uns aber mit Siegfried und den Nibelungen später noch einmal beschäftigen müssen.
Wenn wir uns zunächst den Schauplatz unserer geschichtlichen Betrachtungen vor Augen führen, fällt auf, daß er ungefähr zu Beginn unserer Zeitrechnung im Wesentlichen aus bewaldetem Gebiet bestand, der Süden und Westen zum Imperium Romanum gehörten und daß viele unserer Vorfahren gar nicht hier lebten, sondern noch etwas weiter nordöstlich. Zum Teil gab es auch noch keltische Bevölkerung. Die Römer hatten bereits etliche große Städte gebaut (zum Beispiel Köln, Mainz, Trier, Konstanz oder Augsburg) und außerdem, nachdem verschiedene Versuche gescheitert waren, den Machtbereich dauerhaft in die nördlichen Germanengebiete auszudehnen, quer durch „Deutschland“ eine Mauer errichtet, genauer gesagt einen meist hölzernen Grenzwall mit Wachtürmen und Kastellen: den Limes. Aber im Gegensatz zum vielen noch bekannten „Antiimperialistischen Schutzwall“ sollte beim Limes niemand einfach hereinkommen können. Den Handel mit und innerhalb der germanischen Bevölkerung behinderte er natürlich nicht. Die Römer selbst aber mieden die Gebiete jenseits des Limes nach den Erfahrungen mit den Germanen im Teutoburger Wald und anderer verlustreicher Unternehmungen. Was war geschehen?
In Jahre 9 unserer Zeitrechnung befand sich das Römische Reich noch in seiner Blütezeit und „General“ Varus, der durch seine zu forsche Art als Statthalter einen Aufstand mehrerer germanischer Stämme provoziert hatte, machte sich mit seinen Legionären auf, um deren Region endgültig zu „befrieden“, so wie das Generale nun einmal zu tun pflegen. Das vor allem für offene Feldschlachten bestens ausgebildete Heer wurde aber in den sumpfigen Waldgebieten völlig unerwartet durch germanische „Guerilleros“ völlig aufgerieben. Die Germanen drängten die römischen Truppen in den Jahren danach langsam hinter die Rhein-Main-Donau-Linie (Limes) zurück, verschiedene Strafexpeditionen anderer römischer Feldherren endeten ebenfalls erfolglos.
Hinter den ersten überraschenden Erfolgen der Germanen steckte ein genialer Kopf: ein Cheruskerfürst namens Arminius. So nannten ihn die Römer; ob sein germanischer Name tatsächlich Hermann war, ist nicht sicher. Er war bei den Römern gut bekannt, da er wie etliche andere Germanen vom römischen Militär ausgebildet war, ja sogar einen Offiziersrang trug. Er kannte also die römische Taktik bestens. Auxiliare, also nichtrömische Soldaten (oft ganze Verbände), gab es viele im römischen Heer, in der spätrömischen Epoche umso mehr, da diese einfach billiger zu haben waren. Nicht wenige der eigentlichen Römer sahen sich mittlerweile auch als zu fein an, um sich im Militärdienst zu üben, oder hatten schlicht keine Lust mehr („panem et circenses“6). Der Niedergang des Imperiums hatte auch nicht wenig damit zu tun, daß sich solche Auxiliare später nur ungern für römische Interessen totschlagen ließen. Bis in unsere Tage hinein neigen Großmächte dazu, daß sie gerne andere die Kastanien aus dem Feuer holen lassen, die sie selbst da hineingeworfen haben, wenn sie nicht sogar selbst die Brandstifter waren. Von fremdländischen Hilfstruppen würde man heute natürlich nicht mehr sprechen. Man spricht lieber von Alliierten (Verbündeten), in westlichen Ländern auch von einer Wertegemeinschaft. Diese Werte können so schöne Begriffe wie „Demokratie“ oder „Freiheit“ sein, gerne aber auch die Aktienwerte großer Unternehmen. Und dann gibt es noch die mancherlei „privaten“ Söldnertruppen für die wirkliche Drecksarbeit.
Zurück zu Arminius, dessen Genialität allerdings nun nicht so sehr darin bestand, daß er zunächst einmal seinen Dienstherrn, besagten Varus, verriet, zu den Aufständischen überlief und ihnen beibrachte, wie sie erfolgreich gegen ein römisches Heer vorgehen mußten. Genial war, daß er es fertigbrachte, mehrere germanische Stämme zu vereinen und auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Das haben in unserer Vergangenheit nicht so viele geschafft, und es waren nicht immer die Besten. Der Quell der Uneinigkeit und des Lokalpatriotismus sprudelte bei uns schon immer kräftig, nicht selten zur Freude anderer Völker. Und das tut er noch heute.
Das Denkmal für Arminius steht heute hoch über dem Teutoburger Wald. Daß er es dereinst so weit bringen würde, hätte damals niemand gedacht, denn zunächst einmal wurde er, nach etlichen innergermanischen Auseinandersetzungen, von seinen cheruskischen Verwandten ermordet.
Es kam die Zeit der sogenannten Völkerwanderung, das römische Imperium zog sich mehr und mehr zurück. Etliche germanische Gemeinschaften durchzogen Zentraleuropa, manche blieben, viele zogen weiter. Ostgoten errichteten ein Königreich in Nordostitalien (um Ravenna), die Langobarden siedelten in der Gegend von Mailand (Lombardei), die Burgunden zogen aus ihrer ostpreußischen Heimat bis in das nach ihnen benannte Gebiet im heutigen Frankreich, die Westgoten kamen bis Spanien, die Vandalen sogar bis ins heutige Tunesien, wo sie dem „Vandalismus“ abschworen und recht brave Bürger des römischen Imperiums wurden. (Ab dem 8. Jahrhundert verheerten die Wikinger (Nordmänner) noch bis ins frühe Mittelalter hinein viele Gegenden, die sie mit ihren Booten erreichen konnten, bevor sie als die berühmten Normannen in Frankreich siedelten und später England eroberten, beziehungsweise auf Sizilien ein beachtliches christliches Königreich errichteten.) Zum Christentum bekannten sie sich übrigens irgendwann alle, sei es aus Überzeugung, Kalkül, auf Druck eines Stammesfürsten oder weil es alle halt so machten. Slawische Stämme rückten übrigens auch weiter nach Westen vor.
Im 5. Jahrhundert tauchten auch noch die nichtgermanischen Hunnen unter ihrem sagenumwobenen König Attila (Etzel) auf, die so manchem angeblich wilden Germanenstamm, was Vandalismus betraf, locker den Rang streitig machten. Sie waren unter anderem für die Ausrottung der Burgunden verantwortlich, die später in das Nibelungenlied eingegangen ist, wenn auch anders dargestellt.
So ganz nebenbei: Wer bis dahin aufmerksam gelesen hat und einmal Revue passieren läßt, welche Völkerschaften wir bis hierhin schon haben in unseren Breitengraden auflaufen sehen, der wird zustimmen müssen, daß es mit dem gerne behaupteten reinrassigen Germanentum schon damals nicht so sehr weit her gewesen sein konnte. Nachweisbar gab es hier in spätrömischer Zeit auch jüdische Enklaven in vielen großen Städten. Es ist bei den damaligen Verhältnissen kaum anzunehmen, daß diese Völker beim Zeugen von Nachkommen alle streng unter sich geblieben sind.
Übrigens, nach Mischa Meiers interessantem Buch „Geschichte der Völkerwanderung“ darf man sich diese eben nicht einfach als ein plötzliches Auftauchen wilder, raffgieriger Horden vorstellen, die alles plattmachten. Viele Germanen kamen wohl in kleinen Gruppen schlicht als Flüchtlinge (aufgrund von klimatischen Ereignissen oder Hungersnöten, als Opfer räuberischer Überfälle oder Vertreibung durch andere Völker). Es war eher ein langsames Einsickern in den als sicherer geltenden römischen Machtbereich bei gleichzeitig auftretenden Auflösungserscheinungen des Imperiums. Auch die Bezeichnungen der Gruppen als Franken, Goten oder Alemannen sind meist römischen Ursprungs und spiegeln ein Stammesgefüge vor, das so streng wohl nicht existierte.
Wie auch immer, die Frage, warum sich diese vielen Menschen aufgemacht haben um sich woanders niederzulassen, werden sich die Römer sowie andere Alteingesessene genauso gestellt haben wie wir uns heute anhand der Bilder von Schlauchbooten voller Afrikaner im Mittelmeer oder mit Arabern und Afghanen gefüllter Sporthallen - und bestimmt mit den gleichen Gefühlen. Nun, das reiche, kultivierte Römische Reich hatte eben damals genau die gleiche Anziehungskraft auf die vielen Völker Nord- und Osteuropas wie Europa heute auf die Armen Afrikas und von Krieg und Verfolgung gezeichneten Menschen der arabischen Welt. Unsere heutige Situation unterscheidet sich allerdings von der damaligen in einem wesentlichen Punkt. An den himmelschreienden Zuständen in Afrika und Nah-/Mittelost, welche die Menschen außer Landes treiben, trägt unsere westliche Außen- und Wirtschaftspolitik eine gravierende Mitschuld, und machen wir uns nichts vor: Wenn sich diese Politik nicht ändert, wird auch der Migrationsdruck nicht geringer werden. Neue Zäune und höhere Mauern werden uns dabei auf Dauer wohl nicht helfen. Darüber hinaus gilt es eine neue europäische Gesellschaft zu formen. Wenn Integration nicht gelingt, werden wir dauerhaft Probleme haben. Wir müssen dabei aber auch für unsere Werte einstehen. Haben wir, vom Kontostand abgesehen, überhaupt noch welche?
Das große Römische Reich war während der Zeit der sogenannten Völkerwanderung untergegangen. Aber nicht Fremde haben es zerstört, die meisten Zugewanderten übernahmen sogar römische Sitten und Gebräuche. Das alte Rom ist aufgrund der Dekadenz der Römer selbst gescheitert, vor allem an der seiner Eliten. Warum hat man sie nicht rechtzeitig entmachtet oder ersetzt? Nun, wenn man sich das Rom jener Tage anschaut, stellt sich die berechtigte Frage, wie und vor allem durch wen man sie hätte ersetzen sollen. Wenn der Fisch vom Kopf her erst einmal so kräftig stinkt, muffelt der Rest auch schon deutlich.
Das alte Römische Reich existierte also nach dieser Epoche definitiv nicht mehr. Aber es ist erstaunlich, wie sehr es bis in unsere Zeit Europa in vielfältiger Weise geprägt hat. Was kam danach? Im Südosten Europas, bis nach Vorderasien hineinreichend, hatte sich aus dem Oströmischen Reich zunächst das Byzantinische Reich mit der Hauptstadt Konstantinopel entwickelt. Der Namensgeber der Stadt, Kaiser Konstantin, dem der Westen seines Reiches samt Hauptstadt offenbar nicht mehr zusagte, zog im 4. Jahrhundert nach Byzanz um und baute sich da ein „neues Rom“. Diese neue Hauptstadt nahm in dem Maße an Bedeutung zu, wie das alte Rom nun abnahm. Pro forma herrschten zwar die in Byzanz residierenden Kaiser zunächst noch über das gesamte Reich, de facto aber über den Westen immer weniger bis zuletzt gar nicht mehr.
Nicht mitumgezogen, zwangsläufig, waren die jeweiligen Aufseher (Bischöfe) der großen römischen Christengemeinde, die sich erst um diese Zeit herum Päpste zu nennen begannen. Neben der neuen Hauptstadt lagen viele kulturell bedeutenden Großstädte und christliche Zentren mit entsprechend einflussreichen Metropoliten im Osten. Daß nun die sich mittlerweile Päpste nennenden Bischöfe der alten Hauptstadt, sich dabei auf Petrus als den angeblich ersten Papst und die später als Fälschung erkannte Konstantinische Schenkung berufend, deswegen die Herrschaft und die Lehrhoheit über die gesamte Christenheit hätten, sah man im Osten anders. Vordergründig führten Dispute über einige Lehrfragen zur Trennung von den östlichen (orthodoxen) Kirchen (1054), eigentlich war es aber eine innerkirchliche Machtfrage. Man bannte sich gegenseitig mit im Nachhinein dramatischen Auswirkungen für die Kirche, die Christenheit und letztlich auch das byzantinische Reich.
Wir haben aber ein wenig vorgegriffen. Zurück zum achten Jahrhundert, in dem die Franken längst der größte und mächtigste germanische Stamm waren. Sie hatten sich, beginnend im fünften Jahrhundert mit dem Merowingerkönig Chlodwig, ein Reich erschaffen, das ungefähr die Gebiete des heutigen Deutschlands, Frankreichs und der Benelux-Länder umschloss. Seit sich besagter Chlodwig taufen ließ, sei es aus Überzeugung und/oder Machtkalkül, huldigten die Franken dann auch dem christlichen Glauben. Die Karolinger übernahmen später die Führungsrolle, sodaß Ende des achten Jahrhunderts schließlich Karl, dem man später den Titel „der Große“ verlieh, mit nicht ganz redlichen Mitteln alleiniger Herrscher dieses Frankenreiches wurde. Karl ist beliebt bei uns, wie auch in Frankreich, wo er Charlemagne genannt wird (aus dem lateinischen Carolus Magnus). So gern wir ihn für uns wie auch die Franzosen für sich vereinnahmen: Er war weder Deutscher noch Franzose (beides gab es damals so noch nicht), sondern Germane. Er sprach Thiotisk (oder auch Diutisk), wie viele Germanen, natürlich den fränkischen Akzent. Das Wort „Deutsch“ kommt übrigens daher.
So beliebt und groß dieser Karl uns in der Geschichtsschreibung auch dargestellt wird (die Menschen dachten damals natürlich in anderen Kategorien als wir heute), man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, daß er und seine Vorgänger dieses fränkische Reich mit reichlich Blut und Eisen gegründet haben, um einen bismarckschen Terminus zu gebrauchen. Auch Karl führte fast jedes Jahr seiner Herrschaft Krieg, um das Reich zu erweitern oder zu erhalten. Der Gedanke an ein Imperium war ja seit der Römerzeit vorhanden, sodaß viele in Karls Bestrebungen schlicht die notwendige Restauration des alten Reiches sahen. Besonders hart waren die Auseinandersetzungen mit den Sachsen, die im Nordosten des Reiches lebten bis ins Westfälische hinein. Sie widersetzten sich Karl, da sie nicht unbedingt Christen werden wollten. Die „Bekehrung“ folgte wortwörtlich dem Muster: Willst du nicht mein Bruder sein, schlag‘ ich dir den Schädel ein. Die Vorstellung, daß es in seinem Reich nur eine Religion geben durfte, setzte Karl rigoros durch.
Immerhin, das Reich wurde straff, aber recht gut geführt. Infrastruktur wurde geschaffen, Klöster wurden gestiftet und Schulen gegründet (Klosterschulen, also nicht für jedermann). Zum ersten Mal gab es unter Germanen sogar etwas wie geschriebenes Recht, Grafen als örtliche Vertreter des Herrschers wurden eingesetzt. Karl förderte die Kirche und die Wissenschaft. Er ließ seine Pfalzen (Paläste) kunstvoll ausstatten und brachte so wieder ein Stück römischer Pracht nach Germanien. Karl, selbst ein stattlicher Krieger, lernte in seinen späteren Jahren sogar noch leidlich lesen, eine Kunst, die man sonst nur „Weicheiern“ überließ wie Mönchen, Gelehrten oder Hofbeamten.
Den größten Coup landete man im Jahre 800 zu Weihnachten in Rom. In der Weihnachtsmesse ernannte Papst Leo III. Karl überraschend zum Kaiser des weströmischen Reiches, das ja noch nominell existierte, und setzte ihm eine Krone auf, die er sozusagen „aus dem Hut zauberte“. In Byzanz war man natürlich „not amused“, hatte aber andere Probleme und konnte es nicht ändern. Ob diese glorreiche Idee nun vom Papst, von Karl oder von beiden gemeinsam ersonnen wurde, läßt sich wohl nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, aber gewonnen hatten beide. Die Stellung des Papstes wurde gestärkt und nebenbei wurde Leo seinen ihm feindlich gesonnenen lombardischen Nachbarn los, indem Karl dort - vom Papst ermuntert - einmarschierte und sich die lombardische Krone dazu eroberte. Karl erweiterte so seinen Machtbereich und war nun Inhaber des glanzvollen Titels „Römischer Kaiser“. Germanen wurden so die Nachfolger der römischen Cäsaren, zumindest in Westeuropa. Mit diesem aus römischem Gedankengut entsprungenen, das Imperium umfassenden Kaisertitel konnten Germanen zunächst nicht viel anfangen, sie kannten Könige oder auch Stammesfürsten. Daher wurde der Titel zunächst nach dem Tode des Herrschers einfach weitergereicht oder nach fränkischem Erbrecht sogar auf mehrere Nachfolger übertragen, ohne daß der Papst oder die Kirche damit zwingend etwas zu tun haben mußten. Aber auch die Päpste ernannten mal diesen, mal jenen zum Kaiser. Erst später, nachdem das Kaisertum fest im Ostreich (Hl. Röm. Reich Deutscher Nation) verankert war, wurde für den gewählten deutschen König die Krönung zum Kaiser des (west-)römischen Reiches durch einen Papst Voraussetzung. Weigerte sich der, ließ man notfalls einen neuen, willigen Papst wählen (Gegenpäpste).
Karls Reich war aber noch nicht das, was man später das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“ nennen sollte, denn sein Reich zerfiel oder besser gesagt, wurde zerrissen. Das fränkische Erbrecht sah vor, daß das Erbe unter den Söhnen aufzuteilen war. Drei Söhne - aus verschiedenen Ehen - waren Karl geblieben. Der Krach war vorprogrammiert (mit Auswirkungen bis ins 20. Jahrhundert). Es gab dann das West- und das Ostreich (bitte nicht mit Österreich verwechseln, das kommt später) und eines in der Mitte (ungefähr das heutige Belgien, Luxemburg, Lothringen, über das Elsaß und Burgund bis hinunter in die Lombardei). Der Erbe dieses hatte außerdem Anspruch auf die Kaiserkrone. Man fiel bald übereinander her. Nach etlichen kriegerischen Auseinandersetzungen wurde in den Verträgen von Verdun (843) und Meersen (870) die Teilung festgelegt. Nachdem das mittlere Reich (nach Karls Sohn Lothar entsprechend „Lotharingen“ genannt) ohne Erben war, wurde auch dieses aufgeteilt. Die Kaiserkrone ging letztlich an den Herrscher des Ostreiches, Ludwig, den man später „den Deutschen“ nannte.
Gebietsmäßig sind wir nun endlich beim Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation angekommen. Inhaltlich fehlt aber noch etwas. Nachdem das ostfränkische Herrscherhaus keinen akzeptablen Nachfolger mehr hatte, wählten die Stammesfürsten aus ihren Reihen den Sachsen(!) Heinrich zum König. Mit diesem ersten Heinrich nahm die Sache Fahrt auf. Daß er sich nicht die Kaiserkrone in Rom abholte mag auch daran gelegen haben, daß er zu sehr mit anderem beschäftigt war, nämlich mit ungarischen Reiterhorden, die sporadisch auftauchten und Land und Leute heimsuchten. Einmal hatte er Glück und fing mit seinem kleinen Heerhaufen einen der ungarischen Anführer. Mit diesem Faustpfand handelte er einen Vertrag aus, über den die anderen Stammesfürsten zunächst heftig die Köpfe schüttelten. Der Ungar kam frei und Heinrich bezahlte obendrein noch einen jährlichen Tribut, um sich die räuberischen Horden fernzuhalten.
Sollten Sie, verehrte Leserschaft, sich über lediglich kopfschüttelnde Herzöge wundern, dann sei dazu gesagt: Der gewählte König war zunächst nur ein gemeinsamer Heerführer, den man, wenn einen der Krieg nicht unmittelbar betraf, nicht zwingend unterstützen zu müssen glaubte. Politische Macht hatte er in den anderen Stammesgebieten ohnehin kaum.
Zurück zu Heinrich, der das wohl oder übel so hinnahm, denn er hatte andere, dringlichere Pläne. Er befestigte Marktflecken und große Klöster, ließ Fluchtburgen bauen und Vorräte anschaffen. Für diese Burgen - meist kleine, dunkle Wehranlagen - wurden ständige Besatzungen („Bürger“) rekrutiert. Zeitgleich schuf Heinrich ein schlagkräftiges, gepanzertes Reiterheer, die uns bekannten Ritter. Als er nach vielen Jahren wieder einmal die ungarische Abordnung empfing, die den gewohnten Tribut einstreichen wollte, soll er ihnen einen toten Hund vor die Füße geworfen haben. Jedenfalls gab es nichts mehr, woraufhin die Ungarn wieder ihre Raubzüge aufnahmen. Aber das Land hatte sich verändert und schließlich wurden sie erstmals in einer Reiterschlacht von Heinrichs neuer Streitmacht geschlagen und mußten sich zurückziehen.
Nun schüttelte keiner der anderen deutschen Fürsten mehr den Kopf, im Gegenteil, sie wählten Heinrichs Sohn Otto zum neuen König, nachdem Heinrich diesen noch vor seinem Tod empfohlen hatte. 936 wurde Otto, nunmehr der Erste genannt, zum König, 962 in Rom zum Kaiser gekrönt (durch den Papst). Mit ihm begann unsere große mittelalterliche Kaiserzeit und das, was man im Laufe der Zeit dann Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation nannte. Wie man das Reich nennen würde, spielte für Otto damals keine so große Rolle. Der Begriff „regnum francorum“ wurde in vielen Chroniken noch lange genutzt, im Ost- sowie im Westreich.
Im Gegensatz zu unseren Tagen war das Wesen einer Sache noch viel wichtiger als seine Bezeichnung.
6 Brot und Spiele
Einschub: Das Christentum
Kennen Sie den? Der Sohn eines Einödbauern hatte in Religion eine glatte Sechs. Der Bauer wird deshalb zum Pfarrer zitiert, der die Schulklasse unterrichtet hatte. „Ihr Sohn weiß ja garnix, nicht mal daß unser Heiland gestorb‘n ist!“ echauffiert sich der Geistliche. „Ja schaun’s, Hochwürden,“ sagt der Bauer: „Wir leben ja scho‘ lang da oben auf der Alm, ham keine Zeitung und kein Radio. Wir ham ja noch nicht mal gehört, daß er krank war!“
Das ist - kaum übertrieben - die Situation im sogenannten christlichen Abendland, wie Ihnen jeder Reporter bestätigen kann, der für Radio oder Fernsehen gelegentlich Passanten auf der Straße zum Beispiel nach dem Sinn oder Ursprung eines bestimmten christlichen Feiertages befragt. Die grassierende Unkenntnis, auch aus Interesselosigkeit geboren, hat natürlich vielfältige, oft „hausgemachte“ Gründe. Da ist zunächst die seit Jahrzehnten mangelnde Verkündigung des Evangeliums von den Kanzeln und im wenn überhaupt noch stattfindenden Religionsunterricht zu nennen, an deren Stelle meist nur noch gesellschaftspolitisches, moralisierendes Gerede getreten ist. Daß sich auch deswegen über Jahrzehnte gerade in den „etablierten“ Kirchen die Mitglieder scharenweise zurückgezogen haben, ist nicht neu. Die seit ein paar Jahren geführten Diskussionen um die Mißbrauchsfälle oder die Stellung von Frauen, speziell in der Katholischen Kirche, sind da für viele wohl eher willkommene Anlässe, den Austritt endlich zu vollziehen. Ein Blick in die - außer vielleicht an Weihnachten - meist leeren Kirchen zeigt, daß selbst unter Kirchenmitgliedern der Sonntag schon lange kein besonderer Tag mehr ist. Selbst wenn nur die sich weitgehend in kirchlichem Dienst befindlichen Mitglieder die sonntäglichen Gottesdienste besuchen würden, müßten die Teilnehmerzahlen deutlich höher sein. Das läßt tief blicken!
Taufe, Erstkommunion, Konfirmation oder Hochzeit sind meist nur noch ein Event. Es gehört eben dazu, hat aber offenbar keine tiefere Bedeutung mehr. Und an Gräbern fragen sich dann die leider zu wenigen Geistlichen, die ihren Beruf noch ernst nehmen, nicht selten, was sie, neben Gemeinplätzen, über die ihnen zu Lebzeiten kaum zu Gesicht gekommenen Menschen eigentlich sagen sollen.
Wie man nun zu diesen Dingen steht, muß jeder für sich selbst entscheiden. Darüber doch einmal nachzudenken, wäre sicher ein schönes Ergebnis dieser Lektüre, aber zunächst geht es in diesem Kapitel einfach um das Verstehen des christlichen Glaubens. Auf das Thema Kirche kommen wir an anderer Stelle natürlich auch noch zu sprechen. Ich möchte nun zunächst auf die praktisch allen Christen gemeinsamen Grundlagen des Glaubens eingehen und lasse die für das Verständnis letztlich nebensächlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Konfessionen außen vor.
An der Bibel, den alten jüdischen und etwas neueren christlichen Schriften, kommen wir dabei natürlich nicht vorbei. Wer diese schlicht für ein Märchenbuch hält, irrt gewaltig. Längst haben Historiker und Archäologen bewiesen, daß diese oft weit über zweitausend Jahre alten Texte zumindest seit Beginn ihrer Aufzeichnung durchaus auf Fakten beruhen, zum Teil natürlich auch Niederschriften mündlicher Überlieferungen noch älterer Geschehnisse sind, bei denen die Faktenlage zwangsläufig dünner wird. Es gibt natürlich auch Erzählungen, die bestimmte Themen einfach veranschaulichen sollen, wie zum Beispiel die Entstehung der Welt oder das Buch Hiob. Die Bibel andererseits nun generell wortwörtlich zu nehmen, was Kreationisten und andere christliche „Hardliner“ sogar heute noch tun, bedeutet im Grunde, sich genauso lächerlich zu machen wie die großen Kirchen bis vor gar nicht so langer Zeit. Die Bibel ist nicht, sondern enthält Gottes Wort aus christlicher Sicht. Das ist ein gewaltiger Unterschied! Man spricht deshalb von durch den Heiligen Geist inspirierten Schriften. Laut Jesus weist die Schrift auf ihn, den Erlöser, hin, enthält aber nicht das ewige Leben (Johannes 5, 39). Sie soll also lediglich den glaubenden oder Gott suchenden Menschen ansprechen.
Die Autoren der biblischen Bücher waren keine Historiker im heutigen Sinn oder Wissenschaftler7, sondern wollten mit ihren Schriften von ihrem Glauben und den Taten Gottes, so wie sie überliefert wurden oder wie sie diese zu ihrer Zeit erlebt hatten, berichten. Darüber hinaus haben sie die entweder von ihren geistigen Vorbildern übernommenen oder für die jeweilige Zeit gegebenen Verhaltensweisen weitergetragen und vor allem in den prophetischen Büchern auch Zukünftiges zu beschreiben versucht. Die so entstandenen Heiligen Schriften waren für die Menschen damals übrigens sakrosankt. Es wurde schon öfters behauptet, daß darin gelegentlich herumgeschrieben und manches verändert wurde. Durch die Qumran-Funde einerseits und die aus frühchristlicher Zeit stammenden neutestamentlichen Schriften im Katharinenkloster auf dem Sinai andererseits wissen wir, daß - von erstaunlich wenigen Schreibfehlern und Wortänderungen abgesehen - früher nichts anderes in der Bibel stand, als es heute der Fall ist. Auch wenn Dan Browns Buch „Sakrileg“ (als Film: Der Da-Vinci-Code) sehr gut und spannend geschrieben ist, es bleibt nicht nur diesbezüglich blühender Blödsinn. Ich empfehle deshalb nicht nur den Dan-Brown-Fans das mindestens ebenso spannende Buch „Das Wahre Sakrileg“ von Alexander Schick. Darin beschreibt der Autor übrigens auch, welche Schriften durch die Kirchenväter in die Bibel, so wie wir sie heute kennen, aufgenommen wurden und warum andere, von zweifelhafter Autorenschaft verfaßten oder der damals aufkommenden Gnosis beeinflußten Texte eben nicht. Gerade die geduldete Existenz von vier etwas unterschiedlichen Evangelien zeigt, daß die Kirchenväter nie eine „Glättung“ oder Vereinheitlichung der Berichte über Jesus im Sinne hatten. Alle Evangelien entstanden ja noch zu Lebzeiten von Augenzeugen Jesu.
Daß Menschen irgendwann über den Tellerrand ihrer eigenen Existenz hinausschauen wollten und konnten, hat – zumindest nach christlichem Verständnis - mit der ihnen (wie und wann auch immer) gegebenen, über das rein Biologische hinausragenden Natur (Geist und Seele) zu tun8. Im Laufe der Menschheitsgeschichte begann man irgendwann, über diverse okkulte Praktiken (Sterndeuterei und dergleichen) mehr über das erfahren zu wollen, was man nicht ergründen oder erklären konnte. Unterschiedlichste Kulte und Mythen entwickelten sich bei der Frage nach dem Woher und Wohin. Dabei erdachten und erschufen sich die Menschen zunächst auch vielerlei Götter und Fabelwesen, denen sie huldigten und die sie sich mit Opfergaben meinten gewogen machen zu können. In diesem Zuge entwickelte sich die bis in unsere Tage weit verbreitete Ansicht, daß der Mensch etwas tun könne, ja sogar müsse, um sich den „höheren Mächten“ anzunähern oder diese gar beeinflussen zu können, sei es mit Meditation, Opfern, rituellen Handlungen, guten Taten oder dem Befolgen von irgendwelchen Geboten. Daß das aus christlicher Sicht so einfach nicht funktioniert, klingt zunächst einmal überraschend. Sicher auch für viele, die sich Christen nennen.
Die biblischen Quellen beschreiben, daß sich die alten Israeliten nicht einfach einen eigenen Kult ausgedacht hatten, um ein spirituelles Vakuum zu füllen. Um sie herum gab es etliche Religionen, denen sie zeitweise ja auch anhingen. Es war der einzige, wirkliche Gott selbst in seiner Souveränität und Allmacht, der sich den Menschen (wieder9) zugewandt, sprich offenbart hatte. Er griff für die Menschen erfahrbar in die Geschichte ein. Mit Abraham (arab.: Ibrahim) begann quasi die Geschichte der drei Buchreligionen. Juden und Araber sehen ihn als biologischen Stammvater an, denn Abrahams Sohn Isaak hatte zwei Söhne, einer davon, Jakob (mit späterem Beinamen Israel, deutsch: Gottesstreiter), hatte deren 12.
Von diesen leiten sich die 12 Stämme Israels ab. Juden sind demnach die Nachkommen des Sohnes Juda. Die anderen Stämme sind quasi verschollen, nachdem das israelitische Nordreich erobert und zerstört wurde. Es könnten Vorfahren der Palästinenser oder sonstiger Völker des Nahen Ostens sein. Araber beziehen sich aber auf den ersten, allerdings „unehelichen“ Sohn Abrahams Ismael, den sie statt Isaak für den verheißenen Sohn Abrahams halten. Für die Christen ist Abraham eher der Patriarch des Glaubens an den einen Gott (Monotheismus).





























