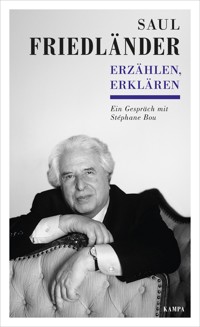
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
Geboren 1932 als Sohn jüdischer Eltern in Prag mit dem Namen Pavel, muss Saul Friedländer mit seinen Eltern vor den Nazis fliehen. In Frankreich können sie den Sohn in einem katholischen Internat verstecken - sie selbst werden an der Schweizer Grenze, festgenommen und deportiert. Pavel überlebt, seine Eltern werden vermutlich in Auschwitz ermordet.Mit dem Journalisten Stéphane Bou spricht der Pulitzer-Preisträger darüber, wie aus dem Waisen Pavel, der Priester werden wollte, Saul wurde und wie schmerzhaft es war, sich den eigenen traumatischen Kindheitserlebnissen zu stellen, dass er sich erst nach Jahrzehnten auf die Erforschung des Holocaust einlassen konnte. Und Friedländer erklärt, wie er deshalb zu einem Historiker wurde, der gar nicht anders konnte, als das »Primärgefühl der Fassungslosigkeit zu bewahren« und wissenschaftliche Geschichtsschreibung mit der persönlichen Erinnerung sowie der von Empathie getragenen Perspektive der Opfer zu verflechten. Sie reden auch über deutsche und jüdische Erinnerungskultur, über Hannah Arendt und den Eichmann-Prozess, den Historikerstreit von 1986 und über filmische und literarische Fiktionalisierungen des Historischen, die das Unerzählbare erzählen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Saul Friedländer
Erzählen, Erklären
Gespräche mit Stéphane Bou
Aus dem Französischen von Nicolaus Bornhorn
Kampa
Vorwort
Mein im Jahr 1983 veröffentlichter Essay Reflets du Nazisme [dt. Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazismus, 1984] ist Ursprung dieses Gesprächsbandes. Stéphane Bou, Kinoexperte, hatte das Buch gelesen und dort Ideen zu einer bestimmten Ästhetik der 1970er-Jahre gefunden, die die Darstellung des Nazismus betrafen, und die er mit mir nach dem Modell der Gespräche mit der Philosophin Élisabeth de Fontenay, die er beim Verlag Seuil veröffentlicht hatte, erörtern wollte. Ich habe bereitwillig zugestimmt.
Das Gespräch begann Ende 2012 – über Skype – und endete 2014. Einmal auf dem Weg, gingen unsere Unterredungen weit über den anfänglichen Rahmen hinaus und erstreckten sich auf Probleme der Darstellung des Nazismus sowohl in künstlerischer als auch historischer Hinsicht, die zusammenhingen mit unterschiedlichen, bisweilen widersprüchlichen Formen des Erinnerns in der besonderen Atmosphäre jener Siebziger- und Achtzigerjahre. Während ich parallel dazu am zweiten Abschnitt meiner Memoiren Wohin die Erinnerung führt. Mein Leben arbeitete, hatten die Gespräche mehr und mehr die Geschichtsschreibung und meinen eigenen Weg als Historiker zum Gegenstand. Die beiden Projekte haben sich gegenseitig genährt.
Die Gliederung, für die wir uns letztlich entschieden haben und die im Hinblick auf die Chronologie unserer Gespräche ein wenig mogelt, schmiegt sich teilweise meinem geistigen Parcours an. Sie beginnt mit meinen ersten Arbeiten in den Archiven des Vatikans und schließt mit der Abfassung von Das Dritte Reich und die Juden. Wir haben den Text 2015 überarbeitet, während ich die Schrift Wohin die Erinnerung führt beendete; dieses Datum erklärt auch die Einbeziehung gewisser Details aus jenem Jahr. Wir haben etwas vom gesprochenen, freien und bisweilen tastenden Stil unserer ersten Unterredungen bewahrt, haben uns einige Abschweifungen erlaubt, in der Hoffnung, bei den Puristen keinen Anstoß zu erregen.
S.F.
Anfänge
Saul Friedländer, Sie sind im Alter von dreißig Jahren Historiker geworden. Was hat Sie dazu bewogen, über die Geschichte des Nazismus zu schreiben?
Ich hatte lange Zeit nicht vor, Historiker zu werden, und habe mich von meiner Vergangenheit ferngehalten. Über Jahre hinweg war ich der Shoah gegenüber – ich würde nicht sagen indifferent, das wäre der falsche Ausdruck, vielmehr war ich ihr gegenüber distanziert. Ich hatte nicht das Verlangen, mich auf dieses Ereignis zu konzentrieren. Ich verspürte nicht die Notwendigkeit. Das war ein gänzlich unbewusster Verteidigungsmechanismus gegen das Übermaß an Gefühlen, das eine solche Geschichte hätte hervorrufen können. Aber Tatsache ist, dass ich, als ich mein Studium wieder aufnehmen wollte, dennoch ein Thema aus der Geschichte der Diplomatie wählte, das im Zusammenhang stand mit dem Nazismus. Ich hatte schon viel über Nazideutschland und den Krieg gelesen. So bin ich also in völliger Unschuld, wenn ich so sagen darf, auf die Suche nach einem Thema für meine Dissertation gegangen. Ich entschied mich dafür, zu dem amerikanischen Faktor in der Außen- und Militärpolitik Deutschlands zwischen September 1939 und Dezember 1941 zu arbeiten. Wie hatten Hitler und die Diplomaten und das Militär in seiner Umgebung die Möglichkeit einer amerikanischen Intervention auf Seiten der Engländer eingeschätzt, insbesondere nach der Niederlage Frankreichs? Und inwieweit hatte dies ihre Außenpolitik und militärischen Vorbereitungen beeinflusst? Das sind einige der Fragen, auf die ich Antworten zu finden suchte.
»Ich hatte lange Zeit nicht vor, Historiker zu werden und habe mich von meiner Vergangenheit ferngehalten. Über Jahre hinweg war ich der Shoah gegenüber distanziert.«
Das hatte, streng genommen, keinen Bezug zur Shoah …
Nein, in der Tat.
Von Genf aus, wo wir wohnten und wo ich am Hochschulinstitut für internationale Studien eingeschrieben war, fuhr ich regelmäßig nach Deutschland, zu jener Zeit Westdeutschland: nach Bonn, in die Archive des Außenministeriums der Bundesrepublik, wo sich auch die Archive des Außenministeriums von Nazideutschland befanden. Dort habe ich viel gearbeitet, ebenso in den deutschen Militärarchiven in Freiburg im Breisgau, sowie in diversen anderen Archiven in Deutschland, aber auch in London. Das hat allmählich dazu geführt, dass meine Vorstellung von der Dissertation an Klarheit gewann. Ich habe sie recht schnell abgefasst und im Dezember 1963 verteidigt. Sie ist sogleich veröffentlicht worden, weil in der Schweiz, wie zu jener Zeit üblich, zweihundert Kopien einer Doktorarbeit gedruckt werden mussten, die das Institut dann an die Universitätsbibliotheken versandte. Jacques Freymond, der Direktor des Instituts, bat mich anschließend, in Genf zu bleiben: Ein Professor war schwer erkrankt und musste ersetzt werden. Anfang 1964 habe ich also am Institut zu lehren begonnen.
Ihr erstes Buch, das sich direkt auf die Shoah bezog – Pius XII. und das Dritte Reich –, stammt aus dem Jahr 1964, anders gesagt, aus der Zeit gleich nach der Verteidigung Ihrer Doktorarbeit. Sie sagten aber gerade, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit waren, dieses Thema anzugehen.
Da hat der Zufall mitgespielt. Obgleich der Begriff »Zufall« zweifellos unangemessen ist: Hätte ich eine andere Kindheit und Jugend gehabt, hätte dieser Vorfall vielleicht nicht meine Aufmerksamkeit erregt. Während ich an meiner Dissertation arbeitete und Einsicht nahm in deutsche Dokumente, die sich auf die Vereinigten Staaten bezogen, stieß ich auf ein fehlerhaft klassifiziertes Archiv, das in Wahrheit zu den Vatikan-Dossiers gehörte. Es handelte sich um einen Brief, datiert vom Dezember 1941, in welchem auf Bitten von Pius XII. eine Anfrage an das in den darauffolgenden Tagen in Rom erwartete Orchester der Berliner Oper erging, ob es in den Gemächern des Papstes Auszüge aus Wagners Parsifal spielen könnte. Ich sagte mir, dass es immerhin seltsam sei, wenn der Papst eine solches Gesuch stellte, wo doch der Krieg an der Ostfront in Gewaltexzesse ausartete und die Ausrottung von russischen Zivilpersonen und von Juden dem Vatikan bekannt war. Das schockierte mich. Das Konzert hat nie stattgefunden, aber die Anfrage war geäußert worden. Ich beschloss also, nach Beendigung meiner Dissertation zurückzukommen, um die Unterlagen zum Vatikan zu sichten. Im Verlauf der Osterferien des Jahres 1964 bin ich dann nach Bonn zurückgekehrt und habe die interessantesten Dokumente aus den Archiven, die die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Nazideutschland behandelten, kopiert.
»Ohne groß darüber nachzudenken, habe ich mich auf natürliche Weise dem angenähert, was dann zur eigentlichen Passion meiner geistigen und emotionalen Existenz werden sollte.«
Sie akzeptierten somit die Idee, eine Arbeit in Angriff zu nehmen, die mit Ihrer eigenen Vergangenheit in Verbindung stand. Insbesondere, weil sie auf den Zusammenhang zwischen katholischer Kirche und Preisgabe der Juden während des Krieges eingeht: Sie selbst sind während des Zweiten Weltkriegs einer religiösen Institution anvertraut worden.
Durchaus. Ohne groß darüber nachzudenken, habe ich mich wegen dieses Dokuments, das mich nicht auf intellektueller, sondern auf affektiver und moralischer Ebene beunruhigte, auf natürliche Weise dem angenähert, was dann zur eigentlichen Passion meiner geistigen und emotionalen Existenz werden sollte.
Auf welche Weise haben Sie sich mit den Archiven des Vatikans beschäftigt?
Die Dokumente waren chronologisch sortiert. Die erste Akte, die das Pontifikat Pius XII. behandelt, beginnt mit dem März 1939. So gelangte ich nach und nach zur Akte Nummer 5, die mit der Besetzung Roms durch die Deutschen zusammenfällt, zu dem Zeitpunkt, da der Marschall Badoglio, Nachfolger Mussolinis seit Juli 1943, die Alliierten, die im Süden der Halbinsel gelandet waren, am 3. September um einen Waffenstillstand ersucht. Die Deutschen halten Rom und Italien bis in den Süden besetzt. Es ist die Periode zwischen September 1943 und Februar/März 1944, in der die Juden Roms und anderer Regionen Italiens deportiert werden. Es ist auch der Zeitabschnitt, in dem man sich in Berlin die Frage stellt, ob der Papst reagieren wird. Wird er Protest einlegen, oder wird er die Deutschen gewähren lassen? Bekanntlich reagiert er nicht. Ernst von Weizsäcker, der Botschafter im Vatikan, schickt ein später berühmt gewordenes Telegramm an Ribbentrop, in dem es heißt: »Der Papst wird nicht einschreiten …« Mit diesem Material befand ich mich im Herzen einer Problematik, die immer noch die Gemüter erhitzt. Es handelte sich plötzlich nicht mehr um eine Arbeit zur Geschichte der Diplomatie, sondern um eine Mischung aus Politik- und Religionsgeschichte, die letztlich nicht nur die Haltung des Papstes gegenüber Nazideutschland betraf, sondern, genauer betrachtet, seine Haltung gegenüber der Judenvernichtung. Darauf lief meine Studie der Dokumente hinaus und wurde dann zum Thema von Pius XII. und das Dritte Reich. Eine Dokumentation. Es ging nur darum, eine Gesamtheit von Texten zu präsentieren und sie in einen Kontext zu stellen.
War es schwierig, einen Verleger für dieses Buch zu finden, das leidenschaftliche Reaktionen hervorgerufen hat?
Als die Hauptarbeit am Text beendet war, habe ich mich auf Anraten Elie Wiesels dafür entschieden, Kontakt zum Verlag Éditions du Seuil aufzunehmen, der damals von Paul Flamand und Jean Bardet, den »Gründervätern«, geleitet wurde. Es war ein katholischer Verlag, zugleich war er jedoch sehr eigenständig. Paul Flamand hat nach Durchsicht meiner Dokumente sogleich zugesagt, das Buch zu veröffentlichen. Es bestand aus einer Serie von sehr kurzen Kommentaren zu den vorgestellten Dokumenten.
Dieses Buch erschien genau zeitgleich mit Der Stellvertreter von Rolf Hochhuth, ein Stück, das 1963 einen Skandal hervorrief, weil es das Schweigen Pius XII. zum Schicksal der Juden während des Zweiten Weltkriegs anprangerte.
Mein Buch ist im November 1964 erschienen, und zu jenem Zeitpunkt wurde in der Tat das Stück Hochhuths, das viel Staub aufwirbelte, überall aufgeführt. Die Haltung des Papstes stand im Zentrum der Diskussionen. Mein Buch ist inmitten dieses Getöses eingeschlagen und hat eine Art Elektroschock ausgelöst. Es wurde von der konservativen – sowohl klerikalen als auch nicht klerikalen – Rechten und von der Kirche angegriffen. Man hat mich mit allen möglichen Schimpfnamen belegt. Von der Linken ist es unterstützt worden. Einige katholische Persönlichkeiten haben es verteidigt, darunter der Kardinal Tisserant, der Dekan des Sacré Collège. Er schrieb mir einen Brief, in dem er sagte, dass es gut sei, dass die Wahrheit ans Licht komme. Ich habe ihn übrigens um die Autorisierung gebeten, den Brief in der amerikanischen Ausgabe des Buches zu veröffentlichen. Was er akzeptiert hat. Das Buch wurde ein Erfolg. Es ist in rund fünfzehn Sprachen übersetzt worden.
Sie waren damals etwas älter als dreißig. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Erfolg Ihre Karriereaussichten neu definiert hat.
Nach Beendigung meiner Dissertation war es ungewiss, ob ich am Institut in Genf eine feste Stelle bekäme; diese Frage stellte sich dann nicht mehr. Ich war zu einer Art Persönlichkeit geworden. Ich sage dies mit einem Lächeln, in der Hoffnung, dass Sie nicht der Ansicht sind, dass all dies mich heute beeindruckt. Ich war zum Historiker geworden, ohne es wirklich gewollt zu haben. Ich habe gleich im Anschluss an mein Buch über Pius XII. meine Forschungen fortgesetzt, wobei mir mehr und mehr bewusst wurde, was ich da machte. Das dann folgende Buch war Kurt Gerstein gewidmet, einem Leutnant der SS, der für die Vernichtungsmaschinerie gearbeitet hat, zugleich aber die Welt, insbesondere den Heiligen Stuhl, von den Massakern, die an den Juden verübt wurden, in Kenntnis setzen wollte.
»Ich war zum Historiker geworden, ohne es wirklich gewollt zu haben.«
Es gibt eine Verbindung zu Ihrem vorhergehenden Buch, da Gerstein von der Idee besessen war, die religiösen Autoritäten und insbesondere den Papst im Hinblick auf die Judenvernichtung zu alarmieren. Hochhuth hat Der Stellvertreter auf Basis seiner Zeugenschaft geschrieben. Der Untertitel des Buches, das Sie ihm gewidmet haben, Die Zwiespältigkeit des Guten, spielt, denke ich, sehr bewusst auf die berühmte Formulierung Hannah Arendts von der »Banalität des Bösen« an.
Ja. Der Untertitel Die Zwiespältigkeit des Guten schlug in der Tat eine Art Antwort auf den Untertitel von Hannah Arendts Buch über Adolf Eichmann vor. Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen war 1963 in den Vereinigten Staaten erschienen, und ich hatte es natürlich sogleich gelesen.
Eine »Erwiderung«, gerichtet an Arendt?
Sagen wir eher: ein indirekter Bezug auf die Formulierung Hannah Arendts.
Offensichtlich handelt es sich bei Gerstein und Eichmann um sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die zweifellos nur in begrenztem Rahmen vergleichbar sind. Abgesehen davon geht es in Ihrem Buch, nach dem Beispiel des Buches von Arendt, darum, ein psychologisches Porträt zu entwerfen und sich dabei auf moralische Kategorien zu berufen (das Böse, das Gute: Wörter, die in Ihren jeweiligen Titeln auftauchen). Aber Ihre Zielsetzungen sind sehr unterschiedlich.
Was mich betrifft, so schien mir, dass es bei Kurt Gerstein den Willen gab, etwas gegen das Geschehen zu unternehmen, aber seine Handlungsweise war zwiespältig, und es war sicherlich jene eines Einzelgängers: Einerseits wollte er die Vernichtungsmaschinerie hemmen, indem er Informationen verbreitete über das, was geschah, in der Hoffnung, Reaktionen hervorzurufen, jene des Vatikans etwa oder jene neutraler Länder; andererseits lieferte er aber weiterhin Ladungen von Zyklon B an die Lager. Für seine Vorgesetzten war Gerstein ein vorbildlicher SS-Mann, doch zugleich hoffte er, die Operationen, an denen er beteiligt war, zu behindern, was für ihn und seine Familie große Risiken mit sich brachte. Die einzelgängerische Natur seiner Vorgehensweise verurteilte sie zum Scheitern, was er sehr bald erkannte. Dennoch verblieb er auf seinem Posten, um, wie er sagte, anschließend Zeugnis ablegen zu können. Nachdem er am Kriegsende vier Berichte für die Amerikaner geschrieben hatte – Berichte, die beim Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher als Zeugenaussagen dienten – wurde er den Franzosen übergeben und inhaftiert. Er hat in seiner Zelle im Pariser Gefängnis Santé Selbstmord begangen.
Und wie sehen Sie die Art und Weise, wie Hannah Arendt die Persönlichkeit Eichmanns zu erklären sucht? Ich habe in unseren vorbereitenden Gesprächen – vielleicht zu Unrecht – eine gewisse Gereiztheit oder Reserviertheit Ihrerseits gespürt, wenn der Name Arendt fiel.
Sie haben die Gereiztheit vollkommen richtig erfasst; sie hat zu tun mit dem Ton des Buches, einer gewissen Form der Arroganz, die dort zum Ausdruck kommt. Was die Persönlichkeit Eichmanns betrifft, so bildet er zweifellos den Gegenpart zu Gerstein: auf der einen Seite ein zögerlicher SS-Mann, in gewisser Weise auch im Widerstand, gequält von dem, was er tut; auf der anderen Seite ein leidenschaftlicher Verfechter des Systems, überzeugt von der Bedeutung seiner Aufgabe, was jedoch seine Banalität nicht verhindert – aber die Beweise für seine Banalität, die Arendt ins Feld führt, und ihre Herangehensweise im Allgemeinen sind für mich befremdlich. Sie stützt sich auf Antworten Eichmanns im Verlauf des Prozesses, in denen er sich auf Kant bezieht, um daraus seine geistigen Fähigkeiten abzuleiten. Man braucht aber nicht sehr gewitzt zu sein, um, wie sie es tut, zu der Aussage zu gelangen, dass die philosophischen Kenntnisse des Oberstleutnants der SS Adolf Eichmann, der eine wesentliche Rolle bei der Jagd auf Juden und ihrem Transport in die Vernichtungslager innehatte, lächerlich gering waren. Arendt nimmt die Zitate Eichmanns wieder auf, um zu zeigen, dass er nichts davon verstanden hat. Aber niemand hat Eichmann für einen Philosophen gehalten! Eichmanns Bezüge auf Kant gehören in den Bereich des stereotypen Nazijargons.
»Wenn Eichmann hinsichtlich seiner bürokratischen Persönlichkeit banal war, bedeutet das nicht, dass das, was er tat, gleichfalls banal war.«
Wie haben Sie ihn Ihrerseits aufgefasst?
Als ich vor langer Zeit eine Vorlesung zum Eichmann-Prozess und zum Buch Hannah Arendts hielt, habe ich versucht, diesen Mann zu verstehen. Ich habe insbesondere die Protokolle der Verhöre Eichmanns studiert, die von Avner Less von der israelischen Polizei durchgeführt wurden; ich kannte ihn gut aus anderen Zusammenhängen. Er führte maßgeblich die Vernehmungen bei der Vorbereitung des Prozesses durch. Was mich verblüfft hat und was Arendt nicht erwähnte – ich weiß nicht, ob sie je diese Dokumente in Händen hielt –, ist die Art, wie Eichmann, als Gefangener in Israel, Avner Less gegenüber von Hitler, Himmler oder gewissen anderen Vorgesetzten jener Zeit gesprochen hat. Er benutzte auch 1961 noch systematisch den gesamten Titel oder Rang. Dies ist doch ein sehr seltsames, sehr symptomatisches Phänomen. Eichmann sagte nicht »Himmler« oder »Heinrich Himmler«, er sagte »der Reichsführer der SS und Kommandeur der deutschen Polizei Heinrich Himmler«. Eichmann hatte den Respekt für die Nazihierarchie so sehr verinnerlicht, dass er sich in seiner Ausdrucksweise nicht davon freimachen konnte. Ich fand das wirklich sehr eigenartig. Da hatte jemand den Gehorsam gegenüber der früheren Obrigkeit so stark verinnerlicht, dass er sich ihr noch fünfzehn Jahre nach dem völligen Zusammenbruch des Systems verpflichtet fühlte. Eichmann, der seine Aufgaben effizient und geschickt ausführte, war vor allem unbedingt gehorsam, bewohnt vom Respekt für die Hierarchie, aber auch, im Gegensatz zu dem, was er glauben machen wollte, gänzlich von der Ideologie durchdrungen. Im Verlauf des Prozesses gab er vor, er sei kein Antisemit; aber in einem Interview, das er Willem Sassen in Argentinien einige Jahre vor seiner Entführung durch die Israelis gegeben hatte, hatte er sich anders geäußert … Offensichtlich war Eichmann der perfekte Typ des Nazi-Bürokraten. Darin hat Hannah Arendt recht. Aber wenn er hinsichtlich seiner bürokratischen Persönlichkeit banal war, bedeutet das nicht, dass das, was er tat, gleichfalls banal war. Es war weit davon entfernt, banal zu sein, es war absolut grauenhaft. Hannah Arendt selbst hatte im Vorwort ihres bedeutendsten Buches Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft im Hinblick auf den Nazismus vom »radikal Bösen« gesprochen. Gershom Scholem, der große Spezialist der Kabbala, der schließlich mit Hannah Arendt brach, hat ihr geschrieben: »Wenn Sie vom radikal Bösen sprechen, verstehe ich Sie, wenn Sie aber von der Banalität des Bösen sprechen, kann ich Ihnen nicht mehr folgen …« Arendt ist von einem Thema zum nächsten übergegangen, hat sich aber dabei auf Elemente gestützt, die, so glaube ich, in dieser Debatte ganz und gar nicht an ihrem Platz waren.
Wie war am Anfang der 1960er-Jahre, einer Periode, in der, wie Sie sagten, »Verteidigungsmechanismen« Sie daran hinderten, die Erforschung der Vernichtung anzugehen, der Stand der Geschichtsschreibung und der Bibliographie zu diesem Thema? Verfolgten Sie aufmerksam das historische Schrifttum zu dieser Frage?
Zu Nazideutschland? Zur Shoah? Ja, ich interessierte mich dafür. Ich danke Ihnen für diese Frage. Darauf zu antworten bedeutet, den Finger auf eine Art Ambivalenz zu legen. Ich verfolgte die Veröffentlichungen zu diesem Thema, es beschäftigte mich, aber als eine Fragestellung unter anderen – so sehe ich es zumindest heute –, natürlich als ein etwas heißeres Eisen, ohne dass sich aber daraus, zumindest bis zum Buch über Gerstein, ein Weg abzeichnete, dem ich folgen sollte. Ich hielt mich vor allem auf dem Laufenden über die allgemeine Geschichtsschreibung zum Dritten Reich, doch las ich auch, das stimmt schon, einige Geschichtsbücher, die sich dem Völkermord widmeten und zu jener Zeit nicht sehr zahlreich waren. Als 1961Die Vernichtung der europäischen Juden von Raul Hilberg erschien, habe ich es sogleich gelesen. Ich las auch Memoiren, Bücher von Überlebenden, die wenigen Romane, die Nazideutschland und die Shoah heraufbeschworen, wie Der letzte der Gerechten (1959) von André Schwarz-Bart oder Gepäck aus Sand (1962) von Anna Langfus, die beide den Prix Goncourt gewannen. Jedoch verspürte ich bis etwa 1965 nicht das Bedürfnis, mich auf das zu konzentrieren, was später zu meiner Passion werden sollte, aber ich verfolgte so weit wie möglich die Veröffentlichungen.
Sie haben das Buch von Raul Hilberg zu einer Zeit gelesen, als sich, glaube ich, außer den Spezialisten kaum jemand dafür interessierte?
Israelische Freunde hatten mir davon erzählt. Ich weiß noch, dass ich es sofort bestellt habe. Es stimmt, nur eine kleine Minderheit interessierte sich dafür, jene Minderheit, die sich mit einer Vergangenheit beschäftigte, die, obgleich sie kurz zurücklag, bei Weitem nicht im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit stand …
Und welche Wirkung hat die Lektüre der ersten Ausgabe dieses imposanten Werkes auf Sie gehabt?
Es ist wahrhaftig ein gigantisches Buch. Im Übrigen denke ich, dass diese erste Ausgabe die beste ist. Weil sie gestrafft ist – gestrafft, aber dennoch gigantisch – und weil sie schon das Wesentliche dessen zum Ausdruck bringt, was Hilberg sagen will. Anschließend, in den dann folgenden Ausgaben, hat er nur mehr Details angehäuft. Durch die Summe dieser Zusätze hat das Buch an Dichte verloren. Die Historiker, scheint mir, waren immer eher von dieser ersten Ausgabe überzeugt. Ich habe das Buch sehr bewundert. Ich bewundere es bis heute. Trotz einiger zusammenfassender Werke zur Shoah, die vorausgingen (jene Léon Poliakovs, Gerald Reitlingers, Wolfgang Schefflers), war Hilberg der erste, der die enorme Masse der Dokumente, die bei den verschiedenen Nürnberger Prozessen präsentiert wurden, innerhalb eines rigorosen konzeptuellen Rahmens analysiert hat, und der uns ein extrem detailliertes und präzises Bild von der Verfolgungs- und Vernichtungsmaschinerie der Nazis gegeben hat.
Sie sind in jener Zeit Historiker geworden, »ohne es zu wollen«, wie Sie sagen, und ohne dazu ausgebildet worden zu sein. Hatten Sie keine Dozenten aus der Geschichtswissenschaft?
Als ich in den 1950er-Jahren in Paris Politikwissenschaft studierte, besuchte ich von Zeit zu Zeit die Vorlesungen Pierre Renouvins und nahm teil am Pflichtseminar Jean-Baptiste Duroselles, aber das bildete einen nicht zum Historiker aus. Ich habe nie einen Professor oder Dozenten gehabt. In Genf, wo ich promovierte, gab es keine. Der Historiker war Jacques Freymond, der Institutsdirektor, und der hatte Wichtigeres zu tun. Ich zeigte ihm von Zeit zu Zeit meine Arbeit. Abgesehen von diesem Austausch hat mich niemand »geformt«. Lange war mein Interesse an der Vergangenheit eher gelegentlicher Natur. Die großen Historiker – Fernand Braudel, Johan Huizinga und viele andere – habe ich erst später gelesen.
»Ich bin durch mein wachsendes Interesse an der Shoah erst wirklich zum Historiker geworden.«
Geschichte hat Sie also zuerst einmal so interessiert, wie sie jeden »aufrichtigen Menschen« interessiert, sie war aber keine tief empfundene Leidenschaft …
Das ist in der Tat seltsam, und ich bin durch mein wachsendes Interesse an der Shoah erst wirklich zum Historiker geworden. Ich habe versucht, jene Lektüren nachzuholen, mit denen ich mich damals in der Zeit, in der ich mich ihnen hätte widmen sollen, nicht befasst habe. Ich habe kein Staatsexamen, keinen Magister, keine agrégation in Geschichte. Meine Dissertation betraf die Diplomatie- und Militärgeschichte, aber ich war nicht mit Leib und Seele Historiker. Ich fand mich 1962 in Jerusalem als Professor dieser Fachrichtung wieder, ohne eigentlich Historiker im klassischen Sinne, nach Abschluss eines traditionellen Studiengangs, zu sein. Ich habe ein Unterrichtssemester in Genf beibehalten, wo ich 1964 mit Vorlesungen begonnen hatte, und einige Jahre bin ich zwischen Genf und Jerusalem gependelt. In jener Zeit habe ich zwei weitere Bücher veröffentlicht: L’Antisémitisme nazi. Histoire d’une psychose collective [Der nazistische Antisemitismus. Geschichte einer kollektiven Psychose, nicht auf Dt.] im Jahr 1971 und Histoire et Psychanalyse1975 [Geschichte und Psychoanalyse, nicht auf Dt.].
Was hat Sie in jener Epoche zu dem psychologischen und psychoanalytischen Ansatz veranlasst?
Ich habe in Genf eine Analyse gemacht. Ich hatte sie dringend nötig. Ich hatte ernsthafte psychosomatische und psychologische Störungen (Phobien, Ängste). Sie haben mich nie an der Arbeit gehindert, haben mir aber jahrelang das Leben erschwert. Ich weiß nicht, ob diese Analyse nach allen Regeln der Kunst erfolgreich war oder nicht. Tatsache ist, dass meine Beschwerden nach und nach verschwanden. Dank der Analyse? Sofern sie nicht dank des Buches über Pius XII. verschwanden, das mich gefühlsmäßig in Beschlag nahm. Ich bin gereist. Ich hielt Vorträge. Das Buch war ein Erfolg. Ich war voller Enthusiasmus. Ich war bereit, mich mit jenen auseinanderzusetzen, die das Buch anfeindeten. Meine Behandlung in Genf hatte mein Interesse an der Psychoanalyse als Therapie, aber auch als Denksystem geweckt. In diesem Zusammenhang habe ich das Buch Antisémitisme nazi. Histoire d’une psychose collective geschrieben, das meiner Ansicht nach nicht sehr gelungen ist. Ich habe eine Zeit lang diesen Weg mit Histoire et Psychanalyse, das ich für wenig besser halte, weiterverfolgt. Heute käme es mir nicht mehr in den Sinn, so zu schreiben. Und ich erinnere mich nicht gern an diese beiden Arbeiten. Ich bin nicht stolz auf sie.
»Meine Behandlung in Genf hatte mein Interesse an der Psychoanalyse als Therapie, aber auch als Denksystem geweckt.«
Was speziell erforschten Sie damals?
Es gibt eine Satz von Jean-Paul Sartre – in den Überlegungen zur Judenfrage (1954), glaube ich –, wo er sagt, der Antisemitismus sei zugleich eine Ideologie und eine Obsession. Die ideologischen Wurzeln sind gut bekannt, und man kann sie weiterhin erforschen. Die Psychoanalyse konnte uns dabei helfen, die obsessionelle Seite des tatsächlichen Antisemitismus zu verstehen. Dieser findet in der Ideologie die eigenen Phantasmen wieder oder erarbeitet eine Ideologie, die Ausdruck seiner Phantasmen ist. Wollte man diese Art psychohistorischer, psychosozialer Studien wieder aufnehmen, müsste man von der Ideologie ausgehen und zeigen, wie die Themen, die sie strukturieren, die Bilder, die bei jeder Gelegenheit wiederkehren, anschließend dazu dienen, persönliche Phantasmen in einem spezifischen antisemitischen Diskurs zu verankern, der je nach Gruppe oder Persönlichkeit wechselt, aber schließlich immer auf einige obsessionelle Bilder hinausläuft, die es zu analysieren gilt.
Zu der Zeit, da ich L’Antisémitisme nazi. Histoire d’une psychose collective schrieb, war ich sehr beeinflusst von der Theorie zur autoritären Persönlichkeit, die selbst wiederum tief verankert ist in den psychoanalytischen Theorien. Aber ich hatte schnell den Eindruck, dass das nicht funktionierte, und habe, wie ich schon sagte, diesen Ansatz aufgegeben.
Was enttäuschte Sie daran?
Was ich schon vom europäischen Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts wusste, schien mir über das hinauszugehen, was die Psychoanalyse dazu sagen konnte. Ich kam schließlich zu der Ansicht, dass der Antisemitismus weitaus komplexer war als das, worauf psychohistorische oder psychosoziale Ansätze ihn reduzierten.
Waren die Texte von Hannah Arendt zum Antisemitismus für Sie von Bedeutung, als Sie L’Antisémitisme nazi. Histoire d’une psychose collective verfassten?
In Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft hat Arendt ihre eigentlichen Theorien über Antisemitismus und Totalitarismus ausgearbeitet. Bei ihr wird der Totalitarismus zu einem Phänomen, das unter anderem auf dem Antisemitismus basiert, was eigenartig ist, weil dies offensichtlich nicht für den sowjetischen Totalitarismus gilt, zumindest nicht so wie für den Nazismus. Die Theorien Arendts sind sehr speziell, sehr persönlich. Wenn ich an Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft denke, kommt mir immer in den Sinn, was man über Spengler mit Blick auf sein Buch über den Untergang des Abendlandes geäußert hat. Ich glaube, Ernst Jünger hat gesagt, dass in seinen Irrtümern mehr Reichtum stecke als in den Wahrheiten vieler anderer Autoren. Dies trifft ein wenig zu auf das Buch Arendts, in dem es vor anregenden Intuitionen, auch zum Antisemitismus, nur so wimmelt. Sie hat von Kafka den Begriff des Paria entliehen – »Sie sind nicht aus dem Schloss, Sie sind nicht aus dem Dorfe, Sie sind nichts«, sagt in Das Schlossdie Gastwirtin zu K. Aber Arendts Beschreibung der Juden am Hof, jener Juden, die im Dienst stehen von Königen, Potentaten, Regierungen, und die der Zivilgesellschaft mehr und mehr verhasst sind, ist sehr anfechtbar, trifft vielleicht teilweise zu auf die deutschen Staaten, aber gewiss nicht auf Osteuropa, wo der christliche Antisemitismus der beherrschende Faktor blieb.
Sie haben in den 1970er-Jahren über den Antisemitismus geschrieben und dreißig Jahre später, im ersten Band von Das Dritte Reich und die Juden, einen berühmten Text über den »Erlösungsantisemitismus« verfasst. Somit wäre die Frage aufschlussreich, welche Entwicklung dieses zentrale Motiv der gesamten Geschichte der Shoah bei Ihnen genommen hat.
Im Anschluss an mein Buch von 1970 über den als kollektive Psychose aufgefassten Antisemitismus, nach der Enttäuschung, von der ich sprach, im Hinblick auf Methode und Theoriebildung, die mich eine Zeit lang gereizt hatten, zog ich es vor, mich an eine äußerliche, eine phänomenologische Beschreibung des Antisemitismus zu halten.
Aber welche Position nehmen Sie ein angesichts der Geschichte des Antisemitismus in Europa, wenn man seine lange Dauer in Betracht zieht? Wo ordnen Sie sich ein in Bezug auf andere Historiker der Shoah, wie etwa Hilberg? Letzterer zeichnet in einem Kapitel von Die Vernichtung der europäischen Juden Europas (mit dem Titel »Die Präzedenzfälle«) die Linien einer tausendjährigen Geschichte des europäischen Antijudaismus nach, die scheinbar auf die Endlösung als vorprogrammiertes Ende zulaufen muss. Man denkt auch an Léon Poliakov und seine gigantische Geschichte des Antisemitismus, für den der Antisemitismus der Nazis eine Bewegung bestätigt, die über die moderne Geschichte, über die Geschichte Deutschlands hinausgeht und sehr tiefe Wurzeln in der Geschichte des christlichen Abendlandes hat. Wie stehen Sie zu dieser Analyse langer Zeiträume?
Ich stimme mit Hilberg überein, wobei er allerdings diese »Präzedenzfälle« zum Nazismus nur auf einigen Seiten erwähnt und dann zu anderen Dingen übergeht, die davon sehr verschieden sind, ja, im Widerspruch dazu stehen. Hilberg skizziert in der Tat im Vorwort diese Vorstellung einer tiefen Verwurzelung des Antisemitismus im Schoß einer christlich-religiösen Ideologie: Ich glaube, er erstellt sogar eine Liste der von diesem oder jenem Konzil, diesem oder jenem Papst erlassenen Edikte gegen die Juden, um zu zeigen, dass die Folge der Maßnahmen große Ähnlichkeit hat mit jenen, die später die Nazis in moderner Form gegen die Juden ergriffen. Dann lässt er im Anschluss diese Intuition fallen, die viele vor ihm gehabt haben und die die christlichen und ideologischen Wurzeln im Allgemeinen betreffen, um sich ausschließlich auf die bürokratische Maschinerie zu konzentrieren, die seiner Ansicht nach von der nazistischen Definition dessen, was ein Jude sei, zu ihrer Auslöschung führt.
Hilberg greift da nur die Ideen von Franz Neumann, seinem Doktorvater an der University of Columbia, auf. Dieser hatte 1944Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933–1944 verfasst, ein für die Epoche bemerkenswertes Buch über die Struktur des nazistischen Totalitarismus, dessen vier bürokratische Säulen – die Partei, die Armee, die Staatsbürokratie und die Wirtschaftsstruktur – er definiert hat. Hilberg macht das auf geniale Weise, er fügt die immense Dokumentation hinzu, die er auf der Basis insbesondere der Dokumente der Nürnberger Prozesse gesammelt hat, um seine These von der bürokratischen Maschinerie zu untermauern, die ihm zufolge zur »Endlösung der Judenfrage« führt, so die nazistische Bezeichnung der Judenvernichtung. Auffallend und seltsam ist aber bei dieser Beschreibung die Preisgabe der im Vorwort präsentierten Elemente; das heißt, die Verbindung zwischen der Ideologie, von der er anfangs spricht, und dem Anwerfen der nazistischen Maschinerie wird nicht deutlich. Das Buch vergisst gewissermaßen unterwegs, im dokumentierten und äußerst präzisen Korpus Hilbergs, die ideologische Dimension. Am Ende seines Buches fügt er der Beschreibung des Mechanismus nur die Reaktion der benachbarten Länder, der Regierungen und jene der Juden hinzu, wobei er diese auf jahrhundertealte Unterwerfung unter die Obrigkeit reduziert und, was die Judenräte betrifft, auf häufige Kollaboration.
Was nun Léon Poliakov angeht, so ging dieser umgekehrt vor. In Le Bréviaire de la haine [Leitfaden des Hasses, nicht auf Dt.], das sich mit dem nazistischen Antisemitismus und der Shoah befasst und sehr früh, 1951, also zehn Jahre vor dem Erscheinen von Hilbergs Buch, veröffentlicht wurde, haben Ideologie und Politik den Vorrang, die institutionelle, bürokratische Seite wird kaum erwähnt. Seine immense Geschichte des Antisemitismus nimmt Poliakov erst später in Angriff und macht daraus die Geschichte einer Ideologie, die in einer umfassenden Kulturgeschichte verankert ist.
In Ihrem Kapitel zum »Erlösungsantisemitismus« ist die Analyse knapper, kompakter: Ihr Interesse gilt vor allem dem 19. und 20. Jahrhundert, ab dem Zeitpunkt, da der Antisemitismus rassisch wird.
Die Idee selbst von einem erlösenden Antisemitismus geht Hitler und dem Nazismus voraus, aber ich hatte bei diesem Buch nicht wirklich den Ehrgeiz, die Geschichte dieses Phänomens über große Zeiträume hinweg zu verfolgen. Die spezifische Form des Antisemitismus, mit der ich mich beschäftige, entstammt einer ideologischen Strömung, die sich vor allem in Deutschland entwickelt und die in der Tat dem religiösen Substrat eine rassische Dimension hinzufügt, wobei dieses religiöse Substrat, man sollte das nicht vergessen, dabei nicht verschwindet. Diese völkische Bewegung, die von Fritz Stern und George L. Mosse so eingehend untersucht worden ist, feiert große Erfolge im intellektuellen Milieu, das Cosima Wagner (die Witwe des berühmten Komponisten) in Bayreuth, der Hochburg des Wagnerkultes, um sich versammelt. Der radikalste Intellektuelle der Gruppe ist der Engländer Houston Stewart Chamberlain, der die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat und mit einer Tochter Wagners verheiratet ist. In seinen Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts führt er das Thema eines Kampfes auf Leben und Tod zwischen Ariern und Juden ein.
Das Buch Chamberlains wird im kaiserlichen Deutschland zum Bestseller. Chamberlain präzisiert zwar nicht, wie dieser Kampf gegen die Juden geführt werden soll, doch im völkischen Milieu verbreitet sich ein Leitgedanke: die Entfernung, das heißt das Verschwinden der Juden aus dem Wirkungs- und Vorstellungsbereich der Deutschen sei unerlässlich. Ansonsten führe die jüdische Präsenz zu Dekadenz und Zerstörung, zu all den Übeln, welche die Juden mit sich brächten. Die Juden werden von jenen, die sich die Frage stellen, wie man sich ihrer entledigen könne, als Parasiten, als Mikroben betrachtet. Dies lässt sich auf verschiedene Weise auffassen und führt zu unterschiedlichen politischen Formen: die Juden aus dem wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Feld zu entfernen und insbesondere sexuellen Kontakt mit Ariern auszuschließen, sie, kurz gesagt, abseits zu halten, um jeglichen Kontakt mit der sie umgebenden Gesellschaft zu vermeiden; sie geographisch an einem Ort zusammenzufassen, den sie nicht mehr verlassen können und an dem sie sich möglicherweise nicht mehr fortpflanzen können; schließlich sie physisch auszulöschen. Hitler und die Politik der Nazis haben diese drei Phasen durchlaufen. Alle sind in Erwägung gezogen worden. Und hier darf man nicht »die Tatsache der Vernichtung isolieren«, um die Wendung von Claude Lanzmann aufzugreifen, sondern sollte im Gegenteil die unterschiedlichen Etappen rekapitulieren, die die Ausarbeitung einer »Endlösung der Judenfrage« durchlaufen hat. Für Hitler geht es von Beginn an in Mein Kampf darum, die arische Welt, letztlich die Menschheit durch Ausschaltung des Juden zu retten, daher mein Begriff des »Erlösungsantisemitismus«.
In den Dreißigerjahren, als sich in diversen Umgebungen schon ein extremer Antisemitismus artikuliert, befinden wir uns eindeutig in der Phase der Segregation, die ihren Höhepunkt Ende 1935 mit den Nürnberger Gesetzen und den dann folgenden Durchführungsbestimmungen erreicht. Die Juden können biologisch gesehen nicht mehr Teil der sie umgebenden arischen Gesellschaft sein. Sie dürfen keine Arier mehr heiraten, keine sexuellen Beziehungen mit ihnen haben, und können daher die arische Rasse nicht mehr »verunreinigen«. Wenig später, 1936 und 1937, nimmt man ihnen nach und nach die Möglichkeit, wirtschaftliche Kontakte mit den anderen Mitgliedern der deutschen Gesellschaft zu pflegen; Ende 1938 kommt es dann mit der Kristallnacht zum vollständigen Ausschluss.
Ab März 1938, ab dem »Anschluss«, treiben diverse Maßnahmen der Nazis die Juden dazu, das nun zum Großdeutschen Reich gewordene Deutschland zu verlassen, oder vielmehr zu fliehen. Dies betrifft die deutschen Juden in jedem Fall, natürlich auch jene des eingegliederten Österreichs, dann die in Deutschland lebenden polnischen Juden, ebenfalls jene in den Sudeten, dann, ab März 1939, die Juden des nunmehr sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren (der tschechische Teil der ehemaligen Tschechoslowakei), kurz gesagt betrifft es bis Kriegsausbruch immer größer gefasste Gruppen. Die Nazis entscheiden dann, die Juden aus allen von den Deutschen besetzten Gebieten zu vertreiben. Es gibt diverse territoriale Pläne. Nach der Eroberung Polens werden Tausende von Juden hinter die deutsch-sowjetische Demarkationslinie vertrieben. Danach tragen die Nazis sich mit der Vorstellung, sie könnten geographisch in der Region von Lublin zusammengezogen werden, eine Lösung, die sich als unausführbar erweist, und sei es nur, weil nicht die nötigen Transportmittel vorhanden sind.
Als Frankreich unter deutsche Herrschaft fällt, kehrt ein altes antisemitisches Vorhaben auf die Tagesordnung zurück, das Projekt »Madagaskar«: alle europäischen Juden auf Madagaskar zusammenzupferchen. Dies erweist sich als illusorisch, da die Engländer die Meere beherrschen und die Deutschen kein einziges Schiff nach Madagaskar überführen können. Schließlich verfällt man auf eine dritte territoriale Idee: die Juden im Norden Russlands, im Bereich des Gulag zu konzentrieren. Im Übrigen denkt Heydrich daran, sie in die Baracken zu stecken, in denen die von Stalin deportierten Gefangenen leben. Der Sieg an der Ostfront ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass dieser dritte Plan territorialer Zusammenlegung verwirklicht werden kann. Sonst wäre es nicht möglich, die Züge in Gang zu setzen oder alle Juden in das Russland jenseits des Polarkreises zu befördern. Offensichtlich sind in all diesen territorialen Plänen die Juden dazu bestimmt, über kurz oder lang den Tod zu finden.
Da all dies misslingt und der Krieg sich nicht nur in die Länge zieht, sondern wahrhaft das Risiko besteht, dass er fortdauert, beschließt Hitler dann – dies ist zumindest meine Interpretation –, eine Wiederholung der Situation der Jahre 1917/





























