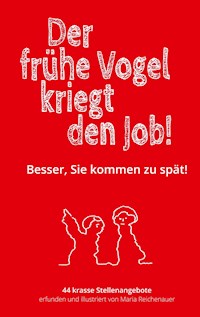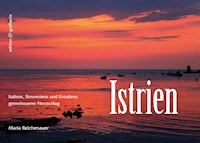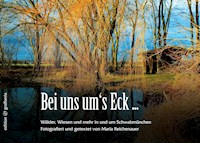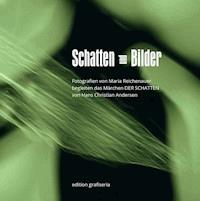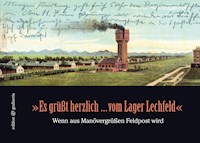
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Erkenntnis, dass das Lager Lechfeld nicht erst seit dem heute bekannten Fliegerhorst zu existieren begann, sondern sich dort bereits seit Mitte des 19. Jh. eine feste militärische Einrichung etablierte, war für die Autorin Anlass, mittels alter Postkarten zu recherchieren und die Entwicklung des Lagers in groben Zügen nachzuvollziehen. So folgte sie den Spuren vom einfachen Übungslager zu einem der wichtigsten Truppenübungsplätze des bayerischen Königreichs, den so gut wie jeder Soldat im Bayernland mindestens einmal in seiner Militärzeit "genießen" durfte. Die gesammelten Ansichtskarten in einem Büchlein zusammenzuführen und als Bildband zu veröffentlichen, das war zunächst der Plan. Als die Autorin jedoch einen Blick auf die Kartenrückseiten warf und ein wenig hineinlas in das, was die Männer nach Hause, an die Frau oder Freundin, an die Familie, an Kameraden schrieben, war klar: Da sollte mehr daraus werden. Denn natürlich wollte man in Friedens- und später auch in Kriegszeiten mit seinen Lieben zuhause in Verbindung bleiben. Die Ansichtskarte war vor ca. 100 Jahren der Kurznachrichtendienst - twittern per Post sozusagen. Da sich auch die Fotografie Anfang des 20. Jh. bereits fest etabliert hatte, konnte man auch gleich ein Bild "posten". So mancher Soldat markierte mit dem Stift die Baracke. wo er untergekommen war, man verschickte Gruppenfotos und Aufnahmen vom Gelände. Auch wenn das Geschriebene oft schwer zu entziffern war, es ist ein kleiner Überblick herausgekommen, was die Männer bewegte und was manchmal nur zwischen den Zeilen stand: Schnelle Grüße, Dank für Post und Pakete, Bericht über größere oder kleinere Probleme des Manöver- und Soldatenlebens ... geschrieben von Männern, die Schießausbildungen absolvierten, Kriegsgefangene bewachten oder von der Front nach hause schrieben. Die älteste Karte ist aus dem Jahr 1896, die neueste von 1920. Dazwischen liegt eine Zeit, in der sorglose Manövergrüße verschickt wurden, aber auch Jahre, in denen aus Manöverpost Feldpost wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Dankeschön …
Wenn aus Manövergrüßen Feldpost wird
1859
1860
1866
1870
1871
1874
1877
1880 - 1900
1911
1914
1916
1918
1919
Presseschau 1859 –1925
Im Fluge durch‘s Leben … wenn es so einfach wäre …
Feldpost
Literaturhinweise
Bisher erschienen:
Dankeschön …
... möchte ich allen sagen, die mir geholfen haben, dieses Büchlein auf den Weg zu bringen; danke für die Zeit, die Sie sich nahmen, um meine Fragen zu beantworten und Auskunft zu geben, wo es keine oder nur wenige schriftliche Unterlagen gab.
Ganz besonders möchte ich mich bei Herrn Anton Zott bedanken für seine Hilfe bei der Recherche zum Fotografen F. W. Putsch sowie Herrn Hans Pade für seine Auskünfte zur damaligen Gastronomie »Steinernes Haus« und »Kronprinz«. Ganz besonders dankbar bin ich meinem Lebensgefährten Günter Köhler, der mir stets mit Rat und Tat zur Seite stand, der mich bestärkt hat, wenn ich gezweifelt habe und mich aufgebaut hat, wenn mir das Schicksal der Kartenschreiber manchmal sehr nahe ging.
Fehler oder Irrtümer sind nie ausgeschlossen, auch wenn man größte Sorgfalt walten lässt. Sollte ich etwas falsch verstanden oder interpretiert haben, so bitte ich um Entschuldigung.
Fort Douaumont bei Verdun, Frankreich
Vor vielen Jahren besichtigte ich das Fort Douaumont bei Verdun in Frankreich. Diese Festung steht wie kein anderer Ort für die ebenso erbittert geführte wie verlustreiche Auseinandersetzung zwischen französischen und deutschen Soldaten. Das Fort wurde am 25. Februar 1916 von deutschen Truppen eingenommen, die französischen Einheiten eroberten es am 24. Oktober 1916 wieder zurück. Dazwischen liegen Monate des Bangens und des sinnlosen Sterbens. Die jeweiligen »Herren« dieser Festung mussten in dunklen, stickigen Unterkünften hausen, der Lärm der Kanonen war unbeschreiblich. Dieser Besuch sowie die Tatsache, dass das Gelände um Verdun immer noch die Narben dieses Krieges trägt, haben sich mir ins Gedächtnis gebrannt. Als mir bewusst wurde, dass das Lager Lechfeld nicht erst mit dem bekannten Fliegerhorst zu existieren begann, sondern dass es bereits militärisches Leben Ende des 19. Jh. dort gab, begann ich, mittels alter Postkarten zu recherchieren. Die gesammelten Ansichtskarten in einem Büchlein zusammenzuführen und als Bildband zu veröffentlichen – das war der Plan. Als ich ein wenig hineinlas in das, was die Männer nach Hause, an die Freundin, an die Familie, an Kameraden schrieben, war mir klar: Da sollte mehr daraus werden.
Die Kartensammlung wuchs kontinuierlich, nun auch mit Blick auf das, was die Rückseiten zu erzählen hatten. Auch wenn das Geschriebene oft schwer zu entziffern war – meist in Sütterlin-Schrift, oft mit Bleistift und in Eile verfasst, vielleicht auch unter nicht besonders guten Lichtverhältnissen – es ist ein kleiner Überblick herausgekommen, was man an seine Lieben zuhause loswerden wollte: Einfach nur Grüße, Dank für Post und Freude über Pakete, Bemerkungen über kleine und größere Probleme des Manöver- und Soldatenlebens … geschrieben und verschickt von meist jungen Männern, die im 1860 gegründeten Lager Lechfeld an Wehrübungen teilnahmen, Schießausbildungen absolvierten, Kriegsgefangene bewachten oder aus dem Feld nach Hause schrieben.
Franz Marc, 1910 (Fotograf unbekannt, aus: Die Unvergessenen, Herausgeber Ernst Jünger, 1928)
Die Karten- und Grußsammlung beginnt um die Jahrhundertwende, die älteste Karte ist von 1896, die letzte von 1920. Dazwischen liegt eine Zeit, in der sorglose Manövergrüße verschickt wurden, aber auch Jahre, in denen aus Manöverpost Feldpost wurde. Geschrieben von Männern, die entweder länger in der Kaserne Dienst taten oder kurzfristig für ihren Einsatz an der Front trainiert und ausgebildet wurden.
Um den Eindruck zu vervollständigen, übernahm ich einige Kartengrüße von Soldaten, die von der Front nach Hause schrieben. Natürlich war die Zensur ständiger Begleiter. Einer der prominentesten Briefschreiber: der Künstler, Maler und Grafiker Franz Marc, dessen feinsinnige Korrespondenz mit seiner Frau Maria, seiner aus dem Elsaß stammenden Mutter und einigen anderen ihm Nahestehenden Eingang in die Literatur fand. Künstler und zugleich Soldat – das ist ein Spagat, den er als spannend, erregend und ernüchternd zugleich empfand. Und tödlich, denn Marc fiel 1916 in Braquis bei Verdun mit nur 36 Jahren. Auf die Bilder, die er nach eigenen Aussagen erst mit 40 oder 50 Jahren hätte malen können, musste die Nachwelt also leider verzichten. Geblieben ist sein Werk im Franz Marc Museum in Kochel. Hatte er das Leben im Kriegsgebiet anfangs aufregend und sogar mythisch empfunden, so erkannte er im Laufe der Zeit auch die Schrecken dieses Krieges. In den Briefen an seine Frau gab er sich eher zuversichtlich, denn er wusste, dass sie eine erklärte Pazifistin war, die sich sehr um ihn sorgte. Doch die Post an Lisbeth Macke, die Ehefrau seines bereits 1914 gefallenen Künstlerkollegen August Macke, offenbart auch, wie sehr er seine anfängliche Begeisterung revidieren musste. Die Briefe aus dem Felde wurden 2020 neu aufgelegt (AlliteraVerlag, ISBN 9783869066219) und sind auch heute eine empfehlenswerte Lektüre.
Aber nicht nur prominente Stimmen sollen gehört werden. Auch wenn in diesem Buch hauptsächlich Ansichtskarten vom Lager Lechfeld abgebildet sind – ich habe während der Entstehung dieses Buches sehr viele Feldpostkarten gelesen, die direkt aus dem Kriegsgebiet Nordfrankreich verschickt wurden, ebenso wie Briefe, die der »Augsburger Neuen Zeitung« zur Veröffentlichung überlassen wurden, die eine deutliche Sprache sprechen – nicht alles konnte die Zensur verhindern. Ob diejenigen, die die Kartengrüße auf den Weg brachten, den verlustreichen Krieg überlebten oder vielleicht ihr Leben im Feld verloren oder im Lazarett starben, lässt sich nicht nachverfolgen. Ich hoffe für jeden einzelnen, dass er gut wieder nach Hause kam. Denn nach vielen Stunden, die ich mit dem Transkribieren der Texte verbrachte, ist mir jeder einzelne ans Herz gewachsen.
In jedem Fall sehe ich dieses Buch als Erinnerung an junge Menschen, die daran glaubten, dass der Staat es gut mit ihnen meint und die sich deswegen für einen als gerecht propagierten Verteidigungskrieg begeistern ließen. Sie wurden in eine kriegerische Auseinandersetzung hineingetrieben, ja hineingejubelt, die vor allem dem Machterhalt ihrer Regierungen diente. Unter dem Strich gab es wie in jedem Krieg allzu viele Verlierer.
Und es ist die eindringliche Mahnung, sich von keiner Seite verführen zu lassen, sondern sich gründlich und unabhängig zu informieren. Es ist einfach unsere Pflicht, kontinuierlich und mit aller Kraft am Frieden zu arbeiten und nicht mit dem Säbel zu rasseln, wie es einst der österreichische Kaiser Franz Josef und vor allem der deutsche Kaiser Wilhelm II. taten. Letzterer stürzte das Deutsche Reich damit nicht nur in die kriegerische Auseinandersetzung von 1914 bis 1918, sondern legte – wenn auch unwissentlich – den Grundstein für den Zweiten Weltkrieg.
Maria Reichenauer, Dezember 2021
Wenn aus Manövergrüßen Feldpost wird
Ungefähr 28.000 Karten wurden während des Ersten Weltkriegs als Feldpost verschickt, natürlich nicht nur vom und ins Lager Lechfeld. Aber auch schon während der Manöverjahre zuvor wurde ein reger Kartenaustausch gepflegt. Die Ansichtskarte war der Kurznachrichtendienst dieser Zeit – twittern per Post sozusagen. Da sich die Fotografie Anfang des 20. Jahrhunderts schon fest im Alltag etabliert hatte, konnte man mit der Karte auch gleich ein Bild »posten«. So mancher markierte mit einem Stift die Baracke, in der er untergekommen war, man konnte Gruppenfotos verschicken oder auch ein wenig damit prahlen, mit welch schwerem Gerät man umzugehen gelernt hatte.
Wahrscheinlich bedeuteten die Wehrübungen in Friedenszeiten für den einen oder anderen sogar eine kleine Auszeit – von den Pflichten zuhause, von der Familie, von der Arbeit auf dem heimischen Hof oder von eintöniger Schreibtischarbeit. Auch wenn der Dienst körperlich anstrengend war, man pflegte Kameradschaft, traf Bekannte aus früheren Übungen usw. Und schließlich kam man seiner »Wehrplicht« nach, aus der sich der als wehrfähig eingestufte Mann nicht einfach herausschleichen konnte. Die Militärpflicht, die durch die Reichsverfassung und weitere Gesetze geregelt wurde, begann mit Vollendung des 20. Lebensjahres und endete mit Vollendung des 39. Lebensjahres. Die aktive Dienstzeit war in der Regel drei Jahre, danach folgten vier Jahre der Reserve. Mit der »Parole« zählte man gerne die Tage, die man noch zur Verfügung stehen musste. Der Militärpflichtige, auch wenn er gerade nicht »diente«, war der Aushebung unterworfen, das heißt, er musste sich regelmäßig bei der zuständigen Behörde melden, wo dann je nach Bedarf über seine weiteren Einsätze entschieden wurde. Zur Kontrolle wurden in den Gemeinden sogenannte Stammrollen geführt. Wer dem Aufruf zur Meldung nicht nachkam, musste mit empfindlichen Strafen rechnen.
Als auf dem Lechfeld mit Beginn des Ersten Weltkriegs Ende Juli 1914 aus den Grüßen vom Übungsgelände Feldpost wurde, änderte sich auf den ersten Blick nicht viel. Doch wenn man zwischen den Zeilen weiterliest, spürt man trotz der vordergründigen Nüchternheit, dass die Situation nun eine andere war. Auch das Gesicht der Ansichtskarten änderte sich. Es werden verstärkt standardisierte Ansichten des Lagers verschickt. Gerne zeigte man den Ausblick auf die Berge, kündigte mit einem kleinen Flugzeug am oberen Rand schon den künftigen oder neuen Flugbetrieb an oder stellte in einer Collage die Infrastruktur des Lagers dar: Wasserturm, Verwaltung, Lazarett, die verschiedenen Lagerstraßen durch die Barackenwelt und den Bahnhof. Darstellungen von Scheingefechten, Artillerie und Kavallerie werden seltener. Es waren jedoch auch »Kitschkarten« im Umlauf, die Soldatenleben und Soldatenliebe schmackhaft machen sollten. Im Lager auf dem Lechfeld spielten sie wohl keine große Rolle Dennoch fanden ein paar Exemplare den Weg in dieses Buch, um den Eindruck zu vervollständigen.
War die Post, die aus den Übungseinheiten verschickt wurde, eher ein sorgloser Kartengruß, so hallen in der Feldpost Sätze wie »Mir geht es noch gut« doch sehr eindringlich nach. Auch wenn auf den ersten Blick Alltägliches mit einer manchmal erstaunlichen Distanziertheit ausgetauscht wird, war es doch so, dass der Schreiber bereits mit einem Bein im Kriegsgeschehen stand. Denn wer – vor allem nach 1914 – ins Lager Lechfeld einberufen und dort ausgebildet wurde, der konnte sicher sein, dass sein Einsatz an der Front bevorstand. Nur wer als Stamm- und Wachpersonal Dienst tat, dem blieb der Fronteinsatz eher erspart. Denn das Lechfeld selbst war während des »Großen Krieges« kein Kriegsschauplatz, aber immer Ausbildungsbasis und schon bald nach Kriegsbeginn zunehmend Kriegsgefangenenlager.
Dies ist wohl der Grund, warum die Grüße aus dem Lager Lechfeld auf den ersten Blick nicht so spektakulär sind wie mancher Brief von der Front. Nach erfolgreichem Abschluss der Übungen ging es für die Absolventen dann aber nicht mehr um Manöverheimweh, sondern um Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und ums Überleben.
Das war den meisten Männern sicher bewusst, doch politische Äußerungen sind so gut wie nicht vorhanden, auch über den Sinn und Unsinn der bevorstehenden kriegerischen Auseinandersetzung wurde nicht offen spekuliert oder gar diskutiert. Ob dies der Zensur zuzuschreiben ist, der die Feldpost unterlag oder ob man die Einberufung als vaterländische Pflicht sah – es geht aus den Texten nicht hervor. Wahrscheinlich war beides der Fall. Es fehlt aber auch die Begeisterung, wie sie vielfach propagiert wurde. Die Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen und die Sorge um die Angehörigen überwiegen, mal etwas unbeholfen und holprig, mal sehr knapp, mal sehr eloquent formuliert.
Da man damit rechnen musste, dass Dinge, die der Obrigkeit nicht gefielen, einfach nicht beim Andressaten ankamen, so hielt man sich wohl auch bewusst zurück. Ein »Mir geht es noch gut« oder »ich hoffe, es geht euch gut« sind in dieser Situation nicht nur Routine, wie man sie aus Urlaubskarten kennt, es sind Botschaften, bei denen Sorge für die Lieben zuhause mitschwang ebenso wie der Wunsch, den Angehörigen ein wenig Kummer und Ungewissheit zu nehmen. Aus jeder Karte spricht aber auch der eindringliche Wunsch, den beiderseitigen Kontakt nicht abreißen zu lassen, die Sehnsucht, Nachricht von zuhause zu erhalten und auch selbst immer wieder ein Lebenszeichen zu senden.
Im Verlauf des Ersten Weltkrieges musste das Lager Lechfeld neben dem Ausbildungsbetrieb bis zu 20.000 Kriegsgefangene verschiedener Nationen aufnehmen – keine einfache Situation für Bewacher und Bewachte. Einige Bilder zeigen Kriegsgefangene: das Leid, das Krieg und beengte Raumverhältnisse mit sich brachten, werden allerdings weder in Wort noch Bild offenbar. Auch hier muss man zwischen den Zeilen lesen. Ein Besuch des 1871 angelegten, heute als historisch geltenden Soldatenfriedhofs von Schwabstadl spricht jedoch eine deutliche Sprache.
Die Rechtschreibung wurde von den Ansichtskarten weitgehend übernommen, sie entspricht nicht immer der heute gültigen Grammatik. Manches nicht lesbare Wort musste ausgeklammert oder sinngemäß ergänzt werden. Schließlich sind die Karten mehr als 100 Jahre alt. Aus Datenschutzgründen wurden trotz dieses Alters nur die Vornamen der Absender und Adressaten verwendet – die Namen sind unwichtig, es zählen nur die Menschen, die hinter den Karten stehen.
F. W. Putsch, Atelier Bavaria, Lager Lechfeld. Geschrieben und verschickt 1915 als Feldpost.
Die nächsten Seiten zeigen stichpunktartig die Entwicklung des Lagers auf dem Lechfeld von seiner Geburtsstunde 1859, seiner Existenz als einer der bedeutendsten Manöverschauplätze in Bayern bis zur Auflösung nach dem Ersten Weltkrieg. Als das Lager nach 1920 schrittweise abgebrochen bzw. zweckentfremdet wurde, konnte sich niemand vorstellen, dass es dort jemals wieder militärische Aktivitäten geben würde.
1859
Der Grundstein für das Lager Lechfeld wurde weit im Süden Europas gelegt. Der Waffenstillstand von Villafranca am 12. Juli 1859 beendete den Sardischen Krieg, in dem sich Piemont-Sardinien mit Hilfe des französischen Kaisers Napoleon III. gegen Österreich erfolgreich durchgesetzt hatte.