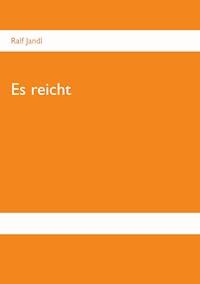
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wende oder Ende Die Streitschrift behandelt Fehlentwicklungen in Deutschland im staatlichen und gesellschaftspolitischen Bereich. Der Autor hat fast 30 Jahre als Jurist in der Ministerialbürokratie gearbeitet und vor allem während seiner Zeit in der Staatskanzlei Einblick in die Mechanismen der Politik bekommen. Seither hat er sich vor allem auf dem Gebiet der Volkswirtschaft und Soziologie weitergebildet. Es wird gezeigt, wie und warum elementare Bereiche der Politik und Gesellschaft sich zum Negativen entwickelt haben, und welche Gefahren damit verbunden sind. Dabei wird auch der Bereich von Religion und Kunst einbezogen. Es wird dargestellt, wie eine Umkehr möglich sein könnte, und wie die Dinge sich in Zukunft entwickeln könnten. Insbesondere wird gezeigt, was zu geschehen hat, um die negativen Trends aufzuhalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Es wussten schon andere
Vorwort
Ein neues Jahrtausend – die alten Probleme
Der Verrat der Intellektuellen
Fernsehphilosophen
Eigennützigkeit der Eliten
Falsche Paradigmen
Das ständige Wachstum
Staatsverschuldung ohne Ende
Zur Rolle der Banken oder zum System des Systemischen
Sparen als Selbstzweck?
Neues durch Piketty?
Piketty und sein Doktorand Zucman
Die neueste Idee: Free Parks
Abgeltungssteuer als Vermögensbildungsplan für Millionäre
Die Schnäppchenrepublik
Unternehmensberater – Macht ohne Verantwortung
Das Prinzip Unverantwortlichkeit
Der Fluch der political correctness
Wo ist Wahrheit?
Lügengebäude:
Der Kalte Krieg – ein Musterfall staatlicher Propaganda und „politischer Incorrectness“
Der Kosovokrieg
Afghanistan – ein Lehrstück aus mancherlei Sicht
Hybride Kriege
Die große Inkubationszeit, wir sind mittendrin! Vorsicht ist geboten!
Zum Casting der Eliten
Erosion der konservativen Substanz
Migration als Dauererscheinung
Mängel der Verwaltung
Das kabarettistische Zeitalter
Destabilisierung, und dann?
Was tun?
Misstrauen als gesellschaftliches Grundprinzip
Wem gehört die Erde?
Der Gedanke des Teilens
Ungleichzeitigkeit der Wahrnehmung
Beschleunigung des Lebens
Verfall des Gesundheitssystems
Bildung als Chance?
Religion als Chance?
Wissenschaft und Kunst als Chance?
Chancen durch Staat und Politik?
Das „Vierte Reich“
Die Zeit der „kämpfenden“ Reiche
Das Paradies auf Erden
Ersatzformen der Demokratie
Wird Deutschland amerikanische Kolonie?
Die große Verweigerung
Ausblick
Es wussten schon andere:
Sören Kierkegaard
Zur Situation der Zeit
Man befürchtet im Augenblick nichts mehr als den totalen Bankrott, dem wie es scheint, ganz Europa entgegen geht, und vergisst darüber die weit gefährlichere, anscheinend unumgehbare Zahlungsunfähigkeit in geistiger Hinsicht, die vor der Türe steht.
Sören Kierkegaard, Tagebuch 1836
(heute aktueller als je zuvor)
Wenn die Menschen den Ruf der Vernunft nicht hören, wird alles zum Albtraum.
Goya y Lucientes
Ich habe genug.
Titel einer Kantate von Johann Sebastian Bach
Die Wahrheit (muss man ) in den Tatsachen suchen.
Deng Xiaoping
Zu wissen, was zwischen Menschen möglich ist und nicht geschieht, macht traurig.
Kuno Bärenbold, Karlsruher Original
Vorwort
„Es reicht“
Der Mensch ist ein biologisches Wesen und trotz seines Verstandes anfällig gegen die verschiedensten Versuchungen.
Er geht gern den breiten Weg. Oft nimmt er kurzfristige Vorteile wahr, weil er sich die daraus ergebenden Nachteile nicht verdeutlicht. Meist strengt er sich nur an, wenn er muss. Dieser Zeitpunkt ist spätestens jetzt gegeben. Schon sind viele Menschen davon überzeugt die Zukunft bringe nichts Gutes. Dies ist aber nur der Fall, wenn die derzeit praktizierten Paradigmen in Berlin und anderswo beibehalten und die Entwicklungslinien weiter verlängert werden. Doch die Geschichte ist offen.
Es gilt zwei globale Gefahren zu erkennen und zu bekämpfen. Die Klimaerwärmung lässt sich im kapitalistischen System nicht aufhalten. Naomi Klein hat hierzu das Nötige gesagt. Ein anderes Wirtschaften bringt auch eine andere Gesellschaft mit sich. Dabei würde auch die zweite Gefahr die Notwendigkeit zu ständigem Wachstum obsolet, die für den Kapitalismus notwendig ist aber nicht nur die Klimaerwärmung befeuert, sondern auch das Finanzsystem unterhöhlt und zu einem Auseinanderdriften von Geldwert und Substanzwert führt, was die Politik der EZB demonstriert.
Ein „weiter so“ würde in einer Weltkatastrophe enden, gegen die das Erdbeben von Lissabon 1755,das damals mit über 20 000 Toten die Welt erschütterte und als Warnung Gottes aufgefasst wurde, als unbedeutend anzusehen wäre.
Heute kann nicht mehr das Wachstum der Wohlfahrt in der westlichen Welt angestrebt werden, sondern nur gerechtere Verteilung der Ressourcen und der Abbau von Diskriminierungen zwischen den Völkern und Menschen. Dies gilt insbesondere auch angesichts der sich abzeichnenden Völkerwanderung aus Afrika und vom Balkan nach Norden und Westen.
Entscheidend ist der Konsens möglichst vieler Menschen, der einzelnen Staaten und der Staatengemeinschaft insgesamt. Weshalb die UNO wo immer und wie immer möglich zu stärken ist.
Einige vermeidbare Fehler sind hier dargestellt, indem gezeigt wird, wie sich Staat und Kultur in Deutschland mit einem gelegentlichen Seitenblick auf Baden-Württemberg in den letzten Jahrzehnten negativ entwickelt haben.
Diese Fehler können nur vermieden werden durch Offenheit und liebenden Ernst im Umgang der Menschen untereinander.
Dieses kleine Buch „Es reicht“ ist als Streitschrift anzusehen, mit Methoden wie der Forderung nach ständigem Wachstum und anderen Irrlehren aufzuhören und wieder zur Realität und Redlichkeit zurückzukehren. Die Bevölkerung würde es der Berliner Regierung danken. Manchmal hat man den Eindruck einer „politischen Inversionslage“: eine (noch) vernünftige Bevölkerung und unverantwortliches Handeln in Berlin. Es ist erschreckend, wie viele sonst loyale, rechtschaffene Bürger den Eindruck haben, in absehbarer Zeit würde das westliche System in Politik , Wirtschaft und Gesellschaft zusammenbrechen, und die Regierungen würden nur noch auf Zeit spielen, um ihren Anhängern die Möglichkeit zu geben, möglichst viel mitzunehmen, wohin bleibt dabei offen.
Es kann jetzt nicht darauf ankommen welchem Zipfel des Parteienspektrums man anhängt, sondern welche sich als zukunftsfähig erweisen und welche von vornherein dafür als ungeeignet erscheinen wie es auch der Sozialwissenschaftler Welzer vorschlägt.
Der Weg wird schwierig werden, da die Politik der Bevölkerung keine neuen Wohltaten mehr bieten kann. Der Kampf um die Abschaffung der Braunkohle zeigt wie selbst Notwendigkeiten nur schwer zu vermitteln sind. Ungewohnte politische Situationen kommen hinzu. Die Deutschen halten die Griechen für undankbar und halsstarrig ohne zu wissen, dass hinter dem südeuropäischen „Populismus“ und dem ungewohnten Verhalten der Regierung Tsipras erprobte Ideen aus Lateinamerika stehen.
Hinzukommt dass durch die sich abzeichnende neue Völkerwanderung aus Afrika, dem nahen Orient und Teilen des Balkans völlig neue politische Dimensionen errreicht wurden die Deutschland hart und lange belasten werden.
Vor 1000 Jahren fürchteten sich die Menschen vor der Jahrtausendwende, weil sie das Jüngste Gericht erwarteten. So schlimm war es im Jahr 2000 nicht, die Begeisterung hielt sich aber in Grenzen.
In einem verregneten Urlaub an der Nordsee dachte der Autor darüber nach, wie das neue Jahrhundert bislang gelaufen war, und wie es weiter laufen könnte. Die Fehler sind alle bekannt, niemand zwingt uns sie weiter zu begehen. Es fehlt allenfalls an Mut.
Ralf Jandl
Nordstetten, Sommer 2015
Ein neues Jahrtausend - die alten Probleme
Die Jahrtausendwende 2000 wurde in Deutschland sehr verhalten gefeiert. Es bestand kein Grund zur Euphorie. Zwar schmetterte im Seniorensender ZDF Roberto Blanco mit Schwung „ ein bisschen Spaß muss sein“, aber es fehlte die rechte Fröhlichkeit beim Publikum. Bezeichnend war, dass im Bestreben der Medien, events möglichst früh zu vermarkten, überall - außer in Staffelstein am Main, dem Geburtsort des Rechenkünstlers Adam Riese - die Jahrtausendwende ein Jahr zu früh gefeiert wurde, nämlich den Abschluss des 20. Jahrhunderts und nicht den Beginn des 21. Zur Jahrtausendwende hatte der Autor als Beamter im Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Stuttgart noch die Idee, die besten Köpfe der Welt - vorsichtshalber nicht des gastgebenden Landes - wie zum Beispiel Mandela, den Dalaih Lama, Nadine Gordimer, Helmut Schmidt und andere im Großen Haus des Staatstheaters eine Rede über die Zukunft der Welt halten zu lassen, die in einer „Stuttgarter Erklärung“ hätte münden sollen.
Der Plan scheiterte aber schon im Vorfeld am damaligen Intendanten des Staatstheaters, dem eine solche Zusammenarbeit mit dem Staat offensichtlich als degoutant, wenn nicht gar als obszön vorkam.
Schade war, dass auch sonst die großen Gesten zur Begrüßung des neuen Jahrhunderts und Jahrtausends fehlten. Kein Rufer wie der Humanist und Ritter Ulrich von Hutten ließ sich vernehmen, der das 16. Jahrhundert mit dem Jubelruf begrüßt hatte:
„Oh Wissenschaft, oh Künste, es ist eine Lust zu leben!“
Und das obwohl er schwer an der Syphilis litt, dem ersten großen Exportgut aus Amerika.
Der Philosoph Karl Jaspers hat das 16. Jahrhundert als letzte Achsenzeit der Geschichte bezeichnet, weil die Reformation, der Buchdruck Gutenbergs und die Entdeckung Amerikas den damaligen Menschen die Türen weit aufgestoßen und ein völlig neues kulturelles Umfeld geschaffen hatten.
Denkbar erscheint es, dass das 21. Jahrhundert sich zu einer noch viel weitergehenden Achsenzeit entwickeln könnte. Gegenüber Druck und Gutenberg hatte das Internet eine galaktische Ausdehnung und bot dem Menschen aktiv und passiv viel mehr Möglichkeiten, von NSA sprach noch niemand. Die Entdeckung Amerikas, die größte Panne in der christlichen Seefahrt, wie manche gern sagen, konnte mit der Globalisierung und dem Erstarken Asiens verglichen werden.
Leider fehlte es an einer Reformation des Denkens in Europa auch nur ansatzweise, das sich von der geistigen Bühne längst abgemeldet hatte und da und dort noch von der großartigen Vergangenheit lebte, die nicht zuletzt im Ausplündern anderer Kontinente bestanden hatte. Große weltpolitische Fragen wurden denn auch zwischen China und den USA direkt verhandelt, ohne die Europäer einzubeziehen. Die alte Weisheit „ex oriente lux“, aus dem Osten kommt das Licht, scheint sich nicht mehr nur auf die Sonne, sondern auch auf die Kultur zu beziehen
Hoffnung bestand in Asien vor allem in China, das sich seit über zweieinhalb Jahrtausenden an Konfuzius orientierte und mit Taoismus und Buddhismus Religionen und Lebensformen übernommen und weiter entwickelt hatte, die auch heute noch den Chinesen und anderen asiatischen Völkern Leitlinien höchster Weisheit vermitteln. Die Besetzung Tibets und die Behandlung der Tibetaner und anderer Minderheiten zeigt, dass der buddhistische Einfluss nicht dominant ist.
Wenn heute die Beziehungen zwischen Ländern nur im Export und Import materieller Güter gesehen wird, dachte man früher weiter. 1698 schrieb als Beispiel der Hannoveraner Philosoph Leibniz an den Kaiser von China und schlug ihm vor, für Konfuzius eine wissenschaftliche Akademie in Hannover zu gründen, während in Peking eine Akademie für die westliche Philosophie errichtet werden sollte. Leider wurde daraus nichts, noch heute könnten wir auf einer derartigen Akademie viel lernen, möglicherweise mehr als die Chinesen von uns, wenn man von hochentwickelter Technik absieht. Was vom Westen durch die Welt geschickt wird ist Musik und Interpreten, die die Jugend begeistern mögen, aber unter dem Verdikt Toynbees steht, die Verbreitungsgeschwindigkeit eines kulturellen Phänomens sei umgekehrt proportional zu seinem kulturellen Wert.
Auffällig war, dass sich in der Bürokratie des Landes Baden-Württemberg ein großer zunehmender Überdruss entwickelte, der schließlich dazu führte, dass bei der Landtagswahl 2011 im „schwarzen“ Baden Württemberg vierzig Prozent der höheren Beamten „Grün“ wählte, ohne dabei zu erröten, und ein jahrzehntelanger Staatssekretär der alten Regierung nach der Wahl erklärte, man habe nur noch die Dummen erreicht. Kein Klima für Intellektuelle im Staatsdienst, auf die der damalige Ministerpräsident Mappus auch gern verzichtete.
Die Weltgeschichte lief weiter und nichts wurde besser, und viele fragten sich, warum in diesem unserem Lande, wie Kanzler Kohl stets schwerfällig formulierte, trotz guter Voraussetzungen manches nicht besser gedeiht. Viele kamen zu dem Ergebnis, dass sich die sogenannten Eliten in Wirtschaft und Gesellschaft, und vor allem die Intellektuellen, zu wenig für den Staat engagierten und dem Mittelmaß in der Politik freiwillig das Feld überließen. Wer 68 gegen den Mief der Talare und die Reste der Nazipolitik anstürmte, übersah in der Folge , dass damit zwar wichtige politische Felder angegangen wurden, aber bei weitem nicht alle. So wurde zwar die Hochrüstung noch bekämpft, aber keineswegs die Staatsverschuldung, die sich zwischen1969 und 1982 allein beim Bund verfünffachte. Schulden, die nicht aus Notwendigkeit entstanden, was es auch manchmal gibt, sondern im Grunde aus Bequemlichkeit, weil sonst Einschränkungen notwendig gewesen wären, und die Korruption zwischen Wähler und Gewählten hätte beendet werden müssen. Es hat keinen Sinn, hier politisch die Schuld zu quoteln, was die Verschuldung angeht gabs aus keiner politischen Ecke Widerstand. Hinzu kam, dass Hedonisten wie Joschka Fischer ,der jede Ausbildung durch seine enorme Ich Stärke ersetzte und heute selbst Tagungen von Spielautomatenherstellern gegen ein größeres Honorar veredelt , wobei er freilich nicht zum Thema Glück durch Spiel, sondern sehr gehoben zum Thema EU spricht, für solche Themen kein Interesse zeigten. Gleiches gilt für Jürgen Trittin, dem es bei der grünen Politik nicht um die Waldblümelein oder gar die blaue Blume gegangen sein dürfte und die beide als Vorbilder für die Jugend deshalb nur sehr begrenz t taugen. Andererseits sah sich kein bürgerlicher Politiker veranlasst, sich mit Herbert Marcuse, Adorno, Horkheimer oder Fromm ernsthaft zu befassen. Erkenntnisse aus ihrem Bereich hätten sie möglicherweise im Urteil unsicherer gemacht, erschwert doch Wissen jede Entscheidung. Es reicht in der politischen Praxis leider, die einen als links die anderen als rechts einzutüten, weshalb Kompromisse selten sind und der geistig kulturelle Fortschritt lahmt. Als Wurzel allen Übels erschien dem Autor beim Nachdenken
Der Verrat der Intellektuellen
Dabei ist nicht an Habermas oder Enzensberger zu denken, die sich vorbildlich selbst noch in höherem Alter mit dem sperrigen Thema Europa und der digitalen Problematik befassten. Besonders die Vielseitigkeit Enzensbergers ist zu bewundern, war dieser doch nicht nur ein scharfsinniger Essayist, ein guter Lyriker, selbst zu ausgefallenen Themen wie den Flechten und sogar Mathematiker, was viel jüngeren Intellektuellen als unzumutbares Fach gilt. Sollte es richtig sein, dass er vor der Währung sich auch im Schwarzhandel von Zigaretten in Süddeutschland Meriten erwarb, würde dies ein Grund mehr sein, der ihn heraushebt, wäre dies doch ein Beweis für Flexibilität und praktische Intelligenz. Zu kritisieren sind vielmehr die vielen Lehrer, Schriftsteller und Pfarrer, die allzu genügsam sind, wenn es nicht gerade um die großen Brocken wie Kernenergie, Pershing Raketen oder dergleichen geht. Unerforschlich ist, was in über sechzig Jahren Demokratie im Fach Gemeinschaftskunde den Schülern vermittelt wurde.
Das Problem ist nicht neu wurde aber gerade von den deutschen Intellektuellen in guten wie schlechten Zeiten erfolgreich ignoriert. Der französische Soziologe Julien Benda hatte1927 sein Pamphlet „La trahison de clercs“ herausgebracht, das in Frankreich zu einem Schlüsselwerk der Zeit zwischen den Weltkriegen wurde. Unter „clercs“ verstand der streitbare jüdische Franzose die Angehörigen der wissenschaftlichen und künstlerischen Berufe. Heute würde er einen Schwerpunkt bei den Medienberufen sehen. Benda war ein radikaler Sozialkritiker. Er buhlte mit keiner Schule, saß zwischen allen Stühlen und erhielt von de Gaulle das Prädikat „un homme seul“.
Die deutschen Intellektuellen, die allen Grund gehabt hätten auch betroffen zu sein, fühlten sich vom Rationalisten Benda und seiner Moralität nicht berührt. Die erste Übersetzung erschien bezeichnenderweise mehr als fünfzig Jahre nach dem Erscheinen der französischen Erstausgabe 1978 bei Hanser mit einem Vorwort von Jean Amery.
Typisch, dachte er sich und fragte sich aber zugleich, ob die Verbesserung der Welt nicht nur ein Wunsch unreifer Jünglinge oder Traumtänzer ist, die mit der Härte der Realität nicht zurechtkommen. Ein Vorwurf, den er sich immer wieder selbst machte, aber dann doch verwarf, denn wenn man die Welt ohne Kritik den Rabauken überließ, wäre alles noch viel schlimmer. Man sollte sich im Übrigen die Intellektuellen nicht als Wesen höherer Ordnung vorstellen. Sie leben vorzugsweise gut und genießen, wie schon Nietzsche sagte, gern ein Lüstchen bei Tage und eines bei Nacht, bis die Kondition nachlässt und sich die Bedürfnisse ganz in den Kopf verlagern.
J.P. Sartre hat sich in seiner Schrift „Plädoyer für die Intellektuellen“ mit diesen wunderlichen Menschen befasst. Er führt den Begriff historisch zurück auf das Engagement von Publizisten in der berüchtigten Affäre Dreyfus im 19. Jahrhundert in Frankreich. Der Vorwurf gegen diese ist meist, dass sie sich um Angelegenheiten kümmerten, die sie eigentlich nichts angehen. Doch genau darin liegt ihre Aufgabe! Sie haben sich Problemen anzunehmen, die sonst von niemand aufgegriffen würden, weil sie über das Interesse von Einzelnen und Verbänden hinausgehen.
Es mag schwindelerregend sein, wenn herausragende Intellektuelle, wie in guten Zeiten Walter Jens, sich über Bundesliga, Judas Theologie und Völkermord in Burundi gleichermaßen kompetent äußern wollen, und mancher Intellektuelle wie Günter Grass mag sich auch überschätzen, aber dennoch ist ihre Meinung wichtig, ist sie doch unabhängig von wirtschaftlichen Aspekten und persönlichen Vorteilen, zumindest wenn es nicht erkennbar um publicity geht, wie es manchmal Grass und anderen vorschnell nachgesagt wurde ohne dies belegen zu können.
Es geht nicht um die Demonstration geistiger Allmacht, sondern um die Konkretisierung von Grundsätzen, wie Gerechtigkeit, Humanität und anderer kultureller Werte, was schon bei der Bundesliga zu einer Herausforderung wird; geht es doch nicht nur um den hehren Sport, sondern auch um Kommerz, Manipulation ja Betrug.
Die Aufgabe der Intellektuellen ist somit die Anwendung ethischer Grundsätze, die für alle gelten, auf Situationen und Gruppen, zu der die unmittelbar Betroffenen gerade wegen ihrer Betroffenheit nicht in der Lage sind.
Dadurch wird der Intellektuelle Spezialist für die Rechte der Menschen und als Generalist zum Wahrer des Gemeinwohls, das in Deutschland von keiner staatlichen oder gesellschaftlichen Organisation originär vertreten wird und dementsprechend darniederliegt, wie es der konservative Juraprofessor Forsthoff schon in den siebziger Jahren feststellte. Jedes Eigeninteresse korrumpiert das Urteil nicht nur bei Intellektuellen.
Wie unterschiedlich die Bewertung einer Epoche durch Intellektuelle und der übrigen Bevölkerung sein kann zeigt sich deutlich an den frühen fünfziger Jahren der Bundesrepublik. Für erstere die „Adenauersche Restauration“. Für die breite Bevölkerung die Zeit des Wiederaufbaus, des Wohnungsbaus und des ersten „fahrbaren Untersatzes“. Zwei Seiten einer Medaille wobei sich niemand die Mühe macht beide zu sehen und einzuordnen. Dass im Bonner Justizministerium mehr NSDAP Mitglieder gewesen sein sollen als im Dritten Reich und die gleichen Seilschaften aktiv kann nicht durch den angeblichen Mangel an unbelasteten Juristen erklärt werden. Die Berufung des Kommentators der Nürnberger Rassegesetze Globke kann nur als Frivolität um nicht zu sagen Frechheit Adenauers angesehen werden über den eine kritische Biographie angebracht ist. Der zeitliche Abstand ist jetzt gegeben. Wie elastisch um nicht zu sagen wetterwendisch, Intellektuelle sein können, zeigt die Biographie des SS Hauptsturmführers Hans Ernst Schneider, der für Heinrich Himmler insbesondere im Amt Ahnenerbe arbeitete. Nach 1945 nahm er den Namen Hans Schwerte an, studierte wiederum Germanistik und promovierte ein zweites Mal. Im Zuge seiner akademischen Karriere wurde er Rektor der Rheinisch Westfälischen TH in Aachen. In seiner Habilitation befasste er sich mit Faust und dem Faustischen als einem Kapitel deutscher Ideologie. Es erweist sich, dass Intelligenz kein Wert an sich ist, sondern nur positiv bewertet werden kann, wenn sie für moralisch tolerable Ziele eingesetzt wird.
Fernsehphilosophen
Ein neuer Typ des Intellektuellen sind die Fernsehphilosophen wie Sloterdijk und Precht oder der Kabarettist von Hirschhausen, den die SZ als Reformhausphilosophen bezeichnete. Losgelöst von den irdischen Problemen ihrer Mitmenschen schweben sie weit über ihnen. Precht ist laut Stuttgarter Zeitung treibende Kraft des Deutschen Revolutionsrates und wird dabei unter anderem unterstützt von Ernst Ulrich von Weizsäcker. Diese große Sippe ist offensichtlich in der Lage für jedes politische System qualifiziertes Personal zur Verfügung zu stellen. Auch die Meinung von Philosophen muss in die Lebenspraxis der Menschen und Staaten umsetzbar sein. Nicht so im Fernsehen. Da gehört es zum guten Ton, sich über Wahlen zu ereifern, ja vorzugeben, nicht einmal zu wissen, wann überhaupt gewählt wird. Die Argumentation ist manchmal so verschlungen wie ihre Beine und die Forderung Platos, Philosophen müssten Könige werden, lässt erschauern. Andererseits ist es für sie nicht einfach, immer wieder einen Einfall zu haben, mit dem man in die Medien kommt. So ist wohl Sloterdijks Idee vor einiger Zeit zu sehen, die Reichen von der Steuer freizustellen und den Staat aus dieser Schicht auf freiwillige Leistungen zu beschränken. Edzard Reuter, der frühere Chef von Daimler fand diese Idee nicht etwa originell, sondern bescheuert und fügte hinzu, das könne gedruckt werden. Dieser Meinung wird jeder sein, der schon auf einem Finanzamt gearbeitet hat und sich dort eine Abteilung für milde Gaben von Millionären nicht vorstellen kann.. Es fragt sich, ob diese Philosophen von Kants Kategorischem Imperativ schon etwas gehört haben, oder es erträglich fänden, wenn die ganze Bevölkerung so denken würde wie sie? Hat Precht überhaupt begriffen, was eine Demokratie ist, wenn ihm die Diskussion über einen Euro mehr oder weniger Mindestlohn zu banal ist? Wahrscheinlich hat er nie im Stundenlohn gearbeitet. Demokratie besteht eben nicht nur aus parlamentarischen Sternstunden, wenn Reich Ranicki oder gar der Papst zu Besuch kommt, sondern aus viel Graubrot, dem berühmten Ziehen von Gänsekot, wie man in Württemberg sagt. Max Webers Vorstellung vom Berufspolitiker war, dicke Bretter zu bohren mit Augenmaß und Leidenschaft zugleich, was die Abgeordneten stets vor sich her sagen sollten. Ach, wie wäre es schön, wenn all die großen Geister sich einmal einer Volkswahl stellen würden. Hätte der Autor nicht einmal versucht, Stadtrat zu werden und den politischen Betrieb in der Staatskanzlei als Referent eines Politikers aus der Nähe mitbekommen, hätte er sich mit seiner Kritik nicht so weit vorgewagt. Politik kann nicht laufen wie ein wissenschaftliches Seminar im elfenbeinernen Turm. Juristisch muss alles korrekt sein, doch führen stets verschiedene Wege zum Ziel. Im Gegensatz zu Frau Merkel muss man mit Nachdruck sagen, es gibt auch immer Alternativen! Schon Frau Thatcher lag mit ihrer TINA Politik (there is no alternative) daneben.
Die Finanzkrise wäre der Bevölkerung nicht in allen Details richtig erklärbar gewesen. Richtig aber ist auch, dass man es nie versucht hat, wenigstens durch die Kanzlerin und ihre Mannen. Dabei wäre es hochinteressant gewesen zu hören, wie die Griechen allein durch Sparen ihre Volkswirtschaft wieder in Gang bringen sollten, und man nicht wie in Europa nach 1945 einen Marshallplan für den Süden braucht. Das ständige Reden von den „Hausaufgaben“, die von den Griechen zu machen wären, wirkte wenig überzeugend. In Anbetracht der konkreten Lebensverhältnisse der griechischen Bevölkerung sogar peinlich.





























