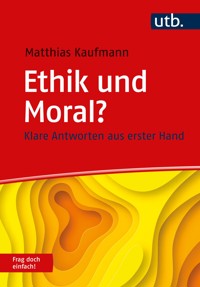
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Frag doch einfach!
- Sprache: Deutsch
Was haben Klimademos, politische Wutreden und die Notlüge gemein? Sie alle berühren unser moralisches Verständnis, das letztendlich Grundlage des Zusammenlebens ist. Matthias Kaufmann erläutert, was genau „Ethik“ bedeutet und welche gedanklichen Welten sich dabei auftun. Im Zuge dessen geht er auch der Frage nach, ob Ethik und Moral global gelten oder ob es hier kulturelle Unterschiede gibt. Die utb-Reihe „Frag doch einfach!“ beantwortet Fragen, die sich nicht nur Studierende stellen. Im Frage-Antwort-Stil geben Expert*innen kundig Auskunft und verraten alles Wissenswerte rund um ein Thema. Die wichtigsten Fachbegriffe werden zudem prägnant vorgestellt und es wird verraten, welche Websites, YouTube-Videos und Bücher das Wissen aus diesem Band vertiefen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
#fragdocheinfach
Professor Dr. Matthias Kaufmann lehrte Ethik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Matthias Kaufmann
Ethik und Moral? Frag doch einfach!
Klare Antworten aus erster Hand
UVK Verlag · München
Umschlagabbildung und Kapiteleinstiegsseiten: © bgblue, iStock
Abbildungen im Innenteil: Figur, Lupe, Glühbirne: © Die Illustrationsagentur
Autorenbild: © privat
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838554440
© UVK Verlag 2024— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 5444
ISBN 978-3-8252-5444-5 (Print)
ISBN 978-3-8463-5444-5 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Ob beim Kampf gegen den Klimawandel, bei der Forderung nach Solidarität mit einem überfallenen Volk oder der Forderung nach Solidarität mit dem globalen Süden, ob in der Gesundheitspolitik, der Migrationsproblematik oder einer der vielen anderen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen der Gegenwart: stets wird alsbald moralisch argumentiert – oder auch umgekehrt vor „Moralisierung“ gewarnt. Dabei fällt schnell ins Auge, dass die Beteiligten mit „Moral“ oft sehr Verschiedenes meinen, was angesichts der Vielzahl möglicher Sichtweisen nicht verwunderlich ist.
Philosophische Reflexion übernimmt seit jeher die Aufgabe, dem Verlust eines selbstverständlichen Konsenses über die grundlegenden moralischen Prinzipien durch begriffliche Klärung entgegenzuwirken, um verbleibende Gemeinsamkeiten aufzufinden oder zumindest die Unterschiede der Positionen möglichst genau zu fassen und einen Dialog zu ermöglichen. In Europa begannen solche Bemühungen mit den Sophisten im fünften Jahrhundert vor Christus, die angesichts der strittig gewordenen moralischen Grundlagen die Natur als verbleibendes Fundament ausmachten, sich indessen nicht einigen konnten, was wir von der Natur zu lernen hätten. So erklärt Hippias von Elis (*5. Jahrhundert v. Chr.) in Platons (*428/427 v. Chr.; †348/347 v. Chr.) ProtagorasProtagoras-Dialog die Anwesenden als Gleiche von Natur verwandt (Platon, Protagoras 337c, d), während KalliklesKallikles (spätes 5. Jahrhundert v. Chr.) in Platons Werk GorgiasGorgias vehement dafür eintritt, dass der Edle und Starke nach dem Recht der Natur mehr haben und die Schwachen beherrschen müsse (Platon, Gorgias 483c–484a).1
Der vorliegende Band soll eine gut nachvollziehbare Einführung in wesentliche Teile der Geschichte und Systematik philosophischer Ethik bieten. Für den Vorschlag, diesen Band zu verfassen, danke ich Rainer Berger vom UVK Verlag, für die Durchsicht früherer Fassungen des Textes und wertvolle Hinweise danke ich Danaë Simmermacher, Elena Kaufmann, Hanne und Georg Müller. Ohne die emotionale wie geistige Unterstützung meiner Frau hätte weder dieses Buch noch eine andere meiner Schriften erscheinen können, dafür bin ich dauerhaft dankbar.
Erlangen, im Januar 2024
Matthias Kaufmann
Was die verwendeten Symbole bedeuten
Toni gibt ergänzenden Literaturtipps und weist auf wichtige Zusammenhänge und Textpassagen hin.
Die Glühbirne zeigt eine Schlüsselfrage an. Das ist eine der Fragen zum Thema, deren Antwort unbedingt lesenswert ist.
Die Lupe weist auf eine Expert:innenfrage hin. Hier geht die Antwort ziemlich in die Tiefe. Sie richtet sich an alle, die es ganz genau wissen wollen.
Was Sie vorher wissen sollten
Ansichten über das Richtige und das Falsche
Wir streiten manchmal darüber, was richtig und was falsch ist. Wir sind uns uneins über konkrete Fragen aus der näheren Umgebung, etwa für welche Hilfsorganisation man spenden sollte, vielleicht auch, ob eine Freundin oder ein Freund Hilfe braucht oder eher in Ruhe gelassen werden sollte. Wir entzweien uns darüber, welchen sozialen Gruppen staatliche Hilfe zusteht und wie die Finanzierung erfolgen sollte. Wir machen uns Gedanken über Gerechtigkeit, über die wichtigen Fragen der Zukunft und manchmal auch über den Sinn des Lebens. Dabei tun sich bei einzelnen Fragen leicht einmal Gräben innerhalb einer Familie oder zwischen guten Freund:innen auf, während Menschen, die sich wenig oder gar nicht kennen, ähnlicher Meinung sind. Gemeinsamkeiten und Unterschiede können sich am Alter, an sozialen Gruppen, Bildungshintergrund oder auch regionalen Kontexten – „Ost“ gegen „West“, „Nord“ gegen „Süd“ usw. – festmachen.
Moralische Argumente spielen eine zentrale Rolle in vielen der öffentlichen Debatten. Beispiele aus dem Beginn der zwanziger Jahre des 21. Jahrhunderts sind die Sorge um die ökologische Zukunft, insbesondere der Streit um die richtigen Maßnahmen im Umgang mit dem Klimawandel, die Auseinandersetzungen um die Aufnahme und die Behandlung von Geflüchteten, aber auch die Diskussionen um die Zustimmungs- oder Widerspruchslösung bei der Organspende sowie um den Einsatz von Gentechnik in der Medizin und der Nutzpflanzenzüchtung. In der Pandemie, die in Europa im Jahr 2020 ihren Anfang nahm, kamen nicht zuletzt moralische Appelle an die Solidarität mit den besonders Gefährdeten ins Spiel, andererseits wurde das Recht auf Autonomie, auf freie Entscheidung eingefordert und diskutiert, ob die staatlichen Maßnahmen tatsächlich elementare Freiheitsrechte betrafen. Während des russischen Angriffs auf die Ukraine entwickelten sich in Deutschland heftige Debatten über Waffenlieferungen und Verhandlungsoptionen, ferner über den Schutz der deutschen Bevölkerung vor den ökonomischen Auswirkungen. In den meisten dieser Kontexte wird nach mehr Gerechtigkeit gerufen, ohne dass es Einigkeit darüber gäbe, worin diese Gerechtigkeit zu bestehen habe. Zahlreiche Umfragen, Studien und Erhebungen zeigen auf, wo die Trennlinien zwischen den Verfechterinnen und Verfechtern gegensätzlicher Positionen und Werteauffassungen verlaufen. So unterscheiden sich oft Stadt und Land, jung und alt, aber auch Menschen mit verschiedener Ausbildung in ihren Sichtweisen.
Die Europäische Union wird immer wieder von prominenten Repräsentant:innen als „Wertegemeinschaft“ deklariert. Nicht immer ist man einig darüber, welches die entscheidenden Werte seien, dafür häufen sich die Klagen darüber, dass Europa seine moralischen Werte verrate. Entsprechend warf und wirft man sich gegenseitig die Verletzung europäischer Prinzipien vor, sei es die Verletzung der Rechtssicherheit einerseits, humanitärer Prinzipien andererseits im Zusammenhang mit den Migrationsbewegungen, dann wiederum in der genannten Pandemie und im Umgang mit der durch Russlands Krieg gegen die Ukraine bewirkten Inflation einen Verstoß gegen europäische Solidaritätsverpflichtungen. Nicht nur in unserem persönlichen Alltag, auch in sämtlichen politischen Themen werden wir also kontinuierlich mit moralischen Fragen konfrontiert.
Zugleich haben wohl die meisten Menschen schon die Erfahrung gemacht, dass sie sich von Leuten, die sich ihrer moralischen Sache gar zu sicher scheinen, genervt oder gar bedrängt und bevormundet fühlen. Entsprechend taucht dann im Alltag, in literarischen Werken, aber auch in philosophischen Texten die Frage auf, ob moralische Regeln denn notwendig seien, ob wir ohne sie nicht unbelasteter und angenehmer leben könnten.
Gelten moralische Regeln überall und immer?
Gegenüber den sogenannten europäischen Werten, seien es Prinzipien der Gleichheit und Gerechtigkeit oder auch die Verteidigung der Menschenrechte, die in Europa allgemein für universell gültig und anwendbar gehalten werden, regte sich besonders im globalen Süden heftige Kritik. Einerseits lässt sich zweifeln, ob diese Werte allein in Europa entstanden, allenfalls kann man bestätigen, dass ein großer Teil der europäischen Staaten sie inzwischen zumindest offiziell anerkennt, wenngleich oft genug dagegen verstoßen wird. Andererseits galt zumindest die Art, wie diese Werte von einigen Mächten umgesetzt wurden, als Teil einer eurozentristischen Sichtweise auf die Welt, von der man eben in Europa glaube, sie sei universell gültig. Von nicht-europäischen Menschen wird dieser universelle Anspruch oft als „imperialistisch“ kritisiert.
Nach dem weitgehenden Ende der kolonialen Herrschaft europäischer Mächte über den „Rest der Welt“ entwickelten sich vermehrt postkoloniale und dekoloniale Studien und Denkansätze, die sich kritisch mit dem kulturellen Erbe Europas befassen. In diesem Kontext verweisen insbesondere Autor:innen aus dem globalen Süden auf eigene Moralkonzepte nicht-europäischen Ursprungs. Nun wurden bekanntlich diverse asiatische Lehren, erinnert sei an Yoga, Zen etc., die sich mit der richtigen, auch moralisch richtigen Form der Lebensgestaltung befassen, in der sogenannten westlichen Welt seit einigen Jahrzehnten enthusiastisch aufgenommen und von relativ breiten Schichten ins eigene Leben integriert.1 Seit einigen Jahren bezieht man sich in Teilen Südamerikas auf das sog. buen vivirbuen vivir – eine spanische Übersetzung der aus Andensprachen stammenden Termini pacha mamapacha mama und sumak kawsaysumak kawsay. Mit diesen, den ursprünglichen Andenkulturen entnommenen Konzepten soll die Einheit von Mensch und Natur und deren harmonische Koexistenz im Gegensatz zum ausbeuterischen Verhalten der Kolonialmächte erfasst werden. In Bolivien und Ecuador wurde der Natur per Verfassung ein Rang als Rechtssubjekt zugesprochen.2 Im Afrika südlich der Sahara spielt der Gedanke des UbuntuUbuntu als religions- und ethnienübergreifendes Lebensgefühl, das Wege zur friedlichen Konfliktlösung und Versöhnung eröffnet, eine wichtige Rolle und wird als Geschenk Afrikas an die Welt bezeichnet.3 Ob das Bestehen dieser Konzeptionen bereits zeigt, dass allgemeingültige moralische Normen nicht möglich sind, oder ob sie ihrerseits universelle Ansprüche erheben oder sich mit anderen universellen Forderungen vereinbaren lassen, wird im Folgenden zu untersuchen sein. Doch waren Zweifel an der allgemeinen Gültigkeit moralischer Forderungen auch innerhalb Europas seit mehr als 2000 Jahren, seit der griechischen Sophistik, präsent und gaben oft den Anstoß für moralische Reflexionen und Begründungsversuche.
Angesichts der Verschiedenheit der Sichtweisen erscheint es hilfreich, ja notwendig, sich über die vorhandenen Moral- und Ethikkonzeptionen etwas Klarheit zu verschaffen um die eigene Position besser einordnen und begründen zu können. Wir werden dabei zunächst in der sogenannten westlichen, letztlich europäischen Tradition beginnen und immer wieder nach möglichen Überschneidungen und Unterschieden beim Vergleich mit anderen Ansätzen fragen.
Die enorme Fülle des Materials und die Begrenztheit des zur Verfügung stehenden Raums erforderten diverse Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl relevanter Themen und Autor:innen. Diese tragen trotz aller Bemühung um eine angemessene Vorgehensweise unvermeidlich auch subjektive Züge.
1 Die Begrifflichkeit
Dieses Kapitel verrät unter anderem, was sich hinter dem Begriff Ethik verbirgt, wie er mit der Moral zusammenhängt und welche Typen von Moral sich grundsätzlich differenzieren lassen. Da für Aristoteles und andere griechische Philosophen der Antike moralisches Handeln eine Bedingung für ein geglücktes Leben darstellte, nimmt es auch gängige und vergangene Konzeptionen von Glück in den Blick. Zudem stellt das Kapitel weitere Differenzierungskriterien für die Begriffe „Moral“ und „Ethik“ vor, beispielsweise von Habermas, Rawls und Kohlberg. Schließlich wird diskutiert, ob Moral notwendig für ein gelungenes Miteinander ist oder eher einen Übergriff auf die Gesellschaftsmitglieder darstellt. Das Ende des Kapitels zeigt auf, warum es allemal sinnvoll ist, moralisch zu sein.
Was ist Ethik? Was ist Moral?
Sowohl Ethik als auch Moral spielen eine Rolle, wenn Menschen wegen ihres Verhaltens gelobt oder getadelt werden. Die Wörter „Ethik“ und „Moral“ werden im Alltag und auch in manchen philosophischen Texten weitgehend gleichbedeutend verwendet. Sinnvoller dürfte es indessen sein, sich der auf Aristoteles zurückgehenden Tradition anzuschließen, die unter Ethik die argumentative, philosophische Reflexion über Moral, aber auch eine philosophisch reflektierte Moral versteht. Ethik befindet sich demnach auf einer stärker reflektierten Ebene, weil sie auch die Regeln für das menschliche Verhalten zum Thema macht, sie etwa auf ihre Widerspruchsfreiheit und ihre Allgemeingültigkeit hin überprüft. Bei Aristoteles (*384 v. Chr.; †322 v. Chr.), der Ethik als einen Bereich menschlichen Nachdenkens und Forschens von der Physik, Logik, Metaphysik und Naturphilosophie unterscheidet, gehört allerdings der gesamte Bereich dessen dazu, was wir heute Praktische Philosophie nennen, also auch politische Philosophie und Rechtsphilosophie. Später, insbesondere seit Immanuel Kant (*1724, †1804), bezieht sich Ethik stärker auf den Bereich des moralischen Handelns, sofern es eben nicht mit dem rechtlichen und politischen Handeln identisch ist.
Ethik ist in diesem Verständnis also die philosophische Reflexion über Moral, in anderer Formulierung eine philosophisch reflektierte Moral, der Sprachgebrauch kennt auch – abweichend von der hier vorgeschlagenen terminologischen Regelung – die Rede von normativer Ethik.
Literaturtipps
Christoph Horn, Einführung in die Moralphilosophie, Freiburg/München 2018.
Dietmar Hübner, Einführung in die philosophische Ethik, Göttingen 32021.
Matthias Lutz-Bachmann, Grundkurs Philosophie: Ethik, Stuttgart 2013.
Wilhelm Vossenkuhl, Die Möglichkeit des Guten. Ethik im 21. Jahrhundert, München 2006.
Dieter Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, Berlin/New York 2003.
Herlinde Pauer-Studer, Einführung in die Ethik, Wien 2003.
Friedo Ricken, Allgemeine Ethik, Stuttgart u. a. 52012.
Annemarie Pieper, Einführung in die Ethik, UTB 2007.
Ernst Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt/M. (stw) 1995.
Richard Hare, Die Sprache der Moral (1952), Frankfurt/M. (stw) 1982.
Was kann gemeint sein, wenn von Moral die Rede ist? Welche Typen moralischer Argumentation gibt es?
Wir können sehen, dass es sehr unterschiedliche Formen von Forderungen gibt, die mit moralischem Impetus an Menschen herangetragen werden und die nicht selten miteinander in Konflikt geraten können. Liebesbeziehungen werden aufgelöst und Menschen in ihren tiefsten Gefühlen verletzt, weil sich eine junge Frau oder ein junger Mann moralisch verpflichtet fühlt, gemäß dem heimischen, ethnischen oder religiösen Brauch zu heiraten. Soldat:innen fühlen sich moralisch verpflichtet, den Eid gegenüber ihrem Land zu brechen und unmenschliche Befehle zu verweigern, andere bringt gerade dieser Eid oder jedenfalls ein Loyalitätsbewusstsein dazu, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen. Selbstmordattentäter:innen, die sich mit zahlreichen unschuldigen Menschen in die Luft sprengen, sind überzeugt, das moralisch Richtige zu tun. Entweder gibt es daher keine Möglichkeit, zwischen diesen Ansprüchen in vernünftiger Weise zu entscheiden und alle sind gleich wichtig – oder manche davon sind schlicht falsch. Das nächste Kapitel befasst sich mit der Frage, ob man über diese Dinge rational argumentieren und entscheiden kann. Hier seien – nicht ohne einige erste Hinweise in dieser Richtung – zunächst einige Wege unterschieden, in welcher Form moralische Forderungen an Menschen gerichtet wurden und werden, um ihnen „ins Gewissen zu reden“.
Eine Möglichkeit, etwas Ordnung in die verwirrende Vielfalt moralischer Verpflichtungen zu bekommen, ist die Unterscheidung von – nicht immer exakt trennbaren – Typen der Moral Moral, Typen gemäß der Begründungsverfahren für ihre Forderungen. Ein Vorschlag wäre es, die Sitte, bei der nicht wirklich begründet, sondern nur darauf hingewiesen wird, dass man es halt so macht, dass es sich so gehört, weil es schon immer so war, zunächst von der Auffassung zu unterscheiden, man habe bestimmten Geboten Folge zu leisten, weil sie von Gott oder von „den Göttern“ erlassen seien oder jedenfalls deren Willen entsprächen. Von beiden verschieden oder jedenfalls mit keiner identisch ist wiederum die Forderung, man habe die eigenen Wünsche und Interessen dem Wohl einer Gruppe unterzuordnen, weil diese wichtiger sei als das Individuum. Eine vierte Variante erwartet die prima facie unparteiliche Berücksichtigung aller vernünftigen, in anderen Versionen aller empfindenden Wesen, eine fünfte beruht auf der Überzeugung, für ein geglücktes Leben bedürfe es auch tugendhaften Verhaltens.
Wie sollte sich Ethik mit dem Bereich der SitteSitte befassen?
Geht es um Sitte, so wird eine Forderung gegenüber der oder dem Einzelnen typischerweise damit „begründet“, dass man es eben so macht, dass es schon immer so war, dass es sich so gehört, also durch Verweis auf bestehende Konventionen und Traditionen.
Dies heißt nicht unbedingt, dass diese Forderungen falsch wären, auch nicht, dass sie nicht begründet werden könnten, es heißt nur, dass in diesem Kontext eben nicht weiter begründet wird.
Der Bereich der Sitte ist deshalb so wichtig, weil viele unserer moralisch relevanten Entscheidungen, bei nicht wenigen Menschen sind es alle, in dieser Sphäre entstehen. Es ist auch nicht falsch, wenn wir unsere moralischen Einschätzungen zunächst einmal „aus dem Bauch“, also ohne explizite Überlegung treffen, ohne jedes Mal genau zu wissen, ob unser Urteil nun aus Gewohnheit, aus Konvention und dergleichen oder aufgrund einer irgendwann erfolgten eigenen reiflichen Überlegung erfolgt.
Diese Art sozialer Regulierung scheint es in der einen oder anderen Form in allen menschlichen Gesellschaften zu geben. Bestimmte Elemente wie ein Verletzungsverbot und ein Aufrichtigkeitsgebot scheinen für den Bestand von Gesellschaften notwendig, in vielen Traditionen finden sich indessen drastische Unterschiede hinsichtlich derer, denen diese Regeln zugutekommen, was häufig mit überregional anerkannten Regeln der Gerechtigkeit kollidiert. In den meisten Kulturen gab und gibt es diskriminierende und grausame Regeln und Gebräuche, denen eine reflektierte Ethik kritisch gegenübersteht. Überzeugungen, die in den Bereich der Sitte gehören, können sich im Laufe der Zeit auch in breiten Teilen der Bevölkerung ändern. Nach diesem Wandel wird etwas anderes als selbstverständlich richtig angenommen als zuvor, doch muss nicht unbedingt die Kenntnis über Begründungszusammenhänge gewachsen sein. So kann die zunehmende Offenheit gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe und anderem Geschlecht bei manchen Beteiligten auf gestiegene Einsicht zurückgehen, dass man niemanden wegen derartigen moralisch irrelevanten Merkmalen benachteiligen darf. Bei anderen hingegen entspringt sie bloßer Gewöhnung. Im Falle der Religionszugehörigkeit, der sexuellen Orientierung, aber auch kultureller Bindungen bedurfte und bedarf es erheblichen argumentativen Aufwands, um die Menschen davon zu überzeugen, dass es ein allgemeines Recht auf freie Entfaltung in diesen Bereichen gibt.
Wichtig bleibt die Sitte auch, weil eine politische Ordnung auf ein gewisses Maß an Verankerung in den Ansichten der Menschen über richtig und falsch angewiesen ist. So wenig man nun die Möglichkeit hat, all seine intuitiven moralischen Urteile ständig zu überprüfen, so wichtig ist es, im Konfliktfall die Möglichkeit einzuräumen, dass die eigenen Urteile durch eher zufällige, biographische Faktoren oder bloße Gewöhnung mitbestimmt sind und daher für Überprüfung und Korrektur offen sein müssen. Die Orientierung an der Mehrheitsmeinung hilft nur sehr begrenzt weiter. Dies sieht man leicht, wenn man bedenkt, wie verbreitet sexistische und rassistische Vorurteile waren und oft genug noch sind.
Wie hängen Moral und göttlicher WilleWille, göttlich zusammen?
Einem anderen Ansatz zufolge ist eine Handlung moralisch richtig, eine Lebensweise gut, weil sie mit dem göttlichen Willen konform ist. Richtig und falsch wird durch mehr oder minder detaillierte Regelsysteme festgelegt, wie etwa die zehn Gebote, die Regeln des Koran, die Veden, die Bhagavadgita oder auch die Bergpredigt.
Es liegt also ein inhaltlich mehr oder minder genau bestimmtes System von Normen vor, das auf irgendeine Weise göttlichen Ursprungs ist und daher Gehorsam beansprucht. In der Regel sorgt ein Berufsstand von Priester:innen, Brahmanen, Imamen, Rabbinern etc. für die genauere Interpretation der von Seiten der Gottheit nicht völlig festgelegten Offenbarung, nicht selten wiederum in schriftlicher Form.
Häufig sind religiös begründete moralische Forderungen eng mit der Sitte verzahnt, doch kann es durchaus Fälle geben, in denen beides gegeneinandersteht, wenn etwa in Zeiten des „Sittenverfalls“ religiöse Erneuerungsbewegungen auftreten und zur Umkehr vom Weg der Sünde aufrufen. Beispiele dafür sind die alttestamentarischen Propheten, aber auch christliche Reformbewegungen.
Es gab und es gibt viele Menschen, auch viele Philosoph:innen, nach deren Überzeugung nur der religiöse Glaube die Menschen zu moralischem Verhalten bewegen kann. Das Problem dieser Auffassung beginnt indessen damit, dass sich religiöse Gebote an die Angehörigen eines bestimmten Glaubens richten, wenngleich der Schutz dieser Gebote sich möglicherweise auch auf andere Menschen, mitunter auf die belebte Natur erstreckt. Die Schwierigkeiten wachsen angesichts der Vielfalt religiöser Glaubensinhalte, die einander nicht selten widersprechen. Dies führte und führt zu Streitigkeiten zwischen Religionen, aber auch bereits zwischen Konfessionen innerhalb einer Religion, bis hin zu blutigen Auseinandersetzungen, in denen sich Gläubige verpflichtet fühlen, die Häretiker und Ungläubigen zu bekämpfen. Manchmal werden sie von Menschen, die den Anspruch erheben, im Namen Gottes zu sprechen, dazu ermuntert oder sogar aufgefordert. Eine für alle Menschen gültige und alle berücksichtigende Form von Moral, wie sie gleich vorgestellt wird, lässt sich auf dieser Basis nur schwer formulieren. Ferner passt es nicht zur aufgeklärten Konzeption von Moral, wonach Menschen in Freiheit, aus Einsicht und im Wissen um die eigene Verantwortung moralisch handeln sollen, wenn das Wohlverhalten der Furcht vor Strafe im Jenseits und der Hoffnung auf Lohn daselbst geschuldet ist.
Seit Platons Dialog EutyphronEutyphron wird darüber diskutiert, ob etwas fromm ist, weil die Götter es lieben, oder sie es lieben, weil es fromm ist (Platon, Eutyphron 10a), was später auf das moralisch Gute übertragen wurde. Wenn die Götter etwas lieben, weil es fromm ist, oder wenn Gott etwas befiehlt, weil es gut ist, dann muss es noch andere Kriterien für das Fromme bzw. für das moralisch Gute geben als allein das göttliche Gebot oder Verbot. Allemal steht die Frage im Raum, ob es derartige Kriterien gibt.
Eine Möglichkeit für ein solches ist der dritte Begründungsweg, nämlich der Hinweis auf das Wohl der Gruppe, der Familie, des Staates, des Volkes, der Partei etc.
Was ist mit „GruppenmoralMoral, Gruppe-Gruppenmoral“ gemeint?
Unter Gruppenmoral kann man Auffassungen subsumieren, denen zufolge die Individuen ihre Interessen dem Wohlergehen der Gemeinschaft unterzuordnen haben, weil diese wichtiger, hochrangiger und beständiger sei als die einzelnen darin lebenden Menschen.
Es handelt sich dabei um ein sehr weit gespanntes Spektrum, sowohl hinsichtlich der in Frage kommenden Gruppen als auch in Bezug darauf, was von den Individuen erwartet wird. Dieses Spektrum beginnt mit der Forderung, für eine Gruppe wie die Familie Einsatz und möglicherweise auch Opfer zu bringen, etwa bei der Pflege von Angehörigen, oft genug wird Gehorsam gegenüber Patriarchen erwartet. Ein anderer Bereich sind Loyalitätsansprüche verschiedener Vereinigungen und die Forderung, zugunsten derselben auf den eigenen Vorteil zu verzichten, sich solidarisch zu verhalten. Dies betrifft durchaus auch den demokratischen Staat oder die Nation, wenn speziell in Krisensituationen Appelle zur Loyalität und Solidarität an die Bürger:innen gerichtet werden. Die Intensität dieser Ansprüche kann sich in eher autoritären Staaten bis zur Forderung nach absoluter, bedingungsloser Unterordnung der einzelnen unter die – angeblichen – Interessen des Staates, des Volkes, der Partei und dergleichen steigern. Worin diese übergeordneten Interessen bestehen, wird dann nicht selten von einer despotisch herrschenden Instanz festgelegt. Im Extremfall gehört zu dieser Unterordnung auch die Bereitschaft, notfalls gegen alle vom einzelnen für richtig gehaltenen moralischen Prinzipien zu verstoßen.
MachiavelliMachiavelli (*1469; †1527) fordert etwa, für das Vaterland habe man nicht nur das Seelenheil zu opfern, sondern auch alle Verbrechen zu begehen, die zum Wohl des Staates nötig seien.1 Dies ist die republikanische Variante einer KriegermoralMoral, Krieger-Kriegermoral, die sich zu bestimmten Zeiten in vielen Kulturkreisen – oftmals in feudalen Gesellschaften – herausgebildet hat und die extremste Form der Gruppenmoral darstellt. Diese Kriegermoral fordert vom Einzelnen nicht nur absoluten Gehorsam und hohe Opfer, sondern auch die Bereitschaft, Grausamkeiten zu begehen, möglicherweise bis zur Tötung der eigenen Kinder, wie uns Heldengeschichten unterschiedlichster Herkunft zu berichten wissen. Wir kennen solche Erzählungen aus der römischen Frühgeschichte, den germanischen Heldensagen, der Bibel, aber auch den Berichten über die Samurai.
Die Schwierigkeit besteht hier offenbar darin, die Grenze zu finden, an der die lobenswerte Bereitschaft, sich für eine Gruppe von Menschen einzusetzen, notfalls auch Opfer zu bringen, übergeht in kritiklose Unterwerfung unter einen fremden Willen. Eine gewisse Hilfestellung bietet hierfür die heute wohl wichtigste Variante der Moral, die sog. universalistische Moral oder Aufklärungsmoral.
Was ist universalistische EthikEthik, universalistisch und warum heißt sie „AufklärungsmoralMoral, Aufklärung-Aufklärungsmoral“?
Als „universalistisch“ bezeichnet man Ethikkonzeptionen, die zunächst von den konkreten sozialen Bedingungen weitestgehend abstrahieren, nur noch auf Vernunftfähigkeit oder Leidensfähigkeit der Betroffenen Bezug nehmen und eine in diesen Punkten weitgehende Gleichheit der Beteiligten unterstellen. Dies bedeutet nicht, dass alle Menschen immer gleich zu behandeln sind, sondern dass es zur Ungleichbehandlung triftiger Gründe bedarf.
Was als triftiger Grund gelten kann ist keineswegs immer eindeutig, mitunter gibt es heftige Diskussionen darum, beispielsweise ob das Geschlecht für die Zulassung zu bestimmten Ämtern eine Rolle spielen darf. Die Ansichten zwischen Kulturen unterscheiden sich häufig, auch innerhalb einer Gesellschaft können sie sich wandeln. Moralische Forderungen im universalistischen Sinn werden auf die Forderung nach Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit, nach der Anerkennung einer und eines jeden als Träger:in möglicherweise berechtigter Interessen und mögliche Quelle vernünftiger Argumente, als Zweck an sich selbst zurückgeführt.
Es ging bei der Herausbildung dieser Prinzipien weniger um die Formulierung neuer Normen als um ein Verfahren zur Überprüfung moralischer Regeln. Es handelt sich um das Resultat philosophischer Bemühungen, das, was das Moralbewusstsein der Menschen in eher unklarer Form enthält, präzise auf den Punkt zu bringen. Prominente Versuche in diese Richtung sind Kants kategorischer Imperativ und das utilitaristische Prinzip vom größten Glück der größten Zahl (vgl. Kap. 4).
Es gibt bei diesen universalistischen Ethiken Unterschiede hinsichtlich der Frage, ob man alle „VernunftwesenVernunftwesen“ – oft heißt es alle PersonenPersonen – mit einbeziehen soll, oder ob die Fähigkeit zu leiden die entscheidende Rolle spielt. Dies wird in späteren Kapiteln zu diskutieren sein. Diese Form moralischen Argumentierens wird mitunter „AufklärungsmoralMoral, Aufklärung-Aufklärungsmoral“ genannt, weil sie sich in ihren Grundsätzen, soweit es die europäische Entwicklung betrifft, im Laufe der Aufklärungszeit, also ab dem späten 17. und vor allem im 18. Jahrhundert herausgebildet hat. Ihre Entstehung ist auch eine Spätfolge der blutigen religiösen Bürgerkriege des 16. und 17. Jahrhunderts, die zunächst die Rolle des sog. NaturrechtsNaturrecht als einer der menschlichen Vernunft zugänglichen, für alle Konfessionen halbwegs annehmbaren Instanz stärkte. Hinzu kamen die wachsende Forderung nach Toleranz und die Zweifel an der moralischen Relevanz sozialer Hierarchien, die Zweifel also, dass es für die moralische Beurteilung einer Handlung eine Rolle spiele, ob Adlige oder Bürgerliche, Geistliche oder Laien handelten und betroffen waren. Ferner trennte man zusehends deutlicher Recht und Moral, weil das Eine, grob gesagt, die äußere Handlung, das Andere die innere Haltung betraf. In vielen heutigen Ethikdiskursen gilt diese Moralität auch als die „eigentliche“ Moral, während verschiedene Kombinationen der anderen Formen als „EthosEthos“ bezeichnet werden.
Langfristig ist diese Moralauffassung die Grundlage dafür, dass es heute in vielen Ländern verboten ist, jemanden wegen des Geschlechts, der Hautfarbe, der Religionszugehörigkeit, sexuellen Orientierung etc. zu diskriminieren, weil diese sich als moralisch irrelevant erweisen. Dies bedeutet keineswegs, dass die Vertreter dieser Konzeption im 18. und 19. Jahrhundert sich in diesem Punkt stets vorbildlich verhalten hätten, im Gegenteil gibt es eine ganze Reihe rassistischerrassistisch und/oder sexistischersexistisch Äußerungen u. a. von David HumeHume, David (*1711; †1776), KantKant, Immanuel und Georg Wilhelm Friedrich HegelHegel, Georg Wilhelm Friedrich (*1770; †1831). Es wird seit einiger Zeit darüber diskutiert, ob dies persönliche Unzulänglichkeiten großer Denker sind oder ob ein systematischer Fehler dieser Ethikkonzeption vorliegt.
Ist die universalistische Ethik imperialistischimperialistisch?
Es wurde und wird kritisiert, die Behauptung, man habe universell gültige Normen gefunden, impliziere den Anspruch, diese Normen auch denen aufzuzwingen, die ihrerseits andere Regeln und Prinzipien für gut und richtig halten. Es wurde bereits angesprochen, dass die universalistische, aufgeklärte Moral sowohl zu lokalen Sitten als auch zu religiösen Forderungen im Widerspruch stehen kann. Ferner wurde bemängelt, die abstrakte Annahme formaler Gleichheit ignoriere die materiale, konkrete Ungleichheit der Lebenssituationen, in denen sich die Menschen befinden, so dass es zu Ungerechtigkeiten komme, wenn sie einfach gleichbehandelt würden, ob sie nun arm oder reich, Unterdrückende oder Unterdrückte, Kolonisierende oder Kolonisierte sind. Anatole FranceFrance, Anatole (*1844; †1924) sprach in bitterer Ironie von „der majestätischen Gleichheit des Gesetzes, das Armen wie Reichen verbietet, unter Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen“.1 Es wurden ferner die Bemühungen „westlicher“ Feministinnen, die Situation von Frauen im globalen Süden zu verbessern, als „imperialistisch“ gebrandmarkt, weil sie die Einbindung der Frauen vor Ort in ihre konkrete Situation nicht berücksichtigten.2
Diese Kritik mag in vielen Fällen auf eine unterschiedslose Anwendung universeller Normen zutreffen und hat in manchen Teilen eine längere Tradition. Bereits für HegelHegel, Georg Wilhelm Friedrich waren die beiden ihm vorliegenden Formen universalistischer Moral, also diejenige KantsKant, Immanuel und des UtilitarismusUtilitarismus, „gleich abstrakter Verstand“, der ohne Verbindung mit der konkreten SittlichkeitSittlichkeit im „leeren Formalismus“ ende.3 In den letzten Jahrzehnten stellten Martha NussbaumNussbaum, Martha (*1947) und Amartya SenSen, Amartya (*1933) dem von Kant inspirierten, liberalen Ansatz von John RawlsRawls, John (*1921; †2002) ihren eher aristotelisch orientierten capability approachcapability approach gegenüber, der versucht, die menschlichen Fähigkeiten – und Bedürfnisse – in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen, eben auch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu beachten, in denen die Menschen jeweils leben.4
Von dieser Kritik bleibt der universalistische Grundgedanke unberührt, dass jeder Mensch, in mancher Fassung zusätzlich die leidensfähigen Tiere oder sogar „die Natur“, wie im Beispiel des buen vivirbuen vivir bzw. pacha mamapacha mama aus den Andenstaaten, moralische Berücksichtigung verdienen und dass bei Menschen zunächst eine Gleichheit der Ansprüche zu unterstellen ist. Darüber hinaus gibt es Forderungen, bestimmte Kriterien – wie z. B. Bedürftigkeit – als triftige Gründe für Ungleichbehandlung anzuerkennen. Die genannten Ansätze stellen wichtige, weitgehend gelungene Versuche dar, diesen Gedanken in angemessener, operationalisierbarer Weise zu formulieren, die sich allesamt in einigen Punkten als revisionsbedürftig erwiesen. Dieser Revisionsprozess wird im Diskurs kontinuierlich fortgesetzt. Wenn dieser Universalismus zusätzlich davon ausgeht, dass Benachteiligungen rechtfertigungsbedürftig sind und der Hinweis, dass es immer so gewesen sei, dafür nicht ausreicht, so bedeutet dies nicht, dass man um jeden Preis die bestehenden Verhältnisse umstürzen will. Vielmehr gilt es das tatsächliche Wohlergehen aller Betroffenen im Auge zu behalten und gegebenenfalls Wünsche nach Reformen mit dem Risiko der Destabilisierung der Situation zum Schaden gerade der Schwächsten abzuwägen.
Macht Moral glücklich?
Eine weitere Form der Moralbegründung, historisch äußerst bedeutsam und nach wie vor interessant, da insbesondere die griechischen Ethikkonzepte darauf basieren, ist die Suche nach einem geglückten, einem guten menschlichen Leben.
Für fast alle griechischen Ethiken gehört zu einem gelungenen Leben auch tugendhaftes, also moralisch richtiges Verhalten. Wie würden wir das heute sehen?
Was meinen wir mit „Glück“?
„Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach er zu ihm: ‚Herr, meine Zeit ist herum, nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn.‘ Der Herr antwortete: ‚Du hast mir treu und ehrlich gedient, wie der Dienst war, so soll der Lohn sein.‘ und gab ihm ein Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war.“
Von den Gebrüdern Grimm weiß man, wie die Geschichte weitergeht: Durch eine Reihe von Tauschgeschäften, die ihm jeweils sehr attraktiv erscheinen oder von anderer Seite schmackhaft gemacht werden, hat Hans seinen gesamten Lohn verloren – und freut sich darüber:
„‘So glücklich wie ich,‘ rief er aus, ‚gibt es keinen Menschen unter der Sonne.‘ Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war.“
Die Geschichte bezieht ihre besondere Spannung offensichtlich aus dem Gegensatz zwischen dem für außenstehende Beobachter unglücklichen Verlauf der Transaktionen und dem bei Hans bis zum Ende anhaltenden Glücksgefühl. Dies verweist uns auf zwei unterschiedliche Verwendungsweisen des Wortes „Glück“, für die es im Englischen auch zwei Wörter gibt: „luckluck“ als das äußere gute Gelingen, der günstige Zufall, worauf wir nur begrenzten Einfluss haben. In der Renaissance wurde dies durch die Glücksgöttin FortunaFortuna symbolisiert, die mit einem Spinnrad in den Händen abgebildet wird, welches die Menschen nach oben und wieder nach unten befördern kann. Dieser Göttin gegenüber kann man sich einerseits mit einer gewissen Gleichmut wappnen, um von möglichen Rückschlägen nicht völlig aus der Bahn geworfen zu werden. Andererseits kann man Vorsorge treffen – oder auch durch beherztes Handeln Fortuna „beim Schopfe packen“.
In einer anderen Bedeutung ist GlückGlück in etwa das mit dem englischen „happinesshappiness“ Gemeinte. „Glück“ kann sich in dieser Bedeutung auf das momentane Erleben beziehen, sei es auf die Freude über einen Erfolg oder ein erfreuliches zufälliges Ereignis, auf die Freude an den vorgefundenen schönen Dingen in der Welt, aber auch auf ein dauerhaftes Zufriedensein mit dem eigenen oder fremden Wohlergehen, der eigenen Leistung etc. Und es kann sich darauf beziehen, dass man ein glückliches, gelungenes, gutes Leben führt. Es geht also um den Bereich der Glücksgefühle, des Wohlergehens, aber auch des guten, gelungenen Lebens als Ganzes, wodurch sich eine Verbindung zum griechischen Begriff der eudaimoniaeudaimonia ergibt, oft übersetzt mit „GlückseligkeitGlückseligkeit“. Für jede griechische Philosophie galt die Anforderung, einen Weg zur Glückseligkeit zu weisen. Dies geschah indessen in sehr unterschiedlicher Form.
Was dachten die griechischen Philosophen über das geglückte Leben und warum ist das heute wichtig?
Gewiss ist seit der Entstehung dieser Konzeptionen viel Zeit vergangen, doch wurden sie in der Folgezeit immer wieder aufgegriffen und nahmen Einfluss auf noch heute vertretene Positionen. Außerdem liefern sie nach wie vor wichtige Paradigmen für die Reflexion über das Verhältnis moralischen Handelns zur Idee des geglückten Lebens.
In stichwortartiger Zusammenfassung lässt sich festhalten, dass für Aristoteles das geglückte Leben in einer tugendhaften Tätigkeit gemäß den besonderen Fähigkeiten des Menschen besteht und zwar das ganze Leben über.1
Was Aristoteles mit TugendTugend meint, wird genauer in Kapitel 3 erläutert. Hier geht es nur darum, dass er diese Charaktereigenschaft als wesentlich für ein geglücktes Leben ansieht, dass dieses jedoch nur völlig gelungen ist, wenn auch äußere Glücksgüter hinzukommen. Auch den Tugendhaftesten wird man nicht vollkommen glücklich preisen, wenn ihm nur immer Schlechtes widerfährt.2
Demgegenüber betonen die Stoiker, dass das Glück gerade und einzig im tugendhaften, vernunftgemäßen Leben besteht.
Laut den StoikernStoiker gibt es ein ewiges WeltgesetzWeltgesetz, demgemäß allem Lebendigen eine eigene Tendenz zur Selbsterhaltung innewohnt. Beim Menschen wird diese Tendenz weiterentwickelt zur unbedingten Liebe zum eigenen Vernünftigsein, zur eigenen moralischen Integrität, da dies das Einzige ist, das uns ganz und gar zu eigen ist. Da wir alle äußeren Güter – bis hin zum eigenen Leben – verlieren können, dürfen wir an ihnen nicht mit emotionaler Intensität hängen.3 Die von den Stoikern geforderte apatheiaapatheia ist daher keine Unempfänglichkeit, sondern die Warnung davor, Dingen, die wir nicht ändern können, den sog. adiaphora,adiaphora, absoluten Wert beizumessen. Der Weise, so einer der für die Liebe einiger Stoiker zu scheinbar paradoxen Formulierungen typischen Sätze, ist auch auf der Folterbank glücklich.4 Schließlich kann der WeiseWeise unter allen Bedingungen seine moralische Integrität wahren. Die führenden Stoiker hielten sich selbst übrigens nicht für Weise. Ihr Konzept der Immunisierung gegen die Wechselfälle des Lebens ist in sich konsequent, dürfte die meisten Menschen jedoch überfordern. Bis in die Gegenwartsdiskussion bleibt indessen der Gedanke aktuell, dass die moralische Integrität das ist, worauf die Person selbst Einfluss hat, unabhängig von den äußeren Umständen.
Epikur (*341 v. Chr.; †270 v. Chr.), der Gründer der anderen großen Tradition hellenistischer Ethik, wollte den Menschen die Furcht nehmen, die Furcht vor dem Tod, die Furcht vor den Göttern, die Furcht vor Krankheit und Schmerz. Das geglückte Leben besteht für ihn in der Lust, die er allerdings nicht als andauernden Genuss, sondern wesentlich als Schmerzfreiheit definiert.
Die fundamentale Form der Lust besteht in der Befriedigung elementarer Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Wohnung. Ob Epikus zusätzlich der Ansicht war, man dürfe sich auch Genuss gönnen, solange man unter dessen Verlust nicht leidet, oder ob er ein asketisches Leben forderte, um sich von den äußeren Umständen unabhängig zu machen, ist in der Literatur umstritten. In jedem Fall bedarf es auch für ihn der TugendTugend um sich die Unabhängigkeit von den Zufällen des Lebens und damit die Kontinuität wahrer Lust und ein geglücktes Leben zu sichern.5 Dies ermöglicht den Menschen ein Leben in heiterer GelassenheitGelassenheit, in AtaraxiaAtaraxia. Auch die WissenschaftWissenschaft soll für EpikurEpikur den Menschen die Furcht nehmen, nämlich vor den Naturerscheinungen. Diese Aufgabe erfüllt sie heute nur teilweise, sie warnt z. B. eher vor der drohenden KlimakriseKlimakrise. In jedem Fall bietet Epikur vielen Menschen noch immer einen lebbaren Ansatz für ein gutes und geglücktes Leben.
Wie sah man dies später – und wie heute?
Das geglückte (irdische) Leben hat im christlichen Abendland während des Mittelalters allenfalls zweitrangige Bedeutung, da es nur für unsere Zeit in viain via




























