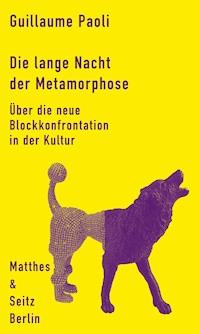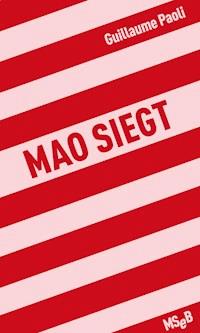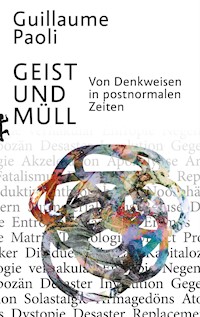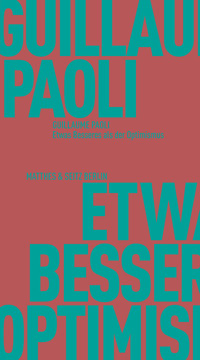
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kritisches Denken ist unwillkommen. Vom Dauerfluss der schlechten Nachrichten klinken sich immer mehr Menschen aus, während in allen Tonarten die Aufforderung wiederholt wird: »Optimismus ist Pflicht« – eine unverhohlene Drohung gegen alle, die als Pessimisten gelesen werden. Stimmungsmache hat vor Meinungsbestimmung Vorrang. Doch werden mit der Prädominanz der Gefühle implizite Ansichten geschmuggelt, die es bloßzulegen gilt. Der Optimismus ist nicht nur Gemüt oder Haltung, sondern ein Begriff, der auf die Leibnizsche Theodizee zurückführt und fatalistische Akzeptanz des Bestehenden verlangt. Gegen den Optimismus vorzugehen, heißt nicht sich dem Pessimismus zu ergeben, sondern sich von dieser plumpen Alternative freizumachen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Etwas Besseres als der Optimismus
Fröhliche Wissenschaft 244
Guillaume Paoli
ETWAS BESSERESALS DER OPTIMISMUS
Inhalt
1. Pessimistin! Was hattest du dir erhofft?
2. Der unverschämte Charme der Subversion
3. Von Maschinenmenschen, sprechenden Affen und Künstlicher Verdummung
4. Freiheitsgespenster
Anhang
Die Optimierung des Tötens
Anmerkungen
1. Pessimistin! Was hattest du dir erhofft?
Mehr denn je ist kritisches Denken unerwünscht.1 Zu einer Zeit, in der selbst ein angenehm warmer Apriltag nicht ohne unterschwellige Unruhe genossen werden kann, zu einer Zeit, in der die Kräfte des Obskurantismus unter dem Deckmantel der Aufklärung hervortreten, zu einer Zeit, die von ihren Chronisten ganz unaufgeregt als »Vorkriegszeit« bezeichnet wird, hat der geringste kritische Vorbehalt alle Chancen, als unzumutbarer Affront wahrgenommen zu werden. Laut einer weltweit angelegten Studie treten immer mehr Zeitgenossen in Nachrichtenstreik. Sie verweigern sich zunehmend der Information durch Massenmedien und zwar nicht so sehr, weil sie der Berichterstattung nicht mehr trauen, sondern weil diese zu negativ sei und missmutig mache. Sie wollen nicht mehr wissen. Bemüht, ihre Konsumenten nicht zu vergraulen, wetteifern also besagte Medien um Positivität und lösungsorientierte Darstellungen. Ein Beispiel unter vielen: Kürzlich ermunterte die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung ihre User zur Lektüre eines Beitrags zum Klimawandel mit einem neuen Trick. Unter zwei Emoticons – Daumen nach oben, Daumen nach unten – stand folgende Anweisung: »Wählen Sie zwischen einer optimistischen und einer pessimistischen Sichtweise auf unsere Klimazukunft. Sie werden die gleichen Grafiken, die gleichen Zahlen sehen, nur der Blinkwinkel darauf verändert sich.«
Auf den Blinkwinkel kommt alles an. Wenn sich die Fakten nicht mehr leugnen lassen, bleibt einem die Click-Freiheit, um diese so oder so, optimistisch oder pessimistisch serviert zu bekommen. Ganz demokratisch darf jeder entscheiden, ob das Glas halbvoll oder halbleer ist. Wobei – ganz frei ist die Wahl nicht. Denn immer öfter wird eine Parole von Karl Popper bemüht, jenem Stichwortgeber des Konsensliberalismus: »Optimismus ist Pflicht«. Angesichts der Tatsache, dass – insbesondere in Deutschland – das Pflichtbewusstsein ganz schnell in Fanatismus ausarten kann, klingt das wie eine kaum verborgene Drohung. Wer als Pessimist gelesen wird, läuft Gefahr, an den Pranger gestellt oder schlimmer noch: totgeschwiegen zu werden. So wurden die Leser durch die spärlichen Rezensionen meines letzten Buchs Geist und Müll, neben allfälligen Komplimenten gewarnt, es sei pessimistisch beziehungsweise hochpessimistisch, was für das Marketing nicht gerade förderlich ist. Ich wähne mich aber hier in guter Gesellschaft, nicht zuletzt von Günther Anders, der demselben Vorwurf mit seinem charakteristischen schwarzen Humor entgegnete: »Pessimistisch ist noch viel zu optimistisch ausgedrückt.«
Gefühlsexhibitionismus ist ein beliebtes Mittel, um eine argumentierte Auseinandersetzung unmöglich zu machen. Eine Emotion lässt sich nicht widerlegen. Nicht nur in sogenannten sozialen Medien, nicht nur im rechten Lager haben sich Meinungsmacher in Stimmungsschleudern verwandelt. Das bedeutet beileibe nicht, dass, wer weiterhin auf kritisches Denken setzen will, Gefühle verbannen oder unterdrücken sollte. Nur gilt es, die unausgesprochenen Annahmen zu entlarven, die mit der Zurschaustellung der Gefühle hineingeschmuggelt werden. Zum Beispiel ist eine Pflicht zum Optimismus eine höchst verdächtige Forderung. Wie kann man denn zu einem Temperament oder einer Gemütslage verpflichtet werden? Da steckt doch etwas dahinter. Wenn ich mich also im Folgenden gegen den Optimismus aussprechen werde, dann nicht um pessimistisch zu argumentieren. Es geht darum, dieser Alternative ihre Relevanz in Bezug auf ein Urteil über die Welt abzuerkennen.
Pessimist. Optimist. Woher kommen diese beiden Kasperletheater-Charaktere überhaupt? Tatsächlich fing alles auf einer Theaterbühne an, wie ich dank dem Historiker Laurent Loty erfuhr.2 Am 22. Februar 1788 wird im Versailler Schlosstheater das Stück eines gewissen Colin d’Harleville uraufgeführt: Der Optimist oder der mit allem zufriedene Mensch. Das Publikum ist begeistert, König Ludwig XVI wird sogar nachgesagt, er habe sich mit dem Protagonisten identifiziert. Aus diesem Erfolg will ein weiterer Autor, Pigault-Lebrun, Kapital schlagen. Am 21. März 1789 findet in Paris die Premiere einer Komödie statt mit dem umgekehrten Titel: Der Pessimist oder der mit allem unzufriedene Mensch.3 Nun ist das Tandem auf Fahrt. Und fährt bis heute. Bemerkenswert ist natürlich das Datum. Im Frühjahr 1789 sind tatsächlich viele Franzosen »mit allem unzufrieden«, und sie werden es sehr bald deutlich wissen lassen. Die politische Absicht beider Stücke ist offensichtlich, und gleich zu Beginn der Revolution wird sie auch erkannt. Fabre d’Églantine, selbst ein mittelmäßiger Stückeschreiber und zwielichtiger Politiker, wirft beiden Autoren vor, sie propagierten eine »anti-soziale Lehre, in der der Starke lernt, alles zu wagen und der Schwache, alles zu erdulden«. Wenig später wird aber Fabre d’Églantine unter der Guillotine enden, wohingegen L’Optimiste wie Le Pessimiste über die ganzen Revolutionsjahre hinaus mit ununterbrochenem Erfolg gespielt werden. Auch Olympe de Gouges, mutige Verfasserin der ersten Erklärung der Frauenrechte, fiel der Schreckensherrschaft zum Opfer. Ehe er sie köpfte, schnauzte sie Henker Samson an: »Pessimistin! Was hattest du dir erhofft?« Offenbar war die Bezeichnung bereits zu diesem Zeitpunkt allgemein gebräuchlich und stand im zwiespältigen Verhältnis zur Hoffnung. Bald zieht das Begriffspaar ins Wörterbuch ein und wird in andere Sprachen übernommen.4 Doch findet der Beginn seiner unaufhaltsamen Karriere zugleich ein plötzliches Ende, denn mit seiner küchenpsychologischen Bagatellisierung wird der Optimismusbegriff unkenntlich gemacht und somit ein philosophischer Streit unter den Teppich gefegt, der das ganze achtzehnte Jahrhundert beschäftigt hatte.
Geschöpft wurde das Wort 1737 von dem Jesuiten Louis-Bertrand Castel in seiner Rezension von Leibniz’ Theodizee, und zwar durchaus abwertend. Ursprünglich also bezeichnet Optimismus die These, wonach wir in der bestmöglichen aller Welten, in einem Optimum leben. Wir bemerken sogleich, dass in diesem Sinne der Gegenspieler des Optimisten nicht so sehr der Pessimist ist, als vielmehr der Maximalist oder Utopist, zumindest jemand, der eine bessere Welt als die bestehende für möglich hält. Das mag für heutige Ohren ungewöhnlich klingen, doch als ich Freunden aus der ehemaligen DDR davon erzählte, waren sie nicht überrascht. Die Pflicht zum Optimismus, das war im Ostblock Staatsdoktrin. Nach der marxistisch-leninistischen Glaubenslehre war der Sozialismus bloß ein Übergangsstadium. Man hatte den Kapitalismus hinter sich gelassen, war unterwegs zum Kommunismus, doch um die Endstation zu erreichen, war keine Umwälzung mehr nötig, sondern die wohlgeordnete Optimierung des bestehenden Systems durch Kybernetik und Planwirtschaft. So wie die Nihilisten, die an keine Besserung glaubten, wurden die Utopisten, die von einer anderen Welt träumten, für feindlich-negative Elemente gehalten. Als schließlich der Glaube an die bestmögliche sozialistische Welt verpuffte, verkündete Heiner Müller das endgültige Urteil: »Optimismus ist Mangel an Information«.
Doch zurück zum Erfinder des Begriffs. Obwohl nach ideengeschichtlichen Maßstäben eine Randfigur, war Castel ein bemerkenswertes Exemplar der mittlerweile ausgestorbenen Gattung der Universalgelehrten. Er veröffentlichte mathematische Arbeiten, entwickelte eine eigene Theorie der allgemeinen Schwerkraft sowie eine originelle Farbenlehre. Aufmerksamkeit erregte er vor allem mit seinem »Augencembalo«, einem Tasteninstrument, das – zwei Jahrhunderte vor Skrjabin – jeden musikalischen Ton mit einer entsprechenden Farbe verknüpfen sollte. Das war für die Zeit doch etwas zu bunt, und obwohl namhafte Denker wie Montesquieu einen regen Austausch mit ihm unterhielten, wurde er gemeinhin für einen Spinner gehalten. Ob Newton’sche Physik, absolute Monarchie oder Musik – es sah so aus, als ob dieser »Don Quijote der Mathematik« (wie ihn Voltaire nannte) darauf bestand, sich immer auf die Verliererseite zu schlagen. Über die wissenschaftlichen wie philosophischen Neuerscheinungen seiner Zeit schrieb Castel angesehene Rezensionen im Journal de Trévoux, dem theoretischen Organ des Jesuitenordens, die zuweilen von seinen Kontrahenten ernster genommen wurden als von seinen geistlichen Kollegen.
Als katholischer Theologe muss Castel die Theodizee-Lehre entschieden ablehnen. Wenn selbst der Allmächtige nicht anders könne, als eine gewisse Menge an Übel zuzulassen, dann wäre er doch überflüssig, zumindest was die irdischen Angelegenheiten angeht. Umso unfreier wäre folglich der Mensch, zwischen Gutem und Bösem entscheiden zu können. Wo es einen freien Willen nicht gibt, gibt es auch keine Sünde. Unsere Taten wären dann gänzlich von Kausalketten vorbestimmt. Um eine solche Anschauung zu charakterisieren, erfindet Castel wieder einen neuen Begriff, den Fatalismus – heute würde man eher von Determinismus sprechen. Zumindest was seine Wortschöpfungen angeht, fehlt es ihm nicht an Bedeutung, lässt sich sein Einfluss auf die französische Aufklärung an den zwei Bestsellern jenes Jahrhunderts erkennen: Voltaires Candide oder der Optimismus und Diderots Jacques der Fatalist. Nichtsdestoweniger wird Castel in der kanonischen Geschichtsschreibung kein Platz gewährt. Stand er doch auf der falschen Seite der nachträglich gezeichneten Grenze zwischen Obskurantismus und Philosophie.
Aber nichts bleibt so, wie es war, und zu meinem Erstaunen erfahre ich, dass Castel neuerdings wiederentdeckt wird, und zwar als Vorreiter der Anthropozän-Theorien! Er soll der Erste gewesen sein, der die Behauptung wagte, der Mensch verändere das Weltklima.5 Anzeichen davon gab es damals bereits. Mit der Kolonisierung Amerikas sowie dem Bau von großen Infrastrukturprojekten wie dem Canal du Midi in Castels südfranzösischer Heimat war beobachtet worden, dass menschliche Unternehmungen die lokalen Klimaverhältnisse beeinflussten. Doch nicht der empirischen Forschung entnimmt Castel seine Hypothese, sie ist Folge einer spekulativen Überlegung. Wie in seinen übrigen Disputen geht es ihm in diesem Fall hauptsächlich um die Würde des Menschen, wobei das Wort hier im ursprünglichen Sinn gemeint ist. Wie auch das lateinische Dignitas bedeutet Würde: »Rang« oder »Stand«. Als Gottes Verwalter wird dem Würdenträger Mensch die Aufgabe zuteil, die Erde umzuformen. Er ist nicht bloß Hirte des Seins, sondern von Amts wegen zuständig fürs Werden. Castels Hauptvorwurf gegen materialistische Wissenschaftler und Denker ist nicht einmal, dass diese Gott leugnen (was sie nur hinter vorgehaltener Hand tun), sondern dass sie den Menschen herabwürdigen. Dabei führt er kein Rückzugsgefecht gegen die aufblühende Naturwissenschaft; er bestreitet bloß, dass der Mensch ein rein natürliches Wesen sei.
Nach Castels Überzeugung muss man zwischen drei Sphären sorgfältig unterscheiden: der natürlichen Sphäre, die mechanistischen Gesetzen unterliege; der übernatürlichen Sphäre, wo ebenjene Gesetze gegebenenfalls von Gott ausgesetzt würden; und dazwischen einer dritten Sphäre, die dem Menschen eigen sei, nämlich der künstlichen. Diese umfasse »alles, was die Natur tut, und [ist] doch durch den freien Willen des Menschen bestimmt«. Zwar ließen sich zum Beispiel Abschuss, Flugbahn und Schlagkraft einer Kanonenkugel dank physikalischer Gesetze genau erklären und berechnen, doch reiche das lange nicht, um das Phänomen Kanonenkugel zu beschreiben. Dazu müssten Fragen geklärt werden wie die, zu welchem Zweck und mit welchen Auswirkungen diese von Menschen konzipiert, hergestellt und geschossen würde. Als verkörperter Geist interagiere der Mensch mit der Materie, dennoch sei er nicht vollständig an ihre Gesetze gebunden. Den regulären Lauf der Natur biege und breche er nach seinem Willen, und so schaffe er