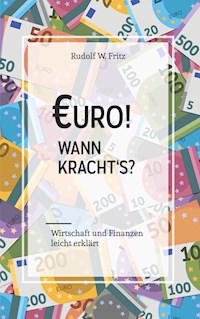
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Wirtschaftsteil einer Zeitung? Trocken, unverständlich, langweilig! Dabei können Wirtschaft und Geld spannend sein wie ein Krimi oder wie ein packender Film im Kino. Die dramatischen Euro-Rettungsaktionen sind ein Beleg dafür. Diese kleine Abhandlung ist als Einstieg ins Wirtschaftsfach und in die Geldpolitik gedacht. In kurzen Aufsätzen ist die heutige Situation der Finanzwelt und der Ökonomie kritisch dargestellt. Einige Male hat der Autor über den deutschen Tellerrand hinausgeblickt und im Nachbarland Frankreich recherchiert, wie dort Wirtschaft und Geld heute gesehen werden. Alleine die in Frankreich schlüssig vertretenen Thesen zum ungebremsten Wirtschaftswachstum sind lesenswert. Das Buch richtet sich an alle wirtschaftlich interessierten Menschen. Sie bekommen Sachinformationen sowie Diskussions- und Argumentationshilfen. Ein Buch zum Mitreden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Frau Regina^
Zur Vita des Autors
Rudolf W. Fritz wurde 1938 in Rottenburg /Bayern (Niederbayern) geboren. Aufgewachsen in ländlicher Gegend. Nach dem Abitur absolvierte er ein Fremdsprachenstudium am Sprachen- und Dolmetscherinstitut (SDI) in München mit den Fächern Französisch und Englisch. Später kam noch Spanisch dazu. Dem Fremdsprachenstudium folgte das Studium der Volks- und Betriebswirtschaft sowie der Politikwissenschaft an der Universität München mit Abschluss Diplom. Danach war er viele Jahre in leitenden Funktionen der Wirtschaft / Export sowie als Personalberater mit dem Schwerpunkt der weltweiten Vermittlung von deutschen und ausländischen Führungskräften tätig. Dazu gehörten Reisen rund um den Globus.
Seit 2003 im Ruhestand. 2004: Gründung eines Instituts für Lernhilfe, Bildung und Beruf (ilbb) in Offenbach. Verheiratet, drei Söhne. Sein besonderes Interesse gilt – neben Weinkeller und Brotbacken – der deutschen und französischen Literatur sowie der Geschichte und dem Schreiben.
Inhaltsverzeichnis
Tauschhandel oder Geld spielt keine Rolle
Die Entstehung des Geldes
Glanz und Elend des Geldes
Was heißt Wirtschaften?
Schluss mit verharmlosenden Anglizismen und Euphemismen in Wirtschaftssprache und Politik!
Echte Demokratie verlangt: Moral – Politik – Wirtschaft
Hat die Demokratie in Zeiten latent vorhandener Finanzkrisen eine Zukunft?
Staat und Volkswirtschaft
Sparen, konsumieren oder investieren?
Ungebremstes Wirtschaftswachstum: Utopie?
Heilsame Gesundschrumpfung des Wirtschaftswachstums
Grenzen des technischen Fortschritts
Bankenkrise: Die Entmystifizierung einer selbsternannten Elite
Die Europäische Union, der Euro und die Europäische Zentralbank
Erster Ausblick: Benötigt die Europäische Union die Europäische Zentralbank oder Wie geht es besser?
Zweiter Ausblick: Gründe, die EU neu aufzubauen
Gleicher Lohn für Frauen und Männer
Überlegungen für eine gerechtere Einkommensverteilung oder Gleichstellung von Arbeit und Kapital
Gigantomanie deutscher Großunternehmen und die fatalen Folgen für Steuerzahler
Es war einmal eine Industrienation, die mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ weltweit Beachtung fand
Schlussbemerkungen
Danksagung
Vorwort
Der Wirtschaftsteil einer Zeitung? Trocken, unverständlich, langweilig – finden die LeserInnen. Dabei können Wirtschaft und Geld spannend sein wie ein Krimi oder wie ein packender Film im Kino. Die dramatischen Euro-Rettungsaktionen sind ein Beleg dafür. Diese kleine Abhandlung ist als Einstieg ins Wirtschaftsfach und in die Geldpolitik gedacht. In kurzen Aufsätzen und verständlichen Ausführungen habe ich versucht, die heutige Situation der Finanzwelt und der Ökonomie kritisch darzustellen. Mein Buch erspart umfangreiche Fachliteratur. Es beschränkt sich auf Wesentliches, das dann leichter im Gedächtnis bleibt.
Einige Male habe ich über den deutschen Tellerrand hinausgeblickt und im Nachbarland Frankreich recherchiert, wie dort Wirtschaft und Geld heute gesehen werden. Alleine die in Frankreich schlüssig vertretenen Thesen zum ungebremsten Wirtschaftswachstum waren einen Blick über die Grenze wert.
Das Buch richtet sich allgemein an alle wirtschaftlich Interessierten, an SchülerInnen von Wirtschaftsschulen, an StudentInnen der Volks-und Betriebswirtschaftslehre sowie an alle in der Wirtschaft tätigen Menschen. Sie bekommen Sachinformationen sowie Diskussions- und Argumentationshilfen. Kurz: Ein Buch zum Mitreden.
Rudolf W. Fritz
1. Kapitel
Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Geschäfte unternimmt. Kein Hund tauscht einen Knochen mit einem anderen.
Unbekannt
Tauschhandel oder Geld spielt keine Rolle
Mit dem Tauschhandel fängt die Wirtschaftsgeschichte an. Was immer der Globus und Menschenhände hergaben, wandelte sich im Lauf der Jahrtausende vermehrt zur Ware. Auch wenn heute Geld zu regieren scheint: Der alte Tauschhandel hat sich bis in unsere Zeit erhalten. Es ist die Form des Handels, bei der Waren- oder Dienstleistungen direkt gegen Waren oder andere Dienstleistungen übergeben werden, ohne Verwendung von Geld.
Vor sehr langer Zeit, etwa 5000 bis 7000 Jahre vor der Zeitrechnung, sind die Menschen ohne Geld ausgekommen. Diese Form des Handels war möglich, weil es nur wenige Menschen gab und der Umfang der Produkte überschaubar war. In Ansiedlungen wusste jeder vom anderen, was und wieviel er oder sie herstellte. Man tauschte Schafe gegen Ziegen, Rinder gegen Schweine, Brennholz gegen Fische, Wurfspeere gegen Äxte oder Felle gegen Salz und selten kostbare Gewürze der Weitgereisten. Doch die Menschen vermehrten sich, und – man ahnt es – je mehr Menschen untereinander etwas anboten, umso weniger praktikabel wurde der Tauschhandel.
Der zweite Grund, warum das System des Tauschhandels scheitern musste, lag in der Tatsache, dass es keine Möglichkeit gab, lebensnotwendige Erzeugnisse aufzubewahren. Was sollte also jemand tun, der mit seinen Ziegen zu viel Milch erzeugte? Auch Fleisch zu viel hatte, das er im Moment nicht brauchte. Wer mehr Fische fing als er essen konnte, dem ging es genauso. Wohin mit dem Überschuss? Die Menschen waren in einer Zwangslage. Es musste ein Tauschmedium gefunden werden, das man akzeptierte, es musste handlich und in passender Stückelung zu verwenden sein. So war damit die Idee des Geldes geboren, doch es würde noch lange dauern, bis die Menschen Gold- oder Silbermünzen prägten.
Bis es Münzgeld gab behalfen sich die Menschen mit Muscheln, Fellen und Perlen. Damit konnte man beinahe alle anderen Waren kaufen. Dennoch: Diese Werte waren zwar leicht aufzubewahren, zeigten sich aber mitunter sperrig und – was die Felle und Muscheln anging – nicht so leicht in großen Mengen zu transportieren. Schließlich setzten sich in vielen Ländern die runden Gold- und Silbermünzen durch. Sie waren leicht aufzubewahren, wendig zu transportieren und der eingeprägte Wert schaffte Vertrauen in diese Währung. Folgerichtig war die Akzeptanz für Münzen sehr hoch.
Jedoch: Münzen waren leicht zu fälschen. Geldfälscher gab es zu allen Zeiten. Gold- oder Silbermünzen nachzuahmen war keine schwierige Aufgabe. Die Gauner nahmen statt Gold und Silber billige Eisenlegierungen oder Kupfermaterial und überzogen es mit einer dünnen Schicht Edelmetall.
Der Tauschhandel hat sich bis in die Neuzeit erhalten. Junge Leute entwickeln gerade eine Wiederbelebung von Tauschmärkten – da geht es um hippe Möbel und angesagte Mode.
Staaten verließen nie ihre Tauschgeschäfte: Frankreich, ehemalige Kolonialmacht in Afrika, tauschte mit dem Diktator der Zentralafrikanischen Republik, Bokassa, Waffen gegen Uran. Damit baute Frankreich seine Force de Frappe atomique – atomare Streitkraft. Das deutsch-sowjetische Röhren-Erdgas-Geschäft: Deutschland lieferte die für die Pipelines benötigten Röhren und erhielt im Gegenzug Erdgas. Etwa zwischen 1977 und dem Mauerfall 1989 kam es in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zu einer Kaffeekrise. Sie wurde bewältigt, indem die DDR Waffen und LKW an Partnerländer lieferte und im Gegenzug Rohkaffee und Energiestoffe erhielt.
Noch einmal zurück zum Tauschhandel im privaten Sektor. In wirtschaftlichen Krisenzeiten verlieren die Menschen schnell das Vertrauen in den Wert des Geldes. In solchen Momenten entsteht der Tauschhandel mit konkreten Güter-Ersatzwährungen. Da gab es im Nachkriegsdeutschland ab 1945 die Zigarettenwährung. Dafür erhielt man Brot, Butter, Kartoffeln oder Kohle. Kaffee war eine Kostbarkeit. Mit Schmuck ließ sich ebenfalls optimal tauschen. Die Städter zogen aufs Land, ließen goldene Uhr oder Silberschmuck bei den Bauern für pralle Rucksäcke, gefüllt mit Mehl, Speck, Brot, Geräuchertem, Eiern.
2. Kapitel
Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu.
Danny Kaye (1911 – 1987)
Die Entstehung des Geldes
Im ersten Kapitel sind die ältesten Geldformen, tierische Produkte, mineralische Erzeugnisse sowie Naturalien und Schmuck bereits angesprochen worden. Recherchiert man in Büchern über Wirtschaftsgeschichte, dann bekommt man leider keine Antwort auf die Frage, wer diese frühen Geldformen erfunden hat. Diese Tauschmittel haben sich aus der zivilisatorischen Entwicklung vor etwa 7000 Jahren ergeben. Nun kamen die Menschen zu der Überzeugung, dass Edelmetall für den Warenaustausch am bequemsten war. Man mochte keine großen Metallplatten, sondern portionierte Stücke, wie kleingehackt. Das ist der Beginn der Münzprägung mit dem Vorteil, dass Münzen – je nach Stückelung – stets gleiche Größe und Gewicht, leicht zu transportieren und zu zählen sind. Solche Tauschmittel konnte jeder annehmen.
Die Erfindung des Münzgeldes fand wahrscheinlich an mehreren Orten der Zivilisation vor etwa 700 Jahren v. Chr. statt. Einen Erfinder des Münzgeldes konnte die Forschung in der Wirtschaftsgeschichte allerdings genau lokalisieren und näher beschreiben. Es handelt sich um Krösus – ein griechisches Wort, das so viel bedeutet wie: ein sehr reicher Mann – der vor etwa 2700 Jahren in Lydien lebte und herrschte. Im Reich von König Krösus, ein Gebiet der heutigen Türkei-Westküste, fand man große Mengen an Gold, die er zu kleinen Münzen prägen ließ. Doch das viele Gold und sein damit verbundener unermesslicher Reichtum machten König Krösus übermütig. Er ließ eine Armee aufstellen, bezahlte die Soldaten mit den Goldstücken und zog gegen Perserkönig Kyros II. zu Felde. Dessen Heer besiegte König Krösus, der nicht nur sein Königreich Lydien sondern auch seinen Goldreichtum verlor. Er soll, wie das in solchen Tragödien üblich ist, bitter enttäuscht und gebrochen gestorben sein.
Immerhin ist die Erfindung der Münze noch heute aktuell und die Bezeichnung „reich wie Krösus“ hat sich ebenfalls erhalten. Und wo blieb das Papiergeld? Wer hat es erfunden – und wie Witzbolde scherzen – warum so wenig? Ob es gerechter zuginge, wenn mehr Geld verteilt würde, lässt sich nicht beantworten. Aber die Frage, wann und wo Papiergeld zuerst in Umlauf kam, kann geklärt werden. Bereits im elften Jahrhundert hat man in China während der Song-Dynastie das Papiergeld erfunden, als Ersatz für Münzgeld.
In Europa war es noch lange nicht so weit. Erst im Jahr 1483 startete in Spanien die Ausgabe von Papiergeld, an Stelle von Münzgeld. Im Jahr 1609 begann die Amsterdamer Wechselbank mit der Ausgabe von Banknoten mit Währungsfunktion. Die ersten offiziellen Banknoten wurden Mitte Juli 1661 durch die Bank von Stockholm herausgegeben. Ein Blick nach Frankreich zeigt, dass unter dem Finanzminister John Law (schottische Herkunft) von 1718 – 1720 Papier-Banknoten in großem Stil emittiert wurden. Diese kurze Episode endete jedoch in einem Fiasko. Und wie sah es in Deutschland mit dem Papiergeld aus? Hier wurden sächsische und preußische Staatspapier- und Tresorscheine im 18. Jahrhundert als Banknoten herausgegeben. Im 19. Jahrhundert verbreitete sich die Banknote schließlich zum allgemein anerkannten Zahlungsmittel neben dem Münzgeld.
Der Vollständigkeit halber sei noch das sogenannte Buchgeld erwähnt. Bankkunden zahlen Geld bei der Bank ein und diese verbucht es auf deren Konten. Das ist der Beginn des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und Überweisungen wurden damit für jedermann möglich. Dennoch: Buchgeld ist kein gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegt folglich keiner Annahmepflicht.
3. Kapitel
Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Verdacht, dass er für Geld alles zu tun bereit ist.
Benjamin Franklin (1817 – 1888)
Glanz und Elend des Geldes
Mit dieser Überschrift ist der Wert des Geldes angesprochen. Es gilt daher zu untersuchen, wie es mit der Wertigkeit des Geldes steht beziehungsweise welche Rolle das Geld in unserem Leben spielt und auch in der Wirtschaft. Als Kinder pflegten wir wegen chronischen Taschengeldmangels zu sagen: Geld spielt keine Rolle, denn es ist keines vorhanden. Später dann: Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein – eine positive Wertung.
Anlässlich eines Besuches in einem österreichischen Automobilhandel-Unternehmen hörte der Autor den Chef des Hauses zum Chefbuchhalter sagen: „Und, Buchhalter Reichle, merk‘ dir eins: Wenn du kein Geld hast, bist du ein Depp.“ „Und wenn du welches hast, kannst du auch ein Depp sein“, ist in der Bemerkung des Unternehmers allemal enthalten. In der Literatur gibt es viele Aussagen, welche die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel auf ein höheres Niveau gehoben haben als der rustikale Autohändler. So kann man lesen, dass Geld immer nur Mittel zum Zweck sei und als Verständigungsmittel zwischen den Menschen diene.
Dass man mit Geld alles kaufen kann, ist eine Binsenweisheit. Und ebenso selbstverständlich ist, dass man mit Geld weder Gesundheit, Glück, Liebe, Freundschaft oder auch Talent und Geist erwerben könnte, die gefragtesten Güter der Menschen. Die Gier nach materiellen Gütern treibt Menschen an, immer mehr sichtbaren Reichtum anzusammeln. In jedem steckt ein kleiner Krösus. Materieller Reichtum bildet so etwas wie den Außenwall der Persönlichkeit, getreu dem Motto: Hast du was, dann bist du was!
Da werden Statussymbole, wie Häuser, Autos, Marken-Armbanduhren gesammelt, Aktien und Anleihen gekauft. Selbstverständlich wird in Erinnerung an Krösus auch Gold erworben. Ein Reitpferd für den Nachwuchs darf nicht fehlen. Andere müssen sich damit begnügen, mit weniger Geld ihre Existenzbedürfnisse zu befriedigen; also wird es ausgegeben für den Kauf von Nahrung und Kleidung und einen Schulranzen für Sohn und Tochter. In den genannten Fällen ist Geld stets Mittel zum Zweck. Es ist, wie weiter oben dargestellt, das Verständigungsmittel zwischen den Menschen bei ihren geschäftlichen Beziehungen.
In den meisten Fällen beziehen die Menschen ihr Geld auf anständige Weise und verwenden es korrekt bei ihren Ausgaben. Die Glanzseite des Geldes ist immer dann sichtbar, wenn diese geniale Erfindung zur Verständigung der Menschen bei ihren geschäftlichen Transaktionen dient. Doch das Erscheinungsbild von Geld hat auch eine Kehrseite. Geld ist immer zu wenig. Hier ist Knappheit und ungleiche Verteilung. Diese beiden Aspekte verleiten viele Menschen zu illegalen Handlungen, um dieses Defizit zu korrigieren. Sie werden zu Kriminellen, brechen in Häuser und Wohnungen ein, überfallen Leute und rauben sie aus, begehen Mord und Totschlag, um an Geld oder Erbe heranzukommen, stehlen alles was sich zu Geld verwerten lässt. Der Einwand, es gab zu allen Zeiten Arme und Reiche – in der Regel stets wesentlich mehr Arme als Reiche – muss nicht auf ewig gelten, mit anderen Worten: Das muss nicht immer so bleiben.
Die beste Prophylaxe, um die Kriminalität zu senken, läge in einer gerechteren Verteilung des Geldes. Auch wenn es der volkswirtschaftlichen Verteilungstheorie des Geldes egal ist, wem Einkommen gehört, sollte das noch lange kein Grund sein, diesen Zustand nicht zu ändern. Ja, man kann der Kriminalität vorbeugen. Man kann jedoch auch philosophisch Volkseinkommen gerechter verteilen.
Ein erster Schritt in diese Richtung wird derzeit unter dem Begriff „Bedingungsloses Grundeinkommen“ diskutiert. Die Befürworter schlagen ein Grundeinkommen im Monat von etwa 1000 Euro vor. Wer über mehr Geld verfügen will, müsste dazu arbeiten, um höheren Ansprüchen zu genügen. Gegner des bedingungsglosen Grundeinkommens führen ins Feld, dass dann viele den Anreiz zu arbeiten verlieren würden. Ein fadenscheiniges Argument, das durch empirische Versuche leicht zu entkräften wäre. Zwangsläufig wäre das mit der Abschaffung einer größeren Beamten-Gemeinde und öffentlicher Angestellten verbunden. Eine gigantische Kosteneinsparung. Würde man dann noch abziehen, was die Bekämpfung der Kriminalität und Gefängnisunterbringung ausmacht, bliebe womöglich Überschuss übrig.
Es ist kurzsichtig, nicht an eine gerechtere Verteilung des Einkommens zu denken. Vorsichtige Versuche sollten einmal unternommen werden, auch unter dem Aspekt, eine friedlichere Gesellschaftsordnung zu erreichen. Die geniale Erfindung Geld würde den Elendsaspekt verlieren und als neutrales Verständigungsmittel zwischen den Menschen dienen.
4. Kapitel
Wer gut wirtschaften will, sollte nur die Hälfte seiner Einnahmen ausgeben, wenn





























