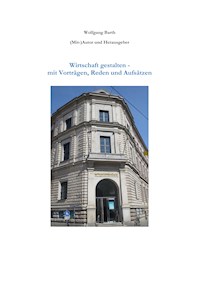Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im vorliegenden Sammelband hat der Autor seine Vorträge zum Euro, zum Europäischen Binnenmarkt und zur Osterweiterung der Europäischen Union von Mitte der 1970er Jahre bis zur Euro-Bargeldeinführung Anfang 2002 zusammengestellt. Der (die) interessierte Leser(in) kann sich so im Rückblick noch einmal über das Für und Wider der damaligen historischen Entscheidungen, die zur Europäischen Union und zum Euro führten und aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden, vergewissern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
I. Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)
Der Vertrag von Maastricht Februar 1992
II. Europäische Währungsunion (EWU)
II.1. Gesamtwirtschaftliche Betrachtung
Der Euro kommt – die D-Mark geht Oktober 2001
Vorbereitung auf die Euro-Bargeldeinführung November 2000
Erste Erfahrungen mit dem Euro Juni 1999
Versprochen – gehalten: Deutschland und der Euro April 1999
Volkswirtschaftliche Überlegungen Mai 1998
Pläne und Perspektiven (II) September 1997
Pro und Contra September 1997
Euro 1999 – Wohin geht die Reise? Dezember 1996
Pläne und Perspektiven (I) Juli 1996
Der Weg zur Europäischen Währungsunion März 1995
Eine kritische Würdigung März 1992
Der europäische Geld- und Kapitalmarkt nach 1992 August 1989
II.2. Auswirkungen auf Teilbereiche der Wirtschaft
Euro – praktische Konsequenzen für Privatkunden Januar 1999
Die Top 10 Fragen zum Euro Dezember 1998
Auswirkungen auf den Immobilienmarkt Oktober 1998
Geld- und Kapitalanlage im Vorfeld der Europäischen Währungsunion Juli 1998
Euro-Umstellung in der Unternehmenspraxis Juli 1998
Konsequenzen für die Unternehmen (II) Juli 1998
Der Euro kommt – Konsequenzen für den Anleger Mai 1998
Euro-Einführung und Auswirkungen aus gewerkschaftlicher Sicht Oktober 1997
Herausforderung und Chance für die Wirtschaft Mai 1997
Chancen und Handlungsempfehlungen für Firmenkunden März 1997
Konsequenzen für die Unternehmen (I) Januar 1997
Konsequenzen für die Bankkunden September 1996
Konsequenzen für die Kreditinstitute März 1996
Argumentarium für Kundenberater November 1995
Konsequenzen für Geldanleger und Kreditnehmer Oktober 1995
Konsequenzen für langfristige DM-Anleihen Dezember 1994
Fragebogen: EG und der Europäische Binnenmarkt September 1994
III. Europäische Einigung
Chronologie der Europäischen Einigung (1952 – 2017) März 2017
Osterweiterung der Europäischen Union Juni 2001
Europäische Nachbarschaft August 2000
Deutschlands Rolle in Europa September 1995
Der EG-Binnenmarkt - Inhalte und Konsequenzen August 1989
Hat die EG noch eine Zukunft? Dezember 1976
IV. Zitate zum Prozess der europäischen Einigung
Vorwort
Das Jahr 2017 ist mit Blick auf den Prozess der europäischen Einigung in mehrfacher Hinsicht ein Jubiläumsjahr:
Vor 60 Jahren, am 23. März 1957, wurden die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomenergiegemeinschaft (EAG) durch Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande in Rom unterzeichnet. Am 1. Januar 1958 traten die Römischen Verträge in Kraft.
Vor 25 Jahren, am 7. Februar 1992, unterzeichneten die europäischen Staats- und Regierungschefs im niederländischen Maastricht den Gründungsvertrag der Europäischen Union (EU), der am 1. November 1993 in Kraft trat. Waren bis dahin - auf Basis der Römischen Verträge – die wirtschaftlichen Interessen der Kern der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, so verpflichteten sich die Mitgliedsländer jetzt zu einer weiter reichenden, engen Zusammenarbeit in so wichtigen Bereichen wie der Außen- und Sicherheitspolitik, der Justiz und des Inneren. Teil des Maastricht-Vertrages waren außerdem die Unionsbürgerschaft, die den EU-Bürgern das freie Aufenthaltsrecht in allen EU-Staaten garantiert, sowie die Einführung einer Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU). Auch die Stärkung des EU-Parlaments geht auf den Vertrag von Maastricht zurück.
Vor 15 Jahren, am 1. Januar 2002, kamen die Euro-Scheine und -Münzen in Umlauf. Damit ersetzte der Euro drei Jahre nach seiner Buchgeldeinführung auch im Alltag in zwölf der damals noch 15 EU-Mitgliedstaaten als Bargeld die Landeswährungen.
Erinnert sei im vorliegenden Zusammenhang außerdem
an den 1. Januar 1957, als vor ebenfalls 60 Jahren das Saarland, das sich nicht zu Unrecht als eine Kernregion Europas ansieht, als elftes Bundesand der Bundesrepublik Deutschland beitrat, und
an die Gründung der Deutschen Bundesbank am 1. August 1957, die mit dem Beginn der EWWU am 1. Januar 1999 in der Europäischen Zentralbank (EZB) aufging.
In wirtschaftlicher Hinsicht brachte der EU-Gründungsvertrag die europäische Integration entscheidend voran. Denn bereits zum 1. Januar 1993 war der Europäische Binnenmarkt realisiert worden, der den freien Verkehr von Personen und Dienstleistungen, Waren und Kapital ermöglichte. Die EU war also von Beginn an ein Wirtschaftsraum ohne Grenzen. Herzstück der Europäischen Währungsunion (EWU) wurde die 1998 gegründete Europäische Zentralbank (EZB), die dem Ziel der Geldwertstabilität verpflichtet ist. Zum anderen wurde die Schaffung einer Gemeinschaftswährung beschlossen - des Euro, wie er später benannt wurde.
Heute ist die Europäische Union Heimat von über 500 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürgern in 28 Mitgliedstaten. Die EU bildet zugleich den größten Binnenmarkt der Welt. Von den aktuell 28 (nach dem Ausscheiden Großbritanniens noch 27) Mitgliedstaaten gehören 19 der Eurozone an. Durch den Vertrag von Maastricht wurde Europa zu einer politischen Union. Weiterverfolgt wurde das Ziel, “eine immer engere Union der Völker Europas zu schaffen“, wie es im Vorwort des Vertrags heißt, mit der Unterzeichnung der Nachfolgeverträge von Amsterdam (1997), Nizza (2001) und Lissabon (2007), die unter anderem institutionelle Änderungen (wie die Möglichkeit von Mehrheitsentscheidungen) beschlossen. Zusammen mit diesen Erweiterungen ist der Vertrag von Maastricht bis heute maßgeblich für die Integration Europas. Er bildet die Grundlage, auf der aktuelle Herausforderungen gemeistert werden können, die das Leben der EU-Bürgerinnen und -Bürger bestimmen - ganz im Sinne des deutschen Staatsmannes und Friedensnobelpreisträgers Gustav Stresemann (1878-1929), der bereits die Idee einer gemeinsamen europäischen Kultur beschwor.1
Die Vereinbarung einer derart eng verzahnten politischen Zusammenarbeit innerhalb Europas ist eine einzigartige historische Leistung, an die die europäischen Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel am 25. März 2017 in Rom feierlich erinnern werden. Doch nun - 60 Jahre nach dieser historischen Weichenstellung - werden Europa und seine Institutionen von vielen Bürgern kritisch gesehen. Das Jahr 2017 wird für unseren Kontinent nach den Worten des neugekürten Bundespräsidenten Walter Steinmeier wohl zu einem Schicksalsjahr werden: Nach dem Schock des Brexit (dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union), der nun konkrete Formen annimmt, der Wahl von Donald Trump zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (am 23. November 2016), der nicht viel von der europäischen Integration hält, und dem grassierenden neuen Nationalismus auch in nahezu allen EU-Mitglieds-staaten, werden Neuwahlen in den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und vielleicht auch in Italien darüber entscheiden, ob die EU zusammenhält oder ob es zum Ausscheiden einzelner Länder aus der Europäischen Währungsunion (EWU) bis hin zum Zerfall der EU kommen wird. Hinzu kommen die ungelöste Flüchtlings frage und der wachsende Terrorismus. Auch in Deutschland mehren sich die Forderungen, der Währungsunion eine neue Struktur zu geben. 2017 kann mit anderen Worten für Europa eine dramatische Zeitenwende einleiten - in Richtung eines weiteren Durchwursteins (“muddling through“) oder gar zu einer Rückabwicklung des europäischen Integrationsprozesses. Die Krise kann aber auch, wie schon öfter in der Geschichte der europäischen Integration, zu einem Neustart des “Projekts Europa“ führen.
Revitalisierung der europäischen Idee
Wie konnte es zu alldem kommen? Wo ist die Vision, die Hoffnung geblieben, die von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in der Kathedrale von Reims zelebriert worden war. Der Wunsch nach einer besseren Zukunft und einer friedlichen Gesellschaft war damals eine treibende Kraft für den Wandel – ehemalige Erzfeinde einte derselbe Wunsch: ihre Volkswirtschaften wieder aufzubauen und zu stärken. Wie kann hier mit Blick in die Zukunft der jungen Generation wieder mehr Vertrauen in den europäischen Einigungsprozess gewonnen werden?
Wer sich mit dieser Frage beschäftigt, sollte sich zunächst einmal vor Augen halten, dass die EU für die Menschen in Europa Frieden und Wohlstand gebracht hat. Das ist, erinnert man sich an die blutigen Auseinandersetzungen im Herzen Europas in der Vergangenheit, alles andere als selbstverständlich. Die EU hat den Menschen im Westen des Kontinents (freilich nicht allen, wenn man an die hohe Jugendarbeitslosigkeit im Süden Europas denkt) Wohlstand gebracht, und sie hat die Demokratisierung der osteuropäischen Mitgliedstaaten und ihre wirtschaftliche Transformation gefördert. Das sind große Leistungen, wobei man bei den Details der Zusammenarbeit gewiss vieles hätte besser machen können. (Zum Beispiel sollten wir im EU-Haushalt mehr Geld für äußere und innere Sicherheit oder die Entwicklungs- und Flüchtlingshilfe ausgeben und weniger für Agrarsubventionen oder teils unsinnige regionalpolitische Projekte.)
“Ein weiterer Schritt (zur Stärkung des Vertrauens) ist, uns allen wieder bewusst zu machen, wo Europa unseren Alltag einfacher und unser Leben besser macht. Dazu zählen der Binnenmarkt, die Reisefreiheit, bei aller kulturellen Vielfalt ein gemeinsamer Kanon an Werten und Grundrechten und natürlich im Euro-Raum die gemeinsame Währung. Diese Errungenschaften sind inzwischen für viele so selbstverständlich, dass es nicht schadet, dann und wann daran zu erinnern“, so der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, in einem Interview mit dem Handelsblatt vom 25. 11.2016.
Ein Blick auf die europäische Einigungsgeschichte zeigt freilich auch, dass es zwischen all den Meilensteinen stets Stillstand und Rückschläge gab. Das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft schon in den 1950er Jahren, de Gaulles Politik des leeren Stuhls in den 60er Jahren oder die sogenannte Eurosklerose2 in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts sowie die Ablehnung des Europäischen Verfassungsvertrages bei den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden (im Mai 2005) sind nur einige der vielen Momente, in denen die Europäische Union vor der Perspektivlosigkeit stand. Der Europäische Integrationsprozess erlitt dadurch erhebliche Rückschläge; das politische und wirtschaftliche Zusammenwachsen Europas kam jedoch nicht zum Stillstand.
Auch die gegenwärtige Situation in Europa ist deshalb nicht das Ende der europäischen Staatengemeinschaft. Sie kann vielmehr, wie die Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, aufgrund der gemeinsamen Interessen und Verflechtungen durch die europäische Solidargemeinschaft und gezieltes Krisenmanagement überwunden werden. “Die EU, die wir heute haben, hat durchaus ihre Schwächen, denken wir nur an die Probleme der Euro-Zone. Aber sie hat auch große Stärken“, so Ifo-Präsident Clemens Fuest in einem Vortrag beim Forum Berlin der Hanns-Martin Schleyer-Stiftung im Dezember 2016. Dazu zähle die Bilanz von 60 Jahren Wohlstand und Frieden in Europa, die Leistungen der EU bei der ökonomischen und demokratischen Entwicklung der osteuropäischen Mitgliedstaaten und die Attraktivität des Binnenmarktes. Wenn die EU eine Zukunft haben soll, dann müsse sie durch Attraktivität überzeugen.
Euro muss durch Attraktivität überzeugen
Was dabei die Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung betrifft, so war (und ist) sie – unter Abwägung ihrer verschiedenen Facetten – auch unter Bankvolkswirten hierzulande immer heftig umstritten gewesen. Der deutsche Sachverständigenrat3 aber auch amerikanische Ökonomen standen dem Euro von Anfang an skeptisch gegenüber. Erinnert sei an einen Artikel von Milton Friedman4, der sich heute wie eine Prophetie liest. Ziel sei es gewesen, so Friedman, die Vereinigten Staaten von Europa vorzubereiten. “Ich glaube, dass die Einführung des Euro den gegenteiligen Effekt haben wird. Sie wird politische Spannungen verschärfen, indem sie divergente Schocks, die durch Änderung der Wechselkurse leicht hätten gemildert werden können, zu umstrittenen politischen Themen macht. (...) Monetäre Einheit, die unter ungünstigen Bedingungen eingeführt wird, wird sich als Hindernis für die politische Einheit erweisen.“
Auch wer den Euro in Summe immer für eine gute Sache gehalten hat, wie der Autor, muss einräumen: Ja, so ist es gekommen.5 Die wirtschaftlichen Folgen des Euros führten zu politischen Spannungen, und letztlich brachen längst überwunden geglaubte Animositäten zwischen den Völkern wieder auf. “Das vermeintliche Friedensobjekt Euro hat Europa Unfrieden gebracht“, konstatierte Hans-Werner Sinn (in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung) im Sommer 2015.6 Die von den Gründungsvätern des Euro erhoffte wirtschaftliche Annäherung (Konvergenz) der sehr unterschiedlich entwickelten Mitgliedstaaten der Währungsgemeinschaft ist ebenso wenig in Erfüllung gegangen wie die Hoffnung, dass die Gemeinschaftswährung der ins Stocken geratenen politischen Integration der EU-Staaten neuen Schub verleihen werde. Heute ist die wirtschaftliche Heterogenität der Euroländer sogar größer als vor 15 Jahren, und die erhoffte wirtschaftliche Dynamik, die vom Lissabon-Vertrag ausgehen sollte, ist (weitgehend) ausgeblieben. Der Maastrichter-Vertrag hat so gesehen sein Ziel verfehlt, einen wirklich einheitlichen Währungsraum zu schaffen.
Die Gründe dafür sind bekannt: So wurden die Konvergenzkriterien, die über die Aufnahme eines Landes in die Währungsunion entscheiden sollten, allzu großzügig interpretiert, gemeinsame Vereinbarungen leichtfertig beiseitegeschoben und die für die finanzwirtschaftliche Stabilität einer Volkswirtschaft essentielle Verfassung des Bankensystems sogar völlig ausgeblendet, um hier nur die wichtigsten Versäumnisse zu nennen. Aber der Schluss, dass der Euro von Anfang an ein Fehler war, sollte nicht leichtfertig gezogen werden. Auch ohne Euro hätte die wirtschaftliche Dominanz Deutschlands in Kombination mit einer mächtigen Bundesbank für bittere Konflikte gesorgt. Die Streitereien über die starke D-Mark nach der Wiedervereinigung gaben eine Vorahnung dessen, was hätte kommen können.
Trotz ihrer Geburtsfehler hat sich die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) bereits in den ersten Jahren ihrer Existenz in vielfacher Weise bewährt: Ohne EWWU (und die Politik der Europäischen Zentralbank) hätte sich die 2007 einsetzende weltweite Wirtschaftskrise für Europa – in den Mitgliedstaaten der EWWU wie in den EU-Staaten außerhalb der Währungsunion – wesentlich dramatischer ausgewirkt. Auf EU-Ebene wurden mit dem Euro-Rettungsschirm ESM, dem Fiskalpakt sowie der Schaffung einer einheitlichen Bankenaufsicht und –abwicklung für den Euro-Raum Instrumente für eine solidarische Krisenbewältigung entwickelt. Selbst die schärfsten akademischen Kritiker fordern heute keine Rückkehr zur nationalen Währung mehr. Zu groß ist die Furcht vor Verwerfungen und Verlusten gerade für Deutschland mit seinen sehr hohen Forderungen an die Peripherieländer. Dies bedeutet aber noch nicht, dass das Europäische Währungssystem in seiner derzeitigen Verfassung vor einem Zerbrechen gefeit ist und der Euro als Weltwährung eine Zukunft hat.7 Folgen müssen nun einige nachhaltige Reformen:
zusätzlich zur Bankenunion eine Kapitalmarktunion, in der Märkte und Regulierung harmonisiert werden und der Wettbewerb fairer wird,
die Haushaltskonsolidierung in den EWU-Problemstaaten, um die Schulden tragfähig zu machen,
Strukturreformen, um Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen und Wachstum zu fördern,
die Wiederherstellung einer Balance zwischen autonomen Handeln und Haftung in den Mitgliedstaaten, um den Steuerzahler künftig vor Verlusten so weit wie möglich zu bewahren
und – last but not least – die Stärkung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) – besser: sein Ausbau zu einem Europäischen Währungsfonds (EWF) -, um den Reformprozess zu überwachen.
Insgesamt also die Rückkehr zum geltenden Ordnungsrahmen (Regelbindung) und seine Fortentwicklung mit Härtung der entscheidenden Schwachstellen (sogenanntes Maastricht 2.0). Was sich - in Kenntnis der jüngsten Entwicklungen - außerdem sagen lässt, ist dies: Europa braucht stärkere Institutionen und unpolitischere Verfahren. Notwendig ist nicht weniger, sondern mehr Europa, so unpopulär das heute auch sein mag. “Europa braucht eine Identität, ein Gesicht, etwas Greifbares, mit dem sich die Menschen identifizieren können. Der Euro (und – bei sicheren Außengrenzen - die offenen Grenzen im Schengen-Raum) ist ein wichtiger Teil dieser Identität, aber er reicht nicht aus, um den Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie zusammengehören. Wichtige Schritte, um Europa eine stärkere, sichtbarere Identität zu geben, sind ein stärkeres Europäisches Parlament, mit einer zusätzlichen Kammer für Themen der Euro-Zone, sowie eine gemeinsame Sicherheitspolitik in Europa.“8 Aktuell verlangt es unter anderem die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Großbritannien (Stichwort: Brexit) und die Pflege der deutschfranzösischen Partnerschaft, die am Beginn des europäischen Einigungsprozesses stand. Keine Alternative scheint mir aus vielen politischen Gründen dagegen die Übertragung fiskalischer Kompetenzen auf die europäische Ebene zu sein, das heißt eine Fiskalunion mit einem europäischen Finanzministerium, wie es mehrfach vorgeschlagen wurde.
Der Weg in die aufgezeigte Richtung wird steinig sein. Aber die Zeit drängt, dass wir uns orientieren und uns – realistisch betrachtet wohl mit unterschiedlicher Geschwindigkeit - endlich auf den Weg machen. Aus der neuen Unsicherheit jenseits des Atlantiks, dem Brexit sowie der Euro-und der Flüchtlingskrise erwachsen für die Europäer neue Möglichkeiten – etwa in der Sicherheitspolitik –, die genutzt werden müssen. Nicht zuletzt braucht Europa ökonomische Impulse als Reaktion auf die USA wie auch auf die diversen internen Probleme. Der Weg dazu ist mehr Gemeinsamkeit nicht nur in der Wirtschaftspolitik. So hat sich Europa in einer Schwächephase Ende der 1980er Jahre schon einmal revitalisiert. Am Ende stand der Binnenmarkt und läutete eine neue Wachstumsperiode ein.
60 Jahre nach Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) will ich in diesem Buch die Entwicklung der europäischen Einigung nachzeichnen, an die Antriebskräfte bei der Einführung der gemeinsamen europäischen Währung erinnern und die (gesamt-)wirtschaftlichen Vorteile und Risiken des Euro sowie seine Auswirkungen auf Teilbereiche der Wirtschaft aufzeigen. Zusammengestellt habe ich dabei Vorträge, wie ich sie mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und vor unterschiedlichen Auditorien in der Zeit von Mitte der 1970er Jahre bis zur Jahrtausendwende (der Euro-Bargeldeinführung 2002) gehalten habe. Wiederholungen ließen sich dabei nicht vermeiden; um dem Leser (der Leserin) inhaltlich geschlossene Texte zu präsentieren. Ich hoffe, es entsteht ein Gesamtbild der europäischen Einigung mit der Europäischen Währungsunion (dem Euro) in ihrem Zentrum, das der jungen Generation Mut macht, den “Weg nach Europa“ - die “Idee Europa“, von der Hugo von Hofmannsthal in einem Vortrag in Bern vor jetzt genau hundert Jahren sprach - konsequent weiter zu gehen.
Wolfgang Barth
München, im März 2017
1 Vgl. 25 Jahre Vertrag von Maastricht – Grundstein des geeinten Europa, in: postfrisch 1/2017, Seite 14f.
2 Der Begriff Eurosklerose wird für die Krisenphase der europäischen Integration zwischen 1973 und 1984 verwendet, in der die Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ihre Bestrebungen bei der Öffnung der europäischen Märkte verringerten und teilweise zu einer nationalen Wirtschaftspolitik zurückkehrten.
3 Siehe Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 1998/99, Vor weitreichenden Entscheidungen, Viertes Kapitel: Neue Rahmenbedingungen durch die Europäische Währungsunion, und ders. Jahresgutachten 1997/87, Wachstum, Beschäftigung, Währungsuni on – Orientierungen für die Zukunft, Sechstes Kapitel: IV. Europäische Währungsunion. 1992 waren es 92 Ökonomen und 1998 155 Ökonomen, die gegen den Euro geschrieben haben.
4 Siehe Friedman, Milton, The Euro: Monetary Unity To Political Disunity?, in Project Syndicate, August 18, 1997, zitiert nach Nikolaus Pieper in der Süddeutschen Zeitung vom 17. Juli 2015.
5 Im Spekulativen muss bleiben, ob das Festhalten an nationalen Währungen oder gar die Abschaffung des Euro wirklich die bessere Alternative (gewesen) wäre. Europa hätte möglicherweise nicht weniger Probleme, sondern andere.
6 Presseartikel von Hans-Werner Sinn, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.07.2015, Seite 16.
7 Vgl. Bert Rürup in Handelsblatt Research Institut vom 3. Februar 2017
8 Siehe Fratzscher, Marcel, Eine Steuer für den Euro, in: Süddeutsche Zeitung vom 25. Juli 2015.
I. Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)
Februar 1992
Der Vertrag von Maastricht9
Die Staats- und Regierungschefs der Staaten der Europäischen Gemeinschaft haben bei ihrem
Gipfeltreffen in Maastricht/Holland am 9. und 10. Dezember 1991
mit dem Abschluss zweier Regierungskonferenzen über die Politische Union sowie über die Wirtschaftsund Währungsunion eine
neue Etappe im europäischen Integrationsprozess
eingeleitet. D
ie Ergebnisse hinsichtlich der Politischen Union sind eher enttäuschend, mehr als ein Anfang wurde hier nicht gemacht. Die auf die Schaffung einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion gerichteten Beschlüsse dagegen haben
(vorausgesetzt, sie werden von den nationalen Parlamenten ratifiziert)
weitreichende Bedeutung.
Durch sie ist das Ziel, eine marktorientierte Stabilitätsgemeinschaft innerhalb Europas zu schaffen, klar umrissen, der Weg dorthin eindeutig und unumkehrbar festgelegt.
Der Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion verlief nicht geradlinig, er war geprägt von Erfolgen und Rückschlägen:
1957:
Vertrag von Rom: Schaffung einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mit Ansätzen für eine engere Zusammenarbeit in der Währungspolitik
1971:
Werner-Plan: fehlgeschlagener Stufenplan zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion
1979
Deutsch-französische Initiative: Gründung des Europäischen Währungssystems EWS
1986:
Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte; Schaffung eines europäischen Binnenmarktes zum 1.1.1993
1990:
Eintritt in die erste Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion: Koordinierung der nationalen Wirtschafts- und Währungspolitiken, Intensivierung der Zusammenarbeit im Ausschuss der Zentralbankpräsidenten, Erweiterung des EWS, Fortschritte bei der Liberalisierung des Kapital Verkehrs.
In Maastricht ist jetzt ein detaillierter Fahrplan in Richtung Vollendung der EWWU erstellt worden (siehe dazu die Anlage). Er wird, falls die nationalen Regierungen zustimmen, bisspä testens 1999 die Einfahrt in den “Zielbahnhof Währungsunion“ erzwingen (lediglich Großbritannien hat sich mit einer Freistellungsklausel eine Hintertür offen gelassen und kann der Endstufe der EWWU fernbleiben). Die sich daraus ergebenden Konsequenzen:
Die Währungen der zur Startgruppe der Währungsunion gehörenden Länder sind fortan unabänderlich miteinander verbunden. An die Stelle der nationalen Währungen tritt eine gemeinsame europäische Währung.
Über die Stabilität dieser Währung wacht eine Europäische Zentralbank. Gleichzeitig erlischt die Souveränität der Notenbanken jener Staaten, die an der Währungsunion teilnehmen.
Kritisch zu beurteilen ist, dass man sich beim Vollzug der Währungsunion zeitlich festgelegt hat. In einer so wichtigen Frage wie der der Einführung einer neuen Währung muss Qualität Vorrang vor Geschwindigkeit haben. Um im Bild zu bleiben: ein Fahrplan funktioniert nur, wenn gesichert ist, dass zum vorgegebenen Zeitpunkt die erforderlichen Gleise verlegt und die richtigen Lokomotiven verfügbar sind.
Natürlich muss der, der ein politisch und wirtschaftlich vereintes Europa will, auch den Mut zum Risiko haben. Den D-Mark-Anker zu lichten ist aber nur dann vertretbar, wenn sicher ist, dass die Gemeinschaft nicht politisch oder wirtschaftlich abdriftet.
Um die Stabilität der neuen Währung zu gewährleisten, wurden zwei Sicherungen vereinbart:
Konvergenzkriterien:
Nur jene Länder, die in Bezug auf Preis- und Währungsstabilität, auf Zinshöhe und Haushaltsgebaren die vorgegebenen Bedingungen erfüllen, erhalten auch Zutritt zur Währungsunion. Derzeit erfüllen diese uneingeschränkt nur Frankreich und Luxemburg. Deutschland ist angesichts der Belastungen durch die Wiedervereinigung (hohe Nettoneuverschuldung) nicht ausreichend qualifiziert.
Der von den Konvergenzkriterien ausgehende Druck ist heilsam. Er darf nicht gelockert und auch nicht durch politische Kompromisse - die rechtlich möglich sind - unterlaufen werden. Wer am Tag X die geforderten Voraussetzungen nicht erfüllt, dem muss der Zutritt zur Währungsunion versperrt bleiben. Man kann nur immer wieder darauf hinweisen: Währungsstärke lässt sich nicht verordnen, sie ist das zwangsläufig sich ergebende Resultat vernünftigen Wirtschaftens.
Souveränität der Europäischen Zentralbank:
Das Statut der EZB ist am Statut der Deutschen Bundesbank ausgerichtet und geht hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen sogar noch über das Bundesbankgesetz hinaus. Von entscheidender Bedeutung sind die Festschreibung des Vorrangs der Geldwertstabilität vor allen anderen wirtschaftspolitischen Zielen und die Unabhängigkeit der Leitungsorgane der EZB von politischen Weisungen.
Trotz dieser Sicherungen
ist keineswegs garantiert, dass die künftige EG-Währung auch ebenso stabil ist wie die D-Mark. Größte Bedeutung kommt deshalb der politischen Verankerung der Währungsunion zu.
Aus der Geschichte ist kein Beispiel bekannt, in dem vor einer Währungsunion nicht erst eine politische Union gebildet worden wäre (auch die Vereinigung Deutschlands bildet dabei keine Ausnahme, denn zu Beginn der Währungsunion stand bereits fest, wann und in welcher Form eine politische Union folgen würde).
Eine auf Stabilität gerichtete Politik einer Zentralbank muss zwangsläufig scheitern, wenn sich andere Politikbereiche (insbesondere die Haushaltpolitik) auf Dauer einer Rücksichtnahme auf stabilitätspolitische Erfordernisse entziehen.
Der gerade auch von Deutschland erhobenen Forderung, in den Verträgen von Maastricht zugleich ordnungspolitische Grundlagen festzuschreiben, wurde leider nur unzureichend Rechnung getragen. Wenn man aber die Währungsunion wirtschaftspolitisch absichern will - und das muss man -, dann muss man auch dafür sorgen, dass Wirtschafts- und Währungsunion marktwirtschaftlich, ordnungspolitisch und stabilitätsmäßig eine Einheit bilden.
Die Arbeit in der zweiten Stufe der EWWU sollte dazu benutzt werden, dies in den einzelnen europäischen Ländern sicherzustellen.
Es ist deshalb unbedingt erforderlich, die Vereinbarungen über die Politische Union nachzubessern.
Ein Beschluss über den Eintritt in die Endstufe der EWWU sollte davon abhängig gemacht werden. Große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der
Stärkung des Stabilitätsbewusstseins
der Bevölkerung in Europa zu. Je ausgeprägter dies ist, umso leichter werden unbequeme Maßnahmen der Notenbank akzeptiert, umso geringer ist der Druck auf die Zentralbank, bei ihren Entscheidungen gegen stabilitätspolitische Notwendigkeiten zu verstoßen. Glücklicherweise hat diese Akzeptanz in den meisten EG-Ländern zugenommen.
Wir müssen mit Spannungen in der Gemeinschaft rechnen.
Ungeachtet der Erfüllung von Konvergenzkriterien wäre ein weiterer spannungsfreier Zusammenschluss von Ländern nur dann zu erwarten, wenn diese ein in etwa gleiches Entwicklungs- und Leistungsniveau aufweisen. Das ist in der EG nicht der Fall. Leistungsschwachen Ländern droht beim Eintritt in die Währungsunion vermehrt Arbeitslosigkeit. Einen Wechselkurs, der diese Leistungsunterschiede bis dahin auffangen konnte, gibt es dann nicht mehr. Die Folge sind Wanderungen von Arbeitskräften von den ärmeren in die reicheren Regionen sowie Zahlungen von Transfers in umgekehrte Richtung. Auch wenn letztere nicht allein von Deutschland zu erbringen sind, so werden wir uns hierbei doch auf beträchtliche Forderungen anderer EG-Staaten einstellen müssen.
Fazit: Die Banken befürworten die Schaffung einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ebenso wie die Schaffung einer Politischen Union Europas. Wir brauchen das vereinte Europa, um uns auf wirtschaftlichem Gebiet unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und um den politischen Herausforderungen gerecht werden zu können, die uns unsere Verantwortung für die Welt abverlangt. Wir bezweifeln nicht das anzustrebende Ziel, warnen aber davor, den Weg dorthin unter zu großem Zeitdruck und ohne die notwendige Sorgfalt bei der Vorbereitung zu gehen. Wir könnten sonst Gefahr laufen, dass wir mehr verlieren, als wir zu gewinnen trachten.
Anlage: Die Ergebnisse von Maastricht
Am 9. und 10. Dezember 1991 haben die europäischen Staats-und Regierungschefs in Maastricht
die Verträge zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)
die Grundlinien einer Politischen Union Europas beschlossen.
Zu a: Am 1.1.1994 erfolgt der Eintritt in die 2. Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (die 1. Stufe begann am 1.7.1990 und hat die Verstärkung der wirtschaftlichen und monetären Koordinierung der Politiken der EG-Länder zum Ziel).
Zu Beginn der 2. Stufe wird ein Europäisches Währungsinstitut (EWI) gegründet, dessen Aufgabe die Vorbereitung auf die 3. Stufe (Endstufe) der EWWU ist - konkret: die stabilitätsgerechte Koordinierung der nationalen Währungspolitiken. Das EWI überwacht das Funktionieren des Europäischen Währungssystems, es fördert die Verwendung der ECU, sorgt für einen reibungslosen Zahlungsverkehr innerhalb der EG und leistet technische Vorarbeiten für die spätere Ausgabe von ECU-Banknoten. Es besitzt allerdings keinerlei geldpolitische Kompetenzen.
Der Ausschuss der EG-Notenbankgouverneure und der Europäische Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit werden aufgelöst, das Vermögen des Fonds geht auf das EWI über.
Die Regierungen statten ihre nationalen Notenbanken mit einem Grad an Kompetenz und Souveränität aus, der sich am Standard der Deutschen Bundesbank orientiert.
Die nationalen Notenbanken behalten die uneingeschränkte geldpolitische Zuständigkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese auf die noch zu gründende Europäische Zentralbank (EZB) übergeht. Dies erfolgt mit dem Eintritt in die Endstufe der EWWU.
Der Übergang von der 2. zur 3. Stufe ist zeitlich festgelegt, geschieht allerdings nicht automatisch. Bis Ende 1996 entscheidet der Rat der EG-Staats-und Regierungschefs mit qualifizierter Mehrheit, ob unter Zugrundelegung von vier Konvergenzkriterien (Preis-, Zins-, Währungsstabilität, limitierte Haushaltsdefizite) die notwendigen Voraussetzungen für den Eintritt in die Endstufe bei der Mehrheit der EG-Mitgliedstaaten vorliegen. Ist das der Fall, wird eine Entscheidung über den Zeitpunkt des Eintritts in die Endstufe getroffen.
Wird ein Datum für den Beginn der 3. Stufe nicht bis Ende 1997 beschlossen, beginnt die 3. Stufe am 1.1.1999.
Welche Länder den Übergang 1999 schaffen, wird bis zum 1.7.1998 aufgrund einer erneuten Tauglichkeitsprüfung und anschließender Beschlussfassung durch den Rat der EG-Staatsund Regierungschefs festgestellt. Dabei ist denkbar, dass die EWWU nicht von einer Mehrheit, sondern einer Minderheit der EG-Staaten gebildet wird. Es bleibt ein
Ermessensspielraum,
wonach auch solche EG-Mitglieder, die - gemessen an den Konvergenzkriterien - noch nicht ökonomisch “fit“ sind, der Währungsunion beitreten können.
Eine Ausnahme gilt für Großbritannien: eine Freistellungsklausel (opting out) berechtigt es, der 3. Stufe fernzubleiben. Alle anderen EG-Mitgliedsländer bekennen sich demgegenüber zur Unumkehrbarkeit der stufenweisen Vollendung der EWWU und sichern einen raschen Übergang zur Endstufe zu.
Unmittelbar nach dem Beschluss über den Beginn der 3. Stufe bzw. nach dem 1.7.1998 wird das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) ernannt. Danach werden die Europäische Zentralbank und das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) errichtet, das EWI wird aufgelöst. Das Entscheidungsgremium der EZB setzt sich aus den Mitgliedern des Direktoriums sowie den Gouverneuren der nationalen Zentralbanken zusammen. Letztere bleiben - wenn auch mit eingeschränkten Zuständigkeiten - erhalten und sind nunmehr integraler Bestandteil des ESZB. Sie handeln gemäß den Richtlinien und Weisungen der EZB.
Das Statut der EZB (es ist Teil eines völkerrechtlich verbindlichen Vertrages, der durch einzelne nationale Parlamente nicht mehr geändert werden kann) ist ganz auf das
Ziel der Sicherung des Geldwertes
zugeschnitten.
Dies hat eindeutigen Vorrang vor allen anderen wirtschaftspolitischen Zielsetzungen.
Die Unabhängigkeit der für die Geldpolitik zuständigen Leitungsorgane der Bank wird ebenfalls durch das Statut gewährleistet, Weisungen seitens politischer Instanzen sind ausgeschlossen. Zentralbanken jener Länder, die noch nicht an der Endstufe der EWWU teilnehmen, haben auch keine Mitwirkungsrechte an der Geldpolitik der EZB.
Hinsichtlich der Ablösung der nationalen Währungen zugunsten einer europäischen Einheitswährung ist vorgesehen:
Mit Beginn der Endstufe werden die Umrechnungskurse der nationalen Währungen untereinander und zum ECU unwiderruflich festgeschrieben.
Die ECU wird in den Rang einer eigenständigen Währung erhoben.
Es werden Maßnahmen ergriffen, um die rasche Einführung der ECU als einheitliche Währung sicherzustellen. Für einen gewissen Zeitraum werden die nationalen Währungen und der ECU parallel umlaufen.
Zu b: Mit Blick auf die Schaffung einer Politischen Union einigten sich die EG-Staaten darauf,
eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu betreiben, in der alle wichtigen Entscheidungen auf Einstimmigkeit beruhen sollen;
eine gemeinsame Verteidigungspolitik der westeuropäischen Union anzustreben - in Verbindung mit der NATO, aber ohne eine eigene europäische Armee;
in Einwanderungs- und Polizeiangelegenheiten politisch zusammenzuarbeiten, insbesondere im Kampf gegen Drogen;
die EG-Zuständigkeit auf die Bereiche Industriepolitik, Gesundheit, Ausbildung, Handel, Umwelt, Energie, Kultur, Tourismus und Verbraucherschutz auszudehnen;
die Sozialpolitik einschließlich des Arbeitsrechts in allen EG-Staaten (Ausnahme: Großbritannien) enger aufeinander abzustimmen und einander anzugleichen;
dem Europäischen Parlament zusätzliche Mitspracherechte in einigen EG-Gesetzgebungsbereichen zu geben;
Spanien, Irland, Griechenland und Portugal (die ärmsten Mitglieder der Gemeinschaft) künftig finanziell stärker zu unterstützen.
9 Vortragsgrundriss von Dr. Lutz Wiegand, Mitarbeiter der Abteilung Volkswirtschaft der Bayerischen Vereinsbank AG
II. Europäische Währungsunion (EWU)
1. Gesamtwirtschaftliche Betrachtung
Oktober 2001
Der Euro kommt – die D-Mark geht
In wenigen Wochen - am 1. Januar 2002 - ist es soweit: das Euro-Bargeld hält Einzug in unsere Geldbörsen. Die D-Mark ist dann Geschichte, der Euro bestimmt unser Leben. Die Euro-Bargeldeinführung ist der letzte Schritt zur Verwirklichung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Währungspolitisch gibt es die D-Mark schon seit dem 1. Januar 1999 nicht mehr. Rein formal ist der Umtausch von Banknoten und Münzen Anfang 2002 nur ein technischer Vorgang. An den Finanzmärkten ist der Euro schon längst Realität aber noch nicht greifbar. Bisher gibt es den Euro nur als Buchgeld.
Versorgung mit Bargeld
Die Bevölkerung, der Einzelhandel und die Automatenwirtschaft werden bereits im Dezember 2001 Euro-Banknoten und –Münzen erhalten. (Front Loading mittels sog. Starter-Kits). Banknoten können ab 1.1.2002 über Geldautomaten bezogen werden.Die Euro-Banknoten und –Münzen werden am 1. Januar 2002 in allen EWU-Staaten eingeführt. Die D-Mark verliert dann ihren Status als gesetzliches Zahlungsmittel (juristischer Big Bang).Der Einzelhandel muss ab 1.1.2002 in der Lage sein, Euro entgegenzunehmen und das Wechselgeld in Euro (oder D-Mark) zurückzugeben.Bis (mindestens) zum 28. Februar 2002 werden die Banken und der Einzelhandel (in gewissem Umfang) die D-Mark akzeptieren. Nach diesem Stichtag wird nur noch die Bundesbank D-Mark eintauschen (sog. modifizierte Stichtagsregelung).Die Münzautomaten werden zügig auf Euro umgestellt.Die Euro-Bargeldumstellung bedeutet eine gewaltige logistische Herausforderung: EU-weit werden 14,9 Milliarden Banknoten und 50 Milliarden Münzen produziert. Aneinander gereiht entspricht das einer Strecke zum Mond und zurück (50mal um die Erde). Für Deutschland ist die Ausgabe von insgesamt rund 17 Milliarden Münzen und 4,8 Milliarden Banknoten vorgesehen. Noten und Münzen mit einem Gewicht von 71.500 Tonnen (250 Lastwagen und 3.000 Güterzüge) müssen nicht nur zu den Banken in Europa, sondern auch auf jede der über 250 griechischen Inseln, die französischen, spanischen und portugiesischen Überseegebiete (Martinique, La Réunion, Guadeloupe, Mayotte, St.-Pierre-et-Miquelon, Französisch Guyana, Madeira und die Azoren, Ceuta und Melilla) in der Karibik, im indischen Ozean und in Afrika transportiert werden. Auch im Vatikan, in San Marino, in Monaco und in Andorra wird der Euro eingeführt. Daneben wird es Trittbrettfahrer geben, die den Euro einseitig als Währung einführen (in Mittel- und Osteuropa: in Mazedonien und im Kosovo) oder als Parallelwährung neben der eigenen Währung gelten lassen (Schweiz).
Parallel zur Ausgabe des neuen Geldes müssen in Deutschland rund 2,8 Milliarden DM-Banknoten im Wert von etwa 280 Milliarden DM und 28,5 Milliarden Münzen mit einem Gewicht von 98.500 Tonnen aus dem Verkehr gezogen werden (Aktion “Schlafmünzen“). Alle Noten zusammen würden eine Strecke von 300 km Länge ergeben.
Die Hauptlast dieser Umtauschaktion haben neben der Deutschen Bundesbank vor allem die Banken und der Einzelhandel zu tragen: Insgesamt 20 Milliarden Euro kostet die Währungsumstellung die deutsche Wirtschaft, 3,4 Milliarden Euro entfallen auf die Banken (70.000 DM pro Bankstelle). Transport, Lagerung, Versicherung, Umstellung von Geldausgabeautomaten und Zählmaschinen, Änderung der Belege, Qualifikation der Mitarbeiter usw. müssen bewältigt werden.
Fahrplan zu Euro-Bargeld-Einführung
Dezember 1996Entwürfe der Euro-Geldscheine werden der Offentlichkeit vorgestelltSommer 1997EU-Rat entscheidet über die Gestaltung der Euro-MünzenFrühjahr 1999EZB legt technische Ausstattung der Banknoten festJuli 1999Serienproduktion der Euro-Bankkonten beginntab Frühjahr 2001vorzeitige Rückgabe gehorteter Münzen über Banken und LZBen zur Entzerrung des Münzrückflusses Ermittlung des Bargeldbedarfs der UnternehmenHerbst 2001Frontloadimg: Abgabe von Euro-Banknoten und -Münzen an Banken, Handel, Automatenindustrie, Werttransportunternehmen u.a. Vorversorgung der Unternehmen durch die Banken Verkauf der Starter-Kids in den Bankfilialen Umstellung der Geldausgabeautomaten17. Dezember 2001gebührenfreie Abgabe der Starter-Kids (Münzhaushaitsmischungen) á 20 Münzen im Wert von 10,23 Euro (20 DM) über die Banken1. Januar 20002Euro löst die D-Mark als alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel ab laufende Versorgung des Einzelhandels mit Bargeld laufende Entsorgung der DM-Münzen und Noten1.1. - 28.2.2002Übergangszeit: Barzahlungen sowohl in D-Mark als auch in Euro, Banken und Bundesbank tauschen DM-Bargeld in Euro um28. Februar 2002Ende des Bargeldumtausches durch Bankenab März 2002Bundesbank tauscht auf D-Mark lautende Banknoten und Münzen weiterhin unbefristet, unbegrenzt und unentgeltlich in Euro umEuro-Umrechnungskurse – gültig ab 1.1.1999
Deutschland1€DEM (Deutsche Mark)Belgien1€BEF (Belgische Franc)Finnland1€FIM (Finnmark)Frankreich1€FRF (Französischer Franc)Irland1€IEP (Irisches Pfund)Italien1€ITL (Italienische Lira)Luxemburg1€LUX (Luxemburgische Franc)Niederlande1€NLG (Niederländische Gulden)Österreich1€ATS (Österreichische Schilling)Portugal1€PTE (Portugiesische Escudos)Spanien1€ESP (Spanische Peseta)November 2000
Vorbereitung auf die Euro-Bargeldeinführung
Mit dem Näherrücken der Euro-Bargeldeinführung am 1.1.2002 lebt die Diskussion, ob der Euro Segen oder Fluch für die Bürger und die Wirtschaft ist, erneut auf. Umfragen in Deutschland ergeben, dass die Bevölkerung die gemeinsame europäische Währung mehrheitlich ablehnt. Die Deutschen sind seit jeher mehr als die Bürger anderer Staaten Euro-Skeptiker. Sie haben auch mehr zu verlieren – nämlich eine der weltweit wertbeständigsten Währungen. Nach ihrem Gefühl verlieren die Deutschen mit der D-Mark eine der drei Säulen – die beiden anderen sind die demokratische Verfassung und die soziale Marktwirtschaft – auf denen nach dem zweiten Weltkrieg hoher Wohlstand, politische Stabilität und internationale Anerkennung entstehen konnten. Die Ablehnung ist außerdem zu verstehen als Folge von zwei gigantischen Währungsvernichtungen in den Jahren 1923 und 1948.
Die Ablehnung beruht zu einem Gutteil aber sicher auch auf der jüngsten Kursentwicklung des Euro an den Devisenmärkten. Seit seinem Start Anfang 1999 hat der Euro gegenüber dem US-Dollar rund 30% an Wert verloren (siehe “Erste Erfahrungen mit dem Euro“, Seite 24). Wie ist das zu verstehen? Hierfür gibt es meines Erachtens einen realen, einen psychologischen und einen politischen Grund.
Der reale Grund liegt darin, dass Euroland (mit 3,5%) bisher noch viel langsamer wächst als Amerika (+5%). So lange diese Wachstumsdifferenz bleibt, wird sich der Euro kaum erholen können.
Der psychologische Grund: Der Euro hat bis jetzt nicht die Vertrauensbasis gefunden, die er verdient. Der Devisenmarkt nimmt nur noch die schlechten Nachrichten wahr, die guten werden ignoriert. Das führt dazu, dass sich die (negativen) Erwartungen immer wieder selbst bestätigen – die Dollarstärke nährt sich aus der Dollarstärke (die Euro-Schwäche aus der Euro-Schwäche).
Politisch schließlich sind die Europäer eine Gruppe von 11 oder 15 Staaten ohne einheitliches Auftreten. Die nationalen Wirtschaftspolitiken laufen weiterhin unkoordiniert nebeneinander her (und auch die steuerpolitischen Strategien weichen deutlich voneinander ab).
Solange dies der Fall ist, wird der Euro dem Dollar nicht Paroli bieten können. Vertrauen nach innen wie nach außen kann für den Euro nur durch vernünftige Wirtschaftspolitik und einen klaren Wachstumskurs gewonnen werden. Ich glaube zwar, dass die gegenwärtige Euro-Abwertung übertrieben ist und es eine Erholung geben kann. Der Abwärtstrend ist jedoch noch nicht gebrochen. Das wird erst dann der Fall sein, wenn sich Europa politisch stärker zusammenfindet.
Darüber sollte man jedoch nicht die Erfolge des Euro vergessen, (die zu einer fairen Sicht dazu gehören). Denn insgesamt ist sein Start gut gelungen:
Die technische Umstellung der zehn nationalen Währungen auf den Euro (in den Banken und dem Europäischen System der Zentralbanken - ESZB) verlief reibungslos. Am 31.12.1998 wurden die Umrechnungskurse zwischen den Währungen der elf Teilnehmerländer und der neuen Gemeinschaftswährung “unwiderruflich“ festgelegt.
An den Finanzmärkten ist der Euro die gängige Währung. Die Impulse durch den Euro wurden dort bereits in strukturelle Verbesserungen und eine Stärkung des Finanzplatzes Deutschland umgemünzt. Der deutsche Finanzplatz, der lange Zeit im Schatten anderer Plätze wie London und Paris stand, nimmt heute innerhalb Eurolands den ersten Platz ein. Die europäischen Börsen rücken immer mehr zusammen.
Die innere Stärke des Euro, die eine wesentliche Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg des neuen Währungsgebiets ist, blieb (bislang) unangetastet, denn die Inflationsrate in Euroland ist sehr gering. Die Europäische Zentralbank (und vorher die Notenbanken der EWU-Teilnehmerländer) haben bei der Stabilisierung der inneren Kaufkraft des Euro - unterstützt freilich durch den weltweiten Prozess der Disinflation während der letzten Jahre -hervorragende Arbeit geleistet. Bei der Preisentwicklung erwarten wir auch für die nächste Zukunft keine Trendwende.
Dementsprechend sind die Zinsen nach wie vor in der Nähe ihrer erst im Januar 1999, also im Euro-Zeitalter, erreichten historischen Tiefststände und deutlich niedriger als die amerikanischen.
Und, last but not least, wird das geldpolitische Instrumentarium, das für alle Länder mehr oder weniger neu gewesen ist, heute mit einer verblüffenden Selbstverständlichkeit angewandt.
Die privaten Banken und die Wirtschaft in Deutschland haben die Errichtung der Europäischen Währungsunion (EWU) von Anfang an unterstützt, (und zwar obwohl sie zunächst erhebliche zusätzliche Aufwendungen hatten und beträchtliche Ertragsausfälle hinnehmen müssen.) Sie sehen darin einen wichtigen Schritt auf dem Weg der europäischen Integration, und sie erwarten gesamtwirtschaftliche Vorteile, die letztlich allen zugutekommen. Die deutsche Wirtschaft wird vom Euro besonders profitieren, weil unsere Unternehmen jetzt bessere Rahmenbedingungen im wichtigen Exportgeschäft haben werden. Aber auch die Menschen werden aus dem Euro Nutzen ziehen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur
an den Wegfall der Umtauschgebühren bei den jährlichen Urlaubsreisen (allerdings erst nach Einführung des Euro-Bargeldes),
an den größeren und attraktiveren Kapitalmarkt mit neuen Finanzierungsformen und der Aussicht auf langfristig niedrige Zinsen
und an den verschärften Wettbewerb zwischen inländischen und ausländischen Anbietern zugunsten der Verbraucher.
Bei der Beurteilung des Für und Wider der Währungsunion gehen wir dabei durchaus nicht blauäugig ans Werk. Wir sehen die Vorteile, wir verlieren aber auch die Risiken nicht aus dem Auge. (siehe “Pro und Contra“, Seite 60)
Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ist eine wichtige Etappe auf dem langen und mühevollen Weg zur europäischen Einheit. Ihren Ursprung hatte die Europa-Idee schon bald nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals standen ökonomische Gründe erst an zweiter Stelle. Vorrang hatte der Gedanke der Versöhnung ehemals verfeindeter Staaten. Ein entscheidender Schritt vorwärts gelang 1987 mit der “Einheitlichen Europäischen Akte“, die den Weg zur Verwirklichung des “Europäischen Binnenmarktes“ 1993 ebnete. Er brachte die völlige Freizügigkeit von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital.
1992 folgte der “Vertrag über die Europäische Union“ (Maastrichter Vertrag), dessen wichtigster Bestandteil die Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. In der EWWU wurden die nationalen Währungen durch eine gemeinsame Europawährung (den Euro) ersetzt. Auch die Geldpolitik wurde vergemeinschaftet, das heißt, sie wird nicht mehr von den nationalen Notenbanken, sondern von der neuen Europäischen Zentralbank, die dem Modell der Bundesbank nachgebildet ist, betrieben. ...
Juni 1999
Erste Erfahrungen mit dem Euro
Der Geburtstag des Euro wurde von den Finanzmärkten mit einem Kursfeuerwerk gefeiert. Am Devisenmarkt wertete er sich am ersten Handelstag, dem 4. Januar 1999, auf über 1,18 US-Dollar je Euro auf; die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sank auf neue Rekordtiefs, und der Euro Stocks 50 Aktienindex europäischer “Blue Chips“ stieg innerhalb von drei Tagen um mehr als 10% gegenüber dem letzten Handelstag des Jahres 1998. Auf die Party der ersten Januarwoche folgte dann jedoch der Kater. Gegenüber allen wichtigen Währungen verlor das Europa-Geld seither an Wert: bis zu 13% gegenüber dem Dollar (auf unter 1,03 US-Dollar je Euro am 8. Juni), 10% zum englischen Pfund und immerhin 7% zum krisengeschüttelten Yen. Die Gründe dafür sind vor allem die starke Konjunktur in den USA, aber auch die enttäuschten Erwartungen der Investoren bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung und vor allem der wirtschaftspolitischen Reformbereitschaft in Europa.
Die Sorge um die Stabilität des Euro hat vor diesem Hintergrund zugenommen, zumal eine nachhaltige Stärkung des Euro-Kurses kurzfristig nicht sehr wahrscheinlich ist. (Sogar ein Verhältnis von 1 Euro zu 1 US-Dollar ist auf kurze Sicht denkbar.) Die unmittelbare Konsequenz für die Bürger Eurolands ist, dass Reisen ins Ausland, insbesondere in die USA teurer werden. Darüber sollte man jedoch nicht die positiven Seiten des Euro vergessen. Denn insgesamt ist sein Start gut gelungen:
Der Start der Währungsunion ist insgesamt gut gelungen:
technische Umstellung,Akzeptanz an den Finanzmärkten,geldpolitisches Instrumentarium effektiv,innere Stärke / Stabilität des Euro.Enttäuscht hat die Kursentwicklung. Die Gründe sind wirtschaftlicher, psychologischer und politischer Natur.
Die
technische Umstellung
der zehn nationalen Währungen auf den Euro verlief reibungslos. Am 31.12.1998 wurden die Umrechnungskurse zwischen den Währungen der elf Teilnehmerländer und der neuen Gemeinschaftswährung “unwiderruflich“ festgelegt. An die Renomination waren europaweit 50.000 Personen beteiligt und obwohl nur fünf Handelstage zwischen dem Beginn des letzten Handelstages in den nationalen Währungen (am 31.12.1998) und dem ersten Geschäftsabschluss in Euro (am 4.1.1999) lagen, verlief die Umstellung in den Banken und dem europäischen System der Zentralbanken (ESZB) reibungslos.
An den
Finanzmärkten
ist der Euro die gängige Währung. Die Impulse durch den Euro wurden dort bereits in strukturelle Verbesserungen und eine Stärkung des Finanzplatzes Deutschland umgemünzt. So hat der Euro seinen Marktanteil als internationale Emissionswährung für Anleihen deutlich gesteigert (und dem US-Dollar den Rang als führende internationale Emissionswährung sogar zeitweise abgelaufen.) Vor allem der deutsche Pfandbrief (und Unternehmensanleihen, die in Deutschland bislang im Dornröschenschlaf lagen,) haben Boden gutgemacht. Der deutsche Finanzplatz, der lange Zeit im Schatten anderer Plätze wie London und Paris stand, nimmt heute innerhalb Eurolands den ersten Platz ein. Die europäischen Börsen rücken – unter Führung Frankfurts - immer mehr zusammen.
Euro: Konkurrent für den Dollar
Der Euro hat gute Voraussetzungen, international eine attraktive Währung zu werden. Hinter ihm stehen eine starke Wirtschaft: Das BIP von Euroland ist (nach den USA) das zweitgrößte der Welt. Die Euroland-Exporte sind größer als die der USA.ein großer Kapitalmarkt: Der Euro-Kapitalmarkt löst elf fragmentierte nationale Kapitalmärkte ab und ist sowohl bei Renten als auch bei Aktien nach den USA die Nr. 2 in der Welt.verlässliche Rahmenbedingungen für stabile Preise: Die EZB, die nach dem Muster der Deutschen Bundesbank konzipiert wurde, ist institutionell gut abgesichert. An der inneren Stabilität des Euro gibt es keinen Zweifel.Der Euro schafft einen neuen Währungsraum, der in Größe und Bedeutung dem US-Dollar - mittelfristig gleichkommt.Die
innere Stärke des Euro,
die eine wesentliche Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg des neuen Währungsgebiets ist, blieb (bislang) unangetastet, denn die Inflationsrate in Euroland ist sehr gering. Die Europäische Zentralbank (und vorher die Notenbanken der EWU-Teilnehmerländer) haben bei der Stabilisierung der inneren Kaufkraft des Euro - unterstützt freilich durch den weltweiten Prozess der Disinflation während der letzten Jahre -hervorragende Arbeit geleistet. Bei der Preisentwicklung erwarten wir auch für die nächste Zukunft keine Trendwende.
Dementsprechend sind die
Zinsen
nach wie vor in der Nähe ihrer erst im Januar 1999, also im Euro-Zeitalter, erreichten historischen Tiefststände und deutlich niedriger als die amerikanischen. Und, last but not least, wird das geldpolitische Instrumentarium, das für alle Länder mehr oder minder neu gewesen ist, heute mit einer verblüffenden Selbstverständlichkeit angewandt.
Demgegenüber haben sich die Hoffnungen auf einen spürbaren und nachhaltigen Impuls zur Steigerung des Wachstums und der Verringerung der hohen Arbeitslosenraten durch den Euro bislang nicht erfüllt. Auch das von einigen verwandte Argument, dass der Euro-Dollar-Kurs weniger schwanken würde als früher der DM-Dollar-Kurs war zu optimistisch. Die Gründe dafür liegen meines Erachtens auf der Hand: Die wirtschaftspolitischen Akteure – nicht zuletzt jene in Deutschland - haben offensichtlich die Notwendigkeit der für dynamisches Wachstum erforderlichen Verbesserung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen (insbesondere in der Steuer-, Arbeitsmarkt- und Ordnungspolitik) noch nicht erkannt oder jedenfalls nicht in die Tat umgesetzt. Der verschärfte Wettbewerb der Systeme innerhalb der EWU verlangt, dass die Wirtschaftspolitiken der Teilnehmerstaaten auf Strukturreformen - vorrangig der Finanz- und Steuerpolitik, der Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik – gerichtet werden, die ein hohes Wachstum von Produktion und Beschäftigung ermöglichen. Das heißt es verlangt eine “offensive Antwort“ auf die Erhöhung des Wettbewerbsdrucks drucks durch die Schaffung eines einheitlichen Währungsraums. Sonst werden wir auch weiterhin vergeblich auf eine wirkliche “Euro-Dividende“ für die Konjunktur warten.
EWU: Geglückter Start
Die Europäische Währungsunion (EWU) startete am 1.1.1999 mit Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Holland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal und Spanien.Die Wechselkurse der zehn beteiligten Währungen wurden – untereinander und zum Euro – unwiderruflich festgelegt.Die Geldpolitik ging von den nationalen Zentralbanken zur Europäischen Zentralbank (EZB) über. Ihre Hauptaufgabe ich die Wahrung der Preisstabilität.Die Finanzmärkte im Euro-Währungsgebiet sind enger zusammen gewachsen.Das Euro-Währungsgebiet ist als einheitlicher Wirtschaftsraum ins öffentliche Bewusstsein gerückt und zu einem stabilen Pol in der Weltwirtschaft geworden.Der Stabilitätspakt begrenzt die Verschuldungsspielräume und entlastet die GeldpolitikApril 1999
Versprochen – gehalten: Deutschland und der Euro
Vorweg meinen herzlichen Dank für die freundlichen Worte zu meiner Begrüßung. Es hat mich gefreut, dass Sie mich als Referent zu Ihrem diesjährigen Symposium eingeladen haben, in dem Sie sich mit Identitätsfragen im neuen Jahrtausend auseinandersetzen. Eine solche Identitätsfrage ist zweifellos auch die Europäische Währungsunion (EWU), die am 1. Januar 1999 - nach einer zehnjährigen, dornigen Vorbereitungszeit (Vorlage des Delorsplans im Frühjahr 1989) – begonnen hat und die für uns alle - vor allem natürlich für die junge Generation - große Bedeutung hat.
Der Euro ist das ehrgeizigste und am weitesten in die Zukunft reichende europäische Integrationsvorhaben. Er könnte, wie ich noch genauer ausführen werde, zum Kristallisationskern für eine europäische Identität im nächsten Jahrhundert werden, die es auch nach 75jähriger paneuropäischer Bewegung noch immer nicht gibt. Er wird alle Lebensbereiche umkrempeln. Denken Sie an die vielen praktischen Fragen im täglichen Umgang mit dem neuen Geld, an Ihre persönliche Vermögensbildung oder an Ihre Altersvorsorge. Denken Sie aber vor allem auch an die enormen Chancen, die nicht zu unterschätzenden Risiken, aber auch an die großen Herausforderungen, die das “Abenteuer Währungsunion“ für die Wirtschaft mit sich bringt. Die gemeinsame Währung setzt den Rahmen für unternehmerisches Handeln, für die Unternehmensfinanzierung, vor allem aber für den globalen Wettbewerb der Unternehmen, völlig neu. Das ist ein Thema, das uns in der Wirtschaft täglich aufs Neue beschäftigt und das einen gesonderten Vortrag erfordern würde. Ich will davon absehen und mich auf einige grundsätzliche - wirtschaftliche und politische -Überlegungen beschränken.
Zunächst ein Blick in die lange Zeit der Vorbereitung: Was war es, was Männer wie Jacques Delors, Franois Mitterrand und Helmut Kohl (und vor ihnen Robert Schumann, Konrad Adenauer, Jean Monnet und Alcide De Gasperi, die Architekten Europas) motivierte, alle Energien zu mobilisieren, alle Widerstände zu überwinden, um das europäische Integrationsvorhaben ins Werk zu setzen? Ihnen ging es vor allem um die Sicherung einer festen Friedensordnung in Europa. Diese Frage gewann besondere Aktualität mit der deutschen Wiedervereinigung. (Erst an zweiter Stelle standen ökonomische Motive. Ein entscheidender Schritt vorwärts gelang in diesem Zusammenhang 1987 mit der “Einheitlichen Europäischen Akte“, die den Weg zur Verwirklichung des “Europäischen Binnenmarktes“ 1993 ebnete. Er brachte die völlige Freizügigkeit von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital.) Für den Euro gaben darüber hinaus folgende drei Beweggründe den Ausschlag:
die Überwindung der europäischen Kleinstaaterei im Zeitalter der Globalisierung,
die Schaffung einer Stabilitätsgemeinschaft in ganz Europa (und nicht nur in Deutschland) als Grundlage einer zukunftsorientierten Gesellschaftsordnung und schließlich
(quasi als Voraussetzung zur Erreichung der beiden vorgenannten Ziele) ein bestmöglicher Start der neuen Währung.
Was ist von diesen Versprechen gehalten worden? Und was muss noch getan werden?
Zum ersten: Der Überwindung der Kleinstaaterei sind wir ein gutes Stück näher gekommen. Mit dem Start der EWU entstand ein Wirtschaftsraum mit gemeinsamer Währung, der von Sizilien bis Lappland, von der Oder bis zur Mündung des Tejo reicht. Der Markt in einheitlicher Währung hat sich für unsere Wirtschaft verdreifacht. Er nimmt mit einem Inlandsprodukt von annähernd 5,2 Billionen Euro (= 16% des weltweiten BIP) nach den USA (20%) und noch vor Japan Platz zwei in der Welt ein. Gemessen an der Zahl von rund 290 Millionen Verbrauchern gegenüber 270 Millionen und einem Exportvolumen von 750 Milliarden Euro gegenüber 600 Milliarden rangiert die EWU aber noch vor den USA. Europa (weist nun ein Währungsgebiet auf, das an Größe, Einwohnerzahl und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit den Vergleich mit den USA nicht mehr zu scheuen braucht. Es) hat jetzt die Basis, um sich dem internationalen Wettbewerb zu stellen. (Die Unternehmen in Euroland können auf einen größeren Heimatmarkt zurückgreifen als ihre amerikanischen Konkurrenten. Das eröffnet ihnen nicht nur Produktionsvorteile, sogenannte economies of scale, sondern auch neue Möglichkeiten bei der Produktentwicklung und -Vermarktung. Allerdings: Der Europäische Binnenmarkt wird durch die gemeinsame Währung auch für ausländische Investoren, die sich bisher eher zurückhielten, attraktiver werden - mit der Konsequenz eines erheblich schärferen Wettbewerbs.)
Noch wichtiger ist, dass Euroland auf Erweiterung angelegt und dadurch immer unempfindlicher gegenüber Störungen von außen wird. Die EU-Mitglieder Dänemark, Griechenland, Großbritannien und Schweden sind noch “Outs“. Teilweise haben sie aber schon Beitrittsabsichten erkennen lassen. Das ließe das (Brutto-)Inlandsprodukt der Währungsunion auf das gleiche Niveau wie das der USA steigen; das Handelsvolumen Eurolands überflügelt schon jetzt das der USA. (Die Exportquote, der Anteil der Exporte am Inlandsprodukt, einer auf 15 Mitglieder erweiterten EWU würde nur noch 7% betragen. Sie wäre nur halb so groß wie die der jetzigen EWU, die mit knapp 14% auch nur noch die Hälfte der deutschen Exportquote (von 28%) ausmacht und der geringen Auslandsabhängigkeit der USA von 10% schon recht nahe kommt; bei Erweiterung ihres Teilnehmerkreises auf alle EU-Länder wird sie diese sogar noch übertreffen. Der Außenhandelsüberschuss der EWU-Länder ist seit 1992 stetig gestiegen. Auch die gemeinsame Leistungsbilanz schreibt per Saldo schwarze Zahlen.) Währungsrisiken (wie zuletzt die Asienkrise) tangieren uns schon jetzt weniger als früher, weil 40% unseres Außenhandels zu Binnenhandel in gemeinsamer Währung geworden sind, also ohne Kursabsicherung auskommen. Dieser Anteil wird bei Erweiterung der EWU von 11 auf 15 Teilnehmer auf über 55% steigen.
Zweites Anliegen: Die D-Mark, eine der stabilsten Währungen der Welt und bisher Anker der Stabilität in Europa, ist in der neuen Stabilitätsgemeinschaft des Euro aufgegangen. Ich bin zuversichtlich, dass die neue Währung genauso wertbeständig sein wird wie die alte. Denn zum einen ist die europäische Stabilitätspolitik institutionell gut abgesichert – die Europäische Zentralbank (EZB) ist von Weisungen der Exekutive unabhängig, darf keine staatlichen Defizite finanzieren, und sie hat einen strikten Stabilitätsauftrag - und zum anderen ist die Stabilitätskultur in Europa heute fester verwurzelt als früher. (Während die Inflationsrate 1980 im EU-Durchschnitt noch bei 14% lag, ist sie inzwischen - unterstützt freilich durch den weltweiten Prozess der Disinflation während der letzten Jahre - auf unter 1% zurückgegangen. In Europa muss man schon bis in die Mitte der 60er Jahre zurückgehen, um auf eine Ära vergleichbarer Geldwertstabilität zu stoßen. Kapitalmärkte, die kaum noch Risikozuschläge bei den Zinsen einkalkulieren, und langfristige Kapitalmarktzinsen auf historischen Tiefstständen unterstreichen, dass auch für die Zukunft nicht mit deutlich höheren Teuerungsraten gerechnet wird. Dafür garantiert (neben den disinflationären Effekten der Globalisierung nicht zuletzt auch) der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der der finanzpolitischen Hoheit der nationalen Parlamente - genauer: ihrer in der Demokratie kaum zu bremsenden Ausgabenfreude - enge Zügel anlegt.
Ein stabiles Geldwesen ist eine wesentliche Voraussetzung für Berechenbarkeit und Fairness in der Wirtschaft. Es reduziert die Transaktionskosten und verbessert die Allokation der Ressourcen, also die Wanderung der Produktionsfaktoren an den Ort ihrer größten Leistungsfähigkeit. Die Märkte, die diese Wanderung organisieren, sind die Kapitalmärkte, die in der EWU die zweitgrößten der Welt sind. (Der neue Rentenmarkt ist mit über 4 Billionen Euro zweieinhalbmal so groß wie der deutsche, aber immer noch um mehr als die Hälfte kleiner als der amerikanische. Beim gemeinsamen Aktienmarkt beträgt die Marktkapitalisierung 2 3/4 Billionen Euro. Damit ist er mehr als dreieinhalbmal so groß wie der deutsche, erreicht aber nur ein Viertel der amerikanischen Marktkapitalisierung. Der Rückstand der EWU gegenüber den USA ist hier also gravierender als beim Rentenmarkt.) Aber auch hier erwarte ich eine Aufholjagd (gegenüber den USA) durch die Privatisierungspolitik der EU-Staaten, die verstärkte Unternehmensfinanzierung über die Börse, andererseits durch die steigende Aktiennachfrage zur Altersvorsorge als Ergänzung der desolaten kollektiven Rentensysteme.
(Durch den größeren Wettbewerb, die sinkenden Emissionskosten und die Beseitigung der Währungsrisiken wird der gemeinsame Kapitalmarkt wesentlich transparenter, liquider und größer als die bisher getrennten nationalen Märkte: Die Finanzierungsmöglichkeiten für die Unternehmen werden dadurch größer, den Investoren am Kapitalmarkt werden sich zusätzliche Anlagealternativen erschließen, und auch die Attraktivität für Anlagekapital aus Drittländern wird zunehmen. Das machte sich schon in den ersten 100 Tagen der neuen Währung bemerkbar. Der Euro hat seinen Marktanteil als internationale Emissionswährung für Anleihen deutlich gesteigert; anfangs konnte der US-Dollar sogar überflügelt werden.)
Leistungsfähige Kapitalmärkte sind im Übrigen eine Voraussetzung, dass der Euro auch als internationale Währung reüssiert. Durch die Einführung des Euro entsteht dem Dollar ein Rivale, der - wenn auch nicht “über Nacht“ - eine vergleichbare Stellung als internationale Anlage-, Handelsund Reservewährung einnehmen kann. Eine wesentliche Voraussetzung ist allerdings, dass die nationalen Wirtschaftspolitiker in Euroland den durch die Globalisierung entstehenden Wettbewerbsdruck in Reformen umsetzen, um die Wachstumskräfte zu entfesseln. Diesbezüglich haben sich die Erwartungen bislang allerdings nicht erfüllt. Dies zeigt sich zum Beispiel an den insgesamt enttäuschenden Fortschritten bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen, vor allem in den großen EWU-Staaten. (Da sich eine wirklich reformorientierte, wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik zumindest in den großen Euroländern nur allmählich durchsetzen kann, wird sich (nach einer merklichen Abschwächung im laufenden Jahr) daher auch 2000 in Europa aller Voraussicht nach noch kein kräftiges Wirtschaftswachstum herausbilden. Nach den insgesamt enttäuschenden ersten Schritten der neuen deutschen Bundesregierung und den ausbleibenden Strukturreformen - vor allem zur Flexibilisierung des Arbeitsmarkts - dürfte auch bei uns die “Euro-Dividende“ später anfallen als ursprünglich erwartet oder sogar ganz ausbleiben.)
(Hoffnungen auf einen spürbaren und nachhaltigen Impuls zur Steigerung des Wachstums und zur Verringerung der hohen Arbeitslosenraten durch den Euro wurden bislang nicht erfüllt. (Ein rascher und deutlicher Wachstumsschub durch die Euro-Einführung war freilich auch nicht zu erwarten. Bereits im Vorfeld der EWU profitierten die Euro-Teilnehmer durch niedrigere Zinsen und größere innereuropäische Wechselkursstabilität.) Die wirtschaftspolitischen Akteure in Euro-Land haben bisher den Regimewechsel, den die Gemeinschaftswährung mit sich bringt, offenbar noch nicht richtig erkannt. Der Euro reduziert die wirtschaftspolitischen Freiheitsgrade - etwa in der nationalen Währungs- und Finanzpolitik -, erhöht die Preis- und Kostentransparenz in Euro-Land bei gleichzeitiger Eliminierung der Wechselkursrisiken grenzüberschreitender Engagements und verschärft so den Wettbewerb der Systeme innerhalb der EWU. Die wichtigste potenzielle Quelle von EWU-bedingten Wachstumsgewinnen sprudelte bislang allenfalls spärlich: Verbesserungen der Angebotsbedingungen als “offensive Antwort“ auf die Erhöhung des Wettbewerbsdrucks durch die Schaffung eines einheitlichen Währungsraums. Hierfür ist ausschlaggebend, dass die Wirtschaftspolitik der Teilnehmerstaaten auf Strukturreformen - vorrangig der Finanz-und Steuerpolitik, der Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik - gerichtet werden, die ein hohes Wachstum von Produktion und Beschäftigung ermöglichen. Sonst werden wir auch weiterhin vergeblich auf die “Euro-Dividende“ für die Konjunktur warten.)
Drittens: Erreicht wurde schließlich auch ein guter Start des Euro. Den Boden für die neue Währung hat in den letzten Jahren der harte Konsolidierungskurs der Teilnehmerländer zur Erfüllung der Maastricht-Kriterien bereitet. (Nicht alle EU-Länder gehören bekanntlich von Anfang an der EWU an. Voraussetzung dafür war die Einhaltung der Konvergenzkriterien - ein hoher Grad an Preisstabilität, eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, die Konvergenz der langfristigen Zinsen und ein stabiler Außenwert der Währung - mittels derer sichergestellt werden sollte, dass sich nur die Länder zu einer gemeinsamen Währung zusammenschließen, die ihre Wirtschaftspolitik harmonisieren und einen hohen Grad an Stabilität erreicht haben. Im Vorfeld wurde über die Einhaltung der Kriterien bekanntlich heftig gestritten. Letztlich wurde die Qualifikation der Kandidaten jedoch weder vom Europäischen Währungsinstitut, dem Vorläufer der Europäischen Zentralbank, noch von der Deutschen Bundesbank in Abrede gestellt.
Die Eintnttsbillets sind jedoch kein Freifahrschein. In den meisten EWU-Ländern bedarf es noch großer Anstrengungen, um die erreichten Stabilitätserfolge auf Dauer zu sichern. Vor allem die Haushaltsdefizite sind in den meisten Ländern noch zu hoch, um der Fiskalpolitik unter dem Stabilitäts- und Wachstumspakt Spielraum bei konjunkturellen Einbrüchen zu geben. Nachdem die Eintrittsbarrieren für die Währungsunion überwunden waren, sind die finanzpolitischen Zügel in einigen Teilnehmerländern sogar wieder lockerer gehalten worden, wie die EZB in ihrem ersten Monatsbericht beklagt hat. Dem muss Einhalt geboten werden. Denn die Kriterien dürfen nicht nur als Preis für den Eintritt verstanden werden. Vielmehr ist ihre Erfüllung auf Dauer unerlässlich. (Zwar unterschreiten derzeit die EWU-Teilnehmerländer die Maastricht-Grenze von 3% des BIP für das Haushaltsdefizit; vom eigentlichen Ziel (das auch im Stabilitäts- und Wachstumspakt formuliert wird), einem ausgeglichenen Haushalt, der sicheren Spielraum für die Abfederung konjunktureller “Schlechtwetterperioden“ bietet, sind sie insgesamt jedoch noch weit entfernt. Die kleinen Länder Finnland und Irland schneiden dabei noch deutlich besser ab als die großen Länder Deutschland, Italien und Frankreich.)
In diesem Zusammenhang kommt dem schon erwähnten Stabilitäts- und Wachstumspakt eine große Bedeutung zu. Denn nur wenn die Konvergenzkriterien dauerhaft eingehalten werden, (wenn ein Land, das die Stabilitätskriterien bei Eintritt noch erfüllt hat, anschließend nicht in eine undisziplinierte, die Stabilität der gesamten Währung gefährdende Wirtschaftspolitik zurückfällt,) kann die Währungsunion gelingen. (Unbestreitbare gesamtwirtschaftliche Vorteile, die letztlich allen, der exportabhängigen deutschen Wirtschaft und den Verbrauchern, zugutekommen, sind dann insbesondere
die Einsparung von Transaktions- und Umrechnungskosten,
der Wegfall des Währungsrisikos im Außenhandel, vor allem bei grenzüberschreitenden Investitionen,
die Schaffung eines großen, liquiden Kapitalmarkts in Europa mit neuen Finanzierungsformen und der Aussicht auf langfristig niedrige Zinsen,
der verschärfte Wettbewerb zwischen inländischen und ausländischen Anbietern zugunsten der Verbraucher,
die economies of scale
und all die anderen positiven Einflüsse des Euro.
Natürlich muss man neben den Chancen auch die Risiken sehen:
die Gefährdung der Preisniveaustabilität (durch stabilitätswidriges Verhalten einzelner Teilnehmerstaaten oder durch einen Missbrauch der Geldpolitik für andere als stabilitätspolitische Zwecke),
den Wegfall des Wechselkursinstruments zur Anpassung divergierender konjunktureller oder struktureller Entwicklungen in den EU-Mitgliedstaaten und
das “Hineingleiten“ in einen umfassenden europaweiten Finanztransfer, der über das schon jetzt vorhandene Niveau hinausginge und vorrangig die stabilitätsorientierten Länder belasten würde.
Meines Erachtens überwiegen die Vorteile jedoch bei weitem - vorausgesetzt wir - und damit meine ich in erster Linie die Wirtschaftspolitik und die Tarifpartner - nehmen die Herausforderungen an, die die neue Euro-Welt zweifellos mit sich bringen wird. (Ich komme darauf gleich noch einmal zurück.)
Gut für den reibungslosen Start des Euro war auch die Berufung anerkannter und in ihrer Stabilitätsorientierung unumstrittener Persönlichkeiten an die Spitze und in das Direktorium der Europäischen Zentralbank. Gelungen war schließlich die Umstellung der Konten und Systeme bei Banken, Börsen und Zentralbanken, die viel Arbeit gemacht hat. Die Menschen stellten sich schnell auf die neue Währung ein. Umfragen zufolge hat inzwischen die Mehrheit der deutschen Bevölkerung Vertrauen in die Stabilität der neuen Gemeinschaftswährung. Die Zahl der Skeptiker ist dagegen drastisch zurückgegangen. Auch die Renten-, Aktien- und Devisenmärkte, an denen seit dem 1. Januar 1999, dem ersten Handelstag im neuen Jahr, alle Geschäfte in Euro abgewickelt werden, haben - ausweislich der Kursentwicklungen - den Euro freundlich aufgenommen.