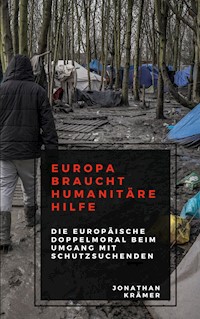
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Worte "Krise" und "Europäische Union" im gleichen Satz zu lesen, ist uns nicht mehr fremd. Trotz Bankenkrise und Eurokrise denken wir bei einer Humanitären Krise jedoch eher an weit entfernte Kontinente. Die Europäische Union zahlt weltweit am meisten in die großen Töpfe der Humanitären Hilfe ein und auch die Zivilgesellschaft packt gerne mit an - Bedarf steigend. Doch seit einigen Jahren häufen sich auch weit hinter den eigenen Grenzzäunen offenbar bewusst geschaffene Elendslager. Dieses Buch prüft anhand von objektiven Kriterien der Hilfsorganisationen, Ministerien und Vereinten Nationen, ob es sich hierbei um vollwertige Humanitäre Krisen auf dem Boden der europäischen Wertegemeinschaft handelt. Sollte dies der Fall sein, stellt sich die Frage, weshalb die Mitgliedsstaaten nicht auch hier proaktiv für die humanitäre Mindestversorgung sorgen. Wird die Situation von Schutzsuchenden innerhalb der EU-Grenzen mit anderen moralischen Maßstäben gemessen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustandkommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Paß niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.
Bertolt Brecht
INHALT
1.
ES GEHT UNS GUT
2.
DER BEDARF AN HUMANITÄRER HILFE STEIGT WELTWEIT AN
Bedarf & Budget
Hunger
Wasser
Klima
COVID-19
Flucht & Vertreibung
Status Quo
3.
WIR HELFEN DOCH GERNE
Zum guten Ton
Demografie & Zahlen
Streuung & Professionalisierung
Ehrenamt & Zivilgesellschaft
Internationale Organisationen
Fazit
4.
HUMANITÄRE KRISEN AUF DEM BODEN DER EUROPÄISCHEN UNION?
Bereits bekannt: Nicht-EU-Europa & EU-Außengrenzen
UNHCR & Institutionelle Akteur:innen
Phänomen Zivilgesellschaft: „Ad hoc & Grassroots“
Die „Big Player“ der weltweiten Humanitären Hilfe
Entstehung & Entwicklung des Bedarfs innerhalb der EU
Humanitäre Hilfe bedeutet nicht gleich Humanitäre Krise
Fallstudie Calais
Subsumtion: Humanitäre Krise in Nordfrankreich?
5.
MORALPARADOXON, DOPPELMORAL UND DIE MENSCHENRECHTE
1.
ES GEHT UNS GUT
Humanitäre Hilfe wird im mitteleuropäischen Raum zumeist mit Ländern und Regionen des sogenannten „Globalen Südens“ assoziiert. Wir denken an hungernde Kinder in Afrika, Tsunamis im Pazifikraum, Maschinengewehre im Mittleren Osten und improvisierte Zeltstädte in Lateinamerika. Wir denken an Hilfsbedürftigkeit, augenscheinlich lebensfeindliche Gebiete und unverschuldete Katastrophenzustände. Auf den ersten Blick scheint es, als könnten diese Krisen nicht unterschiedlicher voneinander sein. Auf den zweiten Blick wird jedoch erkennbar, dass sie alle eins gemeinsam haben: Um das Leid der betroffenen Menschen einstweilig zu verringern, bedarf es schneller und professioneller Hilfe. Oft müssen sich Regierung und lokale Hilfsorganisationen innerhalb kürzester Zeit eingestehen, dass das Ausmaß der Katastrophe ihre eigenen Mittel und Kapazitäten übersteigt.
Weltweit steigt die Anzahl der Konflikte. Kriegerische Auseinandersetzungen weisen heute keine klaren Fronten mehr auf und offenbar beigelegte Konflikte flammen erneut auf. Internationales Recht wird immer mehr wie selbstverständlich gebrochen. Es scheint beinahe gang und gäbe zu sein, dass es eine Handvoll Regierungen gibt, welche in die Gebiete anderer Staaten eindringen dürfen, um dort gezielt Menschen zu töten. In Stellvertreterkriegen in Syrien, Afghanistan oder im Jemen nutzen Militärmächte andere Länder als Austragungsort ihrer geopolitischen Hegemonialbestrebungen. Kurz vor Erscheinen dieses Buches greift eine Großmacht ganz unverhohlen einen angrenzenden Staat in unmittelbarer Nähe zur Europäischen Union an – Verliererin ist immer die völlig unbeteiligte Zivilbevölkerung.
Durch die menschengemachte Klimaveränderung trocknen ganze Flüsse und Seen aus, riesige landwirtschaftliche Nutzflächen verdorren innerhalb weniger Jahre. Industrieller Fischfang europäischer Fischereibetriebe vor den Küsten Afrikas führen zum Verlust der Lebensgrundlagen und zu verheerenden Hungerkatastrophen. Dort, wo die Klimakrise bereits seit Jahren am meisten spürbar ist, steigen parallel politische Instabilität und gewalttätige Konflikte. Zur gleichen Zeit erlebt die Lebensmittelverschwendung in der EU einen neuen Höchststand.1 Jährlich landen hier etwa 87,6 Millionen Tonnen Lebensmittel da, wo sie nicht hingehören: auf dem Müll. Nie gab es mehr Naturkatastrophen und Extremwettersituationen: Die Weltwetterorganisation (WMO) dokumentierte eine Verfünffachung seit Beginn der Messungen in den Siebzigerjahren, ein Großteil der daraus resultierenden Todesfälle wurden hierbei in sogenannten Entwicklungsländern registriert. Impfstoffe gegen globale Pandemien sowie seltenen Krankheiten stehen nur einem kleinen Teil der Weltbevölkerung zur Verfügung. Forschung und Entwicklung im Gesundheitsbereich fokussiert sich maßgeblich auf die Bedarfe der westlichen Industrienationen - bevorzugt auf weiße Männer. Zugang zu Bildung im In- und Ausland ist in vielen Regionen dieses Planeten ein Privileg der oberen Klassen. Das Gleiche gilt für den Bereich Mobilität und der Möglichkeit, mal einen Freizeitausflug oder ein paar Tage Urlaub zu machen.
Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur viele Menschenleben gekostet und die Weltbevölkerung und ihr individuelles Zusammenleben auf eine harte Probe gestellt, sondern innerhalb kürzester Zeit auch die Errungenschaften der Entwicklungszusammenarbeit um Jahrzehnte zurückgeworfen.
Die Auswirkung des Schulausfalls beispielweise traf nicht alle gleich. In großen Teilen der EU konnte innerhalb weniger Monate mehr oder weniger improvisiert auf „Homeschooling“ umgestellt werden, da der Zugang zu den benötigten Ressourcen wie etwa stabiles Internet vorhanden waren. Laut UN haben jedoch 2,2 Milliarden Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren -also zwei Drittel dieser Weltzu Hause keinen Internetzugang. Etwas mehr als die Hälfte hiervon wäre hierzulande schulpflichtig.2 Im Jahr 2020 mussten weltweit etwa 870 Millionen Schüler:innen eine vollständige Unterbrechung ihrer Schuldbildung erleben.3 Der Wegfall des regelmäßigen Besuchs der Schule trifft jene Länder, die diesen stabilen Zugang eben nicht haben, um ein Vielfaches härter. Häufig sind Unterkünfte dort kleiner, durch mehr Menschen bewohnt und somit existiert schlichtweg nicht genug Platz, um zu Hause zu lernen. Schulen dienen oft als eine Art „Safe Space“ gegen häusliche und geschlechterspezifische Gewalt, welche durch die pandemiebedingten Maßnahmen weltweit massiv zunahmen. Empowerment und Emanzipation von Mädchen und jungen Frauen setzt den Zugang zu Information und Bildung voraus. Die Spätfolgen werden in diesen Ländern sicher deutlich verheerender sein.
Vertreibung, Flucht und Migrationsbewegungen sind ein häufiges Symptom solcher Entwicklungen. Der Hohe Flüchtlingskommissar der UN Filippo Grandi spricht von einer „veränderten Realität“, da Vertreibung mit etwa 82,4 Millionen betroffenen Menschen nicht nur einen neuen Höchststand erreicht hat, sondern die Ursachen hierfür längst nicht mehr nur temporär oder vorübergehend sind.4 Wenn also beispielsweise ein Tschadsee etappenweise von der Klimakrise beansprucht wird, vorher aber eine Region -über Landesgrenzen hinwegüber Jahrhunderte mit Fisch und fruchtbarem Boden für Ackerbau versorgt hat, fällt natürlich zuallererst die direkte Nahrungsversorgung und wirtschaftliche Grundlage der dort niedergelassenen Menschen weg. Ein Nährboden für soziale Spannungen, Gebietskonflikte, Konkurrenz, für Folter, Gewalt und radikale Aggressoren. Dieses kleine Beispiel zeigt auf, dass die Ursache für Konflikte vermehrt nicht mehr temporär oder mit einer UN-Mediation ad hoc lösbar sind. Gleichzeitig ist erkennbar, dass Vertreibung, Flucht und Migration somit auch kein temporäres Phänomen sind.
Als unüberlegte Reaktion darauf schotten sich jene Länder, welche sich zum Schutz dieser Menschen verpflichtet haben, hermetisch ab. Die zunehmenden und nicht länger im verborgenen stattfindenden Menschenrechtsverstöße an den Außengrenzen der EU -aber auch innerhalb der Grenzen der Mitgliedstaaten- sind immer mehr nur noch Randnotiz. Längst wird die Situation direkt an den EU-Außengrenzen als humanitäre Katastrophe kategorisiert.5 So richtig schockieren kann nicht mal mehr die menschliche Dimension der grausam verdurstenden oder ertrinkenden Menschen in seeuntüchtigen Booten. Auch das Ausmaß der mittlerweile unverhohlenen Verstöße gegen Internationales und Europäisches Recht macht kaum noch fassungslos. Die Pflicht zur Rettung von in Seenot befindlichen Menschen im Mittelmeer, die Zuweisung eines sicheren Hafens, die Pflicht zur Prüfung eines jeden einzelnen Asylantrags an den Grenzen, das Verbot von Kollektivausweisungen und das pauschale Zurückweisen an der Grenze stehen in der Normenhierarchie über jedwedem nationalen Gesetz. Jedes staatliche Handeln muss diese Vorgaben einhalten. So die Theorie.
All dies sind nur einige wenige Beispiele globaler Trends, welche uns vor Augen führen, dass weltweit der Bedarf an humanitärer Intervention weiterhin tendenziell eher wachsen als schrumpfen wird. Und dennoch scheint das alles weit weg vom Alltag in Mitteleuropa.
Im Kontrast dazu betrachten wir mal die „Millennials“-Generation in Mitteleuropa. Die, die heute etwa 30 Jahre alt sind, bilden die erste Altersgruppe in Deutschland, die ohne Furcht vor Krieg aufwachsen durfte. Die Jugoslawienkriege haben sie meist nicht aktiv verfolgen müssen. Die vorangegangenen Jahrgänge jedoch, ihre Eltern, haben den Kalten Krieg miterlebt. Sie haben erlebt, welche Unsicherheit eine ständige, wenn auch subtile Gefahr mit sich bringt. Nur die wenigsten Luftschutzbunker hätten einem Nuklearsprengkopf auch tatsächlich standgehalten. Die Generationen zuvor waren von bestialischen Kriegen und Genoziden geprägt. Seit 1991 aber ist keine dieser dumpfen Bedrohungen mehr omnipräsent. Die Gefahr, von einem Geheimdienst unvermittelt in den Kofferraum geschmissen zu werden, kennen wir heute fast nur noch aus endlosen Cliffhanger-Serien oder Unrechtsregimen wie im Iran.
Auch war der relative Wohlstand für die breite Masse der Gesellschaft in Deutschland scheinbar nie zugänglicher. Der Zugang zu Bildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung und sozialer Absicherung ist in der Breite sichergestellt. Europa hat weltweit die niedrigste Prävalenz von Ernährungsunsicherheit und kein einziges EU-Mitgliedsland wird mittelfristig eigene Ressourcenknappheit erfahren.6 Grenzkontrollen innerhalb der EU kennen sie nicht mehr, Sprachen lernen sie während ihres Auslandssemesters im Nachbarland und der Besuch bei der Zahnärztin während des Italienurlaubs ist kostenlos. Die Europäische Union nahm 2012 stellvertretend für ihre Mitgliedstaaten den Friedensnobelpreis entgegen und die Gewährleistung und Einklagbarkeit der Grundrechte für EU-Bürger:innen scheint gesichert. Noch nie ging es einer Generation so gut.
Doch auch wenn vorangegangene Generationen noch den Kalten Krieg und Wirtschaftskrisen miterleben mussten, profitieren sie von dem Status Quo. Aufgrund des Privilegs, in dieser Region geboren zu sein, dürfen wir uns aktuell auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von 84 Jahren (statistisch: Männer) beziehungsweise 78 Jahren (statistisch: Frauen) freuen.7 Europa gilt als die friedlichste Region der Welt und acht der zehn friedlichsten Länder der Welt sind hier angesiedelt.8 Deutschland selbst würde beim Global Peace Index 2021 nicht nur auf Platz 23 liegen, würde es aufhören, Waffen und waffenfähige Technologie in Krisenherde der Welt zu exportieren. Jedes Jahr unterschreiben Hunderttausende einen Ausbildungsvertrag bei einem deutschen Unternehmen und das demokratische Wahlrecht in den EU-Ländern gilt größtenteils als sichergestellt. Das alles vorenthalten nur jenen, die nicht dem konservativen, mehrheitsgesellschaftlichen Idealbild entsprechen. Doch dazu an späterer Stelle mehr.
Es geht uns also ganz gut in der Europäischen Union. Insbesondere in den nord- und westeuropäischen Ländern dominiert Sicherheit und Wohlstand. Humanitäre Krisen und deren Folgen finden woanders statt. So könnte man meinen.
Um festzustellen, ob dem tatsächlich so ist, bedarf es vorerst einer Definition dieser Begrifflichkeiten. Dass das natürlich nicht ganz so einfach ist, war vermutlich zu erwarten. Eine allgemeingültige und einheitliche Definition des Begriffs „Humanitäre Hilfe“ gibt es nämlich nicht. Es liegt beinahe in der Natur der Sache, dass jede Katastrophe und jeder Bedarf verschieden ist und folglich einheitliche Definitionen, Maßstäbe oder Blaupausen nur schwierig zu definieren sind. Für die vergleichenden Zwecke dieses Buches sowie die später folgende Subsumtion von Tatbestandsmerkmalen soll insbesondere die Definition der 2003 gegründeten Good Humanitarian Donorship Initiative (GHD) dienen.9 Insbesondere auch EU-Rat, Parlament und Kommission führen eben diese Definition in ihrem „European Consenus on Humanitarian Aid“ von 2007 auf. Dem folgend ist die Humanitäre Hilfe die
„bedarfsorientierte Nothilfe, die während oder im Nachgang einer von Menschen verursachten Krise oder einer Naturkatastrophe stattfindet mit dem Ziel, Leben zu retten, Leid zu mindern und die Menschenwürde zu erhalten sowie die Prävention und Vorsorge für vergleichbare Situationen zu stärken, wenn Regierungen und lokale Akteur:innen überfordert, außer Stande beziehungsweise nicht willens sind, angemessene Hilfe zu leisten“.10
Das Auswärtige Amt ergänzt in der Formulierung ihrer „Strategie zur humanitären Hilfe im Ausland 2019-2023“ ihre Definition noch um Beweggründe, Grundprinzipien und Intention:
„Humanitäre Hilfe ist Ausdruck ethischer Verantwortung und internationaler Solidarität und verfolgt keine interessengeleiteten Ziele. Die Wahrung der humanitären Prinzipien der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit ist zentrale Voraussetzung für die humanitäre Hilfe. Ihr übergeordnetes Ziel ist es, für betroffene Menschen ein Überleben in Würde und Sicherheit zu gewährleisten, ihnen Perspektiven zu ermöglichen und das Leid derer zu lindern, die ihre akute Notlage aus eigener Kraft nicht überwinden können. Dabei geht es darum, Menschen beizustehen, die sich in drängenden Nöten befinden, die ihre Lebensgrundlagen verloren haben oder bei denen das akute Risiko besteht, dass sie aufgrund von Krisen, Konflikten oder Naturkatastrophen in Not geraten.“11
Die GHD-Initiative selbst fügt in ihren „24 Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship“12 noch hinzu, dass an die akute Unterstützung auch anschließende Prävention eine Rolle spielen sollte. In der Praxis ist dies jedoch meist eher Teil der sogenannten „(strukturbildenden) Übergangshilfe“, welche sich eben auf Themen wie die Stärkung der Widerstandsfähigkeit13 fokussiert. Diese beiden Maßnahmen sind ferner von der „Entwicklungszusammenarbeit“ abzugrenzen, welche die langfristige und nachhaltige Arbeit meint.
Humanitäre Hilfe ist also sehr vereinfacht gesagt, die Reaktion auf eine Humanitäre Krise. Für den weiteren Verlauf muss also noch geklärt werden, was eine solche Situation ausmacht. Was ist „humanitär“? Ab wann ist eine Situation eine „Krise“? Und auch hier gibt es aus denselben Gründen wie bei der vorangegangenen Definition keine einheitliche Lesart. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (International Committee of the Red Cross, IKRK/ICRC) ist eine der weltweit bedeutendsten Stakeholder der Branche. Geboren 1949 mit der Verabschiedung der Genfer Konvention, bezieht es ihr Mandat und ihren Auftrag juristisch aus dem humanitären Völkerrecht, konkret aus der Konvention selbst sowie verschiedenen Zusatzprotokollen. Da sich internationale Gesetzgebung, Wissenschaft und ausführende Akteur:innen bisher mehr auf die Definition der Reaktion auf eben jene Krisen fokussierten, berufen sich Nichtregierungsorganisation häufig auf ein Völkergewohnheitsrecht. Hierbei handelt es sich um ein nicht vollständig abgegrenztes Konvolut an Normen und Verträgen, Rechtsprechung (insbesondere des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag, IGH), Verordnungen, „Best-Practices“ und vielem mehr. Dieses Gewohnheitsrecht sieht eine Intervention des IKRK insbesondere in den verschiedenen Formen bewaffneter Konflikte, gewalttätigen Auseinandersetzungen, nationaler Unruhen und deren jeweiligen Folgen vor.
Auch der IGH wollte sich 1986 bei einem Rechtsstreit zwischen Nicaragua und den Vereinigten Staaten nicht so richtig festlegen und stellte sinngemäß fest, dass „humanitarian action das sei, was das IKRK mache“.14 Was macht denn also das IKRK? Erklärtes Ziel ist die Gewährleistung von „Schutz und Hilfe für Betroffene“ von „Notsituationen“.15 Und schon wieder: Es erscheint fast so, als sei der Begriff erneut bewusst oder mangels genauer Definition offengelassen. Nach Ansicht des renommierten Friedensforschers Professor Dennis Dijkzeul liegt dies insbesondere daran, dass nicht die Krise selbst definiert werden soll, sondern vielmehr die „Notwendigkeit von Hilfeleistung“.16 Humanitäre Hilfe ist also notwendig, wenn eine Humanitäre Krise vorliegt, welche wiederum dann vorliegt, wenn Hilfeleistung notwendig ist. Das ist natürlich nicht wirklich zufriedenstellend.
Mangels eindeutiger Rechtslage und Definition verhalten sich die humanitären Akteur:innen also „selbstreferenziell“. Sie folgen also gewissermaßen ihren eigenen Kompetenzen, Expertisen, Erfahrungen und Interpretationen von Humanitarismus. Bei der Analyse der „großen Player“ der Branche sowie deren gemeinsamen Indikatoren für Qualitätssicherung und Rechenschaftspflichten wird schnell klar, dass der Fokus und somit der kleinste gemeinsame Nenner auf die folgenden Bereiche fällt: Nahrungsmittelsicherheit und Ernährung, WASH (Wasser, Sanitärversorgung und Hygieneaufklärung), (Not-)Unterkunft, medizinische und psychologische Versorgung sowie Kleidung fällt.17 Weitere Organisationen sehen ergänzend Schutz und Bildung als solche Basics an.
Selbstreferenziell bedeutet in dem Kontext aber auch, dass die Organisationen nicht nur selbst die Notwendigkeit der eigenen Intervention evaluieren, sondern diese sich meist auch auf bestimmte Schwerpunkte spezialisieren. Keine Organisation kann Expertise und Mittel für alle anfallenden Bedarfe leisten. So spezialisiert sich das IKRK beispielsweise in erster Linie auf Länder und Menschen, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières, MSF) auf medizinische Versorgung, Save the Children auf die Bedarfe von Kindern und so weiter. Organisationsübergreifend entwickelte formalisierte Guidelines wie der „Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability“ verstehen sich als Selbstverpflichtung. Sie gehören mittlerweile seit vielen Jahren zur Grundausbildung und gelten als Referenz für jegliches Handeln der Branche.
Vorerst lässt sich also festhalten, dass eine Humanitäre Krise vorliegt, sobald eine Unterversorgung dieser humanitären Basics vorliegt. Der Auslöser ist im Übrigen für das Vorliegen einer solchen Krise erst mal irrelevant. Es spielt also auch keinerlei Rolle, ob beispielsweise ein Krieg oder eine Klimakatastrophe diese Unterversorgung ausgelöst haben - „man-made“ oder “disaster associated“ macht keinen Unterschied. Es ist ebenfalls nicht von Relevanz, ob die Untätigkeit von Regierung oder Behörden die Lage verursacht oder verschlimmert haben. Es stellt sich schlichtweg nicht die Frage des Verschuldens – wenn der Bedarf erkannt wird, ist es egal, ob sich die betroffenen Menschen auf den ersten Blick selbst in diese Lage gebracht haben oder nicht. Für das Vorliegen einer Humanitären Krise spielt auch die politische Haltung oder Intention der jeweiligen Regierung oder Bevölkerung, beispielsweise gegenüber Minderheiten, Migrant:innen oder Flüchtenden keine Rolle. Diese Haltung oder Intention ist unter Umständen ursächlich oder verschlimmernd, aber für das faktische Vorliegen einer Krise irrelevant.
Doch das nur als Einleitung in die Begrifflichkeiten. Im weiteren Verlauf dieses Buches wird der Begriff der Humanitären Krise detaillierter diskutiert und anhand einer Fallstudie subsumiert.
Im Kontext von Flucht, Migration und Vertreibung geht es meist primär um die schnelle Sicherstellung des Allernötigsten: Wasser, Nahrung, behelfsmäßige Unterkunft, Sanitäreinrichtung, medizinische Erstversorgung. Migrationsbewegungen sind hochkomplex und die Motivation unterscheidet sich individuell kombiniert aus vielen Faktoren. Einen Großteil des Bedarfs an Humanitärer Hilfe im Kontext Migration macht aber die sogenannte Binnenvertreibung aus. Auch wenn es in unseren europäischen Medien oft nicht so aussehen mag und obwohl Rechtsextreme eine von Eliten geplante „Umvolkung“ anprangern, suchen derzeit 69 Prozent aller gewaltsam vertriebenen Menschen in angrenzenden Staaten Schutz.18
Zum Ende des Jahres 2020 die Anzahl der innerhalb des eigenen Aufenthaltsstaates vertrieben Menschen mit 55 Millionen einen neuen Höchststand.19 Ende 2021 waren es bereits knapp 60 Millionen. Hiervon flohen über 53 Millionen aufgrund von Gewalt und Konfliktsituationen und weitere 7 Millionen aufgrund von Katastrophen.20 Ein Großteil hiervon sind „neue“ Vertreibungen. Mit Beginn des Ukrainekriegs und der daraus resultierenden Hungerkrise lassen sich die Zahlen aktuell kaum seriös messen.
Derzeit werden allein in der Türkei aktuell 3,7 Millionen Menschen aufgenommen, in Kolumbien sind es 2,5 Millionen, in Pakistan und Uganda je 1,5 Millionen Schutzsuchende. Binnenflucht oder Flucht in angrenzende Staaten muss nicht immer in einer akuten Unterversorgung münden, jedoch ist dies meist der Fall, wenn Tausende oder gar Hunderttausende Menschen unvorbereitet den Ort wechseln müssen. Es handelt sich hierbei dann um eine humanitäre Krisensituation, welche wiederum kausal aufgrund einer vorangegangenen Krise entstanden ist.
Der Libanon und Jordanien beherbergen eben Hunderttausende solche Menschen aus Syrien und Palästina. Teilweise existieren hier nicht einmal koordinierte Unterkünfte, verlassene Baracken und Häuser werden als Notunterkunft behaust. Dort, wo dies aber ad hoc möglich ist, entstehen jene improvisierten und oft überfüllten Zeltstädte mit den bunten Logos der verschiedenen Agenturen der Vereinten Nationen und den vielen verschiedenen Internationalen Nichtregierungsorganisationen (INGOs). Dann würden wir in unserer westlichen Wahrnehmung die Situation klar als Humanitäre Krise identifizieren. Was wie ein Krisen-Klischee klingt, ist allerdings nicht völlig falsch, denn über 83 Prozent der gewaltsam Vertriebenen fanden in sogenannten Entwicklungsländern („developing countries“) Zuflucht. Bemerkenswert auch, dass die „least developed countries“ circa 27 Prozent aller Asylsuchenden weltweit aufnehmen.21 Dies sind mitunter also Länder, die eine humanitäre Mindestversorgung der Schutzsuchenden häufig nicht mit eigenen Mitteln sicherstellen können. Nicht selten ist zudem die Sicherheitslage für die dort lebende Bevölkerung bereits zuvor eine Herausforderung. Eine Situation, in der Hunderte oder gar Tausende Menschen innerhalb weniger Tage oder Wochen eine vermeintlich temporäre Notunterkunft und humanitäre (Über)lebensgrundlage benötigen, ist immer eine enorme Herausforderung. Im Kontext der Binnenflucht sind diese Erschwernisse aber eben oft noch mal härter, da nicht selten die Ausgangslage des „Hosting Country“ selbst schon eine Herausforderung für sich ist. Zusätzlich gilt es ja auch noch, die humanitäre Versorgung am Krisenursprungsort, beispielweise dem Ort des Taifuns oder Konflikts sicherzustellen. Der politische Wille und die tatsächlichen Möglichkeiten des aufnehmenden Staates haben großen Einfluss auf die Qualität der Versorgung und somit auf die Intensität der Krise. Unklare Regierungsstrukturen oder politische Gründe führen beispielweise zu Behinderung der internationalen humanitären Akteur:innen und so wird aus einer Tragödie schnell eine eigentlich vermeidbare handfeste Krise. De facto kann so beispielsweise aus einer naturbedingten Krise eine menschengemachte Krise entstehen, wenn die zweite „Folgekrise“ durch die Behinderung der humanitären Arbeit ausgelöst oder verschlimmert wurde. Eine Regierung kann mit ihrer Antwort auf die entstandene Faktenlage also entweder humanitär antworten oder eben durch ihr Handeln beziehungsweise Nichthandeln „krisenverschlimmernd“ wirken. Wir halten mit dem Beispiel der Binnenflucht an dieser Stelle fest, dass Migration, Flucht und Vertreibung ein Symptom einer humanitären Krise sein kann und in der Folge zu weiteren humanitären Notsituationen führen kann.
Humanitäre Hilfe im Kontext Flucht, Migration und Vertreibung ist selbstverständlich nicht auf die Intervention im Bereich der Binnenmigration beschränkt: Das Schutzbedürfnis, unter anderem im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, besteht universell für jeden Menschen zu jeder Zeit und überall auf diesem Planeten. Auch wenn es also meist das eigene Geburtsland oder der direkt angrenzende Staat ist, in dem Schutz gesucht wird, so ist es doch möglich, an anderen Orten Schutz zu suchen. Um einer Notlage im Ursprungsland zu entfliehen, nehmen viele Menschen weitere Katastrophen in Kauf, um Schutz zu finden. Nicht selten werden Trecks von Tausenden Kilometern hingenommen, wohlwissend, dass zwischen der vermeintlichen Sicherheit und dem Ursprungsland Folter, Menschenhandel, Vergewaltigungen, Hunger, Durst, Erfrieren und Ertrinken liegen kann. Die individuelle Migrationsmotivation muss also so stark sein, dass die Inkaufnahme von handfesten Humanitären Krisen akzeptabel erscheint. Zu einem späteren Zeitpunkt soll geklärt werden, ob nach Subsumtion von konkreten Tatbestandsmerkmalen bereits Humanitäre Krisen und daraus resultierende Humanitäre Hilfe hinter den Grenzzäunen der EU vorzufinden sind. Auch werden Parallelen zu den uns viel präsenteren „klassischen“ Fällen im nichteuropäischen Ausland aufzuzeigen sein - insbesondere im Hinblick auf die zuvor dargelegten auslösenden und verschlimmernden Faktoren des politischen Willens des aufnehmenden Staates.
Doch vorher noch mal kurz zurück zur „Es geht uns ganz gut“-Union: Aktuell zeichnen sich Tendenzen weg von diesem scheinbaren Idealzustand der größtenteils privilegierten EU-Millennials ab, denn nicht nur die Klimakrise wird die Folgegenerationen der „Gen-Z“ und „Generation Alpha“ in ihrer freien Entfaltung und Lebensqualität massiv einschränken. Das System des Kapitalismus erschafft das Auseinanderklaffen von Arm und Reich, befördert eine radikale Klassenbildung und sorgt zunehmend für innergesellschaftliche Konflikte. Der alte Ost-West-Konflikt scheint wieder aufzuflammen, Russland annektiert völkerrechtswidrig einen Teil der Ukraine und auch die NATO-Länder rasseln mit den Säbeln. Die COVID-19 Krise ist nicht nur eine tödliche Viruspandemie, welches viel zu viele Menschenleben kostete, sondern auch eine Solidaritätskrise. Die erlassenen Schutzmaßnahmen haben Zwischenmenschlichkeit, Empathie und gesellschaftlichen Zusammenhalt auf eine harte Probe gestellt und nicht selten gezeigt, dass Egoismus, Trotz und der Besitz von Toilettenpapier vermehrt einen höheren Platz in der Wertehierarchie einnehmen kann. Kommenden Generationen wird auch erklärt werden müssen, wie wir so viele Tausende Menschen auf dem Boden des Mittelmeers und dem Ärmelkanal verantworten konnten und weshalb trotz proaktiver Hilfsangebote aus der Mitte der EU-Zivilgesellschaft Menschen auf der polnischen Seite der Grenze zu Belarus -also auf EU-Territoriumerfroren sind.22
Auch die einstige Einigkeit rund um den „Friedensgaranten EU“ scheint seit einigen Jahren zu bröckeln. Der EU-eigene Bericht über die Rechtsstaatlichkeit von 2020 prangert offen Defizite ihrer eigenen Mitgliedstaaten in den Bereichen Justizsystem, Korruptionsbekämpfung, Medienpluralismus und Gewaltenteilung an.23 Es ist durchaus bemerkenswert, dass sich eine öffentliche Entität gewissermaßen selbst Probleme bescheinigt. Absurd ist jedoch, dass darauffolgende Maßnahmen durch jene bemängelten Staaten behindert werden können. Demokratiefeindliche Regierungen, wie etwa in Ungarn und Polen, decken sich gegenseitig den Rücken und blockieren sehr erfolgreich legislative Maßnahmen. Strafzahlungen seitens des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) werden einfach lächelnd oder theatralisch polternd von höchster staatlicher Stelle abgelehnt. Erst im Februar 2022 wies der EuGH die Klagen der beiden rechtsextremen Regierungen gegen die sogenannte „Verordnung über die Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit“ ab und die EU-Kommission erklärte, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Union Sanktionsmaßnahmen gegen Mitgliedsländer durchgesetzt werden sollen. Die beiden Länder jedoch erklären den Entscheid einfach als für sie nicht anwendbar und drängen sich vor ihrer Wähler:innenschaft in die Opferrolle. Der Vorrang des EU-Rechts über das nationale Recht wird von den Rechtspopulist:innen auf einmal prinzipiell angezweifelt. Dabei ist es eben das EU-Recht, welches Mindeststandards zu Rechtsstaatlichkeit, Justiz et cetera festlegt.24 Dass solche Maßnahmen überhaupt einmal ergriffen werden müssen, hätte sich noch vor zwanzig Jahren kaum ein Mensch vorstellen können, denn zu den grundlegenden Werten der EU zählen vor allem Solidarität und Gemeinsamkeit.
Der Kontinent Europa hat in den letzten Jahrzehnten verhältnismäßig wenige Naturkatastrophen bewältigen müssen. Laut der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) sorgte hier zwischen 1970 und 2019 tatsächlich Hitze für 93 Prozent aller wetter- und klimabedingten Todesfälle. Allein die beiden Extremsommer der Jahre 2003 und 2010 sorgten für insgesamt 127.946 Todesfälle. In Deutschland starben nur bei dem Extremsommer im Jahr 2003 9.355 Menschen, was bereits 95 % aller wetterbedingten Todesfälle der vergangenen 50 Jahre ausmacht.25 Der Sommer 2022 war ebenfalls eine Jahreszeit der Extreme und wies mancherorts die höchsten Temperaturen seit Beginn der Messungen auf. Die hitzebedingte Übersterblichkeit beläuft sich laut Robert Koch-Institut auf 4.500 Sterbefälle.26
Auch wenn die schrecklichen Bilder von Fluten, Stürmen und Dürre meist als viel tödlicher und invasiver wahrgenommen werden, so führten sie aufgrund zunehmend moderner Warnsysteme doch zu weit weniger Todesfällen. Dennoch werden die wirtschaftlichen Schäden der bis dato schlimmsten Fluten der Jahre 2002, 2007 und 2013 in Deutschland auf 37,12 Milliarden US-Dollar beziffert27.
Das sogenannte „Jahrhunderthochwasser“ 2021 riss ganze Landstriche, Dörfer und Infrastrukturen in Deutschland, Belgien, Luxemburg, Frankreich und den Niederlanden mit sich. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches sind die wirtschaftlichen Schäden noch nicht abschließend ermittelt worden, werden aber voraussichtlich die oben genannten Statistiken in Deutschland spürbar anheben. Etwa 180 Menschen sind dabei allein in Deutschland ums Leben gekommen, viele sind auch Monate später noch vermisst.28 Tausende Menschen haben ihren Besitz, Sicherheiten und Lebensmittelpunkt verloren, werden unter physischen Spätfolgen und psychischen Traumata leiden. Auch wenn in diesem konkreten Kontext in Deutschland meist von Katastrophenschutz gesprochen wird, so ähneln doch viele Parameter denen der klassischen humanitären Krisenhilfe. Zu nennen ist hier konkret das Wegfallen von Wasserversorgung, Infrastruktur, Unterkunft, Strom, Trinkwasser, Kleidung und medizinischer Akutversorgung. Nicht nur Wohnhäuser in den Städten selbst sind betroffen, sondern eben beispielsweise auch agrarwirtschaftliche Unternehmen auf dem Land, welche mit zerstörten Getreidelagern, Weinlesen oder unbefahrbaren Äckern ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage vorerst verloren haben.
Parallelen zur zuvor dargelegten Humanitären Hilfe sehen wir beispielsweise in der temporären Unterbringung der betroffenen Menschen: Viele Betroffene sind vorübergehend bei Nachbar:innen untergekommen, Containerdörfer und provisorische Notunterkünfte wurden errichtet und viele nahmen auch das Angebot von solidarischen Menschen in den umliegenden Landkreisen an – ganz ähnlich wie in dem Beispiel der Binnenflucht weiter oben. Auf die bemerkenswerte „Welle der Solidarität“ kommen wir an späterer Stelle zurück. Dieses Ereignis ist aber an dieser Stelle in Verbindung mit der zuvor dargelegten Intensivierung der Extremwettersituationen sowie weiteren Trends, wie etwa die zu erwartenden Folgen der Atmosphärenerwärmung, zu betrachten. Es zeigt sich, dass nicht nur die Quantität der Naturkatastrophen, sondern eben auch die Qualität, also der zu erwartende Schaden, exponentiell ansteigt.
„Deutschlands oberster Bevölkerungsschützer“, wie die Tagesschau im Juli 2022 titelte, „rät dazu, nicht mehr überall im Land zu leben“.29 Was erst mal nach einem reißerischen Artikel der Bild-Zeitung klingt, fußt jedoch leider auf harten Fakten. Ralph Tiesler, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, hält es aufgrund der Klimaentwicklungen der letzten Jahre für möglich, dass es bald „Klimaflüchtlinge“ innerhalb der Bundesrepublik geben könnte.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Intensität der Naturkatastrophen in Deutschland innerhalb von elf Jahren, gemessen an Todeszahlen und wirtschaftlichem Schaden, stark zugenommen haben.
Die erneute Invasion der Russischen Föderation auf die Hoheitsgebiete der Ukraine im Februar 2022 geschah nur unweit der EU-Außengrenzen. Das humanitäre Ausmaß ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches noch nicht absehbar. Klar war jedoch bereits nach wenigen Tagen, dass die unbeteiligte Zivilbevölkerung am meisten Schaden an den Kampfhandlungen nehmen wird. Internationale Hilfsorganisationen, wie etwa die Caritas, MSF und dem IKRK, sind bereits seit Jahren vor Ort und konnten somit verhältnismäßig schnell auf die Eskalation reagieren. Auf der EU-Seite der Grenze haben sich ad hoc solidarische Menschen aus der gesamten EU versammelt, um eine Erstversorgung und auch Transporte zu ermöglichen. Der Verein Mission Lifeline aus Dresden war einer der ersten, der unbürokratisch und spendenfinanziert Hilfskonvois aus Deutschland realisierte. Gegründet wurde der Verein 2016, um Menschen im Mittelmeer aus Seenot zu retten.
Doch bisher nehmen wir all diese Events weiterhin als Einzelfall wahr. Kampfpanzer und Maschinengewehre kannten wir bis zur russischen Invasion überwiegend nur noch aus Fernsehberichten über die Auslandseinsätze der Bundeswehr in Afghanistan und Mali. Kriege fanden weit weg statt. Die Verortung der Begriffe Humanitäre Katastrophe, Krise und Notlage sehen wir nicht in Europa – und erst recht nicht auf dem Boden der Europäischen Union. Die stabile Gewährleistung von Nahrung, Sicherheit, Mobilität, Bildung, medizinischer Versorgung und Katastrophenschutz ist augenscheinlich vollständig sichergestellt und wird lediglich durch vereinzelte, zeitlich abgrenzbare Extremevents gestört. Und während laut Welthungerhilfe bis zu 828 Millionen Menschen weltweit unterernährt sind, also etwa jeder zehnte Mensch dieses Planeten, schmeißen europäische Staaten jährlich viele Millionen Tonnen an Essen einfach weg.30 Dass sich das alles aufgrund der Klimakatastrophe in den kommenden Jahrzehnten ändern wird, ist wissenschaftlich unbestreitbar.
Dass jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt Menschen aufgrund katastrophaler humanitärer Zustände aus EU-Mitgliedstaaten flüchten, ist weitestgehend unbekannt.
2.
DER BEDARF AN HUMANITÄRER HILFE STEIGT WELTWEIT AN
Bevor sich im weiteren Verlaufe des Buches den Maßnahmen und aktuellen Entwicklungen humanitärer Akteur:innen gewidmet wird, bedarf es einem genaueren Blick auf die humanitäre Situation der Bevölkerung dieses Planeten.
Bedarf & Budget
Jedes Jahr veröffentlicht das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UN OCHA) ihren „Global Humanitarian Overview“. Hauptbestandteil ist neben der Analyse der weltweiten humanitären Lage auch der „Appeal“, gewissermaßen ein Spendenaufruf. UN OCHA werden lediglich 5 % des regulären UN-Budgets zugeteilt und ist für die Realisierung ihres Auftrags somit von zusätzlichen freiwilligen Spenden abhängig. Den gesamten Bedarf abzudecken ist noch nie gelungen. Im Folgenden werden Entwicklungen am Bedarf und Trends in Sachen Finanzierung genauer analysiert.





























