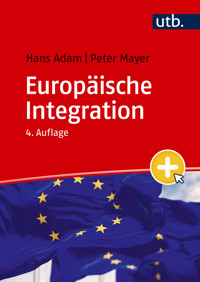
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Europäische Binnenmarkt ist der größte der Welt. Das Wissen um die Europäische Integration ist deswegen für Studierende der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sehr wichtig. Das Lehrbuch führt zu Beginn in die Geschichte des europäischen Einigungsprozesses ein und stellt die institutionelle Struktur der EU vor. Europäische Politikfelder werden in Theorie und Praxis dargestellt und die Herausforderungen der Zukunft diskutiert. Die 4. Auflage wurde vollständig überarbeitet und erweitert: Sie berücksichtigt die aktuellen politischen Debatten über die Zukunft der Europäischen Union und über die Weiterentwicklung der zentralen Politikfelder. Jedes Kapitel zeichnet sich durch Lernziele, Zusammenfassungen und Literaturtipps aus. Ein Glossar rundet das Buch ab. Das Lehrbuch richtet sich an Bachelorstudierende der Volks- und Betriebswirtschaftslehre. utb+: Begleitend zum Buch steht ein E-Learning-Kurs mit 25 Single-Choice-Fragen pro Kapitel zur Verfügung, um das Gelernte zu festigen und zu vertiefen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hans Adam / Peter Mayer
Europäische Integration
Einführung aus ökonomischer Sichtmit eLearning-Kurs
4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
UVK Verlag
Prof. Dr. Hans Adam lehrt Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Osnabrück.
Prof. Dr. Peter Mayer lehrt Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Osnabrück.
Umschlagabbildung: rarrarorro
4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2025
3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2020
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2015
1. Auflage 2014
DOI: https://doi.org/9783838562490
© UVK Verlag 2025— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 ● D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 4110
ISBN mit eLearning-Kurs (Print)
ISBN 9783825262495 (ePub)
Inhalt
Daten und Fakten zur Europäischen Union
© Peter Hermes Furian (iStock)
Vorwort
Die 20er-Jahre dieses Jahrhunderts sind durch umfassende Veränderungen geprägt. Die Auswirkungen des Klimawandels werden deutlich und lassen die Forderungen nach entschiedenem Handeln lauter werden. Der Aufstieg Chinas und Indiens stellt die alte Weltordnung in Frage. Der kriegerische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und damit dem Westen erschüttert vermeintliche Gewissheiten und verändert das Vertrauen in Institutionen der Kooperation, die nach dem Fall der Berliner Mauer weiterentwickelt wurden. Wirtschaftspolitisch sind neue Fragen zu beantworten: Wie muss die Wettbewerbspolitik ausgestaltet werden, welche Rolle spielt die Industriepolitik, wie kann der Binnenmarkt gestärkt werden, welche internationalen Handelsbeziehungen sind zukunftsfähig, wie sieht eine kluge Haushaltspolitik aus, welche Geldpolitik ist angemessen? Die Mitgliedstaaten der EU und die EU-Organe müssen auf diese und andere Herausforderungen Antworten finden. Die Diskussion über die europäische Politik ist intensiv, kontrovers und spannend.
Vor dem Hintergrund solcher Veränderungen wurde diese vierte Auflage grundlegend überarbeitet. Ein Kapitel zur Klimapolitik wurde neu aufgenommen.
Osnabrück, im Herbst 2024
Hans Adam und Peter Mayer
Weiterführende Literatur zur Europäischen Integration
Lehrbücher
Mit der Thematik der Europäischen Integration beschäftigen sich zahlreiche Lehrbücher unterschiedlichen Anspruchsniveaus und Erklärungsumfangs, die als ergänzende Literatur in Lehrveranstaltungen herangezogen werden können. Dazu zählen:
Baldwin, Richard/Wyplosz, Charles (2022): The Economics of European Integration, 7. Auflage, London, McGraw-Hill
Borchardt, Klaus-Dieter (2023): Abc des EU-Rechts, Luxemburg
Brasche, Ulrich (2017): Europäische Integration. Wirtschaft, Erweiterung und regionale Effekte, 4. Auflage, München, Oldenbourg Verlag
De Grauwe, Paul (2022): Economics of Monetary Union, 14. Auflage, Oxford University Press
Kühnhardt, Ludger (2022): Das politische Denken der Europäischen Union. Supranational und zukunftsoffen, Brill Fink, Paderborn, utb
McCormick, John (2021): Understanding the European Union – A Concise Introduction, 8. Auflage, Palgrave-Macmillan
Nugent, Neill (2017): The Government and Politics of the European Union, 8. Auflage, Palgrave-Macmillan
Ranacher, Christian/Staudigl, Fritz/Frischhut, Markus (Hrsg.) (2015): Einführung in das EU-Recht – Institutionen, Recht und Politiken der Europäischen Union, 3. Auflage, Wien, facultas
Wagener, Hans-Jürgen/Eger, Thomas (2014): Europäische Integration. Wirtschaft und Recht, Geschichte und Politik, 3. Auflage, München, Verlag Franz Vahlen
Weidenfeld, Werner (2021): Die europäische Union, 6. Auflage, Brill-Fink, Paderborn, utb
Weidenfeld, Werner/Wessels, Wolfgang (Hrsg.) (2024): Jahrbuch der Europäischen Integration 2024, Baden-Baden, Nomos Verlag (laufender Jahrgang)
Wurzel, Eckhard (2024): Europäische Integration – die ökonomischen Zusammenhänge. Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik sowie Reformansätze, 2. Auflage, Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer
Wichtige Internetquellen
EU: 🔗www.europa.eu
Eurostat: 🔗www.eurostat.eu
Teil I ∙ Das Entstehen der Europäischen Union
1Geschichte der europäischen Integration
eLearning | zu diesem Kapitel finden Sie einen eLearning-Kurs online. Folgen Sie dem Link oder nutzen Sie den QR-Code.
🔗https://narr.kwaest.io/s/1338
Leitfragen
Welche politischen Entwicklungen und Ereignisse haben die europäische Einigung geprägt?
Wie hat sich die europäische Wirtschaft seit Beginn der europäischen Integration verändert?
Welche idealtypischen Vorstellungen haben die Diskussion über die Zukunft Europas bestimmt?
1.1Einführung
Die europäische Einigung seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist ein einzigartiger Prozess, mit dem sich das Zusammenleben der Völker Europas gegenüber den vorherigen Jahrhunderten fundamental geändert hat. Aus einem Kontinent des Krieges wurde ein Kontinent des Friedens, wie es in der Erklärung des Nobelpreiskomitees anlässlich der Verleihung des FriedensnobelpreisFriedensnobelpreises an die Europäische Union im Jahr 2012 noch hieß.
Die Entwicklung der europäischen Einigung der letzten Jahrzehnte war stets eng verbunden mit Veränderungen der weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Rahmendaten. Im folgenden Kapitel wird die Verknüpfung dieser Entwicklungstrends herausgearbeitet.
1.2Die Entwicklung Europas bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
Die europäische Einigung war von Anfang an ein von politischen Motiven geprägter Prozess. Sie war eine Antwort auf die Jahrhunderte alte Realität ständig wiederkehrender Kriege auf europäischem Boden. Eine Auswahl aus der langen Liste der innereuropäischen militärischen Auseinandersetzungen zeigt die Dimensionen (vgl. Simms 2013): England und Frankreich bekriegten sich im Hundertjährigen Krieg 1337–1453. In den Italienischen Kriegen 1494–1559 kämpften unter anderem italienische, französische und habsburgische Truppen.
Russische und schwedische Truppen standen sich wiederholt in den Russisch-Schwedischen Kriegen 1495–1497, 1590–1595 und 1611–1617 gegenüber. Im Dreißigjährigen Krieg 1618–1648 waren unter anderem deutsche, schwedische, spanische, niederländische und französische Truppen beteiligt. Im Großen Nordischen Krieg 1700–1721 kämpften Truppen aus Russland, Schweden und Polen. Der Siebenjährige Krieg 1756–1763 war ein internationaler Konflikt auf deutschem Boden mit Beteiligung Englands, Frankreichs und Österreichs. In den napoleonischen Kriegen 1803–1815 waren mehr als 20 Kriegsparteien einbezogen. Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 war eine Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich. Im Ersten Weltkrieg 1914–1918 waren rund 40 Staaten involviert, 17–20 Millionen Menschen verloren ihr Leben. Schließlich kamen in dem von den Nationalsozialisten ausgelösten Zweiten Weltkrieg 1939–1945 allein in Europa mehr als 50 Millionen Menschen um. Die Verluste an Menschenleben all dieser Kriege waren hoch und wuchsen mit der Entwicklung der Technik, die Lebensgrundlage der Menschen wurde wiederholt vernichtet.
Am Ende des Zweiten Weltkrieges war das Bedürfnis groß, die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Völkern Europas und die Machtpolitik europäischer Nationen zulasten anderer europäischer Nationen hinter sich zu lassen und eine Ordnung für ein friedliches Zusammenleben, für Völkerverständigung, für Demokratie und die Beachtung der Menschenrechte zu finden. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft kann nur vor diesem historischen Hintergrund verstanden werden. Und auch die vielen Veränderungen innerhalb der Europäischen Union, die Erweiterung der Gemeinschaft von sechs Mitgliedern auf 28 und später 27 Mitgliedsländer waren ganz wesentlich von politischen Motiven geprägt, dem Ende der Diktaturen im Süden Europas, der Auseinandersetzung im Kalten KriegKalter Krieg und den Umwälzungen in Osteuropa am Ende des 20. Jahrhunderts.
Wirtschaftlich war Europa in vielerlei Hinsicht bis in das 19. Jahrhundert fragmentiert: Hohe Transportkosten begünstigten die lokale Produktion. Verschiedene Maßsysteme und unterschiedliche Währungen machten den Handel beschwerlich. Die für den Tausch erforderlichen Informationen über Angebot und Nachfrage auf der Seite des Handelspartners waren nur begrenzt verfügbar. Selbst der Handel zwischen Regionen und Städten innerhalb der Staaten war durch Zölle und Abgaben für Güter belastet. Die im Mittelalter dominierende Philosophie des MerkantilismusMerkantilismus sah den wirtschaftlichen Austausch generell nicht als für beide Seiten nutzbringend an. Warenaustausch zwischen den Nationen war über Jahrhunderte auf wenige Güter und Dienstleistungen beschränkt. Die Migration der Menschen war in Friedenszeiten durch das Feudalsystem begrenzt.
Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wandelten sich die wirtschaftspolitischen Vorstellungen, Handel wurde nicht als ein „Null-Summen-Spiel“ begriffen, sondern als potenziell vorteilhaft für exportierende und importierende Staaten. Die wirtschaftlichen Rahmbedingungen änderten sich, Transportkosten sanken, Informationen standen schneller zur Verfügung. Der Anteil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt europäischer Länder, im Jahr 1810 auf 3 % geschätzt, stieg auf 16 % im Jahr 1913. Dieser Wert fiel aber wieder auf 6 % im Jahr 1938 (vgl. Molle 2006), die Entwicklung in Europa in der ersten Hälfe des 20. Jahrhunderts war durch Desintegration geprägt. Niedrige Wachstumsraten und hohe Arbeitslosigkeit waren die wirtschaftlichen Folgen, die Neigung der Bevölkerung, totalitäre Systeme zu unterstützen eine andere verheerende Konsequenz. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 15 europäischen Ländern, welches 1913 noch 57 % des Wertes der USA betragen hatte, sank auf 47 % im Jahr 1950 ab (vgl. Eichengreen 2007, S. 18).
Obgleich die europäischen Völker aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Parzellierung durchaus eigenständige kulturelle Gewohnheiten entwickelten, war Europa gleichwohl ein gemeinsamer Kulturraum (vgl. Thiede 2010). Ein wesentlicher Grund waren die verbindenden religiösen und philosophischen Wurzeln. Die griechische und römische Philosophie hat Europa nachhaltig geprägt. Auch die Baukunst der Antike strahlte Jahrhunderte in ganz Europa aus. Der christliche Glaube fand seinen Weg in alle europäischen Länder und mit ihm auch die christlich geprägte Kultur. Die engen Beziehungen der europäischen Aristokratie trugen zu einem Austausch der kulturellen Werte bei. Die meist kriegs- und verfolgungsbedingte Migration brachte kulturelle Vorstellungen in andere Länder. Philosophen, Musiker, Literaten des 18. und 19. Jahrhunderts suchten europaweit den Austausch. Die Gedanken der Französischen Revolution und Aufklärung verbreiteten sich schnell und beeinflussten die geistige Entwicklung in ganz Europa.
Vor diesem Hintergrund wurden immer wieder Ideen zur europäischen Einigung entwickelt: Das Reich Karls des Großen kann als Versuch der Herstellung eines geeinten Europas interpretiert werden. Der Jurist Pierre Dubois schlug im Jahr 1306 eine regelmäßige „Zusammenkunft des europäischen Adels“ vor, der Quäker William Penn veröffentlichte 1693 eine Schrift mit der Forderung für ein europäisches Parlament, der Philosoph Jeremy Bentham regte eine „Europäische Versammlung“ an. Der Abt Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre schlug die Schaffung einer „europäischen Union“ vor. Jean-Jacques Rousseau entwickelte das Konzept einer „Europäischen FöderationEuropäische Föderation“. Der Österreicher Richard Graf Coudenhove-Calergi forderte eine „Paneuropäische Bewegung“ (vgl. Eichengreen 2007, S. 41), der französische Premier und Außenminister Briand empfahl 1927 die Schaffung eines „föderativen Bandes unter den europäischen Nationen“.
1.3Die Entwicklung seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
1.3.1Die unmittelbare Nachkriegszeit 1945–1950
Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in der Nachkriegszeit
Die dem Ende des Zweiten Weltkriegs folgenden Jahre waren eine Zeit der umfassenden Transformation der politischen WeltordnungWeltordnung. 1945 gründeten 51 Staaten die Vereinten Nationen, die zentrale der Erhaltung des Friedens und der Zusammenarbeit der Nationen verpflichtete internationale Organisation. Im gleichen Jahr schufen 29 Staaten den Internationalen Währungsfonds, der die Währungszusammenarbeit der Mitgliedsländer koordinieren sollte. Und mit der Unterzeichnung des „General Agreement on Tariffs and Trade“ (GATT)General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) im Jahr 1947 dokumentierten die wesentlichen Handelsnationen der damaligen Zeit ihre Bereitschaft, den internationalen Handel zu liberalisieren und gemeinsame Regeln zu beachten.
Auch in Europa kam es zu einer politischen Neuordnung. Westeuropäische Staaten orientierten sich an Demokratie und Marktwirtschaft. In Osteuropa wurde eine kommunistische staatliche Ordnung eingeführt, wirtschaftspolitisch entschied man sich für zentralverwaltungswirtschaftliche Strukturen. Und da bereits die Besetzung der Tschechoslowakei durch sowjetische Truppen im Jahr 1948 signalisierte, dass die Politik der Sowjetunion auf Expansion angelegt war, betrachteten beide Seiten Europa (und andere Kontinente) im Kontext des Kampfes um Einflusssphären. Die Bipolarität, die sich bereits während des Zweiten Weltkrieges abgezeichnet hatte, mündete auf westlicher Seite in der Truman-Doktrin, die für die US-amerikanische Außenpolitik das Ziel formulierte, den „freien Völkern“ beizustehen, diese zu unterstützen, sich der „angestrebten Unterwerfung“ zu widersetzen (vgl. Brunn 2017). Angesichts dessen gründeten zwölf Staaten im April 1949 die „North Atlantic Treaty Organization“ (NATO), ein Bündnis europäischer und nordamerikanischer Staaten zur gegenseitigen Unterstützung im Verteidigungsfall. Im Jahr 1949 wurde der Europarat geschaffen, eine parlamentarische Versammlung zur Stärkung der demokratischen Entwicklung in den Mitgliedsländern (vgl. Brunn 2017).
Die USA unterstützten den Aufbau marktwirtschaftlicher Strukturen in Westeuropa. Mit der Gründung der Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) im Jahr 1948 wurde eine Institution geschaffen, die erhebliche Finanztransfers für den Wiederaufbau Europas bereitstellte. Vor dem Hintergrund der Bedrohung Westeuropas wurde die in den USA zunächst geführte Debatte, ob ein schwaches Deutschland im Interesse der USA liegen könne, schnell zugunsten eines stabilen demokratischen, prosperierenden, in europäische Strukturen eingebundenen Deutschlands beendet (vgl. Brunn 2017).
In den Jahren unmittelbar nach Ende des Krieges 1945 war das wirtschaftliche Wachstum zunächst gering. Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war groß. Am Ende des Jahrzehnts änderte sich dies, die Eckdaten der neuen Wirtschaftsordnung wurden klarer. Die von den USA zur Verfügung gestellten Marshall-PlanMarshall-Plan-Mittel zeigten Wirkung, insbesondere die Auflagen, die mit den Mitteln verknüpft waren, führten zu einer besseren Ressourcenallokation. Die Reorganisation der Volkswirtschaften zugunsten ziviler Zwecke ermöglichte sichtbare Verbesserungen des Lebensstandards der Menschen in Europa. Die Anwendung der technologischen Neuerungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlaubte deutliche Fortschritte in der Arbeits- und Kapitalproduktivität. Zwischen 1947 und 1951 wuchs die Produktion in den Ländern Westeuropas, die Marshall-Plan-Mittel erhielten, um 55 % (vgl. Eichengreen 2007, S. 57).
Die Entwicklung der europäischen Einigung in der Nachkriegszeit
In vielen europäischen Ländern mehrten sich die Stimmen, dass eine nachhaltige Lösung der wiederkehrenden Auseinandersetzungen in der Überwindung nationalstaatlicher Denkweisen besteht. Noch vor Ende des Krieges, im Jahr 1943, betonte einer der späteren Architekten der Europäischen Gemeinschaft, der Franzose Jean MonnetMonnet, Jean, dass die Staaten Europas einzeln nicht stark genug sein würden, Prosperität und soziale Entwicklung für die Menschen zu garantieren. Er forderte die Einigung Europas, die Schaffung eines gemeinsamen Marktes, er wünschte die Einführung einer föderalen politischen Ordnung (vgl. Gasteyger 2006, S. 52–85). Winston ChurchillChurchill, Winston, von 1940–1945 und erneut von 1951–1955 Premierminister Großbritanniens, appellierte in einer Rede in Zürich 1946 an die europäischen Staaten, einen neuen Weg zu beschreiten und ein vereintes Europa zu schaffen. Churchill forderte die Etablierung „einer Art Vereinigte Staaten von Europa“ (vgl. Gasteyger 2006, S. 43–45). Frankreich und Deutschland sollten die wesentlichen Treiber der europäischen Einigung sein, Großbritannien sah er allerdings nicht als Teil eines solchen Bündnisses (vgl. Schmidt 2000, S. 123–124).
Auch die Auseinandersetzung zwischen Ost und West förderte auf beiden Seiten des Atlantiks die Vorstellung, dass Westeuropa nur gemeinschaftlich die Zukunft gestalten kann: In Westeuropa wuchs die Angst vor der sowjetischen Bedrohung. Hinzu kam, dass kommunistische Parteien in vielen Ländern Westeuropas einflussreich waren. Vor diesem Hintergrund nahm auch in den USA die Unterstützung für ein europäisches Einigungsprojekt zu, sie wurde Teil der US-amerikanischen „Containment-Politik“.
Die Idee einer europäischen Gemeinschaft gewann an Kraft und blieb doch umstritten: Die Überwindung nationalstaatlicher Strukturen war (und ist) für Gesellschaften ein revolutionärer Schritt, zumal die Nationalstaaten meist mit einer gemeinsamen Sprache, einer gemeinsamen Geschichte, einer gemeinsamen Kultur verknüpft sind. Auch war völlig unklar, welche Form eine Gemeinschaft annehmen könnte.
⁈ Verständnisfrage | Welche Veränderungen der Weltordnung und der europäischen Ordnung unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges haben den Charakter der europäischen Einigung bestimmt?
1.3.2Die 1950er-Jahre
Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in den 1950er-Jahren
Gleich zu Beginn der 1950er-Jahre erinnerte der KoreakriegKoreakrieg von 1950 bis 1953 an die Herausforderungen, die aus der Konfrontation des Westens und Ostens erwuchsen. Die wachsende Bedrohung durch die militärische Macht der Sowjetunion wurde auch durch die Niederschlagung von Aufständen in der DDR im Jahr 1953 und in Ungarn im Jahr 1956 unterstrichen. Wirtschaftlich waren die 1950er-Jahre eine Zeit des Aufschwungs, eine Zeit der „goldenen Jahre“. Das durchschnittliche Produktivitätswachstum je Arbeitnehmer in den europäischen Staaten war hoch, wie die folgende → Abb. 1 zeigt.
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität in Prozent, 1950–1960 | Quelle: Eichengreen 2007, S. 88
Bessere institutionelle Rahmenbedingungen und die Vorteile aus der grundsätzlich marktwirtschaftlichen Ressourcenallokation trugen ebenso zu dem Erfolg bei wie hohe private und öffentliche Investitionen, der Einsatz moderner Technologien und funktionsfähige industrielle Beziehungen (vgl. Eichengreen 2007, S. 85–88).
Die Entwicklung der europäischen Einigung in den 1950er-Jahren
Nach intensiven Vorarbeiten Jean Monnets schlug der französische Außenminister Robert SchumanSchuman, Robert am 9. Mai 1950, exakt fünf Jahre nach Kriegsende in Europa, eine europäische Gemeinschaft vor, die zunächst auf eine sektorale Zusammenarbeit beschränkt werden sollte: Europa lasse sich, so seine Argumentation, nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es werde durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen. Er forderte eine enge europäische Kooperation der Kohle- und StahlindustrieKohle- und Stahlindustrie. Damit sollte die europäische Zusammenarbeit in einem für die Energieversorgung und den Wiederaufbau wichtigen Sektor beginnen. Hinzu kam, dass damit auch eine multilaterale Kontrolle der Waffenproduktion in den Mitgliedstaaten möglich war, eine mit Blick auf eine etwaige Wiederbewaffnung Deutschlands wichtige Komponente.
Am 18. April 1951 wurde in Paris von den sechs Staaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) unterzeichnet. Die EGKS, auch als Montanunion bezeichnet, nahm offiziell am 01.01.1952 ihre Arbeit auf und sollte für die folgenden 50 Jahre die Rechtsbasis für die Zusammenarbeit in diesem Sektor regeln. Eine „Hohe Behörde“ und ein „Ministerrat“ waren mit der Beschlussfassung betraut, während eine Parlamentarische Versammlung beratende Funktion hatte. Die Mitglieder unterwarfen sich supranationaler Kontrolle, d. h. die geschaffenen Organe konnten verbindliche Beschlüsse fassen, denen sich die Mitgliedsländer beugen mussten.
Nach diesem Erfolg der Integrationsbefürworter blieb der Weg zu weiteren aussichtsreichen Gemeinschaftsinitiativen jedoch beschwerlich: Im Jahr 1950 hatte Jean Monnet auch die Schaffung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft vorgeschlagen, eine von der französischen Regierung unterstützte Idee einer gemeinsamen europäischen Armee (während die Mitgliedsländer, mit Ausnahme Deutschlands, weiterhin das Recht haben sollten, eine eigene Armee zu stellen). Der Vertrag zur Gründung wurde im Jahr 1952 von denselben sechs Mitgliedstaaten unterzeichnet, die auch die EGKS gebildet hatten. Die Initiative scheiterte jedoch, als im Jahr 1954 die französische Nationalversammlung die Ratifizierung verweigerte (vgl. Bulmer/Parker/Bache u. a. 2020). Damit kam auch die Initiative zur Schaffung einer Europäischen Politischen GemeinschaftPolitische Gemeinschaft zu einem abrupten Ende, ein von dem belgischen Außenminister Paul-Henri Spaak vorangetriebenes und damals schon weitgediehenes Projekt. Dieses sollte die Europäische Verteidigungsgemeinschaft und die Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl eng verknüpfen und sah die gemeinsame Zuständigkeit für außenpolitische Belange und die Errichtung eines Gerichtshofes vor.
Erfolg beschieden war jedoch dem Projekt der Schaffung einer engen Kooperation in Wirtschaftsfragen. Im Jahr 1955 wurde im Rahmen einer Außenministerkonferenz in Messina auf Sizilien die Arbeit an einem Vertragswerk vereinbart, für das der belgische Außenminister Spaak verantwortlich zeichnete. Am 25. März 1957 wurde schließlich der Vertrag von Rom zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)EWG unterzeichnet. Durch die Bildung eines Gemeinsamen MarktesGemeinsamer Markt und die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten sollten, so heißt es in Artikel 2 des Vertrages, eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens, eine ausgewogene Wirtschaftsentwicklung, eine größere Stabilität und eine Anhebung des Lebensstandards erreicht werden. Und weiter heißt es in Artikel 3, dass Zölle abgeschafft und Hindernisse für den freien Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr beseitigt werden sollen. Eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet der Landwirtschaft wurde verabredet, so auch die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften. Der Vertrag von RomVertrag von Rom enthielt zahlreiche ambitionierte Zielvereinbarungen.
Gleichzeitig und ebenfalls in Rom wurde in einem weiteren Vertrag die Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOMEURATOM) vereinbart. Die Mitgliedstaaten versprachen sich davon einen engen Austausch in Kernenergiefragen, höhere Versorgungssicherheit und ein gemeinsames Schultern der hohen Kosten der Entwicklung der Nukleartechnologie. Auch hier spielte der Gedanke eine Rolle, durch die enge Kooperation einen Missbrauch der Technologie für militärische Zwecke zu verhindern.
Mit der Schaffung der EGKSEGKS, der EWG und der EURATOM wurde ein Prozess der „Europäisierung“ in Gang gesetzt: Die Verhaltensweisen in den Mitgliedstaaten nähern sich einem einheitlichen europäischen Standard an, den sie gemeinsam gestalten und prägen.
Die Entwicklung Europas in den 1950er-Jahren zeigte gleichzeitig den beschwerlichen Weg der europäischen Integration, der auch in den folgenden Jahrzehnten den Ausbau bestimmen sollte: Kräften für mehr Integration standen starke Kräfte gegen die Ausweitung der Zusammenarbeit entgegen, Schritten hin zu mehr Integration folgten Rückschläge. Integration war sowohl das Ergebnis internen Drucks als auch Ergebnis des Drucks von außen. Ob gewollt oder nicht, der Weg der europäischen Integration war durch Gradualismus gekennzeichnet. Hinzu kam, dass es keinen Konsens über die optimale Form der Kooperation gab.
Box 1 | Idealtypische Vorstellungen über die Kooperation: ein föderales Europa oder intergouvernementale Zusammenarbeit europäischer Staaten
Seit Beginn der europäischen Zusammenarbeit gibt es unterschiedliche Vorstellungen über die beste Form und Intensität der Kooperation, speziell über die Organisation der Hoheitsgewalt, d. h. die Kompetenzverteilung zwischen den Teileinheiten und dem sie umgreifenden Gesamtverband, welche mit dem Gegensatzpaar FöderalismusFöderalismus und IntergouvernementalismusIntergouvernementalismus beschrieben wird.
Der intergouvernementale Ansatz in der europäischen Integration sieht den Integrationsprozess als eine Zusammenarbeit von Staaten, bei der die Nationalstaaten im Mittelpunkt der Entscheidungsprozesse verbleiben. Entscheidungskompetenzen werden nicht an die oberhalb der Staaten angesiedelte europäische Ebene abgegeben, die Hoheitsrechte verbleiben bei den Staaten. Die Nationalstaaten können gemeinsame Entscheidungen treffen, Entscheidungen müssen aber einstimmig fallen, die Souveränität wird nicht an die europäische Ebene delegiert. Es handelt sich hierbei nicht um einen Bundesstaat („federal state“), sondern um einen Staatenbund („federation“).
In einem intergouvernemental gestalteten System treiben die Nationalstaaten die Entwicklung voran (vgl. Nugent 2017, Schmidt/Schünemann 2013, S. 379–402).
Der föderale Integrationsansatz zur europäischen Integration sieht hingegen das Ziel der Integration in einem europäischen Bundesstaat: Souveränität ist geteilt, einige staatliche Aufgaben werden von der europäischen, der dann „supranationalen“ Ebene wahrgenommen und verantwortet, es kommt zu einer Abtretung ausgewählter Hoheitsrechte, andere verbleiben bei den Nationalstaaten. Eine föderale politische Ordnung von Staaten schreibt eine bestimmte Form der vertikalen Gewaltenteilung fest. In einer Verfassung oder einem ähnlichen Dokument wird die Aufgabenverteilung zwischen der supranationalen und der nationalstaatlichen Ebene niedergeschrieben.
Föderale Staaten wie Deutschland, die USA, Kanada oder die Schweiz haben die Aufgabenteilung zwischen den Ebenen sehr unterschiedlich geregelt. Allgemeine wirtschaftspolitische Aufgaben, außen- und sicherheitspolitische Aufgaben werden typischerweise von der übergeordneten Ebene verantwortet. Wie weit die Variabilität auf der zweiten Ebene geht, zeigen die unterschiedlichen Regelungen der Todesstrafe in den US-Staaten, Unterschiede in der Steuerpolitik, der Verkehrs- oder der Bildungspolitik der Gliedstaaten.
Einige föderale Staaten waren das Ergebnis des Zusammenschlusses ursprünglich unabhängiger Staaten (z. B. Schweiz im Jahr 1848), in anderen Fällen sind sie das Ergebnis der gezielten Devolution wie etwa in Kanada oder Indien (vgl. Cini/Pérez-Solórzano Borragán (Hrsg.) 2022).
Schon die Gründerväter der Europäischen Gemeinschaft hatten unterschiedliche Vorstellungen, wie diese ausgestaltet werden sollte. Jean Monnet war expliziter Befürworter eines föderalen Europas, die Überwindung nationalstaatlichen Denkens war ein wichtiges Motiv seines Handelns. Andere sahen die Zukunft Europas stets im Rahmen einer intergouvernementalen Zusammenarbeitintergouvernementalen Zusammenarbeit.
Die Verträge von Paris und Rom enthielten Elemente beider politischer Ordnungsprinzipien. Dies gilt auch für die späteren Gemeinschaftsverträge. Die Europäische Union ist eine Institution „sui generis“sui generis.
1.3.3Die 1960er-Jahre
Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in den 1960er-Jahren
Auch die 1960er-Jahre waren durch den Ost-West-Konflikt geprägt. Im August 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut, die Kubakrise 1962 brachte die Weltmächte an den Rand eines Atomkrieges, der Prager Frühling 1968 zeigte erneut, wie weit die Sowjetunion im Kampf um Dominanz in Osteuropa gehen würde, der Vietnamkrieg wurde als Stellvertreterkrieg verstanden, in Afrika und Asien kämpften die Großmächte mit Beginn der Dekolonialisierung um Einflusssphären (vgl. Laqueur 1992, S. 373–450).
Gleichzeitig waren die 1960er-Jahre in Westeuropa weiter durch hohe Wachstumsraten geprägt, die Arbeitslosigkeit war in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gering. Die Handelsverflechtung innerhalb der Gemeinschaft wuchs, auch der Handel mit den Ländern außerhalb der Gemeinschaft der sechs Staaten gewann an Bedeutung und ermöglichte erhebliche Wohlfahrtsgewinne.
Die Entwicklung der europäischen Integration in den 1960er-Jahren
Während erneute Initiativen zur Vertiefung der politischen Integration scheiterten (Fouchet-Plan von 1961), entschieden die sechs Mitgliedstaaten der EWG, EGKS und EURATOM, die institutionellen Strukturen der drei Gemeinschaften zusammenzuführen (vgl. van Meurs/de Bruin/van de Grift u. a. 2018). Am 8. April 1965 wurde in Brüssel der Vertrag zur Fusion der Exekutivorgane der drei Gemeinschaften unterzeichnet. Ein gemeinsamer Rat und eine gemeinsame Kommission wurden geschaffen, der Vertrag trat am 1. Juli 1967 in Kraft. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bildete den Mittelpunkt der europäischen Zusammenarbeit. Eine große Rolle spielte dabei die gemeinsame Agrarpolitik. Ein zweiter Schwerpunkt der Arbeit der EWG war die Handelspolitik: 1968 wurden zwei wichtige Etappen auf dem Weg zur Zollunion geschafft. Am 1. Juli 1968 entfielen die Binnenzölle und ermöglichten damit den Freihandel zwischen den Mitgliedstaaten. Und gleichzeitig wurden der gemeinsame Zolltarif und damit eine echte Zollunion eingeführt (siehe auch das Kapitel zur Handelspolitik). Von handelspolitischer Bedeutung war ebenfalls das Abkommen mit den 18 sogenannten AKP-Staaten (Afrika, Karibik, Pazifik) aus dem Jahr 1963, ein Schritt zur Vertiefung der Integration.
Während Belgien, Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande, die Gründungsstaaten der drei Gemeinschaften EGKS, EWG und EURATOM, zunehmend anspruchsvollere Ziele formulierten, schlossen sich andere europäische Staaten zu einer Freihandelszone zusammen.
Box 2 | Die Gründung der Europäischen FreihandelsassoziationEuropäische Freihandelsassoziation (EFTA) (European Free Trade Association EFTA)
Sieben europäische Staaten gründeten 1960 die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA). Diese war dezidiert als reine Freihandelszone geplant. Zölle für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten wurden abgeschafft, Außenzölle für den Handel mit Nichtmitgliedern blieben im Verantwortungsbereich der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Gründungsmitglieder waren Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und die Schweiz, Finnland trat 1961 dem Bündnis bei, Island 1970.
Irland, Großbritannien, Dänemark und Norwegen stellten 1961 bzw. 1962 den Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Wegen grundsätzlicher Bedenken von französischer Seite gegen eine Mitgliedschaft Großbritanniens kam es in den 1960er-Jahren allerdings nicht zu einem Beitritt.
1.3.4Die 1970er-Jahre
Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in den 1970er-Jahren
Die 1970er-Jahre bedeuteten für drei Länder Westeuropas eine Hinwendung zu einer demokratischen Ordnung. In Griechenland endete 1974 die sogenannte Obristenherrschaft, eine ab 1967 regierende Militärdiktatur. Auch in Portugal verlor die autoritäre Regierung im Jahr 1974 die Macht, die Nelkenrevolution beendete die lange Phase des sogenannten Salazar-Regimes (Salazar selbst war bereits 1970 gestorben). Und der Tod Francos 1975 machte auch in Spanien den Weg für eine demokratische Ordnung frei (vgl. Laqueur 1992, S. 515–537).
Die drastische Begrenzung der Produktionsmengen durch die erdölexportierenden Länder im Nahen und Mittleren Osten in der Nachfolge zu dem Jom-Kippur-Krieg 1973 führten zu schweren Erschütterungen der Wirtschaft Westeuropas und Nordamerikas. Der Anstieg der Ölpreise traf die Volkswirtschaften unvorbereitet. Die Inflationsraten stiegen in ganz Europa (→ Abb. 2). Die Ölpreissteigerungen erklären einen Teil dieser Entwicklung, die Aufgabe der Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften in den meisten europäischen Ländern war ein weiterer wichtiger Grund.
Inflationsrate in der Europäischen Union 1970–1980 in Westeuropa (BIP-Deflator) | Quelle: Darstellung auf Basis von Daten von UN Data (🔗www.unstats.un.org)
In den 1970er-Jahren schien das WachstumsmodellWachstumsmodell Europas an seine Grenzen zu stoßen. Die hohen Kapitalrenditen der Nachkriegszeit, Ergebnis des Wiederaufbaus, der Bereitstellung zusätzlicher Produktionsfaktoren und des Einsatzes vorhandenen Wissens kamen genauso zu einem Ende wie die Lohnzurückhaltung der Arbeitnehmer und Gewerkschaften. Im Ergebnis flachte das Wachstum in den 1970er-Jahren deutlich ab. Während zwischen 1962 und 1969 die Volkswirtschaften der 15 europäischen Länder (Mitgliedsländer der EU seit 1995) durchschnittlich real um 4,8 % gewachsen waren, stieg die Leistung in der Zeit von 1970 bis 1982 im Jahresdurchschnitt nur um 2,8 %. Die Arbeitslosigkeit nahm zu: Noch in den 1960er-Jahren lag die Quote bei rund 2 % und stieg in den 1970er-Jahren sukzessive auf mehr als 5 % an.
Die Entwicklung der europäischen Integration in den 1970er-Jahren
1973 kam es zur ersten ErweiterungErweiterung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Großbritannien, Irland und Dänemark traten der Gemeinschaft bei. Auch Norwegen hatte den Antrag gestellt, in einem Referendum lehnte allerdings die Bevölkerung des Landes die Mitgliedschaft mehrheitlich ab. Mit dem Beitritt wuchs die Gemeinschaft auf neun Mitgliedsländer. Damit kam die Mitgliedschaft Großbritanniens, Irlands und Dänemarks in der EFTA zu einem Ende, die Assoziation verlor als Alternativmodell zur europäischen Gemeinschaft an Bedeutung.
In ausgewählten Bereichen kam es in den 1970er-Jahren zu einer Vertiefung der ZusammenarbeitVertiefung der Zusammenarbeit. Gleichzeitig wurden der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft neue Aufgaben übertragen: Die EWG zeichnete fortan für umweltpolitische Fragen verantwortlich, ein Regionalfonds zur Förderung des Lebensstandards in unterentwickelten Regionen war 1974 ein wichtiger Schritt zur Schaffung einer Regional- oder auch Kohäsionspolitik. Die Außenbeziehungen mit 46 Entwicklungsländern wurden im Rahmen des Lomé-Vertrages geregelt.
Insbesondere im Bereich der Währungspolitik war die EWG gefordert, die Zusammenarbeit neu zu ordnen. Der Zusammenbruch des über 25 Jahre währenden Systems fester Wechselkurse mit gegenüber dem US-$ fixierten Paritäten führte in Europa zu intensiven Diskussionen über Vorteile und Nachteile flexibler Kurse und Möglichkeiten einer europäischen Währungskooperation. Erste Ideen für eine einheitliche Währung wurden erarbeitet (Werner-PlanWerner-Plan). Die Mitgliedsländer der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft entschieden sich 1972 für eine Koordination der Paritäten ihrer Währungen im Rahmen des Europäischen Wechselkursverbundes. Zentralbanken der beteiligten Länder garantierten die fest vereinbarten Paritäten und unterstützten sich gegenseitig bei den notwendigen Interventionen und der Verteidigung der Kurse. Dies mündete schließlich in der Errichtung des Europäischen Währungssystems im Jahr 1979. Die europäische Währungseinheit ECU wurde geschaffen und war Bezugspunkt für die Berechnung der Paritäten, von denen die Währungen im Normalfall um 2,25 % nach oben oder unten abweichen konnten, bevor Interventionen ausgelöst wurden.
1.3.5Die 1980er-Jahre
Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in den 1980er-Jahren
Auch die 1980er-Jahre waren vom Kalten Krieg geprägt. Sowjetische Truppen waren im Dezember 1979 in Afghanistan einmarschiert. Die Rüstungsausgaben nahmen auf beiden Seiten des Ost-West-Konfliktes zu. In Polen zeigten sich mit der Gründung der Gewerkschaft Solidarnosc deutliche Spannungen des totalitären Systems. Ende des Jahrzehnts kam es schließlich zum Kollaps der kommunistischen Ordnung.
Währenddessen war das Wirtschaftswachstum in Westeuropa weiter abgeflacht. Die durchschnittliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes zwischen 1980 und 1990 lag bei 2,3 %, während jene Veränderungsraten für die USA und Japan deutlich höher lagen.
Das Jahrzehnt war von der Diskussion über die Rolle des Staates geprägt: Mit Ronald Reagan in den USA und Margaret Thatcher in Großbritannien standen Personen an den Spitzen der beiden Länder, die umfassende Reformen der marktwirtschaftlichen Ordnung einforderten. Weniger staatliche Koordinierung, Privatisierung öffentlicher Unternehmen, Senkung der Steuerlast waren wesentliche Themen der Debatte, mit erheblichen mittelfristigen Auswirkungen auf die Umgestaltung der Wirtschaftspolitik in westlichen Industrieländern.
Die Entwicklung der europäischen Einigung in den 1980er-Jahren
1981 kam es zur zweiten Erweiterung der EWG. Griechenland wurde neues Mitglied. In der dritten Erweiterung kamen am 1. Januar 1986 Spanien und Portugal hinzu, die Zahl der Mitglieder war somit auf 12 angestiegen.
Zwar hatten die Mitgliedstaaten der EWG den Freihandel auf den Gütermärkten grundsätzlich verwirklicht und auch die Zölle für den Warenverkehr mit Drittländern vereinheitlicht, die europäischen Länder hatten sich jedoch bereits im Vertrag von Rom anspruchsvollere Ziele gesteckt, die Kooperation sollte weit über eine Freihandelszone hinausgehen.
Im Jahr 1986 verabredeten die Mitgliedsländer der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in der „Einheitlichen Europäischen AkteEuropäische Akte“ einen echten Binnenmarkt zu schaffen, d. h. einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem die „vier Freiheitenvier Freiheiten“, der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital, gewährleistet sind.
Das Zieldatum für die Erreichung dieser Freiheiten war der 31. Dezember 1992. Durch die Beseitigung aller Hemmnisse im innergemeinschaftlichen Handel sollten die nationalen und bis dahin fragmentierten Märkte zu einem einheitlichen gemeinsamen Markt verschmelzen. In der Folge wurden zahlreiche Maßnahmen beschlossen, physische, technische und steuerliche Hindernisse wurden beseitigt.
Verknüpft mit der Idee des freien Personenverkehrs war das Ziel der Abschaffung der Kontrollen an den Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten. Am 14. Juni 1985 wurde in Schengen das nach dieser Stadt bezeichnete Schengen-AbkommenSchengen-Abkommen unterzeichnet, an dem sich einige, aber nicht alle Mitglieder der europäischen Gemeinschaft beteiligten. Das Abkommen gilt als ein Beispiel für ein Europa der zwei Geschwindigkeiten.
Box 3 | Europa der zwei Geschwindigkeiten
Die Grundidee der Europäischen Gemeinschaft bestand in dem Aushandeln gemeinsamer Integrationsschritte, die von allen Mitgliedsländern grundsätzlich gleichzeitig vollzogen werden. Je mehr Länder Mitglieder einer Gemeinschaft und je heterogener die Gegebenheiten und Interessen sind, desto schwieriger ist es, Integrationsvorhaben zu verabreden, die den Präferenzen und Möglichkeiten aller Mitgliedsländer entsprechen. Seit den 1980er-Jahren mehren sich die Vorschläge, in ausgewählten Bereichen Mitgliedern der Gemeinschaft die Entscheidung zu überlassen, einen Integrationsschritt später zu vollziehen, und damit zwei oder mehr Gruppen zu haben, welche die Integration mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vollziehen. Das Schengen-AbkommenSchengen-Abkommen und die Einführung des Euros sind die bekanntesten Beispiele für die Vereinbarung einer vertieften Integration, die aber zunächst nur von einer kleineren Gruppe umgesetzt wird. Getrennt davon handelt es sich bei dem Konzept „Europa à la carteEuropa à la carte“ um die Idee, dass Mitgliedstaaten auch dauerhaft unterschiedliche Integrationswege beschreiten. Statt stets gemeinsam voranzuschreiten, wählen Länder jene Bereiche aus, in denen die Integration gewollt wird.
Die Heterogenität der wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, von Unterschieden in der Ausstattung mit Produktionsfaktoren, der Einbindung in die Weltwirtschaft und der wirtschaftspolitischen Ausrichtung hatte erhebliche Spannungen innerhalb des Europäischen Währungssystems zur Folge. Währungsparitäten wurden temporär ausgesetzt, Paritäten wurden wiederholt angepasst, Regierungen stritten über die richtige Wirtschaftspolitik, wie dies Anfang der 1980er-Jahre zwischen Deutschland und Frankreich der Fall war, bevor schließlich der Franc abwertete, die DM aufwertete und die französische Regierung zu einer fiskalisch konservativen austeritätsorientierten Politik wechselte (vgl. Eichengreen 2007, S. 286–290).
⁈ Verständnisfrage | Was sind die Vorteile eines Europas der zwei Geschwindigkeiten, was sind die Nachteile?
1.3.6Die 1990er-Jahre
Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in den 1990er-Jahren
Die 1990er-Jahre waren durch die historische Umwälzung in Osteuropa geprägt (vgl. Delouche 2012, S. 416–430). Staaten, die bis dahin kommunistisch regiert wurden, erhielten die Freiheit, sich für Demokratie und Marktwirtschaft zu entscheiden. Am 3. Oktober 1990 wurde die deutsche Einheit vollzogen, die Zahl der Bürger der Gemeinschaft wuchs um 20 Millionen. In Polen wurde 1990 der ehemalige Gewerkschaftsvorsitzende Lech Walesa zum Präsidenten des Landes gewählt. Auch Litauen, Lettland und Estland, die ihre Unabhängigkeit erlangt hatten, entschieden sich für Demokratie und Rechtsstaat. Die Tschechoslowakei spaltete sich 1993 in die Slowakei und die Tschechische Republik auf, beide Länder führten demokratische Strukturen ein. Ungarn ging einen friedlichen Weg zur Demokratie. Die Aufteilung Jugoslawiens verlief hingegen dramatisch. Nur nach heftigen kriegerischen Auseinandersetzungen, die auch die Außenpolitik der Europäischen Union an die Grenzen der damaligen Leistungsfähigkeit führte, entstanden schrittweise die Staaten Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien und mit großer zeitlicher Verzögerung Kosovo (vgl. Delouche 2012, S. 424–431).
Mit den Veränderungen in Osteuropa und dem Ende der sowjetischen Vorherrschaft in Osteuropa schien der Kalte Krieg beendet. Rüstungsausgaben wurden in allen Ländern zurückgefahren, der Anteil der Rüstungsausgaben am BIP sank in der Europäischen Union von 2,7 % im Jahr 1990 auf 1,9 % im Jahr 2000.
Das Wachstum der Volkswirtschaften der Europäischen Union schwächte sich währenddessen weiter ab. Der Abstand zwischen den Ländern der EU und den USA weitete sich aus, die Wachstumsraten der USA waren in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren höher als in Westeuropa. In der Folge wurde in den 1990er-Jahren intensiv über die Zukunft des europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells diskutiert.
Box 4 | Diskussion über „Spielarten der MarktwirtschaftSpielarten der Marktwirtschaft“
Es gibt verschiedene Varianten der Marktwirtschaft. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Corporate-Governance-SystemeCorporate-Governance-Systeme und des Selbstverständnisses des unternehmerischen Sektors, der industriellen Beziehungen, der wohlfahrtsstaatlichen Absicherung, der Rolle des Finanzsystems, der Koordination zwischen dem Staat und der Zivilgesellschaft und anderes mehr. Der Franzose Albert brachte dies auf die häufig zitierte Formel „angelsächsische Form des Kapitalismus“ oder „Rheinischer Kapitalismus“ (vgl. Turowski 2006, S. 32–35).
Das angelsächsische Modell basiert auf einer eindeutigen liberalen Orientierung. Ihm wird eine Offenheit für radikale Innovationen und schnelle strukturelle Änderungen zugeschrieben. Das Modell des „Rheinischen Kapitalismus“ hingegen wird als ein System beschrieben, welches gesellschaftliche Kompromisse aushandelt, durch eine stärkere wohlfahrtsstaatliche Orientierung geprägt ist und dem Staat und der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle in der Koordination der Politik zuweist. Ihm wird eine Neigung zu inkrementellen Innovationen nachgesagt (vgl. Eichengreen 2007).
Eine andere Unterscheidung, die ebenfalls eine Dichotomie kapitalistischer Ordnungen betont, stellt „liberale Marktwirtschaften“ wie die USA oder Großbritannien den „koordinierten Marktwirtschaften“ wie Deutschland, Frankreich oder Japan gegenüber. In dem „varieties of capitalism“-Konzept werden die vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten marktwirtschaftlicher Systeme untersucht (vgl. Hall/Soskice 2001).
Wichtig, aber gegenwärtig unbeantwortet, bleibt die Frage, ob es die generelle Überlegenheit des einen oder anderen Systems gibt, und wie die Systeme in Zeiten der Globalisierung mit den Herausforderungen umgehen (vgl. Hall 2015). Obgleich eine gewisse Konvergenz der Systeme unbestritten ist, bleibt offen, wie weit diese Konvergenz gehen soll bzw. gehen wird.
In Westeuropa war diese Diskussion Ergebnis der Wachstumsraten der Volkswirtschaften, der Arbeitslosigkeit in vielen Ländern und wachsender Belastungen für öffentliche Haushalte (vgl. Eichengreen 2007, S. 382–384). In Osteuropa mussten sich die Staaten nach der Öffnung entscheiden, wie sie ihre Sozialsysteme, Unternehmensverfassungen, Finanzsysteme und ihr Staatswesen ordnen wollten. Die staatlichen Strukturen waren grundlegend diskreditiert (gleichwohl in vielen Ländern weiterhin sehr einflussreich) und wurden von der Bevölkerung mit großer Skepsis gesehen. Andererseits waren die Erwartungen an die soziale Absicherung in vielen Ländern groß, zumal das Pro-Kopf-Einkommen im Vergleich zu westeuropäischen Ländern im Durchschnitt weniger als 30 % betrug und durch die Transformation zunächst weiter einbrach.
Die Entwicklung der europäischen Einigungeuropäische Einigung in den 1990er-Jahren
Das Binnenmarktprojekt, das Mitte der 1980er-Jahre gestartet wurde, zeigte Erfolge, der Abbau weiterer Hemmnisse, die Umsetzung der vier Freiheiten kam voran und wurde offiziell als erreicht verkündet (vgl. Brunn 2017).
Die Länder der Europäischen Gemeinschaft reagierten auf die politischen Umwälzungen in Europa mit einer umfassenden Reform der Institution. In dem Vertrag von Maastricht, der am 7. Februar 1992 unterzeichnet wurde und 1993 in Kraft trat, wurde das Spektrum der gemeinschaftlich verantworteten Politikfelder ausgeweitet. Die Kooperation im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) wurde ebenso wie jene im Bereich der Innenpolitik und Justiz in den Aufgabenkatalog des Integrationsbündnisses aufgenommen („Drei-Säulen-Struktur“). Mit dem Vertrag von Maastricht wurde „Europäische Union“ der offizielle Name (vgl. Delouche 2012, S. 418–431).
Der Maastricht-VertragMaastricht-Vertrag enthielt auch den Beschluss, eine gemeinsame Währung zu etablieren. In kurzer Zeit wurde dieses anspruchsvolle Integrationsprojekt umgesetzt. Das Europäische Währungsinstitut und schließlich das Europäische System der Zentralbanken mit der Europäischen Zentralbank (EZB) wurden geschaffen und die gemeinsame Währung am 1. Januar 1999 eingefürt (vgl. Issing 2023).
1995 kam es zur vierten Erweiterungsrunde. Österreich, Finnland und Schweden wurden am 1. Januar 1995 Mitglieder der Europäischen Union. Vor dem Hintergrund der historischen Transformation in Osteuropa stellten zehn Länder Osteuropas in den Jahren 1994 bis 1996 Anträge auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
Box 5 | Gibt es eine optimale Größe der EU?
Auch wenn ein numerischer Wert für die ökonomisch wünschenswerte Zahl an Mitgliedsländern der EU nicht a priori angegeben werden kann, können aus der Theorie der Clubs (vgl. Buchanan 1965) Hinweise abgeleitet werden, wie die optimale Größe einer Gemeinschaft bestimmt werden kann.
ClubtheorieClubtheorie – optimale Mitgliederzahl bei gegebener Clubgröße
In → Abb. 3 wird dies am Beispiel eines Tennisvereins für eine gegebene Ausstattung (Clubhaus, Anzahl an Tennisplätzen) illustriert (vgl. Leach 2006, S. 188ff.). Ist die Mitgliederzahl (M) noch gering, wird sich der individuelle Nutzen (N) eines Clubmitglieds mit zunehmender Mitgliederzahl zunächst erhöhen, da die Chance steigt, geeignete Partner vergleichbarer Spielstärke zu finden. Bei Überschreiten eines bestimmten Schwellenwertes (M0) für die Mitgliederzahl vermindert sich der Nutzen jedes Clubmitglieds, weil etwa Plätze zu den gewünschten Spielzeiten schon reserviert sind. Für eine gegebene Anzahl an Vereinsmitgliedern gilt umgekehrt, dass der Nutzen jedes Mitglieds mit zunehmender Clubausstattung steigt: Ein Ausweichen auf weniger präferierte Termine ist nicht erforderlich, je mehr Tennisplätze zur Verfügung stehen. Der Nutzenzuwachs eines weiteren Tennisplatzes für ein Clubmitglied dürfte allerdings mit zunehmender Clubgröße abnehmen.
Hängen die Kosten des Tennisclubs proportional von der Clubausstattung ab, gilt bei gleicher Aufteilung der Clubkosten auf die Mitgliederzahl, dass die auf jedes Mitglied entfallenden Kosten (K) mit zunehmender Mitgliederzahl sinken.
Die optimale Mitgliederzahl (M*) eines Clubs gegebener Größe ist erreicht, wenn die Differenz zwischen den individuellen Nutzen und Kosten maximal ist. Dies ist im Schnittpunkt von Grenznutzen (N') und Grenzkosten (K') der Fall (vgl. Klump 2020).
Der Ansatz lässt sich modifiziert für die beiden Dimensionen optimale Mitgliederzahl und optimale Integrationstiefe auf die EU übertragen. Die Union bietet Clubgüter (z. B. Handelsintegration) an, die ausschließlich den Mitgliedern zur Verfügung stehen. Die Vorteile der Bereitstellung dieser Güter sind umso ausgeprägter, je mehr Mitgliedsländer beteiligt sind. Ist die Handelsintegration schon weit fortgeschritten, dürften nur noch geringere Handelszuwächse aus einer Erweiterung der Union erwartet werden. Demgegenüber stehen die Kosten der Aufnahme weiterer Mitgliedsländer, da der Abstimmungsprozess innerhalb der EU komplizierter wird und die Entscheidungskosten umso höher sind, je stärker die Präferenzen der Mitgliedsländer divergieren. Da das Clubgut Handelsintegration die Form der Zollunion wie darüber hinaus auch des Binnenmarktes annehmen kann, lässt sich für alternative Vertiefungsgrade eine optimale Mitgliederzahl wie für alternative Mitgliederzahlen eine optimale Integrationstiefe bestimmen (vgl. Ohr 2007, Schemm-Gregory 2010).
Die EU beschloss auf einem Gipfel in Dänemark die anzuwendenden Kriterien für die Aufnahme neuer Mitglieder, die „Kopenhagen-KriterienKopenhagen-Kriterien“: Erfüllt sein müssen das
Politische Kriterium: institutionelle Stabilität als Garantie für eine demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten.
Wirtschaftliche Kriterium: funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten.
Acquis-KriteriumAcquis-Kriterium: Fähigkeit, die aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu übernehmen und sich die Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion zu eigen zu machen.
Sogenannte Europaabkommen, die zwischen 1995 und 1998 in Kraft traten, regelten die Zusammenarbeit mit den Ländern Osteuropas und mit einer Vielzahl von Hilfsprogrammen begleitete die EU den Transformationsprozess.
1.3.7Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts
Die politische und wirtschaftliche Entwicklung im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts
Das Jahrzehnt war eine Phase der Neuordnung. Staaten und Bündnisse suchten nach einem adäquaten Rollenverständnis. Dass aber nicht nur traditionelle militärische Konflikte, sondern auch terroristische Akte bedrohlich werden können, machte der Anschlag am 11. September 2001 deutlich. Auch Europa war gefordert, die eigene Rolle in der Weltpolitik zu klären. Dies galt insbesondere für die eigenen Nachbarregionen wie Russland, Zentralasien, Naher Osten und Nordafrika.
Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 führte zu den höchsten Rückgängen der Wirtschaftsleistung in den Industriestaaten seit der großen Depression 1929. Die Wirtschaftsleistung in der EU-27 sank im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr um 4,3 %, in den Ländern des Baltikums gar um mehr als 14 %. Allein Polen konnte eine positive Wachstumsrate verzeichnen. Die Rettung der Banken bzw. Bankensysteme, die Ausweitung fiskal- und sozialpolitischer Programme trieb die Staatsverschuldung in die Höhe. In zwölf Staaten der Europäischen Union lag die Staatsverschuldung im Jahr 2010 über dem Schwellenwert von 60 % des BIP.
Die Entwicklung der europäischen Einigung in dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts
Die Europäische Union erkannte einen erheblichen Reformbedarf der Wirtschafts- und Sozialordnung an. Im Jahr 2000 wurde daher die „Lissabon-StrategieLissabon-Strategie“ verabschiedet, ein Strategiepapier, das die Maßnahmenbereiche beschrieb, welche angegangen werden sollten, um die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu erhöhen. Das Ziel war wenig bescheiden beschrieben (vgl. Europäischer Rat 2000): Die Union sollte zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt“ werden, ein Wirtschaftsraum sollte entstehen, „der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“. Gleichzeitig enthielt die Lissabon-Strategie ein eindeutiges Bekenntnis zu einem Europa, welches grundsätzlich an den gewachsenen Wertvorstellungen und institutionellen Strukturen festhält, diese aber weiterentwickelt.
Am 1. Mai 2004 schließlich erfolgte die große Osterweiterung der Europäischen Union. Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen, die fünf mitteleuropäischen Staaten Polen, Ungarn, Slowenien, die Slowakei und Tschechien und die beiden Mittelmeerstaaten Malta und Zypern wurden Mitglied der Europäischen Union. Im Jahr 2007 stießen die beiden osteuropäischen Staaten Bulgarien und Rumänien ebenfalls hinzu. Die EU umfasste damit 27 Mitgliedsländer, die Zahl der Einwohner betrug 500 Millionen.
Die Reform der Europäischen Union im Rahmen des Vertrages von Nizza, am 26. Februar 2001 unterzeichnet und am 1. Februar 2003 in Kraft getreten, war nur ein kleiner, generell als unzureichend eingeschätzter Schritt auf dem Weg, die Europäische Union den neuen Herausforderungen anzupassen. Im Jahr 2003 entschieden sich die Mitglieder für die Einberufung eines Konvents zur Zukunft der Europäischen UnionKonvent zur Zukunft der Europäischen Union. Dieser schlug nach intensiven Beratungen eine Reform der Europäischen Union vor. Eine „Europäische Verfassung“ wurde von den Staats- und Regierungschefs unterzeichnet. Diese wurde jedoch in der Nachfolge in den zwei Gründerstaaten Frankreich und Niederlande von der Bevölkerung abgelehnt. Eine Überarbeitung der geplanten Strukturen und Dokumente führte schließlich zum Lissabon-Vertrag, der unterzeichnet wurde und seit 2009 die rechtliche Grundlage für die Kooperation darstellt.
Die Einführung des Euros wurde zu Beginn des Jahrzehnts als erfolgreich eingeschätzt, der Tenor der Feierlichkeiten anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Einführung im Jahr 2009 war überwiegend positiv. Die Inflationsrate in der Eurozone lag zwischen 2000 und 2010 stets unter 2,5 %. Auch der Außenwert erwies sich als stabil, die anfängliche Abwertung gegenüber dem US-$ im Jahr 2000 war von kurzer Dauer. Ende des Jahrzehnts zeigte sich jedoch, dass externe Schocks, die Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich treffen, eine Zone mit einheitlicher Währung an die Grenzen ihrer Belastbarkeit führen.
1.3.8Das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts
Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Ordnung
Im Zuge der Ukraine-Krise mit der russischen Invasion der Krim im März 2014 erreichen die Ost-West-Beziehungen einen neuen Tiefpunkt. Wechselseitige Schuldzuweisungen, Visaverbote, Vermögenseinfrierungen, gegenseitige Wirtschaftssanktionen und weitere Schritte wie der Ausschluss Russlands von den G8-Treffen kennzeichnen das schwierige Verhältnis; vor einer Rückkehr zur Epoche des Kalten Krieges wird gewarnt.
Box 6 | Östliche Partnerschaft der EU
Im Zuge der im Jahr 2009 beschlossenen „Östlichen Partnerschaft“ zwischen der EU und den Nachbarstaaten und ehemaligen Sowjetrepubliken Ukraine, Moldau, Georgien, Belarus, Armenien und Aserbaidschan kam es seit 2013 zu schweren Verwerfungen mit Russland. Der Verzicht auf die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine nach russischer Einflussnahme führte dazu, dass sich in Kiew und den pro westlichen Landesteilen Widerstand gegen die Regierung formierte („Euromaidan“). Den Umsturz in der Ukraine nahm Russland zum Anlass, die Krim zu annektieren und durch Unterstützung der Separatisten die Ostukraine zu destabilisieren. Nach dem Scheitern der Friedensbemühungen auf der Grundlage des Protokolls von Minsk (Minsk I) wurde mit dem Abkommen vom 12. Februar 2015 (Minsk II) erneut vereinbart, den Kriegszustand in der Ostukraine zu beenden und eine politische Lösung des Konfliktes zu finden (vgl. Deutscher Bundestag 2022). Dieses Ziel wurde nicht erreicht.
Mit der Östlichen Partnerschaft als Teil der Europäischen Nachbarschaftspolitik ist beabsichtigt, die politische Anbindung und wirtschaftliche Integration mit den Partnerländern in Osteuropa und im Südkaukasus voranzubringen (vgl. Europäischer Rat/Rat der Europäischen Union 2024).
Durch den Bürgerkrieg in Syrien, die Unruhen in mehreren nordafrikanischen Ländern, Unterdrückung und Gewalt in einigen Subsahara-Staaten und die Bedrohung durch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ sah sich Europa wachsenden Flüchtlingsströmen gegenüber. Die Flüchtlinge gelangten ungesteuert und unkontrolliert auf dem Landweg über die Türkei, Griechenland und über die Balkanroute in die Zielländer oder auf dem in Schlepperbooten lebensgefährlichen Seeweg über das Mittelmeer vor allem nach Italien und Malta. Unterschiedliche Interessen zwischen den östlichen und westlichen Mitgliedsländern der EU wie innerhalb der westlichen Staaten erschweren eine einvernehmliche und solidarische Lösung der Flüchtlingskrise (vgl. Mak 2020). Grenzziehungen und GrenzkontrollenGrenzkontrollen





























