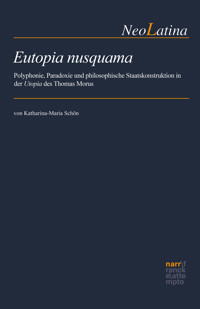
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: NeoLatina
- Sprache: Deutsch
Der Humanist Thomas Morus treibt in seiner Utopia ein humorvolles Spiel, dem eine ernste Botschaft unterliegt, und legt so den Grundstein für ein neues literarisches Genre. Die vorliegende Arbeit widmet sich einer historisch-literarischen Kontextualisierung und einer umfassenden Sequenzanalyse des lateinischen Originaltextes, in der Bezüge zu antiken Vorbildern und zeitgenössischen Autoren wie Erasmus von Rotterdam herausgearbeitet werden. Auf dieser Basis wird gezeigt, dass eindimensionale Deutungen des Werkes zu kurz greifen und dessen facettenreiche Botschaft verengen. Mithilfe der Konzepte der "Polyphonie" und der "Paradoxie" wird eine neue Gesamtinterpretation präsentiert, welche die hermeneutische Offenheit des Textes würdigt. Ein Ausblick auf die Gattungsentwicklung literarischer Utopien ab der Renaissance rundet die Monographie ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 996
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katharina-Maria Schön
Eutopia nusquama
Polyphonie, Paradoxie und philosophische Staatskonstruktion in der Utopia des Thomas Morus
DOI: https://doi.org/10.24053/9783823396253
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 1615-7133
ISBN 978-3-8233-8625-4 (Print)
ISBN 978-3-8233-0534-7 (ePub)
Inhalt
Vorwort und Danksagung
A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing. And when Humanity lands there, it looks out, and seeing a better country, sets sail.
– Oscar Wilde
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Utopie beginnt für viele mit dem idealistischen Impuls der Weltverbesserung sowie mit dem Bedürfnis, sich an einen besseren Ort zu träumen, von dem aus man über die Gegenwart reflektieren oder sogar gestaltend auf sie einwirken kann. Gerade in politisch unsteten Zeiten erscheint es heilsam, Abstand von der Realität zu gewinnen und den Status quo neu zu perspektivieren. Als Archetyp dieser Denkform übt der fiktive Staatsentwurf des Thomas Morus auch heute noch eine starke Anziehung auf seine Leserschaft aus. Die vorliegende Arbeit, die eine überarbeitete Fassung meiner Dissertation (Wien, 2022) darstellt, setzt sich zum Ziel, die Utopia aus dem Blickwinkel einer klassischen Philologin in eine geistesgeschichtliche Tradition von philosophischen Staatsmodellen der Antike einzuordnen. Darüber hinaus möchte diese Studie den Text des Morus im intellektuellen Milieu des Renaissancehumanismus verorten und mithilfe der Konzepte der ‚Polyphonie‘ und der ‚Paradoxie‘ kohärent neu deuten. Schließlich soll in einem Ausblick beleuchtet werden, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass die Utopia das Fundament für die Entwicklung einer neuen literarischen Gattung gelegt hat.
Die Abfassung dieser Arbeit war kein linearer Prozess, sondern eher eine turbulente Berg- und Talfahrt. Bisweilen glich sie sogar einer herkulischen Aufgabe. Daher möchte ich nun all jenen Menschen meinen Dank aussprechen, die mich während dieses Projekts unterstützt und ermutigt haben. Dass meine Liebe zu den studia humanitatis überhaupt erst entstehen konnte, habe ich vielen großartigen Mentor:innen und Lehrer:innen zu verdanken, die mich während meines Doktorats und auf meinen akademischen Weg dorthin begleitet haben. An erster Stelle möchte ich Hartmut Wulfram danken, der meine Dissertation mit großer Umsicht betreut hat. Während meiner Zeit als Assistentin an seinem Lehrstuhl hat er es mir ermöglicht, die bunte Vielfalt der Welt des Humanismus kennenzulernen, und mir die Freiheit gelassen, meinen wissenschaftlichen Interessen und Intuitionen nachzugehen. In persönlichen Gesprächen hat er mich dabei unterstützt, meine Thesen zu entwickeln, und mich dazu ermutigt, erste Zwischenergebnisse bei einschlägigen Fachkonferenzen zu präsentieren. Dass man die Rolle des Doktorvaters nicht nur mit Wohlwollen, Scharfsinn und philologischer Akribie, sondern auch mit geistreichem Humor ausfüllen kann, hat mir Hartmut Wulfram in beispielloser Manier gezeigt. Nicht nur für seine Betreuung, sondern auch für seine Großzügigkeit, mit der er die Publikation dieser Arbeit finanziell unterstützt hat, bin ich ihm von ganzem Herzen dankbar.
Als äußerst gewinnbringend für meine Studien hat sich zudem der Austausch mit führenden Expert:innen des Center for Thomas More Studies erwiesen. Stellvertretend für die gesamte Forschungsgruppe möchte ich mich besonders bei Marie-Claire Phélippeau, Veronica Brooks, Gerard Wegemer, Stephen Smith und Travis Curtright bedanken. Durch ihren unermüdlichen Einsatz haben sie es geschafft, die Thomas-Morus-Community sogar in Pandemiezeiten im virtuellen Raum zusammenzubringen. Als eine enorme Bereicherung habe ich darüber hinaus die zweimalige Teilnahme an der jährlichen Konferenz dieses Forschungszentrums an der University of Dallas empfunden (2021, 2023). Durch ihre Herzlichkeit, ihren wertschätzenden Umgang miteinander und ihre intensiven Bemühungen um interdisziplinäre Kollaborationen gelingt es dieser Forschungsgruppe meiner Meinung nach auf bemerkenswerte Weise, den Esprit der humanistischen res publica litterarum wiederzubeleben.
Für meine Einbindung in diesen transatlantischen Gelehrtenkreis bin ich ebenso dankbar wie für Galionsfiguren der klassischen Philologie, die mich während meines Studiums an der Universität Wien geprägt haben: Christine Ratkowitsch und Kurt Smolak, zwei Koryphäen der Latinistik und Mediävistik, haben mich durch ihren Unterricht nachhaltig inspiriert. Alfred Dunshirn hat meinen Blick auf die altgriechische Literatur in seinen Lehrveranstaltungen grundlegend verändert. Während meines Doktoratsstudiums ist er mir stets als Ansprechperson in sprachlichen Belangen zur Seite gestanden und hat mir dabei geholfen, weite Teile des umfangreichen Textkorpus von Platon und Lukian zu erschließen und ausgehend davon die Traditionslinien besser zu verstehen, die bis in die Frühe Neuzeit reichen. Schließlich hat er sich bereit erklärt, als interner Gutachter bei meiner Defensio zu fungieren, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Auch meinem Zweitgutachter Wolfgang Kofler möchte ich von Herzen für seine feinsinnigen Kommentare zu einer früheren Fassung dieser Arbeit danken. Als einer der Herausgeber der NeoLatina hat er außerdem die Publikation in dieser Reihe angeregt und mit Sorgfalt die anonymen Peer-Reviewer ausgewählt, von deren gelehrten und konstruktiven Stellungnahmen ich bei der Überarbeitung meiner Dissertation sehr profitiert habe. Für das Lektorat und die kompetente Betreuung von Seiten des Verlags danke ich Tillmann Bub und Luisa Santo. Nicht zuletzt möchte ich auch dem Kuratorium und dem wissenschaftlichen Beirat des Theodor-Körner-Fonds zur Förderung von Wissenschaft und Kunst dafür danken, dass meine Doktorarbeit 2022 mit dem Preis für Geistes- und Kulturwissenschaften ausgezeichnet wurde.
Für die gewissenhafte Korrekturlektüre eines früheren Manuskripts sowie für Anregungen, die zur Nachschärfung mancher Details beigetragen haben, danke ich meinem lieben Freund und Kollegen Christoph Schwameis. Ebenso möchte ich mich bei Elisabeth Fromhund bedanken, die sich mit Enthusiasmus und mit wissenschaftlicher Neugierde in das Themenfeld der neulateinischen Utopien eingearbeitet und mich als Studienassistentin bei der Fertigstellung dieser Publikation unterstützt hat. Für wertvolle Hinweise, die mir bei der Erstellung des Index geholfen haben, danke ich Matthias Baltas und Florian Feldhofer. Für ihre kollegiale Wertschätzung und für ihre Hilfe in administrativen, bibliothekarischen und technischen Belangen danke ich Lavinia Enache, Sonja Reisner und Doris Vickers, drei unverzichtbaren Mitarbeiterinnen des Instituts für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universität Wien.
Mindestens genauso wichtig für den erfolgreichen Abschluss dieser Arbeit waren mehrere Personen aus meinem persönlichen Umfeld, deren fortwährende Unterstützung mich zumal in Momenten des Zweifelns emotional bestärkt hat. Aus meinem Freundeskreis möchte ich besonders Verena Sprachowitz und Bianca Waschnig hervorheben und mich bei ihnen für ihr Vertrauen in mich und meine wissenschaftlichen Fähigkeiten bedanken. Großen Rückhalt habe ich ebenfalls von meiner Familie erhalten. Meine Geschwister Sebastian, Severin, Benedikt und Anastasia haben meine Utopieforschungen mit politischem Interesse und mit Humor verfolgt und Thomas Morus womöglich öfter, als ihnen lieb war, als gedanklichen Zaungast bei unseren Tischgesprächen willkommen geheißen. Meine Eltern Martha und Mathias haben nicht nur meine akademische Entscheidung für den unkonventionellen Weg der humanistischen Studien unterstützt, sondern mich auch durch ihr Vorbild geprägt. Als Dank für ihre liebevolle Zuwendung und für ihre bedingungslose Förderung, die sie mir Zeit meines Lebens zukommen haben lassen, möchte ich ihnen diese Arbeit widmen.
Schließlich und doch vor allen anderen möchte ich Pascal Wild für seine sorgfältige Lektüre dieses Buches, für seine mentale Unterstützung und für viele erbauliche Gespräche danken, durch die ich in Phasen der Faszination, der Obsession und der Frustration die Balance finden konnte. Mit seiner technischen Expertise hat er mir außerdem dabei geholfen, einige abstrakte Inhalte dieser Arbeit zu visualisieren. Rückblickend war es die größte Bereicherung für mich, dass wir unsere geistes- und naturwissenschaftlichen Doktoratsstudien parallel betrieben haben und die entscheidenden Hürden gemeinsam meistern konnten.
In der Hoffnung, dass ich meinem einst utopischen Gedankengebäude in der vorliegenden Arbeit eine konkrete und nachvollziehbare Form geben konnte, möchte ich mit einem Zitat des Architekten Jean Nouvel enden, das mir stets eine Perspektive geboten hat: L’utopie prend du sens avec le temps.
Wien, im März 2025
1Einleitung und Forschungsüberblick
1.1Problemstellung und Zielsetzung
Dass die Utopie das proteische Genre par excellence ist, zeigt nicht nur ein Blick auf ihre vielfältigen Verzweigungen in sozio-politischen, philosophischen und literarischen Diskursen, sondern auch eine Rückbesinnung ad fontes: Das Epochalwerk Utopia des Thomas Morus, dessen Relevanz für die geistesgeschichtliche Entwicklung der Gattung unbestritten ist, kann als ein vielfach chiffriertes Enigma klassifiziert werden, das die Leserschaft durch seinen Anspielungsreichtum, durch seinen reflektierten Umgang mit antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Intertexten, durch die Verschränkung verschiedener Interaktionsniveaus und nicht zuletzt durch seine innovative Form vor komplexe Dekodierungsaufgaben stellt.
Da eindimensionale Deutungsansätze der Utopia als Fürstenspiegel, als philosophischer Traktat, als Jenseitsprophetie, als satirischer Gegenentwurf zur Wirklichkeit oder als politisches Reformprogramm zur Herstellung einer besseren Welt zu kurz greifen und der Vielschichtigkeit des Werkes keineswegs Genüge tun, setzt sich die vorliegende Studie zum Ziel, die der Utopia inhärente und von Morus wohl intendierte Multiperspektivität mit besonderem Blick auf deren Prätexte und deren narrative Vermittlungsstrategien zu analysieren. Eine wesentliche Voraussetzung für diese Lesart ist die scheinbar paradoxe Prämisse, dass der utopische Entwurf des britischen Humanisten nur dann ästhetisch kohärent ist, wenn man seine funktionale und intentionale Indeterminiertheit akzeptiert. Konsequenterweise sollten alle Gesamtinterpretationen der Utopia, die das angedeutete Prinzip der Ambiguität zu ihrem Leitbild erheben, hermeneutisch offen sein.
Eine wesentliche Basis für die Entschlüsselung des Werks ist der von Morus erschaffene Perspektivenreichtum, der einerseits durch die sich wechselseitig relativierenden Positionen der Protagonisten entsteht, andererseits durch den Rekurs auf verschiedene literarische Vorbilder (z.B. PlatonPlaton, AristotelesAristoteles, CiceroCicero, Marcus Tullius, SenecaSeneca der Jüngere, LukianLukian von Samosata) untermauert wird. Die Utopia operiert nicht nur mit dem Strukturprinzip der Dichotomie, indem sie den mundus vetus, Europa, und den mundus novus, den fiktiven Inselstaat, antithetisch gegenüberstellt, sondern sie generiert auch innerhalb der beiden Bücher mehrere inter- und intratextuelle „Überblendungseffekte“: Dabei greift der Autor auf ein reichhaltiges Repertoire linguistischer, rhetorischer und erzählerischer Techniken zurück, welche ein ausgeklügeltes literarisches Spiel entstehen lassen. Exemplarisch wird dieser jeu d’esprit, dem zweifellos auch eine ernste Botschaft unterliegt, in den Paratexten, besonders in den Briefen von Morus’ Humanistenfreunden, verdeutlicht, die einige Erstleser-Reaktionen enthalten und somit einen zeitgenössischen Blick auf die Utopia durch ausgewählte interpretatorische Fokalisationslinsen ermöglichen. Die Uneinigkeit hinsichtlich einer einzigen und konsensualen Deutung, die in diesen Begleitmaterialien evident wird, weist auf die bewusst eingestreuten Widersprüchlichkeiten hin. Der privilegierte Blick durch die Paratexte zeigt also, dass es sich bei der Utopia um ein semiotisch verschlüsseltes Werk handelt, das auch heutige Leser:innen auf verschiedene Fährten lotst. Wie ein Überblick über die dominanten Forschungsansätze zeigen wird, setzt sich diese Polyvalenz in der Deutung bis in die Gegenwart fort.
Obwohl der Autor selbst seine Schöpfung bescheiden als „Büchlein“ (libellus) bezeichnete und die Utopia zu seinen Lebzeiten keine außerordentliche Resonanz in der Gelehrtenwelt erzeugte, war sie mehr als ein dem Müßiggang entsprungenes hypothetisches Konstrukt, denn sie barg ein großes gesellschaftspolitisches und geistesgeschichtliches Wirkungspotential in sich. Die sukzessive Verbreitung von Morus’ Monumentalwerk führte zu einer explosionsartig anwachsenden Reihe von literarischen Nachfolgern seit dem 16. Jahrhundert, die den Text des britischen Humanisten einerseits durch Selektion gewisser thematischer Aspekte, andererseits durch die Adaption narrativer Vermittlungsstrategien auf verschiedene Weise weiterentwickeln. So wurde die Utopia, womit ihr Verfasser Thomas Morus wohl kaum gerechnet hätte, zu einem gattungsgeschichtlichen Fundament mit normbildenden Effekten, der die Jahrhunderte überdauern sollte.
Im Titel dieser Studie Eutopia nusquama wird der Versuch unternommen, einige der heterogenen Absichten, die bei der Konzeption des Werks eine Rolle gespielt haben dürften, oxymorontisch in einem kompakten Format zu verbinden: Eine Etymologisierung der beiden Neologismen (Eutopia, griechisch: „der gute Ort“ / nusquama, lateinisch: „der Nicht-Ort“) macht nicht nur auf das paradoxe Wesen und die spatio-temporale Alterität, genauer gesagt, auf die Nicht-Existenz des idealstaatlichen Entwurfs aufmerksam, sondern vereint auch die beiden im Humanismus florierenden Sprachen des klassischen Altertums, aus deren Fundus Thomas Morus maßgebliche Inspirationen schöpfte und deren Kenntnis er bei seinem gebildeten Zielpublikum voraussetzte. Demnach ist es ein erklärtes Ziel der vorliegenden Arbeit, die Utopia im Hinblick auf den breit gefächterten literarischen und altsprachlichen Horizont ihres Autors in einer neuen Tiefe zu untersuchen und dabei besonders den folgenden Schwerpunktfragen Rechnung zu tragen: Welche Anhaltspunkte liefert der Text, um das Genre der literarischen Utopie zu begründen, seine Kernelemente zu definieren und ein Rahmenwerk zu etablieren, anhand dessen sich spätere Werke kategorisch einordnen oder ausschließen lassen? Welche Rolle spielen die rhetorischen und narrativen Mittel der Polyphonie und der Paradoxie, um inhaltliche Spannungen und scheinbare Inkonsistenzen des Textes zu erklären? Und schließlich: Welchen Beitrag leistet die philosophische Dimension der Utopia? Wie wird einerseits mit einer feinen satirischen Klinge auf konkrete politische Missstände verwiesen, wie wird andererseits die zentrale Debatte aus dem unmittelbaren zeitgenössischen Kontext gehoben und so ihre zeitlose Relevanz aufgezeigt? Diese Kernfragen sollen zunächst mit Bezug auf die Sekundärliteratur und mit einem kurzen Blick auf den biographischen Hintergrund des Autors approximiert und dann in einem zweiten Schritt im Zuge einer detaillierten Sequenzanalyse des lateinischen Textes, die das methodische Herzstück dieser Arbeit bildet, weiter erforscht werden. Auf Basis der so dargebotenen, intra- und intertextuell untermauerten Lesart der Utopia wird schließlich im letzten Kapitel eine neue Gesamtinterpretation vorgestellt, die das Werk – ohne dessen historischen oder sozio-politischen Entstehungskontext außer Acht zu lassen – als Teil eines elaborierten Fiktionalitätsdiskurses begreift, der sich aus etlichen, bisweilen sogar scheinbar konkurrierenden Rezeptionslinien speist, die in der Renaissance eine neue Blütephase erlebten, und durch ebendiesen Facettenreichtum ein neues literarisches Genre begründet.
1.2Forschungsgeschichtliche Ausgrenzungen
Die Polyvalenz des Begriffs „Utopie“, der eine „dynamische Konfliktzone epistemischer Konfigurationen“1 darstellt und dessen Heterogenität sich in der heutigen Utopieforschung widerspiegelt, macht vorab eine Auseinandersetzung mit den facettenreichen Dimensionen dieses Terminus notwendig.2
Der Beginn von genretheoretischen Untersuchungen ist im 19. Jahrhundert anzusiedeln: Robert von Mohl, der die zur damaligen Zeit bekanntesten utopischen Denker und deren Werke überblicksartig zusammenstellte, zählt zu den Begründern dieser Forschungsrichtung.3 Im Rahmen seiner Pionierarbeit klassifiziert er die Utopie als „Reformprogramm“ sowie als „Staatsroman“. Während er das politische Gestaltungspotential des Genres positiv hervorhebt, bemängelt er dessen literarische Ungeschliffenheit, die sich in der reduzierten Handlung, dem Fehlen von psychologischem Tiefgang der Charaktere und der Gleichförmigkeit der formalen Einkleidung manifestiere. Auf seinen Überlegungen fußt die historische Geschichtsforschung, welche die Utopie weniger als literarisch autonomes Kunstwerk, denn als Quellenmaterial ansieht. Unter Betonung ihrer diskursiv-didaktischen Funktion geht diese Strömung davon aus, dass sich die Utopie in einem Spannungsfeld zwischen einer dokumentierenden Rolle und einer sozio-politischen Wirkintention befindet.4
Im Zentrum vieler geschichtswissenschaftlicher Analysen steht die Aufschlüsselung utopischer Werke nach rein thematischen Gesichtspunkten (z.B. Politik, gesellschaftliche Institutionen, Gesundheitswesen, Technik, Infrastruktur, Religion, Sprache, Literatur, Architektur, Staatsphilosophie), die in einem zweiten Schritt spiegelbildlich auf reale Gesellschaften projiziert werden – ein methodischer Vorgang, durch den die Utopieforschung wie eine Subkategorie der Sozialwissenschaften anmutet.5 Über ideengeschichtliche Interpretationen hinausgehende Deutungsansätze utopischer Entwürfe, die einen geschärften Blick auf deren konkrete Realisierbarkeit werfen, heben einerseits ihren (meist) kommunistisch inspirierten, minimalstaatlichen Libertarismus als positiv hervor,6 betonen andererseits aber im negativen Sinne die Gefahr, die vom Totalitarismus autoritärer Staatsromane ausgeht.7 In zeitgenössischen medialen und politischen Diskursen erfährt der Utopie-Begriff bisweilen insofern eine Abwertung, als er aufgrund seiner konzeptuellen Dehnbarkeit zu einem polemischen Synonym für „Weltfremdheit“ und einem irrationalen oder gar destruktiven Idealismus degradiert wird.
Wenn man sich lediglich auf die „normativ-ethische Korrektivfunktion“8 des untersuchten Genres bezieht und dadurch zeitgenössische Wertvorstellungen auf einen Text überträgt, der einer vergangenen Epoche entstammt, ist eine anachronistische Lesart oft die logische Konsequenz. Darüber hinaus kann eine rein inhaltlich-thematisch orientierte Analyse eines utopischen Werks, welche die Unterschiede zwischen Gegenwart und Vergangenheit stillschweigend nivelliert, mit einer ungerechtfertigten literaturästhetischen Abwertung des Genres einhergehen.
In eine andere Kerbe schlägt die allgemeine Utopieforschung, welche die umfassendste Definition des „Utopischen“ liefert – das Neutrum ist in diesem Fall gegenüber dem Femininum „Utopie“ vorzuziehen – und dieses als eine von jeder Gattungszugehörigkeit abgekoppelte Bewusstseinsform oder sogar als eine anthropologische Konstante benennt.9 In dieser Hinsicht lassen sich intentionale10 und instrumentale11 Ausprägungen unterscheiden:
Intentionale Utopiebegriffe erfassen eine Bewußtseinshaltung gegenüber der Wirklichkeit, die sich als Appell ausdrückt, Werturteile und Normen zu verändern und in die Wirklichkeit verändernd einzugreifen. Instrumentale Utopiebegriffe dagegen sind weniger an der Wirkungsabsicht der Texte interessiert, vielmehr erfassen sie die formalen Schritte der Bewußtseins-operationen, die es ermöglichen, in der Phantasie Wirklichkeitsvorstellungen zu entwickeln, die von der Erfahrungswelt abweichen.12
Philosophisch betrachtet ist es demnach konstituierend für den utopischen Impuls, auf der Suche nach Alternativen für den Ist-Zustand die Empirie zu transzendieren und diese etwa aus dem Blickwinkel der Vergangenheit oder der Zukunft zu spiegeln, wobei darauf zu achten ist, dass die retrospektive und die prospektive Dimension nicht konzeptuell verschwimmen oder irrtümlich miteinander verschmelzen.13 Dieses Moment der Überschreitung der Gegenwart wurde wechselweise als fehlende „Seinskongruenz“14 mit transformativem Potential, als „Antizipation“15 oder „psychologische Propensität“16 beschrieben. Erst eine kritische Auseinandersetzung mit dem Status quo und die Negation seiner Validität ermöglichen die Konzeption eines Gegenentwurfs, der, im jeweiligen historischen Kontext betrachtet, ein emanzipatorisches Potential in sich bergen kann, aber nicht unbedingt Verwirklichungsansprüche artikulieren muss. Im rein ontologischen Sinn ist also die utopische Intention am besten ex negativo zu fassen: Sie ist als eine Negation der negativen Aspekte der Wirklichkeit, die in der Idealvorstellung fehlen, konzipiert. Gleichzeitig baut die Utopie aber auch auf dem Prinzip der Affirmation auf, indem sie ein überwiegend positives, in sich geschlossenes, heuristisch anspruchsvolles System entwirft, welches (mitunter in gleichnishafter Form) auf der Basis einer zeitlichen und räumlichen Alterität operiert und somit gewissermaßen eine Einladung an den Leser darstellt, in seinem Bewusstsein und seinen Wunschvorstellungen das real Gegebene zu transzendieren.17 Was ihren modus operandi betrifft, so kann die Utopie – philosophisch betrachtet – nach dem Prinzip
des Dogmatismus im Sinne eines verheißungsvollen, normbasierten Apriorismus,
des Kritizismus im Sinne eines negativ ausgerichteten Utilitarismus, der ausschließlich mit der Falsifizierbarkeit von Aussagen operiert, ohne sich auf eine historische Notwendigkeit zu stützen, oder
des Konstruktivismus, der eine Formulierung heterogener Lebensformen sowie unterschiedliche Wertorientierungen auf Basis eines verbindlichen Konsens erlaubt,
gestaltet sein.18
Wegen ihrer inhaltlichen Prioritätensetzung ist diese Studie weniger in die skizzierten philosophischen und historischen Forschungsansätze, sondern vielmehr in einen literarischen Utopiediskurs einzuordnen, dessen Grundzüge im nächsten Kapitel näher beleuchtet werden.
1.3Überblick über die literaturwissenschaftliche Utopieforschung
Die ersten einschlägigen literaturwissenschaftlichen Untersuchungen des Utopiebegriffs sind dadurch charakterisiert, dass sie eine Reihe von genrekonstituierenden, inhaltlichen Merkmalen herausdestillieren, z.B. die insulare Lage des fiktiven Staates, seine an geometrischen Prinzipien orientierte Architektur, seine ökonomische und politische Autarkie, und neben der Analyse ideologischer Färbungen ein Hauptaugenmerk auf die artistische Komposition legen.1 Literaturwissenschaftliche Ansätze gehen davon aus, dass die utopische Fiktion nicht nur Einzelschicksale, sondern in überwiegend deskriptiver Form eine systemisch geschlossene Gesamtheit von Lebenszusammenhängen abbildet.2 Somit fungiert sie bewusstseinsbildend, indem sie die Leserschaft zur Analyse realer Tatbestände und gegebenenfalls zu deren gedanklicher Überschreitung anregt. Ein derartiger Prozess wird bei den Rezipient:innen nicht zuletzt deswegen angeregt, weil durch das limitierte Sprachmaterial, das jedem Autor zur Verfügung steht, notwendigerweise Versatzstücke aus der Realität in die Fiktion übernommen werden. In anderen Worten: Die literarische Utopie kann sich an den Spielregeln der Wirklichkeit orientieren und ist somit nicht immer ein autonomes Kunstprodukt. Weil ein idealstaatlicher Entwurf nicht zwangsläufig in abstrakt-deduzierenden, konjunktivischen Wenn-Dann-Formeln konzipiert sein muss, spielt im literarischen Rezeptionsprozess einer Utopie nicht nur deren stringente Argumentationsstruktur, sondern auch die Darstellungstechnik eine wichtige Rolle: Der Erzähler, der in den utopischen Kosmos eintritt und seine Erfahrungen zeitgleich oder in Retrospektive referiert, kann in das utopische Konstrukt intervenieren und die Legitimität der Welt, aus der er ursprünglich entstammt, gegenüber dem neuen Modell verteidigen. Auch das Gegenteil kann der Fall sein. Unabhängig davon, ob sich der Erzähler für oder gegen das utopische Modell ausspricht, das er präsentiert, lässt sich Folgendes für die Rezeptionshaltung konstatieren: Je konkreter und detaillierter die von ihm entworfene Illusion ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Leser:innen auf einer emotionalen Ebene auf die Vorstellungswelt einlassen.3
Neben der Wertschätzung ihrer ästhetischen Ausdruckskraft und ihrer appellativ-affektiven Intentionen schreiben literaturwissenschaftliche Studien der Utopie auch didaktische, parodistische und sozialkritische Wirkabsichten zu. Besonders die satirische Komponente rückt in den 1970ern ins Zentrum von Untersuchungen, die utopische Werke auf ihre dialektische Beziehung, i.e. die Kritik des europäischen Gesellschaftszustandes und die durch Inversion erschaffene idealstaatliche Kontrastfolie, hin analysieren. Studien dieser Façon sehen in der literarischen Utopie einerseits eine eminente inhaltliche (nicht aber formale) Gattungsnähe zu der menippeischen oder der römischen Verssatire,4 andererseits ein ironisches Spiel, das sich sowohl epideiktischer Mittel (laus, vituperatio) als auch sprechender Namen bedient, um gleichermaßen die Wirklichkeit zu karikieren und den Mangel an Praktikabilität des utopischen Entwurfs zu demonstrieren.5 Dies geschieht durch Verfremdungseffekte, welche die Inkongruenz von Realität und Imagination durch strategisch positionierte Alteritätsmarker kenntlich machen6 und bisweilen zum Lachen anregen. Eine derartige, vom Autor gewiss intendierte Reaktion auf Seiten der Leser:innen bleibt meistens kein reiner Selbstzweck, sondern birgt kathartisches sowie subversives Potential in sich: Sie führt die Rezipient:innen von bisher als „unveränderlich“ Angenommenem weg und bewirkt durch diesen comicrelief eine perspektivische Distanzierung; in anderen Worten: „le rire est la vérité de l’Utopie elle-même.“7 Suvin (1979) gilt als Begründer des einflussreichen Konzepts des cognitive estrangement, welches es den utopischen Denker:innen erlaube, sich durch Hypothesenbildungen über realhistorische Gegebenheiten hinwegzusetzen, indem sie in den Text ein novum einführen. Dieses ziele darauf ab, die Rezipient:innen durch einen radikalen ontologischen Bruch mit der Wirklichkeit so sehr zu überraschen, dass sie dazu angehalten werden, gewohnte Denkmuster kritisch zu hinterfragen und über Alternativen der Weltkonzeption nachzudenken.
Die Vermittlung dieses problematischen Aspekts der (Un-)Realisierbarkeit der entworfenen Gegenwelt erfolgt durch mehrere fiktionale Akteure, denen unterschiedliche funktionale Rollen zukommen: Ebenso wichtig wie der Augenzeuge, der seine erkenntnistheoretische Entwicklung Revue passieren lässt, oder der utopische Gewährsmann, der als ein intradiegetischer Garant für die Authentizität des Berichts fungiert, ist der Empfänger der Botschaft. Letzterer kann (1) expressis verbis als Interlokutor eingesetzt und durch eine dialogische Annäherung mit der utopischen Fiktion vertraut gemacht werden oder (2) nur implizit präsent sein, wenn die Rede des Augenzeugen das gesamte Narrativ umspannt. In diesem Fall präfiguriert der textimmanente Zuhörer die Erfahrung des idealen Lesers, der durch die Schilderungen des Augenzeugen schrittweise in die fremde Welt eingeführt wird.8 Daraus lassen sich folgende Thesen ableiten: Die narrative Aufmachung bestimmt nicht nur die Gestaltung und Identität der Erzählerfigur, sondern auch den Raum, in dem sich das utopische System entfaltet.
Die Dialogform, die sich in der Renaissance großer Beliebtheit erfreute, eignet sich sowohl für eine dialektisch-didaktische Auseinandersetzung mit der Materie als auch für eine Distanzierung von der offenkundigen Fiktionalität des idealstaatlichen Entwurfs sowie für metadiskursive Reflexionen über dessen Prozesshaftigkeit.9 Wenn die inhaltliche Ambiguität einer literarischen Utopie nun direkt proportional zu ihrer dialogischen Dualität ist und durch den Wegfall konträrer diskursiver Positionen kontinuierlich abnimmt, so lässt sich im Umkehrschluss eine deutlichere Lenkung des Rezeptionsprozesses durch den Autor in der Wahl einer monologischen Form des utopischen Narrativs erkennen.10
Weitere poetologische Studien, die sich auf diachrone Untersuchungen der Gestaltung des utopischen Handlungsverlaufs, auf die dialogische bzw. monologische Aufmachung, auf die Rahmen- und Binnenhandlung sowie auf strukturelle Parameter der Fiktionalität konzentrieren, haben einige wesentliche Entwicklungslinien aufgezeigt, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:11
Typologische und narrative Entwicklung des utopischen Genres
Auf diesen Erkenntnissen fußen Bemühungen, welche die Gattung der Utopie nicht nur in ihrer Gesamtheit erfassen, sondern auch typologisch klassifizieren wollen. So hat man das Verhältnis des erdachten Idealstaates zur Wirklichkeit skaliert und ausdifferenziert in:
ein irreales Nirgendwo,
ein erträumtes, potentielles Irgendwo und
einen realisierbar gedachten, in die Zukunft transponierten Entwurf.
Durch diese Entwicklung ist auch eine Verzeitlichung der Utopie erfolgt, die zu einer zunehmend prospektiven Orientierung des Genres und zu einer Ablösung der Fokussierung auf die räumliche Dimension geführt hat. Demnach fanden auch neue Bezeichnungen Eingang in den literaturtheoretischen Diskurs wie etwa „konstruktive (Sozial-)Utopie“, „Fluchtutopie“, „Fürstenspiegel“, „Arkadien“, „Schlaraffenland“, „voyage imaginaire“, „phantastische Luftreise“, „chiliastische Utopie“ oder „utopische bzw. dystopische Satire“, die nach wie vor ein treffendes analytisches Instrumentarium darstellen.12
Dieser Facettenreichtum utopischer Anthologien suggeriert, dass sich dieses literarische Genre in einem permanenten Wechselspiel befindet zwischen Ausweichmanövern, die zum Eskapismus tendieren und die utopischen Entwürfe in einem vagen Raum-Zeit-Gefüge zu verankern suchen,13 und affirmativen Bemühungen, die danach trachten, die Fiktion zu authentifizieren. Literarische Mittel, welche die Plausibilität der Illusion erhöhen, umfassen dabei, wie die Utopia des Thomas Morus exemplarisch vorführt, eine Nebeneinanderstellung fiktiver und nicht-fiktiver Charaktere, die Umrahmung des Dialogs durch eine nachweislich historische Situation, die den Wirklichkeitsvorstellungen der zeitgenössischen Rezipient:innen vertraut ist, sowie die Erschaffung einer Herausgeberfiktion und eine Diskussion über den empirischen Wert der Erzählung in den Paratexten.14
Die genannten Kategorisierungen werfen aber auch Fragen hinsichtlich der Möglichkeit, einen utopischen Nukleus von seinem schmückenden Beiwerk zu lösen, auf – beispielsweise: Welchen Anteil dürfen fantastische und mythische Elemente einnehmen? Ist die Projektion der Utopie auf eine Insel als hermetisch geschlossenes System eine conditio sine qua non? Muss die Wegmetapher an eine symbolische Erkenntnisreise gekoppelt sein? Darf die Erzählperspektive zwischen objektiv-wissenschaftlichen, auktorialen Elementen und subjektiv-emotionalen Schilderungen der erlebenden Charaktere mäandrieren? Besteht in der Utopie die Notwendigkeit der Hypothesenbildung in einer logisch-kausalen Pseudowirklichkeit? Ist die Integration von erzählerischen Elementen, die eine Idee des (technischen) Fortschritts vermitteln und auf die Perfektionierbarkeit einer Gesellschaft hinweisen, mit einem literarischen Werk, das den Anspruch auf rezeptionsästhetische Autonomie erhebt, vereinbar? Angesichts der Tatsache, dass die Suche nach definitiven Antworten auf diese Fragen wohl aporetisch bleiben muss, scheint es unerlässlich für literaturwissenschaftliche Utopieforscher, die bestehende „Unsicherheit über den ontologischen Status der Gattung“15 anzuerkennen. Die Lage wird dadurch verkompliziert, dass die Utopie durch funktionale Adaptionen und Modifikationen als „Gattungszitat“ gelegentlich in anderen Genres eingesetzt wird.16
Wenngleich also rigide kategorische Normativität bei der Interpretation utopischer Werke nicht zielführend ist, so kann man doch anhand der erläuterten Entwicklungslinien konstatieren, dass der literarische Wandel und die zunehmende Fiktionalisierung des utopischen Genres als Reaktion auf neue gesellschaftliche Ordnungen und einen sich verändernden Wirklichkeitsbegriff zu verstehen sind. Man kann und sollte der literarischen Utopie also eine gewisse Gattungsdynamik zugestehen; wie die Rezeptionsgeschichte der Utopia im Epilog zu dieser Studie noch ausführlicher zeigen wird, beheimatet dieses produktive und in die Zukunft hin offene Genre eine Vielzahl gesellschaftlicher Idealbilder, welche durch ihre Interaktion miteinander zu einer gegenseitigen Bestärkung führen und sogar Handlungsanweisungen enthalten können.17
Mit diesem gattungstheoretischen Zugeständnis sind aber terminologische Schwierigkeiten noch nicht abschließend geklärt: Grenzziehungen zwischen „Utopie“ und
„Utopismus“, der eine allgemeine Form des soziopolitischen Träumens ist,
„Anti-Utopie“, die als nicht-existente gegenweltliche Projektion verstanden wird, in der die verbesserten Aspekte der ‚Idealgesellschaft‘ kritisiert werden, und
„Dystopie“, die eine negative Projektion der zeitgenössischen Gesellschaft liefert,18
sind weithin etabliert; je nach fachwissenschaftlichem Ausgangspunkt besteht außerdem ein Dissens hinsichtlich der Frage, ob man die Utopie
als eigene Gattung,
als diskursive Textqualität, die verschiedenen Genres zugehörig ist, oder
als eine inszenierte Lebensform, wie sie beispielsweise in den sogenannten intentional communities praktiziert wird,
verstehen soll. Überlegungen zu diesen Differenzierungen beginnen ab den 1990ern zu florieren, als die Anthropologie ins Zentrum des Forschungsinteresses rückt. Waren noch ein Jahrzehnt zuvor rein literaturwissenschaftliche Arbeiten quantitativ führend, so übernehmen ab diesem Zeitpunkt die Sozial- und Politikwissenschaften die leitende Position: Jameson (2007) macht sich beispielsweise für die integrative Dimension der Utopie stark und befürwortet die These, dass durch eine Öffnung des Begriffs für außerliterarische Diskurse eine Grundlage geschaffen werden könne, um verschiedene Formen akademischer Forschung (z.B. cineastische Science-Fiction, politisch-ideologische Analysen von anarchistischen oder totalitären Modellen, futuristische Visionen künstlicher Intelligenz) auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Zielführender für literaturwissenschaftlich orientierte Studien wie die vorliegende Arbeit ist aber der Ansatz von Saage (2005): Er plädiert angesichts der skizzierten konzeptuellen Rivalität für einen klassischen, auf Morus zurückgehenden Utopiebegriff, welcher einerseits eine Abgrenzung zu den oft als verwandt bezeichneten Phänomenen des Mythos, der Science-Fiction und der Eschatologie ermöglicht, andererseits einen wesentlichen Ausgangspunkt für eine die Epochen durchmessende Analyse der Wirkungsgeschichte der Utopie darstellt.19 Es gilt hier allerdings zu bedenken, dass – selbst wenn man diesem eng gefassten Ansatz folgt – in den Überblicksdarstellungen der gängigen Forschungsliteratur mehrere, bisweilen synonym verwendete Begriffe – „literarische Utopie“ (Berghahn/Seeber), „utopische Erzählung“ (Stockinger), „utopischer (Staats-)Roman“ (Gnüg) – zirkulieren, die wechselweise zur Kategorisierung des vorhandenen Textkorpus herangezogen werden.20
Trotz dieser divergierenden terminologischen Ansätze stimmt die Mehrheit der literaturwissenschaftlich orientierten Utopieforscher:innen dahingehend überein, dass man Texte, die sich als Kandidaten für eine Einordnung in das Genre profiliert haben, unter Berücksichtigung der diachronen Perspektive auf einer inhaltlichen, funktionalen, intentionalen und formalen Ebene analysieren muss, bevor eine definitive Zuordnung stattfinden kann.
Gattungsgeschichtliche Veränderungen sollten dabei als dynamische Reaktionen auf sich wandelnde historische Gegebenheiten begriffen werden, die nicht „teleologisch“, sondern „prozessmetaphorisch“ zu verstehen sind: Die literarische Utopie kann anders als andere Genres nicht anhand eines transhistorischen Kriterienkatalogs limitiert werden, was bedeutet, dass die Veränderung der literarischen Form nicht automatisch einen funktionellen Paradigmenwechsel einleiten muss.21 Durch die in der Erzählung angelegten Wirklichkeitsbezüge sowie deren literarische Konkretisierungen verwandelt sich der Text in ein philosophisch-soziologisch-ästhetisches Gesamtkunstwerk. Diesem Ansatz entsprechend soll als Arbeitshypothese für den Hauptteil der vorliegenden Studie die folgende Utopie-Definition gelten:
[Utopie ist der] zumeist literarisch verfasste, fiktionale und universale Entwurf von idealtypisch und rational experimentell konstruierten Institutionen und Prinzipien eines Gemeinwesens, der den realhistorischen Verhältnissen in kritischer Intention gegenübergestellt und auf ein besseres Leben der Menschen gerichtet ist.22
Welche Aspekte dieser Begriffsbestimmung in ihrem gattungsgeschichtlichen Prototyp, der Utopia des Thomas Morus, bereits angelegt sind, von welchen literarischen, biographischen und historischen Einflüssen der Autor geprägt war und welche forschungsgeschichtlichen Ansätze und erzähltheoretischen Grundlagen eine gewinnbringende strukturelle Annäherung an das Werk erlauben, soll im folgenden Teil näher beleuchtet werden.
2Die Genese und Konzeption der Utopia des Thomas Morus
2.1Historische, literarische und biographische Perspektivierung1
Omnibus omnium horarum hominem agere et potes et gaudes, schreibt Erasmus von RotterdamErasmus von Rotterdam anerkennend über Thomas Morus in seiner Widmung der Laus StultitiaeErasmus von RotterdamLaus Stultitiae an den britischen Humanisten, in der er seinen feinsinnigen Humor, seine Offenherzigkeit, seine Konvivialität, seinen vielseitigen Geist und seine Fähigkeit, sich wie der Philosoph DemokritDemokrit mit einem Lächeln von trivialen weltlichen Belangen zu lösen, lobend hervorhebt.2 Kaum ein anderes Schlagwort wurde in der Rezeptionsgeschichte und in der Forschung öfter als kürzestmögliche Paraphrase für den Charakter des Morus verwendet als: A man for all seasons.3 Bereits seine ersten drei Biographen, William RoperRoper, William (Morus’ Schwiegersohn), Nicholas HarpsfieldHarpsfield, Nicholas (ein Freund der Familie) und Thomas StapletonStapleton, Thomas, stellen ihre (teilweise idealisierenden) Lebensdarstellungen, die kurz nach dem Ableben des Morus verfasst wurden, bis zu einem gewissen Grad unter diese aphoristische Zuschreibung.4 Wer war dieser so kontrovers diskutierte Mann, der vielfach als fachkundiger Jurist, als kalkulierender Politiker, als zerrissener Literat und als christlicher Märtyrer apostrophiert wird? Welche Schritte in seinem literarischen Schaffen haben zur Erfindung der Utopia geführt und wie ist das Werk im Gesamtkorpus von Morus’ Schriften zu bewerten? Diese und weitere Fragen sollen im Folgenden im Zentrum stehen.
2.1.1 Prägende Anfänge: humanistische Bildung, religiöse Einflüsse und literarische Vorbilder
Geboren im Februar 1478, wuchs der junge Thomas als Sohn von Sir John, einem tüchtigen Geschäftsmann und erfolgreichen Anwalt, in einem von mittelalterlich-feudalen Strukturen geprägten, unter dem starken Einfluss der katholischen Kirche stehenden London auf. Nach seinem Besuch der renommierten St. Anthony’s School in der Threadneedle Street stand er ab dem Alter von 12 Jahren unter der Schirmherrschaft des Erzbischofs von Canterbury, des damaligen Lordkanzlers Sir John MortonJohn Morton (Erzbischof von Canterbury), der 1493 zum Kardinal erhoben wurde und den Thomas Morus später in einem literarischen Porträt in der Utopia verewigte. Unter dem Patronat des Erzbischofs kam er als Knappe häuslichen Pflichten nach und setzte seine literarischen Studien fort. Diese inkludierten eine Instruktion in der ciceronischen Rhetorik, praktische Übungen in den Suasoriae und eine Bekanntschaft mit den römischen Komödienautoren, v.a. TerenzTerenz (Publius Terentius Afer), dessen Stücke Einblicke in kolloquiales Latein boten und als Vorlage für Adaptionen dienten, welche die Eleven unter der Leitung des Kaplans Henry MedwallMedwall, Henry regelmäßig aufführten. Morus’ schauspielerische Qualitäten, v.a. sein Improvisationstalent, werden von seinem ersten Biographen William RoperRoper, William gewürdigt.1 Dass er sich mit Leichtigkeit verschiedene Rollen (personae) aneignen und gedankliche Perspektivenwechsel vornehmen konnte, zeugt von einem hohen Grad an Reflektiertheit und von einem guten dramatischen Gespür.
Die vielseitigen Begabungen des jungen Thomas dürften einen bleibenden Eindruck bei MortonJohn Morton (Erzbischof von Canterbury) hinterlassen haben, denn er kümmerte sich um ein Stipendium, das es dem talentierten Schüler von 1494 bis 1496 ermöglichte, seine Studien des klassischen Kanons, der Philosophie und der Logik in Oxford fortzusetzen.2 Wegen des Verlusts der Universitätsregister für den Zeitraum 1471 bis 1505 können keine gesicherten Aussagen darüber getroffen werden, welche Fächer Morus für sein Curriculum gewählt hatte. Briefliche Belege bezeugen jedoch seine Vertrautheit mit den scholastischen Methoden, seinen glühenden Einsatz für die Förderung der litterae Graecae in Oxford3 sowie seinen Umgang mit den humanistischen Gelehrten John ColetColet, John, William GrocynGrocyn, William und Thomas LinacreLinacre, Thomas. Nach eingehenden Studienreisen nach Frankreich und Italien und nach einer Bekanntschaft mit dem Florentiner Philologen Angelo PolizianoPoliziano, Angelo sowie den Neuplatonikern Cristoforo LandinoLandino, Cristoforo und Marsilio FicinoFicino, Marsilio brachte die Trias das neu erworbene Wissen zurück nach England, wovon Morus als eifriger Zuhörer profitierte; auch ErasmusErasmus von Rotterdam schwärmt in einem späteren Brief an Robert FisherFisher, Robert (datiert auf den 5. Dezember 1499) über die philosophische Gewandtheit seiner britischen Freunde:
Coletum meum cum audio, Platonem ipsum mihi videor audire. In Grocino quis illum absolutum disciplinarum orbem non miretur? Linacri iudicio quid acutius, quid altius, quid emunctius? Thomae Mori ingenio quid unquam finxit natura vel mollius, vel dulcius, vel felicius?4
Wenn ich meinen ColetColet, John höre, scheine ich PlatonPlaton selbst zu hören. Wer würde an GrocynGrocyn, William nicht seinen Horizont und seine vollkommene Gewandtheit in allen Disziplinen bewundern? Was ist scharfsinniger, erhabener und gewitzter als das Urteil LinacresLinacre, Thomas? Was hat die Natur jemals erschaffen, das geschmeidiger, gefälliger oder erfreulicher als der Charakter des Thomas Morus ist?
Zumal durch Vermittlung der italienischen Humanisten gelangte ein substantieller Bestand an klassischem Gedankengut in die englischen Universitäten und in renommierte Bildungszentren, wo eine Ummodellierung der geisteswissenschaftlichen Studien stattfand, die bis zu diesem Zeitpunkt der mittelalterlichen Unterteilung in trivium und quadrivium gefolgt waren. Hervorzuheben sind die übersetzerischen Tätigkeiten von Leonardo BruniBruni, Leonardo und Marsilio FicinoFicino, Marsilio, die maßgeblich zur Popularisierung lateinischer Fassungen der Schriften des AristotelesAristoteles und des PlatonPlaton beitrugen.5
Auch Morus selbst wurde als Übersetzer tätig. Gemeinsam mit ErasmusErasmus von Rotterdam, den er 1499 bei seinem ersten Besuch in England kennengelernt hatte, widmete er sich der Latinisierung ausgewählter Schriften des Satirikers LukianLukian von Samosata. Eine Inspiration dafür könnte das Wirken der italienischen Humanisten Guarino da VeronaVerona, Guarino da und Giovanni AurispaAurispa, Giovanni gewesen sein, die bereits eine Generation zuvor Manuskripte dieses Autors zu Übersetzungszwecken von Konstantinopel nach Italien gebracht hatten. Abgesehen davon, dass um 1470 bereits der Großteil der 82 dem Lukian zugeschriebenen Schriften auf Latein verfügbar war, kam es 1496 zur ersten Publikation des griechischen Lukian durch Janus LascarisLascaris, Janus (Florenz, Drucklegung durch Lorenzo di Francesco de AlopaAlopa, Lorenzo di Francesco de). Während die editio princeps nur eine eingeschränkte Reichweite besaß, bewirkte die zweite Drucklegung durch den renommierten Verleger Aldus ManutiusManutius, Aldus (Venedig, 1503), dass Lukians Œuvre durch die leichtere Zugänglichkeit des Textes einen enormen Bedeutungszuwachs erlebte und seinen Siegeszug in den Norden antrat: Zu den Bewunderern, Liebhabern und Nacheiferern des Satirikers aus Samosata zählten jenseits der Alpen unter anderen Rudolph AgricolaAgricola, Rudolph, Johannes ReuchlinReuchlin, Johannes, Philipp MelanchthonMelanchthon, Philipp, Willibald PirckheimerPirckheimer, Willibald, Ulrich von HuttenHutten, Ulrich von, Hans SachsSachs, Hans und Petrus MosellanusMosellanus, Petrus; eine (zumindest oberflächliche) Kenntnis Lukians gehörte in humanistischen Kreisen bald zum guten Ton.6
Dass auch Thomas Morus trotz seiner starken religiösen Prägung an diesem Autor, der sich als gnadenloser Spötter, als Skeptiker und als Atheist einen Namen gemacht hatte, Gefallen fand, mutet zunächst befremdlich an. Seine Beschäftigung mit ihm war wohl zu einem guten Teil autodidaktisch motiviert und diente dazu, seine Griechischkenntnisse aufzupolieren.7 Außerdem dürften ihn LukiansLukian von Samosata Experimentierfreudigkeit und seine originelle Neukombination von etablierten literarischen Genres sowie seine humorvoll-geistreiche Vermittlung moralischer Lektionen fasziniert haben, was aus einem Widmungsschreiben an den königlichen Sekretär Thomas RuthallRuthall, Thomas abzulesen ist, das der Edition von 1506 (Paris, Drucklegung: Badius Ascensius) vorangestellt ist.8 Dort begründet Morus nicht nur seine Auswahl der vier von ihm übersetzten Schriften (CynicusLukian von SamosataCynicus, Menippus siveNecyomanteiaLukian von SamosataMenippus sive Necyomanteia, PhilopseudesLukian von SamosataPhilopseudes, TyrannicidaLukian von SamosataTyrannicida), sondern er betont auch mit Nachdruck die Attraktivität des lukianischen Stils:
Si quisquam fuit unquam, vir doctissime, qui Horatianum praeceptum impleverit, voluptatemque cum utilitate coniunxerit, hoc ego certe Lucianum in primis puto praestitisse. Qui et superciliosis abstinens Philosophorum praeceptis et solutioribus Poetarum lusibus honestissimis simul et facetissimis salibus vitia ubique notat atque insectatur mortalium. Idque facit tam scite, tantaque cum fruge, ut quum nemo altius pungat, nemo tamen sit, qui non aequo animo illius aculeos admittat. […] E lepidissimis Luciani dialogis alius alium praeoptat, mihi certe isti praecipue placuerunt, neque temere tamen (uti spero) neque soli.9
Wenn es jemals einen Menschen gab, hochgelehrter Herr, der das horazische Prinzip befolgte und das Vergnügen mit der Nützlichkeit kombinierte, dann glaube ich gewiss, dass sich LukianLukian von Samosata in dieser Hinsicht besonders ausgezeichnet hat. Er, der sich sowohl von den hochmütigen Lehren der Philosophen als auch von den ausgelassenen Spielereien der Dichter fernhält, tadelt und verspottet überall mit seinem zutiefst ehrlichen und erlesenen Humor die Fehler der Sterblichen. Und dies tut er so geschickt und mit so großem Nutzen, dass es, obwohl niemand tiefer unter die Haut dringt, trotzdem niemanden gibt, der seine Sticheleien nicht mit Gleichmut erträgt. […] Von den äußerst amüsanten Dialogen des Lukian bevorzugt jeder einen anderen, mir freilich haben die folgenden besonders gefallen, und – wie ich hoffe – nicht grundlos und nicht nur mir allein.
Abgesehen davon, dass Morus hier über den Paganismus LukiansLukian von Samosata wohlwollend hinwegsieht, wertet er ihn durch die Autorität des HorazHoraz (Quintus Horatius Flaccus) poetologisch auf. Die sorgsam ausgewählten Schlagworte der voluptas und utilitas, durch welche die gleichermaßen vergnügliche wie instruktive Lukian-Lektüre umrissen wird, spielen auf einen literaturästhetischen Grundsatz des römischen Dichters in der Ars poetica (V. 343–344) an, demzufolge der Nutzen und die Unterhaltung zwei Desiderate seien, die qualitativ hochwertige Literatur erfüllen müsse: Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, / lectorem delectando pariterque monendo. – „Allgemeinen Beifall erhält, wer das Nützliche mit dem Angenehmen mischt und den Leser dadurch gleichermaßen unterhält und belehrt.“
Als methodisch bemerkenswert erachtet Morus des Weiteren, dass LukianLukian von Samosata die Scheinheiligkeit und Verlogenheit prätentiöser Philosophen und allzu anmaßender Dichter, welche er als Zielscheiben seines Spotts ausmacht, systematisch demontiert, ohne dabei in einen starren Dogmatismus zu verfallen. Aufgrund seiner literarischen Qualitäten, i.e. seines Anstands (honestas), seiner witzigen Einfälle (facetiae) und seiner entwaffnend-gefälligen Ausdrucksweise (lepor), besitze Lukian ein großes didaktisches Potential – ein Urteil, das Morus mit seinem Freund und Kollaborator ErasmusErasmus von Rotterdam teilte, der in seinen AdagiaErasmus von RotterdamAdagia von Lukian wertschätzend als einem „beharrlichen Kritiker aller abergläubischen Fanatismen“ spricht (Lucianusadamantinus omnium superstitionum insectator, Adag. 677Erasmus von RotterdamAdagiaAdag. 677). Darüber hinaus teilte Morus die Meinung von zeitgenössischen Pädagogen, die das formvollendete Attisch Lukians zu ihrem Stilideal auserkoren, auch wenn nicht alle Schriften für den Unterricht geeignet waren.10
Ein Markenzeichen des in der Renaissance gefeierten Autors der Zweiten Sophistik war seine Strategie des serio ludere (griech. σπουδαιογέλοιον), die in einer Mischung von Komik und Ernst besteht, und sein facettenreicher Einsatz von Ironie, der auch auf Morus abfärbte. Dieser lässt sich unterteilen in (1) uneigentliches Sprechen, wobei das Gegenteil des Gesagten gemeint ist, (2) den Gebrauch von Litotes und Untertreibungen sowie (3) absichtliche Vereinfachungen. Morus greift in seiner Widmung an RuthallRuthall, Thomas auf das gesamte lukianische Repertoire zurück, wenn er auf die Leichtgläubigkeit der Menschen und deren Missbrauch durch verquere religiöse Praktiken, die von Predigern und Hagiographen entworfenen Fiktionen über Märtyrerviten, welche die einfachen Gemüter zum Narren halten sollen, sowie auf die Kluft zwischen konventionellen und authentischen Werten aufmerksam macht.11
Morus verwendet in seinen Schriften oft den Distanzierungsmechanismus der Ironie, um zu verdeutlichen, dass der Idealzustand niemals vollkommen erfüllt, sondern immer nur approximiert werden kann. Diese Ansicht vertritt bereits LukianLukian von Samosata, wenn er etwa von paradoxen Sprechsituationen (z.B. im Muscae EncomiumLukian von SamosataMuscae Encomium oder in den menippeischen Dialogen) und von Charakteren, die den Typus des philosophus gloriosus verkörpern (z.B. im CynicusLukian von SamosataCynicus und im PhilopseudesLukian von SamosataPhilopseudes), Gebrauch macht, was für Morus – nicht zuletzt dank seines Theaterfaibles und seiner späteren rhetorischen Schulung im Genre der declamatio – sehr attraktiv gewesen sein dürfte. In der Tat zählte diese Art des geistigen Exerzitiums, also der gedanklichen Abarbeitung an einer komplexen hypothetischen Fragestellung im Rahmen eines argumentum fictum in utramque partem zu einer von Morus liebsten Freizeitbeschäftigungen, wie ErasmusErasmus von Rotterdam voller Bewunderung in einem Brief an Ulrich von HuttenHutten, Ulrich von (1519) erläutert:
Primam aetatem carmine potissimum exercuit, mox diu luctatus est ut prosam orationem redderet molliorem, per omne scripti genus stilum exercens. […] Declamationibus praecipue delectatus est, et, in his, materiis adoxis, quod in his acrior sit ingeniorum exercitatio. Unde adolescens etiamnum dialogum moliebatur, in quo PlatonisPlaton communitatem ad uxores usque defendit. […] Vix alium reperias qui felicius dicat ex tempore: adeo felici ingenio felix lingua subservit. Ingenium praesens et ubique praevolans, memoria parata; quae cum omnia habeat velut in numerato, prompte et incontanter suggerit quicquid tempus aut res postulat.12
Er widmete seine Jugend vor allem der Dichtkunst, bald darauf rang er lange darum, seine Prosa in eine geschmeidigere Form zu bringen, indem er seinen Stil in allen Gattungen übte. […] Besonders erfreute er sich an den Deklamationen, zumal an absurden Themenstellungen, die der allgemeinen Meinung zuwider liefen, weil er darin eine größere intellektuelle Herausforderung sah. Als junger Mann versuchte er sich sogar an einem Dialog, in dem er die platonischePlaton Frauengemeinschaft verteidigte. […] Man findet kaum einen anderen, der geschickter im improvisierten Sprechen ist: Seine Sprache dient so erfolgreich seinem hochbegabten Verstand. Sein Scharfsinn ist allgegenwärtig und eilt überall voraus, wohl geschult ist sein Erinnerungsvermögen, das alles wie auf Abruf bereit hat; unverzüglich und mühelos gibt es genau das wieder, was die Zeit oder die Umstände erfordern.
Wie ErasmusErasmus von Rotterdam hier unmissverständlich klarstellt, erlaubte die declamatio durch ihr schützendes fiktives Korsett das gedankliche Experimentieren mit Themen, die der Intuition und der communis opinio zuwider liefen. Je unglaubwürdiger das Sujet anmutete, desto verdienstvoller war die Leistung des erfolgreichen Deklamators zu bewerten. Im Falle des jungen Morus, der eine Vorliebe für diese materiae adoxae zu haben schien, bestand sein erstes Herantasten an die Utopia-Thematik in dem Entwurf einer Verteidigungsrede für die in der PoliteiaPlatonPoliteia (Pol. 5,451c–461ePlatonPoliteiaPol. 5,451c–461e) propagierte Frauengemeinschaft. Dieses Unterfangen setzte eine fundierte Kenntnis von PlatonsPlaton Staatsentwurf sowie eine Vertrautheit mit gängigen Rhetoriktraktaten der klassischen Antike – z.B. CicerosCicero, Marcus Tullius De inventioneCiceroDe inventione (87–83 v. Chr.), der pseudo-ciceronianischen Rhetorica ad Herennium (85–80 v. Chr.) und QuintiliansQuintilian (Marcus Fabius Quintilianus)Institutio OratoriaQuintilianInstitutio Oratoria (ca. 94 n. Chr.) – voraus.
Auf ebendieses theoretische Fundament in der Disputierkunst konnte Morus zurückgreifen, als er sich – zumal auf Drängen seines Vaters, der sich für seinen Sohn einen solideren Brotberuf als die klassische Philologie wünschte – seine juristische Expertise im New Inn (1494–1496) und im Lincoln’s Inn (1496–1501) erwarb und damit zwei führende rechtswissenschaftliche Fakultäten im damaligen London besuchte. Obwohl er bei seinem Abschlussexamen reüssierte und sich bald als erfolgreicher Rechtsanwalt und Unterhändler einen Namen machte, hegte Morus Zweifel, ob er sein weiteres Leben gänzlich der Jurisprudenz widmen wollte. Da er dem monastischen Ideal nicht abgeneigt war, verweilte er zwischenzeitlich als Postulant bei den Kartäusern im London Charterhouse, wo er sogar das Priesteramt in Erwägung zog. Auf Einladung des William GrocynGrocyn, William, seines ehemaligen Mentors und Griechischdozenten aus Oxford, der nunmehr als Spiritus Rector der Church of St. Lawrence Jewry fungierte, hielt Morus in dieser Zeit eine gelungene Vortragsreihe über De civitate DeiAugustinus von HippoDe civitate Dei (entstanden 413–426 n. Chr.), das 22 Bücher umfassende Monumentalwerk des AugustinusAugustinus von Hippo (Kirchenvater), in welchem der Kirchenvater in struktureller Anlehnung an PlatonsPlatonPoliteiaPlatonPoliteia den irdischen Staat (civitas terrena) mit dem Gottesstaat (civitas Dei/caelestis) kontrastiert, wobei er die politische Vergangenheit des römischen Reiches thematisiert und als christliche Heilsgeschichte neu aufrollt. Es steht außer Zweifel, dass Morus’ eingehende Auseinandersetzung mit De civitate Dei prägend für den Entwurf der Utopia war: Im augustinischen Staatsentwurf ist die Dichotomie zweier Welten in transzendentaler Form bereits angelegt.13
Auf diese kontemplative Lebensphase, in der Morus eingehend über die philosophia Christi, die Erbsünde und die gesellschaftsverzerrenden Effekte korrupter sozialer Institutionen sowie verdorbener menschlicher Gewohnheiten reflektieren konnte, folgte nach seinem Entschluss gegen die Priesterschaft eine erneute geistige Hinwendung zu seinem Freundes- und Gelehrtenkreis aus Oxford und London: Gemeinsam mit John ColetColet, John, William GrocynGrocyn, William und Thomas LinacreLinacre, Thomas widmete er sich dem Florentiner Neuplatonismus, wobei er besonders an der Figur des Giovanni Pico della MirandolaMirandola, Giovanni Pico della (1463–1494) Gefallen fand, dessen Vita von seinem Neffen Gianfrancesco PicoMirandola, Gianfrancesco Pico della auf Latein verfasst und erstmals im Jahre 1496 in Bologna gedruckt worden war.
Da Morus Zugriff auf die Bibliothek des Klosters Syon in Isleworth (London) hatte, in dem der Druck nachweislich vorhanden war, widmete er sich der Übersetzung der Pico-Biographie ins Englische, der er den Titel The Life of John Picus Erle of Myrandula (1505) gab. Nach sorgsamer Selektionierung und Auslassung gewisser Aspekte der lateinischen Fassung, z.B. der von Gianfrancesco PicoMirandola, Gianfrancesco Pico della eingestreuten Hinweise auf Girolamo SavonarolaSavonarola, Girolamo,14 verwandelte Morus die ihm vorliegende Vita in das Porträt eines Gelehrten, der das Ideal eines in sich gekehrten Weisen verkörperte: Als wissbegieriges „Wunderkind“ hatte sich Pico della MirandolaMirandola, Giovanni Pico della bereits in jungen Jahren mit der Theologie und der Philosophie befasst, die seiner Ansicht nach nur verschiedene Artikulationen einer einzigen übergeordneten Wahrheit waren, weswegen er 1486 den Versuch unternahm, neunhundert Thesen öffentlich zu verteidigen, die dem Christen- und Judentum, der platonischen und aristotelischen Philosophie sowie den Offenbarungslehren des Hermetismus, des Zoroastrismus, des Orphismus und der Kabbala entnommen waren. Weil dieses Unterfangen bei Papst Innozenz VIII.Innozenz VIII. (Papst) wenig Anklang fand, unterband er die öffentliche Disputation und ließ den auf der Flucht befindlichen PicoMirandola, Giovanni Pico della in der Nähe von Lyon verhaften. Durch die Gunst des französischen Königs Karl VIII.Karl VIII. (König von Frankreich) erlangte er bald seine Freiheit wieder und verbrachte die Zeit bis an sein Lebensende in der ländlichen Umgebung von Ferrara, wo er sich von säkularen Ambitionen loslöste, sich dem Dominikanerorden anschloss und im Gedenken an die Passion Christi regelmäßig Selbstgeißelungen praktizierte. Als höchst produktiver Autor konstatierte er mehrmals den freien Willen, den das Individuum durch eine Hingabe an Gott spirituell sublimieren oder durch ein Hinabsinken in die Welt der Begierden verlieren konnte. Um seine moralische Integrität vor den verderblichen Einflüssen der Außenwelt zu schützen, pflegte er keinen Umgang mit Frauen und verzichtete freiwillig auf sein materielles Erbe – eine Geste, die Morus in der Profilierung seines Protagonisten der Utopia wieder aufgreift.15
2.1.2 Die Wahl der vita activa und die Entwicklung zu einem politischen Schriftsteller
Durch seinen beruflichen Werdegang und durch seine Entscheidung zur Familiengründung repräsentierte Thomas Morus einen diametralen Gegensatz zu Pico della MirandolaMirandola, Giovanni Pico della. Anfangs dürfte er sehr mit der Wahl des politischen Lebens und wohl auch mit seiner Sexualität gehadert haben. Er ernährte sich enthaltsam, schlief nicht mehr als fünf Stunden pro Nacht auf dem Boden oder einem aus Holzscheiten notdürftig zusammengezimmerten Bett, um nicht der Todsünde der Trägheit zu verfallen, und legte sich regelmäßig ein Büßerhemd an, um sich in Demut zu üben und sich den sinnlichen Begierden zu entziehen.1
Trotz dieser Vorkehrungen konnte er seine melancholische Ader nicht unterdrücken, ganz im Gegenteil – er durchlebte in seinen Zwanzigern eine Sinnkrise, wie ein Brief an den Theologen John ColetColet, John (datiert auf den 23. Oktober 1504) bezeugt: In diesem klagt Morus über die Einsamkeit in London, die er in Abwesenheit seines Freundes und Mentors verspüre, sowie über die Verlockungen und Trugbilder der rastlosen Stadt, die keinen Gestaltungsraum für ein tugendhaftes Leben ließen. So sei er zum dauerhaften Aufenthalt in der Unterwelt, dem lasterhaften London, verdammt.2
Trotz dieser eskapistischen Tendenzen und ernsthafter Versuche, einen asketischen Lebensstil zu pflegen, entschied sich Morus gegen das Priesteramt, weil er sich – wie Erasmus von RotterdamErasmus von Rotterdam in seiner für Ulrich von HuttenHutten, Ulrich von verfassten Kurzbiographie (1519) berichtet – nach einer Ehe sehnte:
Interim et ad pietatis studium totum animum appulit, vigiliis, ieiuniis, precationibus aliisque consimilibus progymnasmatis sacerdotium meditans. Qua quidem in re non paulo plus ille sapiebat quam plerique isti qui temere ad tam arduam professionem ingerunt sese, nullo prius sui periculo facto. Neque quicquam obstabat quo minus sese huic vitae generi addiceret, nisi quod uxoris desyderium non posset excutere. Maluit igitur maritus esse castus quam sacerdos impurus.3
In der Zwischenzeit lenkte er seinen ganzen Sinn auf das Studium der Frömmigkeit und bereitete sich durch Nachtwachen, Fasten, Gebete und ähnliche Übungen auf das Priestertum vor. In dieser Hinsicht zeigte er weit mehr Weisheit als die meisten von denen, die sich leichtfertig in einen so anspruchsvollen Beruf stürzen, ohne zuvor irgendein persönliches Opfer gebracht zu haben. Nichts hinderte ihn daran, sich diesem Lebensstil zu widmen, außer der Tatsache, dass er sein Verlangen nach einer Frau nicht unterdrücken konnte. Also zog er es vor, ein keuscher Ehemann zu sein, als ein unreiner Priester zu werden.
Ab 1504 war Morus Parlamentsmitglied und ab 1505 mit Joan ColtColt, Joan verheiratet, mit der er drei Töchter (MargaretRoper, Margaret, ElisabethMore, Elisabeth und CecilyMore, Cecily) und einen Sohn (John) hatte. Nach dem Tod seiner ersten Gattin, die er, wie William RoperRoper, William in seiner Biographie berichtet, geheiratet hatte, obwohl er Joans jüngere Schwester wesentlich attraktiver fand, nahm Morus 1511 die wohlhabende Witwe Alice MiddletonMiddleton, Alice zur Frau, die eine Tochter (Alice) in die Verbindung mitbrachte; diese zweite Ehe, die primär aus ökonomischen Erwägungen geschlossen wurde, weil Morus eine Ersatzmutter für seine Kinder und eine Hausverwalterin suchte, die in seiner Absenz allfällige adminstrative Agenden übernehmen konnte. Diese zweite Ehe währte bis an sein Lebensende, blieb aber kinderlos.4
Dass Morus’ politisches Engagement nicht immer von Erfolg gekrönt war, belegt eine nicht mehr exakt zu rekonstruierende Auseinandersetzung mit Heinrich VII.Heinrich VII. (König von England), im Zuge derer er sich gegen die exorbitant hohen Steuerveranschlagungen des Königs ausgesprochen hatte: Morus soll sich beispielsweise geweigert haben, eine gewisse Geldsumme für Prinzessin Margaret aus der Staatskassa zu liquidieren, mit der eine Reise nach Schottland zu König James IV.James IV. (König von Schottland), ihrem vorgesehenen Gemahl, finanziert werden sollte. Morus begründete seine Intervention mit dem Argument, dass Margaret diese Reise bereits angetreten habe, da die arrangierte Hochzeit schon ein Jahr zuvor (1503) stattgefunden habe, wodurch er den Zorn von Heinrich VII. auf sich zog, der eine einstweilige Verfügung ausstellen und sogar eine Inhaftierung des Vaters, Sir John MoreMore, John, in Auftrag geben ließ. Dass der britische Humanist nicht zuletzt infolge dieses Konflikts große Ressentiments gegen opportunistische Monarchen und deren schamlose Ausnutzung ihrer königlichen Privilegien hegte, bezeugen einige seiner lateinischen Epigramme, in denen er die Willkür der Tyrannei kritisch beleuchtet und für einen konsultativen Führungsstil plädiert.5 Stellvertretend für eine Reihe bemerkenswerter Gedichte sei an dieser Stelle ein Achtzeiler mit dem Titel Ad aulicum (Epigr. 162) zitiert, in dem die lyrische persona den Adressaten, einen unbedarften Höfling, vor den Gefahren warnt, die in der Entourage eines wankelmütigen Königs entstehen können:
Saepe mihi iactas faciles te ad principis aures
Libere et arbitrio ludere saepe tuo.
Sic inter domitos sine noxa saepe leones
Luditur, ac noxae non sine saepe metu.
Infremit incerta crebra indignatio causa
Et subito mors est, qui modo lusus erat.
Tuta tibi non est, ut sit secura voluptas.
Magna tibi est, mihi sit dummodo certa minor.6
Oft prahlst du mir gegenüber, dass dir die Ohren des Königs geneigt sind und dass du mühelos, frei und nach deinem eigenen Willen mit ihm scherzen kannst. So spielt man auch mit gezähmten Löwen – oft unverletzt, aber nicht unbesorgt. Häufig brüllt er vor Empörung aus einem ungewissen Grund, und plötzlich wird das zum tödlichen Ernst, was gerade noch ein Spaß war. Deine Unterhaltung ist nicht so frei von Gefahr, dass sie dich von deinen Sorgen befreien könnte. Zwar ist dein Vergnügen groß und meines klein, dafür aber ist es mir sicher.
Während der Schauplatz, i.e. der königliche Hof, hier mit einem Raubtiergehege verglichen wird, in dem ein unberechenbarer Löwe umherschweift, der den Herrscher symbolisiert, treibt Morus als poeta doctus sein eigenes Spiel, das sich an drei Facetten des Verbs ludere und des dazugehörigen Substantivs lusus festmachen lässt: Zunächst wird dadurch die Perspektive des Höflings fokussiert, der sich über jeden Zweifel erhaben wähnt und sich damit brüstet, durch seine Beratertätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf den Machthaber auszuüben (iactas libere ludere). Im nächsten Gedanken wird diese Position durch das Hinzutreten des Vergleichs mit dem Löwen dahingehend relativiert, dass es sich um ein riskantes Unterfangen handle, das in einer kontinuierlichen Provokation mit unsicherem Ausgang bestehe (luditur non sine saepe metu) und aus dem in Sekundenschnelle bitterer Ernst werden könne (et subito mors est, quimodo lusus erat). Dass der Umschwung vom Glück ins Unglück nur einen Wimpernschlag entfernt ist, wird durch die changierenden Attribute, die dem Substantiv voluptas jeweils beigeordnet sind, verdeutlicht: Auch wenn man als Berater vereinzelt große Erfolge verbuchen könne, sei man stets der Willkür des Herrschers ausgeliefert (non tuta / non secura / magna voluptas). Daher sei das geringere, aber sichere Vergnügen, das man nur mit der nötigen Distanz gewinnen könne, zu bevorzugen (certa / minor voluptas). Diese ironische Analyse politischer Verblendung ist ein Indiz dafür, dass Morus bereits in jungen Jahren subtile Nuancen des lukianischen Humors so sehr verinnerlicht hatte, dass er selbst Epigramme mit dieser spezifischen satirischen Prägung verfassen konnte.7 Zudem bezeugt sein ununterbrochenes literarisches Schaffen, dass er selbst in einer politisch sehr bewegten Zeit den klassischen Studien nicht abtrünnig wurde, auch wenn er zeitgleich diverse Verpflichtungen als Jurist und königlicher Berater zu erfüllen hatte.
Als ambitioniertestes literarisches Unterfangen des Thomas Morus vor der Abfassung der Utopia gilt The History of King Richard III. (Historia Richardi Regis Angliae Eius Nominis Tertii), ein zwischen 1513 und 1518 auf Englisch und Latein verfasster unvollendeter politischer Essay, der in parabelhafter Form vor den Gefahren der Tyrannei warnt. Die kritische Darstellung, die aufgrund ihres polarisierenden Inhalts erst posthum publiziert wurde und später William ShakespeareShakespeare, William als Inspiration für sein Drama The Tragedy of King Richard the Third (1597) diente, konzentriert sich auf die letzten Lebensjahre des Königs, der als ein machthungriger, janusgesichtiger, skrupel- und gottloser Herrscher porträtiert wird, der nicht einmal davor zurückgeschreckt sei, seine eigenen Neffen inhaftieren und ermorden zu lassen, um sich die Thronfolge zu sichern. Morus betont in der Charakterisierung Richards III. vor allem seine bis zur Perversion perfektionierte Verstellkunst, seine doppelzüngige Rhetorik und seine launenhafte Unberechenbarkeit.8 Intertextuell verwertet Morus in seiner Verfallsanalyse nicht nur ThukydidesThukydides, TacitusTacitus (Publius Cornelius Tacitus) sowie einige kulturpessimistische Thesen des SallustSallust (Gaius Sallustius Crispus), die dieser in seiner Coniuratio CatilinaeSallustConiuratio Catilinae (Cat. 7SallustConiuratio CatilinaeCat. 7, Cat. 11–12SallustConiuratio CatilinaeCat. 11–12) artikuliert, sondern er thematisiert anhand der Karriere von Richard III.Richard III. (König von England) auch die verheerenden Effekte unbändiger Machtgier, libido dominandi – ein Leitmotiv, das auch AugustinusAugustinus von Hippo (Kirchenvater) in seiner De civitate DeiAugustinus von HippoDe civitate Dei (1,29–30, 3,14Augustinus von HippoDe civitate DeiCiv. 1,29–30, 3,14) verwendet, um die vermeintlich lineare Erfolgsgeschichte des römischen Reichs zu dekonstruieren. Abgesehen davon, dass sein politischer Essay von literarischen Anspielungen auf die klassische Antike saturiert ist, honoriert Morus darin die diplomatischen Bemühungen von Kardinal MortonJohn Morton (Erzbischof von Canterbury), der aufgrund persönlicher Differenzen zum Erzfeind von Richard III.Richard III. (König von England) wurde, sich mit Heinrich VII.Heinrich VII. (König von England) aus der Tudor-Dynastie verbündete und nach seiner Thronbesteigung (1485) zu dessen politischem Berater, zum Erzbischof von Canterbury (1486) sowie zum Kardinalpriester der Basilica di Sant’Anastasia in Rom (1493) erhoben wurde.9
2.1.3Die Freundschaft zu ErasmusErasmus von Rotterdam und das Wirken im internationalen Gelehrtenkreis
Neben der Bewunderung für seinen ehemaligen Patronus John MortonJohn Morton (Erzbischof von Canterbury) übte die Freundschaft zu ErasmusErasmus von Rotterdam, die durch die gemeinsame Tätigkeit der beiden Humanisten als LukianLukian von Samosata-Übersetzer eine erste Blütephase erlebt hatte, einen nachhaltigen Einfluss auf Morus aus: Er war früh mit dessen Erstlingswerken De taedio IesuErasmus von RotterdamDe taedio Iesu (1501), Enchiridion militis ChristianiErasmus von RotterdamEnchiridion militis Christiani (1503) sowie den ständig wachsenden AdagiaErasmus von RotterdamAdagia (Adagiorum Collectanea: 1500; Adagiorum Chiliades: 1508 und 1515; mehrere Editionen in Basel: 1517–1528; Adagiorum Opus: 1533) sowie der Institutio Principis ChristianiErasmus von RotterdamInstitutio Principis Christiani (1516) vertraut und hielt ihm durch beständige briefliche Korrespondenzen die Treue.
Als besonderes geistesgeschichtliches Testimonium ihrer Beziehung darf die Laus StultitiaeErasmus von RotterdamLaus Stultitiae (griechisch: Μωρίας ἘγκώμιονErasmus von RotterdamΜωρίας Ἐγκώμιον (Laus Stultitiae)) gelten, deren Erstfassung ErasmusErasmus von Rotterdam





























