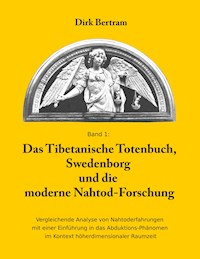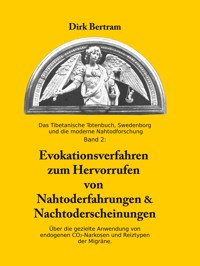
Evokationsverfahren zum Hervorrufen von Nahtoderfahrungen & Nachtoderscheinungen E-Book
Dirk Bertram
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Das Tibetanische Totenbuch, Swedenborg und die moderne Nahtodforschung
- Sprache: Deutsch
Vorbemerkung: Da Band 2 eine ausführliche Einführung in das Nahtod-Erfahrungs-Phänomen enthält, kann Band 2 auch ohne Kenntnis von Band 1 gelesen bzw. verstanden werden. Der nun vorliegende Band 2 befasst sich mit den Ursachen der beeindruckenden Übereinstimmungen in den Texten des Tibetanischen Totenbuchs, den Jenseits-Beschreibungen Emanuel Swedenborgs und modernen Nahtodberichten, wie sie im ersten Band "Das Tibetanische Totenbuch, Swedenborg und die moderne Nahtod-Forschung - eine vergleichende Analyse ..." aufgezeigt wurden. (Hinweis: zu Band 1 gibt es eine ausführliche Lesung des Swedenborg-Zentrums Berlin). Bestätigte sich in Band 1, dass Berichte über Nahtoderlebnisse offensichtlich kulturell und zeitlich unabhängig einheitlich sind, so wird in diesem Band konkret dargelegt, welche Mittel bzw. Techniken von den Begründern des Tibetanischen Totenbuchs und Swedenborg angewandt wurden, um Nahtod-Erfahrungen hervorzurufen. Wie detailliert nachgewiesen wird, fungierten hierbei schwere Funktions-Störungen und Ausfälle des Gehirns durch selbsterzeugte (endogene) CO2-Narkosen (als Folge exzessiv ausgeführter Atem-Unterdrückung, Atem-Verlängerung bzw. Pranayama) und/oder selbstinduzierte Migräne im fernöstlich klassischen Yoga & bei Swedenborg für das Hervorrufen von Nahtod-Erfahrungen als Auslöser. In diese Beweisführung einbezogen wurde auch Dr. Raymond Moodys Evokationsverfahren zum Hervorrufen von Nachtod-Begegnungen & Nahtod-Erfahrungen, das Moody in seinem Buch "Blick hinter den Spiegel" vorstellt. Anhand von Ausführungen des Neurologen Dr. Oliver Sacks, die in seinem Buch Migräne zu finden sind, lässt sich eindeutig nachweisen, dass auch Moody für das von ihm entwickelte Evokationsverfahren sog. Reiztypen der Migräne verwendete, um bei seinen Probanden "Mini-Nervenzusammenbrüche" hervorzurufen, die ihm als Voraussetzung für Nachtod-Begegnungen und Nahtod-Erfahrungen dienten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Das Phänomen der Nahtod-Erfahrungen
1. Saboms Studie zu Nahtod-Erfahrungen
1.1 Motivation: Von Moody inspiriert
1.2 Konzeption der Studie
1.2.1 Zielsetzung
1.2.2 Definition einer lebensbedrohlichen Krise
1.3 Ergebnisse
1.3.1 Das autoskopische Sterbeerlebnis
1.3.2 Autoskopische Operations-Erlebnisse
1.3.3 Autoskopische KP-Reanimationsbeschreibungen mit genauen Einzelheiten
1.4 Schlussfolgerungen
2. Nahtod-Erfahrungen als veränderte Bewusstseinszustände
2.1 Ursachen und Merkmale veränderter Bewusstseinszustände
2.2 Keine Nahtod-Erfahrungen bei Sauerstoffmangel
2.3 Nahtod-Erfahrungen infolge von CO2-Intoxikation
2.4 Bewusstsein in Narkose und Schlaf
2.5 Nahtod-Erfahrungen ohne Todesnähe
2.6 Neurophysiologische Voraussetzungen für Bewusstsein
3. Hirnphysiologische Funktionsstörungen und NahtodErfahrungen
3.1 Narkose und Koma als Hauptverursacher von NahtodErfahrungen
3.2 Neuronale Störungen und Ausfälle als Ursache von NahtodErfahrungen
Kapitel ll
Narkose und Koma als Ursache von Nahtod-Erfahrungen
4. CO2-Narkose durch Atemdepression
4.1 Betäubende Wirkung reduzierter Atmung im Yoga
4.1.1 CO
2
-Narkose infolge extrem niedriger Atemfrequenzen
4.1.2 Atemdepression bis zur Unmerklichkeit
4.1.3 Narkose und Nahtod-Erfahrungen als Ziel der Atemdepression
4.2 Yoga als Grundlage des Tibetanischen Totenbuchs
4.2.1 Bisherige Ergebnisse
4.2.2 Padmasambhava, der Begründer des Tibetanischen Totenbuchs
4.2.3 CO2-Narkose zum Hervorrufen von Jenseits-Visionen
4.3 Atemdepression bei Swedenborg
5. Erinnerung an Nahtod-Erfahrungen
5.1 Häufigkeit erinnerter Nahtod-Erfahrungen
5.2 Erinnerungsvermögen im luziden Traum
5.2.1 Luzides Träumen im REM-Schlaf
5.2.2 Beispiele luziden Träumens
5.3 Atemdepression und CO2-Narkose im Traum
5.3.1 Traum-Yoga
5.3.2 Atemsteuerung im luziden Traum
5.3.3 Meditation und Atemsteuerung im Yoga
5.4 Yoga-Erfahrungsinhalte im Tibetanischen Totenbuch
6. Wachbewusste Erfahrungen trotz funktionaler Störungen des Gehirns
6.1 Luzide Träume in koma-/narkoseähnlichen Zuständen
6.2 Kommunikation (Bewusstsein) und reduzierte Signalweiterleitung (physiologische Bewusstlosigkeit)
6.3 Luzides Träumen: Bewusstsein trotz hirnphysiologischer Bewusstlosigkeit
6.4 Wachkoma: Bewusstsein trotz hirnphysiologischer Bewusstlosigkeit
6.4.1 Nachweis von Bewusstsein bei Wachkoma-Patienten
6.4.2 Der Fall „Carol“
6.4.3 John Eccles: Autarker Geist
6.4.4 Der Fall „Juan“
Kapitel III
Migräne als Auslöser von Nahtod-Erfahrungen
7. Migräne
7.1 Was ist Migräne?
7.2 Migräne als häufigste psychosomatische Reaktion
7.3 Migräne-Aura
7.4 Phasen der Migräne-Aura
7.4.1 Einfache und geometrische Halluzinationen
7.4.2 Form-Konstanten durch Selbst-Organisation
7.4.3 Vollständig ausgebildete Halluzinationen der Migräne
7.5 Migräne-Auren der Hildegard von Bingen
7.6 Auslöser der Migräne
7.6.1 Arousal-Migränen
7.6.2 Ermattungs-Migränen und ›Crash‹-Reaktionen
7.6.3 Situation nachlassender Spannung
7.6.4 Resonanz-Migräne
8. Moodys Verfahren zur Kommunikation mit Verstorbenen
8.1 Motivation
8.2 Möglichkeiten der Kristallomantie
8.3 Versuchsaufbau
8.4 Begegnung mit Verstorbenen unter Laborbedingungen
8.5 Moodys Selbstversuch
9. Migräne-Auren im Vorfeld von Jenseits-Erfahrungen
9.1 Auftreten klassischer Migräne-Auren in Moodys Evokationsverfahren
9.1.1 Halluzinosen der Migräne
9.1.2 Auftreten von Nahtod-Erfahrungen in evozierten Nach-Tod-Begegnungen
9.2 Migräne-Auren im Yoga
9.2.1 Geometrische Halluzinosen
9.2.2 Vollständig ausgebildete Halluzinationen im Yoga
9.3 Nutzung Migräne auslösender Reize bei Moody und im Yoga
9.3.1 Konzentrierte Schau auf leuchtenden Gegenstand
9.3.2 Moody: Veränderte Bewusstseinszustände
9.3.3 Umstandsbedingte Migräne
9.3.4 Situation nachlassender Spannung
9.3.5 Resonanz-Migräne
9.4 Unterschätzte Faktoren: Synergie und Einwirk-Dauer
Epilog
Anhang
A. Saboms Fallbeispiele 2 und 3
B. Bericht von Dr. Elisabeth Kübler-Ross
C. Helen Aintree
Literaturverzeichnis
Kapitel l
Dar Phänomender Nahtod-Erfahrungen
1. Saboms Studie zu Nahtod-Erfahrungen
Der Öffentlichkeit wenig bekannt ist die Tatsache, dass zur Thematik der Todesnähe-Erfahrungen neben einer Reihe deskriptiver, das Nah-Tod-Erfahrungs-Phänomen beschreibender Arbeiten sowie analytisch vergleichender Untersuchungen auch medizinisch-klinische Studien zum Nahtodphänomen vorliegen.1 Mit Blick auf medizinisch-klinische Studien sei an dieser Stelle neben Dr. Michael Saboms Studie, der wir uns im folgenden noch ausgiebig zuwenden werden, auf eine weitere bedeutsame medizinisch-klinische Studie hingewiesen, und zwar auf die des niederländischen Kardiologen Dr. Pim van Lommel, deren Ergebnisse unter dem Original-Titel „Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring“2 erschienen.
1.1 Motivation: Von Moody inspiriert
Eine der eindrucksvollsten medizinisch-klinischen Studien zum Nahtod-Erfahrungsphänomen wurde zwischen 1976 und 1981 durchgeführt. Als sich der US-amerikanische Kardiologe Dr. Michael B. Sabom, der Initiator der weltweit ersten medizinisch-klinischen Studie zu Nahtod-Erfahrungen, veranlasst sah, sich der Nahtod-Erfahrungsthematik zu stellen, empfand er alles andere als Begeisterung für seinen neuartigen Forschungsgegenstand, ein Umstand, auf den Dr. Sabom in seinem Buch zur Studie „Erinnerung an den Tod – Eine medizinische Untersuchung“, das 1982 erschien, an mehreren Stellen hinweist:
„[…] Obwohl ich in einer religiösen Familie groß geworden war, hatte ich immer versucht, Religion und Wissenschaft auseinanderzuhalten. Für mich diente damals der christliche Glaube an ein Fortleben nach dem Tod lediglich dem Zweck, irdisches Verhalten in richtige Bahnen zu lenken und den Menschen die Angst vor dem Sterben und dem Tod zu nehmen; derartige Lehren waren für mich also subjektiv und unwissenschaftlich.“ (Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 14.)
„Als ich im Frühjahr 1976 zum ersten Mal das Buch Leben nach dem Tod3 las, waren für mich [...] diese Erlebnisse nichts anderes als ›eine neue Phantasterei‹, die die Phantasie der Öffentlichkeit und der Medien anregen sollte…“ (Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 199.)
„[…] Mein wissenschaftlich indoktrinierter Geist konnte einfach keine ernsthafte Beziehung zu der weit hergeholten Beschreibung von Geistern im Jenseits und dergleichen mehr herstellen […]“ (Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 15.)
Stellt sich somit die Frage, welche Motive Dr. Sabom dazu bewegten, ausgerechnet über diesen ursprünglich von ihm selbst als Phantasterei eingestuften Gegenstand eine umfangreiche, mehrjährig akribisch geführte Studie zu initiieren. In seinem Buch gibt uns Sabom Einblicke über die Ereignisse, die seinen Gesinnungswandel herbeiführten:
„1976 beendete ich das erste Jahr meiner kardiologischen Studien an der University of Florida in Gainesville. Ich beschäftigte mich sehr intensiv mit den Feinheiten der klinischen Kardiologie und entwickelte dabei eine Vorliebe für ganz bestimmte Forschungsrichtungen auf diesem Gebiet. Damals schlossen sich meine Frau und ich auch einer lokalen Methodistengemeinde an. An einem Sonntagmorgen im Frühjahr dieses Jahres machte uns Sarah Kreutziger, eine in Psychiatrie ausgebildete Sozialarbeiterin an einer Universität, in unserer Sonntagsschule für Erwachsene auf ein Buch aufmerksam, das ihr bedeutsam erschien. Das Buch, Leben nach dem Tod von Dr. Raymond Moody, befasste sich mit seltsamen Erlebnissen von Leuten, die beinahe gestorben wären. Die meisten Mitglieder der Sonntagsschule zeigten sich stark interessiert. Meine eigene Reaktion dagegen war alles andere als enthusiastisch. Mein wissenschaftlich indoktrinierter Geist konnte einfach keine ernsthafte Beziehung zu der weit hergeholten Beschreibung von Geistern im Jenseits und dergleichen mehr herstellen. Da ich an jenem Morgen der einzige Arzt in der Gruppe war, wurde ich am Ende von Sarahs Ausführungen um meine Meinung gefragt. Das Höflichste, das mir damals einfiel, war: »Ich glaube das alles nicht.«
Ein paar Tage später rief mich Sarah an. Sie hatte eine Einladung angenommen, Moodys Buch einem größeren Gemeindepublikum vorzustellen, und wollte mich als medizinischen Fachmann bei der Veranstaltung dabei haben. Ich sagte ihr noch einmal, wie skeptisch ich Moodys Erkenntnissen gegenüberstand, sie ließ jedoch nicht locker und beruhigte mich damit, dass meine Aufgabe hauptsächlich darin bestehen würde, medizinische Fragen abzublocken, die bei einem derartigen Thema mit Sicherheit gestellt würden. Zögernd sagte ich zu.
Zur Vorbereitung auf unser Gespräch lieh mir Sarah ihr Exemplar von Leben nach dem Tod, da das Buch erst kurz vorher erschienen und in den Buchläden von Gainesville noch nicht erhältlich war. Ich las es aufmerksam von der ersten bis zur letzten Seite, blieb aber bei meiner Überzeugung, dass es sich bei dem Inhalt um reine Erfindung handle. Kurze Zeit danach traf ich mich mit Sarah zur Vorbereitung der Präsentation. Um den Vortrag etwas untermauern zu können, beschlossen wir eine kurze Befragung einiger unserer Krankenhauspatienten, die ähnlich wie die Leute in Moodys Buch eine lebensbedrohende Krise durchgemacht hatten. Wir vereinbarten sie zu fragen, ob sie irgendwelche Erlebnisse gehabt hätten, während sie bewusstlos gewesen und im Sterben gelegen waren. Falls niemand ein solches Erlebnis gehabt hatte (womit ich mit Sicherheit rechnete), konnten wir unseren Zuhörern zumindest berichten, dass wir gefragt hätten. Sollten wir dennoch durch irgendeinen Zufall Kenntnis von einem Erlebnis erlangen, so konnten wir dieses zur Ausschmückung unserer Präsentation verwenden.
Es war für uns beide nicht schwierig, Patienten zu finden, die eine lebensbedrohende Krise durchgemacht hatten. Sarah hatte tägliche Kontakte zu Kranken in der Dialyseabteilung. Viele von ihnen litten schon lange an Nierenversagen und waren deshalb schon mehr als einmal dem Tod nahe gewesen. Ich dagegen betreute eine Vielzahl von Patienten, die nach einem Herzstillstand wiederbelebt worden waren. Wir begannen mit unseren Interviews.
Bei dem dritten Patienten, an den ich mich wandte, handelte es sich um eine Hausfrau mittleren Alters, die, wie aus ihrer Krankengeschichte hervorging, bereits mehrmals aus den verschiedensten Gründen sterbenskrank gewesen war. Damals lag sie im Krankenhaus, um sich einigen diagnostischen Routinetests zu unterziehen. Ich traf mich mit ihr gegen 20 Uhr in ihrem Zimmer, und wir hatten ein längeres Gespräch über medizinische Einzelheiten ihrer früheren Krankheiten. Schließlich fragte ich sie, ob sie während der Zeit, in der sie bewusstlos und in der ihr Zustand kritisch gewesen war, irgendwelche Erlebnisse gehabt habe. Nachdem sie davon überzeugt war, dass es sich bei mir nicht etwa um einen Psychiater handelte, der sich als Kardiologe ausgab, beschrieb sie mir das erste Sterbeerlebnis, das ich in meiner medizinischen Laufbahn zu hören bekam. Zu meinem grenzenlosen Erstaunen deckten sich die Einzelheiten mit denen in Leben nach dem Tod. Ich war außerdem stark beeindruckt von der Ernsthaftigkeit der Patientin sowie von der tiefen Wirkung, die das Erlebnis auf sie gemacht hatte. Am Ende des Interviews hatte ich das bestimmte Gefühl, dass es sich bei dem, was mir diese Frau berichtet hatte, um einen ganz persönlichen Einblick in einen medizinischen Aspekt handelte, von dem ich nichts wusste.
Noch am selben Abend informierte ich Sarah. Ihre Ergebnisse waren ähnlicher Natur – sie stammten von einem Patienten mit chronischem Leber- und Nierenversagen. Wir beschlossen, die Berichte für unsere Buchpräsentation auf Band aufzunehmen. Unsere beiden Patienten stimmten zu, wollten jedoch ihre Anonymität gewahrt wissen.
Die Vorstellung des Buches Leben nach dem Tod mit den auf Band aufgenommenen Berichten unserer zwei Patienten in dem bis zum Bersten gefüllten Saal erregte großes Aufsehen. Für mich war damit der Fall erledigt, denn ich war der Meinung, das Versprechen, das ich Sarah gegeben hatte, mehr als nur eingelöst zu haben…“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 15 ff.)
Dieser Absicht entgegen kehrten Saboms Gedanken in den folgenden Wochen immer wieder an die von ihm interviewte Patientin und die Auswirkungen, die ihr Erlebnis auf ihr Leben gehabt hatte, zurück. Auf der Suche nach der Bedeutung dieser Erfahrung wandte sich Sabom erneut Moodys Buch zu:
„Ich nahm mir noch einmal Moodys Buch vor. Nach wie vor störte mich einiges an dem Material und der Art und Weise, wie es dargeboten wurde. So waren beispielsweise die Fälle in Leben nach dem Tod mehr oder weniger zufällig und unsystematisch gesammelt worden. Viele der Berichte stammten von Leuten, die mit Moody nach einem seiner Vorträge Kontakt aufgenommen hatten. Es ließ sich also nicht feststellen, ob ihre Aussagen authentisch waren oder ob es sich dabei um nachkonstruierte Geschichten handelte. Weiterhin räumte Moody ein, 150 Personen für das Buch interviewt, aber nur einen kleinen Teil der Berichte aufgenommen zu haben. Es erhob sich somit die Frage, ob alle 150 Berichte in die beschriebenen Muster passten oder nur einige wenige, die folglich nicht als repräsentativ für die Gesamtzahl angesehen werden konnten. Wer waren außerdem die Leute, die von diesen Erlebnissen berichtet hatten, aus welchen sozialen Verhältnissen stammten sie, welchen Beruf übten sie aus und welcher Religion gehörten sie an? Vor allem wollte ich als Arzt natürlich auch Einzelheiten darüber erfahren, was zu den Sterbeerlebnissen geführt hatte. All diese Auslassungen störten mich doch sehr. Moody selbst gestand viele dieser Fallen seines Werkes in einer Erklärung am Ende von Leben nach dem Tod ein: »Ich bin mir bei der Abfassung dieses Buches sehr wohl der Tatsache bewusst gewesen, dass meine Absicht und meine Perspektiven sehr leicht missverstanden werden können. Ich möchte vor allem wissenschaftlich ausgerichteten Lesern sagen, dass es sich bei dem, was ich zusammengetragen habe, um keine wissenschaftliche Studie handelt.«
Zur Beantwortung meiner Fragen war eine ›wissenschaftliche Studie‹ erforderlich. Ich beschloss, einen Versuch zu wagen […]“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 17 f.)
Im Hinblick auf die Grundlagen der von ihm beabsichtigten Studie legte Sabom besonderes Augenmerk auf eine klassisch wissenschaftliche Vorgehensweise. In seinem Buch zur Studie gewährt er uns einen Eindruck, mit welcher akademischen Grundeinstellung die von ihm beabsichtigte Studie initiiert und schließlich nach fünf Jahren Forschungsarbeit auch abgeschlossen wurde:
„Und ich hatte mir fest vorgenommen, niemals unwissenschaftlich zu sein. Meine jahrelange medizinische Ausbildung hatte mich zu der Überzeugung gebracht, dass man früher oder später eine Antwort auf die meisten, wenn nicht sogar auf alle offenen Fragen des Universums finden werde, wenn man wissenschaftlich vorgehe, sich also der Laborforschung bediene. Es gab also keine unerklärbaren Phänomene, sondern lediglich ›wissenschaftliche Fakten‹, die erst noch entdeckt werden mussten. Man musste lediglich den richtigen wissenschaftlichen Weg finden, dann würde man auch eine Antwort bekommen.
Wie jeder Student, der schon einmal einen wissenschaftlichen Kurs belegt hat, weiß, besteht die wissenschaftliche Forschungsmethode aus einer systematischen Sammlung objektiver Beobachtungen, sogenannter ›Daten‹. Aber nur wirklich methodisch und unvoreingenommen gesammelte und präsentierte Daten werden von der Wissenschaft akzeptiert. In der Medizin hat die Anwendung von Erkenntnissen, die auf solchen Daten basieren, in jüngster Zeit zu großen Fortschritten auf dem Gebiet der Diagnose und der Behandlung geführt. Der Arzt, der aus den bekannten wissenschaftlichen Daten eines Krankheitsprozesses Nutzen zu ziehen weiß, hat demnach die besten Chancen, eine solche Krankheit erfolgreich zu behandeln.
In den ersten Semestern meines Medizinstudiums machte ich mir diese grundlegende Logik der wissenschaftlichen Methode im Hinblick auf die Diagnose und Behandlung von Krankheiten sehr stark zu eigen. Ich fühlte mich besonders zu den Aspekten der Medizin hingezogen, die sich mit der Sammlung und Auswertung messbarer physiologischer Daten beschäftigten. Dies war der Grund, weshalb ich mich in den späteren Jahren meiner Ausbildung dem Untergebiet der Kardiologie zuwandte – einer präzisen technologischen Disziplin, die sehr stark auf die Erfassung und Interpretation physiologischer Daten und deren Anwendung auf Herzkrankheiten und Herzfunktionsstörungen aufbaut. Für den modernen Kardiologen, dem diese Daten zur Verfügung stehen, sind Erkrankungen des Herzens wie ein Puzzle, dessen Teile den messbaren Druck in den vier Herzabschnitten (die mathematischen Formeln, mit denen sich aufgrund dieses Drucks die Herzfunktion berechnen lässt, sowie die speziellen Röntgentechniken, die eine anatomische Beschreibung von Herzkrankheiten ermöglichen) einschließen. Ich war darüber hinaus zu der Erkenntnis gelangt, dass für gültige Aussagen über alle Naturphänomene erst einmal sorgfältig sachdienliche Daten gesammelt werden müssen, von denen dann später Schlüsse und Vermutungen abgeleitet werden können.“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 14 f.)
1.2 Konzeption der Studie
1.2.1 Zielsetzung
Von besagter klassisch wissenschaftlichen Methodik überzeugt, begann Sabom mit seinen Vorbereitungen zur weltweit ersten klinisch-medizinischen wissenschaftlichen Studie des Nahtod-Erfahrungs-Phänomens:
„[…] Ich setzte mich mit Sarah in Verbindung, und diese erklärte mir ihre Bereitschaft, mitzumachen. Aufgrund unserer früheren Interviews wussten wir, dass wir ohne weiteres Zugang zu einer Vielzahl von Patienten mit lebensbedrohenden Krankheiten hatten und so die idealen Voraussetzungen gegeben waren, eine derartige Untersuchung durchzuführen. Wir waren beide aktiv mit der Beratung bzw. Behandlung dieser Patienten beschäftigt und brauchten deshalb keine besondere Erlaubnis, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Weiterhin waren wir sowohl den Patienten als auch dem Pflegepersonal bekannt und liefen somit nicht Gefahr, für außenstehende Forscher gehalten zu werden, die um eines außergewöhnlichen Zweckes willen plötzlich auf der Bildfläche erschienen.
Ich besprach mit Sarah meine Haupteinwände gegen Moodys Buch, und davon ausgehend entwickelten wir unsere Studie, die auf der Beantwortung von sechs Fragen aufbaute. Zuerst wollten wir sicherstellen, dass es zu diesen Sterbeerlebnissen wirklich kam, wenn sich die Patienten in kritischem Zustand befanden und dem Tode nahe waren. Wir hatten ja bereits zwei Fälle gefunden, aber wir brauchten viele, um davon überzeugt sein zu können, dass es tatsächlich einheitliche Erlebnisse gab. Ursprünglich wollten wir zwanzig oder dreißig Kranke interviewen und unsere gewonnen Erkenntnisse dann als Vorabbericht in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlichen.
Als zweites wollten wir den Inhalt persönlich gesammelter Fälle sorgfältig untersuchen und unsere Ergebnisse anschließend mit Moodys anekdotenhaften Beschreibungen von Sterbeerlebnissen in Leben nach dem Tod vergleichen. Folgten diese Erlebnisse einem einheitlichen Muster oder wichen sie von Person zu Person sehr stark voneinander ab?
Drittens, wie häufig ist das Sterbeerlebnis? Zur Beantwortung dieser Frage musste eine Gruppe von Leuten, die dem Tod nahe gewesen waren, interviewt werden, ohne dass Sarah oder ich im voraus wussten, ob es bei ihnen zu Sterbeerlebnissen gekommen war. Die Häufigkeit der Erlebnisse konnte dann durch einen Vergleich der Zahl der Personen, die von einem Sterbeerlebnis berichteten, mit der Gesamtzahl der interviewten Patienten, die dem Tode nahe gewesen waren, bestimmt werden. Ein solches Vorgehen bezeichnet man als prospektive Studie.
Viertens, welchen Bildungsstand, welchen Beruf, welchen sozialen Status und welche Religionszugehörigkeit hatten die Personen, die ein Sterbeerlebnis gehabt hatten, als sie an der Schwelle des Todes gestanden waren? Ließen sich aus diesen Informationen Schlüsse ziehen, warum einige derartige Erlebnisse haben, andere dagegen nicht? Weiterhin, wurde das Auftreten von Sterbeerlebnissen durch medizinische Gegebenheiten, beispielsweise durch die Art der lebensbedrohenden Krise, durch die Dauer der Bewusstlosigkeit oder durch die Methode der Wiederbelebung beeinflusst?
Fünftens, wirkten sich Bildungsstand, der Beruf, der soziale Status und die Religionszugehörigkeit des Patienten sowie die Art der lebensbedrohenden Krise auf den Inhalt des Sterbeerlebnisses aus? Beschrieb zum Beispiel nur jemand, der streng religiös war, ein Wesen aus Licht und eine wunderschöne jenseitige Szenerie? Stammten plausible außerkörperliche Schilderungen von Wiederbelebungstechniken ausschließlich von gebildeten, informierten Patienten, die sich einiges Wissen darüber angelesen oder in Laienkursen über pneumokardiale Wiederbelebung und dergleichen mehr angeeignet hatten? Warfen nur Leute, die längere Zeit bewusstlos waren, einen Blick ins ›Jenseits‹?
Sechstens, war die verminderte Angst vor dem Sterben, welche die von Moody interviewten Leute zum Ausdruck brachten, das Ergebnis des Sterbeerlebnisses oder ging sie lediglich darauf zurück, dass diese Leute dem Tod noch einmal entronnen waren?
Ein anderer Punkt beschäftigte mich schon, seitdem ich Moodys Buch gelesen hatte. Er bemerkte, dass sich viele Leute ganz konkret an Dinge erinnert hätten, die in der Nähe ihres physischen Körpers passiert waren, als sie allem Anschein nach bewusstlos gewesen waren. Diese Erinnerung bestand sogar aus optisch wahrgenommenen Einzelheiten. Moody versuchte jedoch nicht, diese Berichte durch medizinische Unterlagen und andere verfügbare Quellen zu untermauern. Die Mehrzahl der Patienten, die ich interviewen wollte, war nach einem Herzstillstand wiederbelebt worden. Ich war damals schon an weit über hundert solcher Wiederbelebungen beteiligt gewesen und wusste ganz genau, was dabei vorging. Ich wartete deshalb schon voller Spannung auf den Augenblick, in dem ein Patient behaupten würde, er habe ›gesehen‹, was in seinem Zimmer während seiner eigenen Wiederbelebung passiert sei. Sollte es dazu kommen, so wollte ich ganz genau nach Einzelheiten fragen, die einem Nichtmediziner normalerweise unbekannt waren. Ich wollte also meine Erfahrung als ausgebildeter Kardiologe den angeblich optischen Erinnerungen von Laien gegenüberstellen. Dabei, so war ich überzeugt, würde es zu offensichtlichen Ungereimtheiten kommen, und aus den visuellen Beobachtungen des Patienten würden sehr schnell bloße Vermutungen werden.
Nachdem sich Sarah und ich über die Ziele unserer Studie einig geworden waren, besprachen wir die Kriterien für die Auswahl der Patienten. Da das Material sehr subjektiv war, beschlossen wir keine Patienten zu befragen, von denen bekannt war, dass sie an einer psychischen Krankheit oder an irgendeiner geistigen Störung litten. Wir mussten zumindest sicherstellen, dass unsere Probanden geistig normal waren, bevor wir ihre Aussage in unsere Studie aufnahmen. Das war die einzige Einschränkung, die wir machten. Meine Aufgabe würde es sein, mit Patienten Kontakt aufzunehmen, die in der internistischen Intensivstation der beiden Kliniken der University of Florida – Shands und Veteran Administration – eine lebensbedrohende Krise durchgemacht hatten. Sarah dagegen wollte sich um Fälle in der Dialyseabteilung des Shands sowie um solche kümmern, auf die sie bei ihrer allgemeinen Beratung von Schwerkranken stieß.“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 18 ff.)
1.2.2 Definition einer lebensbedrohlichen Krise
Da die beabsichtigte Studie im Wesentlichen auf Aussagen von Menschen aufbauen sollte, die eine lebensbedrohende Krise überstanden hatten, galt es einzugrenzen bzw. zu definieren, was unter einer Krise im Sinne der Studie zu verstehen sei. Wie im Folgenden ersichtlich, lässt sich dieser für die Studie wichtige Zustand nicht so leicht definieren, wie dies auf den ersten Blick scheinen mag:
„Eine Krise schloss für uns alle Krankheiten und Vorfälle ein, bei denen ein Patient bewusstlos geworden und dem Tode nahe gewesen war. Wie und nach welchen Kriterien sollten wir jedoch die Bewusstlosigkeit definieren und feststellen? Die Frage beschäftigte mich deshalb, weil es keine allgemeinverbindliche medizinische oder wissenschaftliche Definition der Bewusstlosigkeit gab, die sich unter Einsatz objektiver wissenschaftlicher Techniken verifizieren ließ. Selbst Anästhesiologen, denen alle klinischen Möglichkeiten (einschließlich der Enzephalographie) zur Verfügung stehen, sind oft nicht in der Lage, trotz genauester Beobachtung den Grad des Bewusstseins (oder der Bewusstlosigkeit) von narkotisierten Patienten zu bestimmen.4
Aus zahllosen Berichten in der medizinischen Literatur geht hervor, dass sich Patienten, die angeblich tief in Narkose lagen, hinterher an starke Schmerzen und Angstzustände auf dem Operationstisch erinnern konnten, weil sie in Wirklichkeit gar nicht ganz betäubt gewesen waren.5 Die gleichen Schwierigkeiten, den Zustand der Bewusstlosigkeit zu definieren, haben auch Psychologen und Physiologen, die außerhalb des Krankenhauses tätig sind. Für unsere Studie einigten wir uns darauf, unter ›Bewusstlosigkeit‹ den Zeitraum zu sehen, in dem jemand weder seine Umgebung noch sein eigenes Ich subjektiv wahrgenommen hatte. In der Laiensprache wird dieser Zustand sehr häufig als ›Blackout‹ bezeichnet.
Unsere Patienten mussten jedoch nicht nur bewusstlos, sondern auch dem Tod nahe gewesen sein. Sie mögen sich fragen, ob dies dem ›klinischen Tod‹ entspricht. Leider wird der Begriff ›klinischer Tod‹ in letzter Zeit so unüberlegt verwendet, dass er seine präzise Bedeutung verloren hat. Eine, wenn auch schon alte Definition stammt von Professor Negowskii, einem russischen Wissenschaftler. Dieser stützte sich dabei auf eine Reihe physiologischer Versuche, die im Laboratorium für experimentelle physiologische Wiederbelebung an der Akademie der medizinischen Wissenschaften in der UdSSR durchgeführt worden waren. Von einem tödlichen Blutverlust bei Hunden ausgehend, definierte er den ›klinischen Tod‹ folgendermaßen:
»Der klinische Tod ist ein Zustand, bei dem es keine äußeren Lebenszeichen (Bewusstsein, Reflexe, Atmung und Herztätigkeit) mehr gibt, bei dem jedoch der Organismus als ganzer noch nicht tot ist; es kommt weiterhin zu Stoffwechselprozessen im Gewebe, und es ist unter bestimmten Gegebenheiten möglich, alle Funktionen des Organismus zu reaktivieren. In anderen Worten, dieser Zustand ist bei entsprechenden therapeutischen Maßnahmen reversibel. Kommt es beim klinischem Tod zu keinem Eingriff in den natürlichen Ablauf, so folgt ein irreversibler Zustand – der biologische Tod. Der Übergang vom klinischen zum biologischen Tod ist gleichzeitig ein Ende und ein kontinuierlicher Prozess, denn es ist bereits in seiner Anfangsphase unmöglich, alle Funktionen des Organismus, einschließlich der des zentralen Nervensystems, vollständig zu reaktivieren, es ist jedoch noch möglich, den Organismus teilweise, bei veränderten Funktionen der Hirnrinde, zu aktivieren, d.h. unter Bedingungen, die keine natürlichen Existenzbedingungen sind. Man kann also noch ganz bestimmte Organe reaktivieren, wozu man später keine Möglichkeit mehr hat. Während des biologischen Todes setzt der für einen toten Organismus typische Abbau des Stoffwechselprozesses ein ... Aus dem reichlichen, von verschiedenen Autoren zusammengetragenen experimentellen Material geht hervor, dass beim klinischen Tod die Hirnrinde eines Erwachsenen nur dann wieder voll funktionsfähig gemacht werden kann, wenn der Zustand nicht länger als fünf bis sechs Minuten gedauert hat.«6“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 21 f.)
Dr. Sabom merkt zu obigen Ausführungen folgendes an:
„Bei der Definition dieses russischen Wissenschaftlers handelt es sich um eine präzise Beschreibung eines spezifischen physiologischen Zustandes. Heutzutage wird der Begriff ›klinischer Tod‹ jedoch bei einer Vielzahl von medizinischen und nichtmedizinischen Gegebenheiten verwendet: bei Herz- und Atmungsstillstand, bei Koma mit fortdauernder Herz- und Atmungstätigkeit, bei Reaktionslosigkeit aufgrund einer einfachen, komplikationslosen Ohnmacht, bei alkoholbedingter Regungslosigkeit und so weiter: Noch weiter kompliziert wird das Problem durch die Tatsache, dass es auch den Begriff ›Hirntod‹ gibt; damit bezeichnen Mediziner bei Patienten, die sie für unrettbar halten, sehr häufig einen irreversiblen, allgemeinen Funktionsstillstand des Gehirns (also ein ›flaches Elektroenzephalogramm [EEG]‹) – selbst wenn das Herz noch schlägt. Legt man Negowskiis Definition zugrunde, so ist ein ›hirntoter‹ Patient klinisch nicht tot, weil die normale Herztätigkeit andauert, er gilt aber andererseits oft als ›so tot‹, dass von lebenserhaltenden medizinischen Maßnahmen abgesehen wird. Wegen dieser offensichtlichen terminologischen Konfusion entschieden wir uns dafür, Patienten auszuwählen, die für uns physisch dem Tode nahe gewesen waren – die sich also in einem körperlichen Zustand befunden hatten, der auf eine unfallbedingte oder anderweitige extreme physiologische Katastrophe zurückgegangen war, bei dem in der Mehrzahl der Fälle mit dem irreversiblen biologischen Tod gerechnet werden muss und der dringend medizinischer Behandlung erfordert, so dies möglich ist. Dieser Zustand schloss Herzstillstand, schwere traumatische Verletzungen sowie tief komatöse Zustände, die auf eine Stoffwechselstörung oder auf eine systemische Krankheit zurückzuführen waren, und dergleichen mehr ein.“ (Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 22 f.)
1.3 Ergebnisse
Die Fülle von Daten, die in den nun folgenden fünf Jahren Forschungsarbeit zusammengetragen wurden, ist immens. Um einen kurzen, effizienten Überblick der von Sabom initiierten und mit Sarah Kreutziger durchgeführten Pionierarbeit zu ermöglichen, sei an dieser Stelle die von Sabom in seinem Buch zur Studie angeführte Inhaltsangabe wiedergegeben:
„2. Allgemeine Merkmale des Sterbeerlebnisses .......... 31 Unaussprechlichkeit 32 · Gefühl der Zeitlosigkeit 33 · Gefühl der Realität 33 · Gefühl des Todes 34 · Vorherrschende Gefühle 36 · Trennung vom physischen Körper 40
3. Das autoskopische Sterbeerlebnis .......... 43 ›Optisch‹ wahrgenommene Einzelheiten 47 · Akustische Wahrnehmungen 51 · Kommunikationsversuche 52 · ›Gedankenreise‹ 54 · Die Rückkehr 54 · Das Erzählen von Erlebnissen 57
4. Das transzendente Sterbeerlebnis .......... 59 Die finstere Region oder Leere 62 · Licht 64 · Die transzendente Landschaft 66 · Begegnungen 69 · Lebensrückblick 73 · Die Rückkehr 74 · Das kombinierte Sterbeerlebnis 76
5. Analyse der Daten .......... 79
Wie häufig ist das Sterbeerlebnis? 80 · Das Sterbeerlebnis – wer hat es und unter welchen Umständen? 81 · Variiert der Inhalt des Sterbeerlebnisses bei Gruppen mit verschiedenen lebensbedrohenden Krisen? 84 · Beeinflusst das Sterbeerlebnis die Todesfurcht oder den Glauben an ein Leben nach dem Tod? 85 · Zusammenfassung
6. Operationserlebnisse
Das autoskopische Operationserlebnis 90 · Das transzendente Operationserlebnis
7. Das autoskopische Sterbeerlebnis: Tatsache oder Phantasie?
Autoskopische Beschreibung ohne genaue Einzelheiten 117 · Autoskopische Beschreibung mit genauen Einzelheiten 119 · Schlussfolgerungen
8. ›Nacherlebnisse‹: Erneute autoskopische Erlebnisse
9. Auswirkungen des Sterbeerlebnisses
Auswirkungen für den einzelnen 163 · Auswirkungen auf die medizinische Betreuung 174 · Auswirkungen innerhalb des Gebiets des Todes und des Sterbens 189 · Der ›Lebenswille‹
10. Erklärungen
Zustand des Halbbewusstseins 202 · Bewusste Erfindung 206 · Unterbewusste Erfindung 209 · Entpersönlichung 212 · Autoskopische Halluzinationen 216 · Träume 218 · Vorfreude 220 · Drogenbedingte Wahnvorstellungen oder Halluzinationen 222 · Endorphinausschüttung 226 · Schläfenlappenanfall 229 · Veränderte Bewusstseinszustände
11. Gedanken über die Bedeutung des Sterbeerlebnisses
Anhang
Erklärung der statistischen Methoden
Tabelle I: Biographische Daten der Interviewten
Tabelle II: Biographische Daten von prospektiv interviewten Patienten: Vergleich zwischen Gruppen mit und ohne Sterbeerlebnis
Tabelle III: Biographische Daten von Patienten in ›Vorkenntnis‹ – Kontrollstudie
Tabelle IV: Umstände der lebensbedrohenden Krisen
Tabelle V: Umstände der operationsbedingten Krisen
Tabelle VI: Umstände der lebensbedrohenden Krisen bei prospektiv Interviewten, nicht operierten Patienten: Vergleich zwischen Gruppen mit und ohne Sterbeerlebnis
Tabelle VII Umstände weiterer lebensbedrohender Krisen
Tabelle VIII: Typ und Elemente des Sterbeerlebnisses
Tabelle IX: Elemente des Sterbeerlebnisses und die Häufigkeit ihres Vorkommens in 61 nichtoperativen Fällen
Tabelle X: Biographische Daten von 61 nichtoperierten Personen, die von einem Sterbeerlebnis berichteten: Vergleich zwischen Gruppen mit Hinblick auf die Elemente 1-10
Tabelle XI: Umstände der lebensbedrohenden Krise bei 61 nichtoperierten Personen, die von einem Sterbeerlebnis berichteten: Vergleich zwischen Gruppen mit Hinblick auf die Elemente 1-
Tabelle XII: Beschreibung der transzendenten Landschaft
Tabelle XIII: Begegnung während des transzendenten Sterbeerlebnisses
Tabelle XIV: Auswirkungen der lebensbedrohenden Krise auf die Todesfurcht und den Glauben an ein Leben nach dem Tod
Tabelle XV: Nachfolgestudie über Auswirkungen der lebensbedrohenden Krise auf die Todesfurcht von 44 Personen
Anmerkungen im Text .......... 279“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 5 ff.)
1.3.1 Das autoskopische Sterbeerlebnis
Im Rahmen der von Dr. Sabom durchgeführten Studie beschrieben zweiunddreißig Personen ihr Sterbeerlebnis so, als ob sie sich in einem vom physischen Körper befreiten/losgelösten Zustand befanden und hierbei ihren Körper, Gegenstände als auch Ereignisse in der Nähe ihres physischen Körpers „optisch“ wahrgenommen hätten. Da der von Sabom zur Bezeichnung besagten Vorganges (der ein Selbstbetrachtungs-Element beinhaltet) verwendete Begriff „autoskopisch“ bzw. „autoskopisches Sterbeerlebnis“ zum Zeitpunkt seiner Studie nicht gebräuchlich war, jedoch sinnvoll erschien, geht Sabom im Folgenden auf die Gründe ein, die ihn bewegten, diesen Begriff in den wissenschaftlichen Diskurs einzuführen:
„[…] Autoren vor mir haben in dieser Phase des Sterbeerlebnisses ein ›außerkörperliches‹ Erlebnis gesehen. Und die Beschreibung der körperlichen Trennung und der optischen Wahrnehmung des physischen Ich und seiner Umgebung von einer anderen, erhöhten Stellung aus passt auch gut in die Vorstellung von einem außerkörperlichen Erlebnis. Wir werden jedoch noch sehen, dass auch eine andere Phase des Sterbeerlebnisses (nämlich die transzendenten Elemente) von Menschen, die dem Tode nahe waren, so beschrieben wird, als habe sie sich ›außerhalb ihres Körpers‹ abgespielt. ›Außerkörperlich‹ kann sich somit auf alle Phasen des Sterbeerlebnisses beziehen. Da meine Analyse der Erlebnisse in späteren Kapiteln die Selbstbetrachtungselemente getrennt von den anderen (transzendenten) Elementen behandelt, habe ich mich entschlossen, die Phase, um die es in diesem Kapitel geht, als autoskopisch zu bezeichnen.“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 46 f.)
Dr. Sabom weist darauf hin, dass von zweiunddreißig Personen, die über autoskopische Sterbeerfahrungen berichteten, der weitaus überwiegende Anteil, neunundzwanzig Personen, von optisch deutlich wahrgenommenen Einzelheiten berichtete. Lediglich drei Personen hatten den Eindruck, ihre optischen Wahrnehmungen hätten unklar gewirkt. Doch auch in diesen Fällen zeigten sich erstaunliche Einzelheiten, so auch im folgenden von Sabom aufgeführten Fallbeispiel:
„[…] Im Dezember 1977 wurde ein 66jähriger Postangestellter mit einem schweren Herzanfall in die Notaufnahme der University of Florida eingeliefert. Während er untersucht wurde, kam es bei ihm zu einem längeren Herzstillstand, und es bedurfte acht Stromstöße, um sein Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Als ich ihn kurz danach interviewte, erzählte er mir, er sei, nachdem er das Bewusstsein verloren habe, in der Tür der Notaufnahme gestanden und habe seine Wiederbelebung beobachtet. Obwohl er alles »etwas verschwommen« wahrgenommen hatte, habe er dennoch, wie er mir sagte, die Schläge auf seine Brust gesehen (»die haben wie verrückt auf meine Brust eingeschlagen«), und er konnte sich auch noch daran erinnern, von welcher Größe und Farbe die Defibrillatorelektroden waren, und wie sein Körper auf die künstliche Beatmung und auf die Stromstöße reagiert hatte. (I-13)“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 47 f.)
Für Dr. Saboms Forschungen von besonderem Wert erwiesen sich autoskopische Eindrücke, die von Berichterstattern vollständig klar zur „optischen“ Wahrnehmung gelangten, wie folgende Beobachtung eines 44jährigen Mannes, der im Zuge einer stationären Behandlung auf der Intensivstation einen Herzanfall mit Herzstillstand erlitt. Seine Wiederbelebung erfolgte durch mehrfach verabreichte Defibrillation. Obwohl dieser Mann bis zum Zeitpunkt des von Sabom mit ihm geführten Interviews noch keinen Defibrillator in Betrieb gesehen hatte, erinnerte sich der Patient, neben weiteren konkreten Einzelheiten, auch an verschiedene Zeigerpositionen des Defibrillators zur Zeit der an ihm durchgeführten Reanimation:
»Es war fast so, als ob ich abgetrennt war, auf der Seite stand und alles beobachtete, nicht als Beteiligter, sondern als unbeteiligter Zuschauer ... Sie hoben mich hoch und legten mich auf das Sperrholz. Dann fing Dr. A. mit der Herzmassage an. Ich bekam Sauerstoff, durch einen dieser kleinen Nasenschläuche, den nahmen sie mir dann aber raus und setzten mir eine Maske auf, so eine, die Mund und Nase bedeckt. Sie funktionierte irgendwie mit Druck ... eine weiche Plastikmaske, hellgrün ... Ich erinnere mich noch daran, dass sie den Wagen ranfuhren, auf dem der Defibrillator stand, das Ding mit den Elektroden ... Er hatte einen Zähler, der war quadratisch und hatte zwei Zeiger, der eine stand still und der andere schlug aus ... Er schlug ziemlich langsam aus, nicht so schnell wie bei einem Strommesser oder Spannungsmesser oder so ... Beim ersten Mal blieb er zwischen ⅓ und ½ stehen. Sie machten es noch einmal, und diesmal ging er über ½ hinaus, und beim dritten Mal stand er ungefähr bei ¾ ... Er [der Defibrillator] hatte viele Skalen ... Und dann waren da auch noch die beiden Elektroden mit den Drähten ... Sie sahen aus wie Scheiben mit Griffen ... Ich glaube, an den Griffen waren kleine Knöpfe ... Ich konnte sehen, wie ich durchgeschüttelt wurde.« (I-32)“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 48.)
Auf Seite → seines Buches zur Studie nimmt Dr. Sabom rückblickend auf diesen und weitere Fallbeispiele autoskopischer Reanimationswahrnehmungen wie folgt Stellung:
„Kommentar: Aus den Krankenhausunterlagen ging hervor, dass es bei diesem Mann am zweiten Tag seiner stationären Behandlung auf der Intensivstation zu einem Herzstillstand gekommen war und dass er durch Defibrillation wiederbelebt worden war. Leider enthielten die Unterlagen keine weiteren Angaben über die KPR-Prozedur [Kardio-Pulmonale-Reanimations-Prozedur].
Die Beschreibung, die der Mann von seiner Wiederbelebung gab, entspricht genau dem Verfahren, das ein qualifiziertes Team auf einer Intensivstation in der Regel anwendet. Besonders fasziniert war ich von der Beschreibung der Zeiger bei der Aufladung des Defibrillators. Diese Aufladung erfolgt erst unmittelbar vor der Defibrillation, da das Gerät bei unsachgemäßer Behandlung eine große Gefahr darstellt.
War es möglich, dass dieser Mann durch seine Ausbildung zum Air-Force-Piloten so viel von KPR-Instrumenten und -Methoden wusste, dass er in der Lage war, eine ganz genaue Beschreibung seiner eigenen Wiederbelebung zu geben, ohne sie tatsächlich gesehen zu haben? Während des Interviews hatte er zahlreiche medizinische Ausdrücke (»Lidocain«, »Defibrillator«, »Wattsekunden« usw.) benutzt, die darauf hindeuteten, dass er einiges von Medizin verstand. Als ich ihn daraufhin ansprach, erklärte er mir, er habe genau zugehört, was während seines autoskopischen Sterbeerlebnisses gesprochen worden sei, und er erinnere sich noch an einen Großteil der Gespräche, die die Ärzte und Schwestern geführt hatten. (»Dann hörte ich, dass sie irgendetwas von Wattsekunden in Zusammenhang mit dem Defibrillator sagten – Watt oder Wattsekunden«.) Er bestritt ganz energisch, jemals schon eine KPR-Prozedur beobachtet oder einen Defibrillator in Funktion gesehen zu haben. Aus dem Interview und auch aus nachfolgenden Gesprächen gewann ich den Eindruck, dass der Mann keinerlei Grund hatte, in diesem Punkt die Unwahrheit zu sagen. Ich bin deshalb der Meinung, weil er während all unserer Unterhaltungen ständig die Bedeutung seines eigenen Erlebnisses herunterspielte. Er war sich zwar ziemlich sicher, dass er seine eigene Wiederbelebung so beobachtet hatte, als ob er »abgetrennt« gewesen und »auf der Seite« gestanden war, und dass seine Beobachtungen real gewesen waren, er war jedoch von dem Geschehen als solchem kaum beeindruckt. Er gehörte unter den von mir interviewten Personen zu den wenigen, für die ihr Sterbeerlebnis nichts Ungewöhnliches war:
»Es ist wie ein Traum. Man ist vom Körper losgelöst und betrachtet ihn wie ein Zuschauer ... Die einzige Erklärung, die ich habe, ist die, dass das Gehirn noch funktioniert, obwohl es teilweise tot ist oder nicht genug Sauerstoff bekommt. Alle glauben, man sei bereits hinüber, aber man nimmt seine Umwelt noch wahr, auch wenn man nicht sprechen und sich nicht bewegen kann ..., optisch und akustisch. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Meine Einstellung zum Leben, zum Tod und zum Jenseits hat sich dadurch nicht verändert. Es ist eins von den Dingen im Leben, die man nicht erklären kann.«
Auch zweieinhalb Jahre nach unserem ersten Gespräch hatte sich in der Einstellung dieses Mannes zu seinem Sterbeerlebnis noch nichts geändert.“ (Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 137 f.)
Detaillierte „optische“ Wahrnehmungen im Rahmen einer lebensbedrohenden Krise dokumentiert auch das folgende, von Sabom aufgeführte Beispiel einer 37jährigen Patientin, die während eines Klinikaufenthaltes, in Verbindung mit einer bereits 17 Jahre zurückliegenden Schwangerschaftsintoxikose, eine Grand-mal-Attacke erlitt. Die während des epileptischen Anfalls gemachten Wahrnehmungen erweckten in dieser Frau den Eindruck, „in einer Theaterloge zu sitzen und hinunterzuschauen“:
»Ich wusste, dass irgendetwas passieren würde ..., und dann wurde ich bewusstlos ..., und ich schaute hinunter und konnte sehen, wie ich von Krämpfen geschüttelt wurde. Ich drohte aus dem Bett zu fallen, und das Mädchen im Bett daneben schrie nach den Schwestern ... Eine Schwester packte mich und legte mich zurück, und dann waren da auch noch zwei weitere Schwestern, und eine rannte weg und holte einen Zungenspachtel. Und sie klappten die Seitenteile am Bett hoch und riefen nach dem Arzt ... Es war ein Gefühl der Höhe, der großen Entfernung, das Gefühl, leicht zu sein, ich hatte den Eindruck in einer Theaterloge zu sitzen und hinunterzuschauen und alles zu beobachten. Ich war irgendwie losgelöst und beobachtete praktisch jemand anderes, so, wie man sich beispielsweise einen Film anschaut ... Ich war ruhig und entspannt, ich empfand ein Gefühl der Behaglichkeit ... Alles war deutlich zu sehen, wie beim Fernsehen ... Es war kein schöner Anblick für mich, wie sich mein Körper im Bett herumwarf, ... und das Mädchen im Bett nebenan bekam es mit der Angst zu tun ... Die Krämpfe dauerten nicht sehr lange, und dann erinnere ich mich erst wieder daran – ich weiß nicht, wie dieses Überwechseln vor sich geht –, dass ich am nächsten Morgen aufwachte und wieder in mir drin war.«“ (Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 49.)
1.3.2 Autoskopische Operations-Erlebnisse
Im Rahmen der von Sabom geführten Studie wurden auch Patienten befragt, bei denen sich im Zuge einer Operation lebensbedrohende Komplikationen einstellten. Dreizehn von einer lebensbedrohenden Krise betroffene Patienten berichteten von autoskopischen und/oder transzendenten Erfahrungen. Es zeigte sich jedoch, dass im Operationskontext evozierte Sterbeerlebnisse unter Berücksichtigung der StudienVorgabe aus der Gesamtgruppe der Sterbeerlebnisse herausgelöst werden mussten:
„[…] Unter einer solchen Krise verstanden wir jeden körperlichen Zustand, bei dem es zu einer physischen Bewusstlosigkeit kommt und bei dem in der Mehrzahl der Fälle mit dem irreversiblen biologischen Tod gerechnet werden muss, wenn nicht sofort eine medizinische Behandlung erfolgt. Zu den Leuten, die wir befragten, gehörten natürlich auch solche, bei denen es während einer schweren Operation zu lebensbedrohenden Komplikationen gekommen war. Wir mussten jedoch erkennen, dass es unmöglich war festzustellen, ob die Bewusstlosigkeit während einer Operation auf die lebensbedrohende Krise als solche oder auf die verabreichten Narkotika zurückzuführen war. Waren beispielsweise die starken Blutungen, die bei einer Nephrektomie (Nierenentfernung) aufgrund der unabwendbaren Milzverletzung auftraten, so stark, dass ein sonst wacher Patient das Bewusstsein verlor? Wir wussten es einfach nicht. Auf jeden Fall aber war eine Krise während einer Operation nicht voll und ganz mit unserer Definition einer lebensbedrohenden Krise in Einklang zu bringen. Wir lösten diese Operationserlebnisse aus der Gesamtgruppe der Sterbeerlebnisse heraus und beschäftigten uns mit ihnen separat…“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 89.)
Sabom weist zudem darauf hin, dass die Umstände, unter denen Operationserlebnisse auftraten, äußerst uneinheitlich waren. So berichteten bspw. drei Patienten von Erlebnissen, obwohl sich zur Zeit der an ihnen durchgeführten Operation keinerlei Komplikationen einstellten und folglich ein lebensbedrohender Zustand ausgeschlossen werden musste:
„[…] Diese Erlebnisse deckten sich inhaltlich sehr stark mit denen von Personen, die nicht operiert worden waren. Wir bekamen sowohl von autoskopischen als auch von transzendenten Erlebnissen Kenntnis […]“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 90.)
(Wie wir noch sehen werden, stieß Sabom im Verlauf seiner Studie auf weitere Nahtod-Erfahrungsinhalte, ohne dass die hiervon Betroffenen zur Zeit ihrer Erfahrungen im medizinischen Sinne vom Tode bedroht waren.)
Im Rahmen von Operations-Erlebnissen richtete sich Saboms besonderes Augenmerk auf jene Erlebnisse, in denen Patienten behaupteten, ihre Operation von der Decke des Operationssaales aus ›beobachtet‹ zu haben. Derartige autoskopische Operationserlebnisse boten für ihn die Möglichkeit, die dort behaupteten autoskopischen Erlebnisinhalte mit dem vom Chirurgen angefertigten Operations-Protokoll konkret abzugleichen. Wie sich zeigen sollte, ergaben sich hierbei erstaunliche Übereinstimmungen, so auch im folgenden Fallbeispiel eines 52jährigen Patienten, der 1978 am offenen Herzen operiert wurde:
„Vier Personen behaupteten, ihre Operation von der Decke des Operationssaales aus ›beobachtet‹ zu haben. Eine davon war ein 52-jähriger Nachtwächter aus einer ländlichen Gegend im Norden Floridas, bei dem im Januar 1978 am offenen Herzen operiert wurde. Der Mann, der bereits 1973 und 1975 einen schweren Herzanfall mit Herzstillstand gehabt hatte, war im November 1977 wegen einer Herzkatheterisierung und zu einer Untersuchung auf eine mögliche Operation hin in die Universitätsklinik eingeliefert worden. Damals hatte ich ihn auch kennengelernt, und er hatte mir bei einer unserer Begegnungen von einem langen autoskopischen Sterbeerlebnis während seines ersten Herzstillstands erzählt. In Kapitel 3 und 7 finden Sie eine ausführliche Wiedergabe dieses Interviews. Nach seiner Operation im Januar 1978 deutete er mir gegenüber an, er habe erneut ein Erlebnis gehabt, er wollte jedoch nicht so recht mit der Sprache heraus, weil er Angst hatte, sein früheres Sterbeerlebnis in Frage zu stellen. Er meinte, diesmal würde nicht einmal ich die Geschichte schlucken. Es kostete mich einige Überredung, bis er mir schließlich die folgenden Erinnerungen an seine Operation erzählte:
»Der Narkosearzt betäubte mir diese Gegend hier und gab mir dann eine Spritze ... Ich muss eingeschlafen sein ... Ich war vollkommen weg, als sie mich in den Operationssaal hinunterschafften, ich kann mich an absolut nichts erinnern, ich weiß erst wieder, dass ich plötzlich in dem hellerleuchteten Saal war; ich hatte ihn mir aber noch heller vorgestellt. Dann merkte ich, dass sie schon einiges mit mir gemacht hatten. Sie hatten mich schon abgedeckt, und der Narkosearzt fuhrwerkte schon herum. Auf einmal bemerkte ich, ... dass ich mich ein paar Fuß über meinem Kopf befand, ... so, als ob ich eine andere Person im Raum war ... Ich hatte das Gefühl, ich musste nur an etwas denken, und schon sah ich es in Farbe und in einem Rahmen. Ich erinnere mich genau daran, dass ich zwei Ärzte sah, die mich nach der Operation zunähten. Dr. C., ja, ich glaube es war Dr. C., weil der so große Hände hat, spritzte mir zweimal irgendetwas ins Herz, einmal von der einen Seite und einmal von der anderen. Ich erinnere mich auch noch an den Apparat, mit dem sie mir die Rippen auseinanderhielten; irgend etwas schoben sie mir hier oben in die Vene und sie lasen die Anzeigen von irgendeinem Gerät ab. Der Narkosearzt, da bin ich mir ganz sicher, hatte etwas Glänzendes in der Hand. Ich konnte alles sehen. Auch, dass mein Kopf abgedeckt war und dass mein übriger Körper mit Tüchern abgedeckt war, mit mehreren übereinanderliegenden Tüchern. Ich wusste, dass es mein Körper war. Ich hatte mir immer vorgestellt, das Licht würde viel heller sein, aber das Licht dort war gar nicht so hell. Es kam mir mehr wie eine Neonröhre vor als wie ein starker Scheinwerfer... Ich konnte auch zum Teil hören, was geredet wurde, und das überraschte mich ... In der Öffnung steckten jede Menge Instrumente, ich glaube, man sagt Klemmen dazu. Ich war erstaunt, weil ich gedacht hatte, es würde alles in Blut schwimmen, aber es war gar nicht soviel Blut zu sehen, auf jeden Fall nicht soviel, wie ich mir vorgestellt hatte. Irgendwie konnte ich alles wie hinter meinem Kopf stehend beobachten. Mir war das alles ziemlich unheimlich, weil ich nicht wusste, warum ich diese Fähigkeit hatte. Aber ich weiß, dass ich das alles sah. Das ist keine Einbildung, glaube ich zumindest ... Es war ziemlich viel abgedeckt. Ich konnte nicht allzuviel von meinem Kopf sehen, aber von den Brustwarzen abwärts war mein Körper besser zu sehen ... Ich war außerhalb meines Körpers ... Zuerst machten sie mir innen ein paar Stiche und dann nähten sie mich außen zu. Der kleinere Arzt fing unten an, und der andere Arzt nähte von der Mitte aufwärts. Hier, an dieser Stelle, hatten sie ganz schöne Schwierigkeiten, aber sonst ging alles recht schnell ... Das Herz schaut gar nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es ist ganz schön groß und es war auch noch groß, nachdem der Arzt kleine Stücke weggeschnitten hatte. Ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Mein Herz sah ungefähr so aus wie der afrikanische Kontinent, oben war es breit, aber unten wurde es schmaler ... Außen war es rötlich und gelb. Der gelbe Teil war für mich Fettgewebe oder so etwas Ähnliches. Irgendwie sah er widerlich aus. Ein anderer Teil, entweder rechts oder links, war dunkler als der Rest ... Ich könnte Ihnen die Säge, die sie benutzten, und das Ding, mit dem sie mir die Rippen auseinanderhielten, aufmalen. Das Ding war die ganze Zeit da, daran erinnere ich mich noch besser als an die anderen Sachen. Es war zwar rundum bedeckt, aber ich konnte den Metallteil sehen. Um die Öffnung herum hingen Instrumente, die es zum Teil verdeckten, und manchmal nahmen sie [die Ärzte] die Klemmen heraus und steckten Schwämme hinein, und die Hände verdeckten mir oft die Sicht ... Dr. C. stand meistens links von mir. Er schnitt mir Stücke von meinem Herzen ab. Er nahm es in die Hand, drehte es nach allen Seiten und untersuchte es ganz schön lang. Sie sahen sich auch einige Arterien und Venen an, und dann gab es eine große Diskussion darüber, ob ein Bypass notwendig war oder nicht. Ich glaube, ich hatte eine krankhaft erweiterte Ader, die zuviel Blut führte, darüber sprachen sie zumindest ... Es klingt seltsam, aber ich machte mir überhaupt keine Sorgen ... Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl zu sterben. Ich hatte jede Menge Zutrauen zu Dr. C. Er ist ja auch wirklich beeindruckend ... Das Ding, mit dem sie mir die Brust offenhielten, war aus richtig gutem Stahl ohne Rost, ich will damit sagen, es war überhaupt nicht verfärbt. Wirklich gutes, hartes, glänzendes Metall ... Sie spritzten mir irgend etwas ins Herz. Das ist vielleicht komisch, wenn man sieht, wie sie einem eine Nadel mitten ins Herz stechen ... Ich war richtig neugierig, aber ich wollte niemanden vom Operationsteam fragen, weil ich mir dumm vorkam. Alle Ärzte, bis auf einen, hatten Plastiküberzüge über den Schuhen, nur der eine hatte weiße Schuhe an, die voller Blut waren. Ich fragte mich, warum wohl dieser eine Arzt mit weißen Lackschuhen im Operationssaal herumlief, während die anderen Ärzte wie auch die Schwestern grüne Plastiküberzüge über den Schuhen hatten. Ich möchte zu gern wissen, warum das so war. Es war so komisch ... Mir kam es unhygienisch vor. Ich weiß nicht, wo er mit den Dingern herumgelaufen war, sie störten mich auf jeden Fall. Er hätte meiner Meinung nach auch solche Überzüge tragen müssen ... Dann war da auch noch ein Arzt, der hatte etwas am kleinen Finger der rechten Hand. Es sah aus, als ob er den Nagel verlieren würde. Unter dem Nagel war ein Blutgerinnsel, das konnte ich durch seinen Handschuh sehen, der mehr oder weniger durchsichtig war. Das Ding war ziemlich dunkel, und ich konnte es eindeutig erkennen. Dieser Arzt stand auf der anderen Seite des Operationstischs gegenüber von Dr. C. und nähte mich mit zu.« (I-19s)“ (Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 90 ff.)
Die oben vorgestellte, detaillierte Schilderung eines medizinischen Laien über eine an ihm durchgeführte Operation am offenen Herzen, über die der Berichtende in Anbetracht der zur Operationszeit obligatorischen Bewusstlosigkeit grundsätzlich kein Wissen hätte erlangen können, erwies sich für Sabom als willkommene Gelegenheit, die vom Patienten gemachten Angaben mit dem vom operierenden Chirurgen angefertigten Operationsprotokoll direkt abzugleichen:
„Wie lässt sich denn nun die Beschreibung, die ein Laie aus einer ländlichen Gegend im Norden Floridas von einer Operation am offenen Herz gab, vergleichen mit dem tatsächlichen Ablauf der Operation, wie er vom Operateur zu Protokoll gegeben wurde? In diesem Bericht (den der Patient nie zu Gesicht bekam) stand folgendes zu lesen:
»Der auf dem Rücken liegende Patient erhielt eine ausreichende Allgemeinnarkose (Halothan) ... Er war vom Kinn bis unterhalb der Knöchel rasiert und desinfiziert und in der üblichen Weise steril abgedeckt. Von genau unterhalb des Brustbeinausschnitts bis hin zum Schwertfortsatz des Brustbeins wurden Haut und subkutanes Gewebe [Unterhautgewebe]7 durchtrennt. Die dabei auftretenden Blutungen wurden gestillt ... Das Brustbein wurde der Länge nach aufgesägt, und über den Wundtüchern wurde ein Automatenhaken eingesetzt ... In das rechte Atrium [Vorhof] wurden [nachdem das Herz freigelegt worden war] zwei Schläuche eingesetzt ... Einer dieser Schläuche reichte bis zur Vena cava inferior [unteren Hohlvene] und der andere bis zur Vena cava superior [oberen Hohlvene] ... Das Ventrikelaneurysma [großer vernarbter Teil des Herzens, der auf einen früheren Herzinfarkt zurückgeht und der eine andere Farbe hat als der normale übrige Herzmuskel] wurde freigelegt ... Das Aneurysma schien sehr groß zu sein ... Nachdem das Herz im Perikardialraum [Herzhöhle] umgedreht worden war, erfolgte ein Einschnitt in den dicksten Teil des Aneurysmas ... Das gesamte Aneurysma wurde reseziert [herausgeschnitten] ... Dann wurde die linke Ventrikel [Herzkammer] verschlossen ... Die Luft wurde aus der linken Ventrikel mit einer Nadel und einer Spritze abgesaugt ... Die ersten beiden Versuche, den Patienten vom pneumokardialen Bypass abzusetzen, scheiterten ... Herz und Kreislauf des Patienten stabilisierten sich allmählich ... Die Wunde wurde schichtenweise verschlossen ... Zuerst wurde die Fascia pectoralis [Bindegewebshülle, die die äußere Fläche des großen Brustmuskels überzieht] verschlossen, ... dann wurde das subkutane Gewebe verschlossen ... und dann die Haut ... Der Patient wurde in stabilem, aber kritischem Zustand in die Intensivstation geschafft ... Operationsbeginn 9.10 Uhr ..., Operationsende 12.20 Uhr.«“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 93 f.)
Vergleicht man diesen vom Chirurgen protokollierten Hergang der Operation mit den Beschreibungen des Patienten, so zeigen sich bemerkenswerte Übereinstimmungen:
„Dieser Operationsbericht enthält viele Einzelheiten, die auch der Patient beschrieb, und zwar so, als ob er sie optisch wahrgenommen habe. Im folgenden werden einige dieser Einzelheiten miteinander verglichen:
Beschreibung des Patienten
Beschreibung des Operateurs
1) »... dass mein Kopf abgedeckt war und dass mein übriger Körper mit Tüchern bedeckt war, mit mehreren übereinanderliegenden Tüchern.«
1) »… in der üblichen Weise steril abgedeckt.
2) »Ich könnte Ihnen die Säge aufmalen.«
2) »Das Brustbein wurde der Länge nach aufgesägt…«
3) »... das Ding, mit dem sie mir die Rippen auseinanderhielten ... Das Ding war die ganze Zeit da ... Es war zwar rundum bedeckt, aber ich konnte das Metallteil sehen. Das Ding, mit dem sie mir die Brust offenhielten, war aus richtig gutem Stahl ohne Rost, ich will damit sagen, es war überhaupt nicht verfärbt. Wirklich gutes, hartes, glänzendes Metall.«
3) »… und über den Wundtüchern wurde ein Automatenhaken eingesetzt.«
4) »Ein anderer Teil, entweder rechts oder links, war dunkler als der Rest.«
4) »Das Ventrikelaneurysma wurde freigelegt … Das Aneurysma schien sehr groß zu sein.«
5) »Er schnitt mir Stücke von meinem Herzen ab. Er nahm es in die Hand, drehte es nach allen Seiten und untersuchte es ganz schön lang.«
5) »Nachdem das Herz im Perikardialraum umgedreht worden war, erfolgte ein Einschnitt in den dicksten Teil des Aneurysmas. … Das gesamte Aneurysma wurde reseziert.«
6) »Dann spritzten sie mir etwas ins Herz. Das ist vielleicht komisch, wenn man sieht, wie sie einem eine Nadel mitten ins Herz stechen.«
6) »Die Luft wurde aus der linken Ventrikel mit einer Nadel und einer Spritze abgesaugt.«
7) »Zuerst machten sie mir innen ein paar Stiche, dann nähten sie mich außen zu.«
7) »Die Wunde wurde schichtenweise verschlossen ... Zuerst wurde die Fascia pectoralis verschlossen, ... dann wurde das subkutane Gewebe verschlossen ... und dann die Haut.«
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 94 ff.)
Dr. Sabom merkt zum vorgestellten Beispiel ergänzend an:
„Die Beschreibung des Patienten enthält viele Einzelheiten und ›optische‹ Eindrücke, die im Operationsbericht nicht vorkommen, weil sie für den Ablauf des Eingriffs ohne wesentliche Bedeutung waren. Wichtig ist jedoch, dass diese zusätzlichen Beobachtungen des Patienten exakt auf eine Operation am offenen Herz zutreffen. So stimmen beispielsweise seine Angaben über die Form und die Beschaffenheit seines freigelegten Herzens haargenau.“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 96.)
In seinem Buch zur Studie stellt Sabom drei weitere autoskopische Operationserfahrungen vor und dokumentiert auch in diesen Fällen hochsignifikante Übereinstimmungen zwischen Patientenberichten und den von den Chirurgen hierzu angefertigten Operationsprotokollen.
Neben autoskopischen Operationserlebnissen wandte sich Sabom einer weiteren Gruppe autoskopischer Erfahrungen zu, der aus nahtod-wissenschaftlicher Sicht hohe Bedeutung beizumessen ist, da auch in dieser Gruppe die dort vorgebrachten Wahrnehmungsinhalte mit tatsächlichen Begebenheiten konkret abgeglichen werden können. Als Ausgangspunkt besagten Forschungsgegenstandes erwies sich für Dr. Sabom der folgende Bericht eines Vietnam-Veteranen, der ihn zu weiteren Forschungen motivierte:
»Es war am Morgen des 6. Juni 1966 etwa um 5 Uhr ... Wir konnten in einer Entfernung von etwa 300 Fuß die Vietcong recht gut ausmachen. Wir waren damals an die 33 Mann. Sie beschossen uns mit Granatwerfern und mit Maschinengewehren. Wir konnten ein paar von den Maschinengewehren sehen, und der Kamerad drei Meter weiter links von mir hatte eine leichte Panzerabwehrwaffe, die man wie eine Bazooka auf die Schulter nimmt. Er bekam den Befehl, zu versuchen, eines der Maschinengewehre außer Gefecht zu setzen. Als er in Stellung ging, erwischte es ihn ... Ich wollte ihn herumreißen, um die Richtung des Geschosses zu verändern, doch da wurde ich zwischen Daumen und restlicher Hand getroffen. Als ich zurückspringen wollte, explodierte das Geschoss, und ich machte durch die Druckwelle einen Salto rückwärts ... Gerade als ich am Boden aufkam, explodierte hinter mir eine Granate, und ich machte einen Salto vorwärts. Dann fehlen mir in der Erinnerung offensichtlich ein paar Stunden ... Ich konnte die Vietcong sehen. Ich konnte den Kerl sehen, der mir die Stiefel von den Füßen zog. Ich konnte sehen, wie sie im Kreis herumliefen und verschiedene Sachen aufsammelten ... Ich hatte das Gefühl, von oben hinunterzuschauen. Ich konnte mich sehen ... Ich hatte das Gefühl, auf eine Puppe hinunterzuschauen, die dort unten lag ... Ich konnte mein Gesicht sehen und ich konnte meinen Arm sehen. Ich war ziemlich verbrannt, und überall war Blut ... Ich konnte eine M-14 [Gewehr] in drei oder vier Fuß Entfernung sehen und ich versuchte ranzukommen, ich konnte mich aber nicht bewegen ... Es war so, wie in einem tiefen Traum ... Ich sah, wie sich der Kerl an meinen Stiefeln zu schaffen machte, und ich wartete darauf, dass er endlich wegging, damit ich an das Gewehr rankam, ich konnte jedoch meinen Körper nicht bewegen ... Ich spürte keinerlei körperliche Schmerzen, ich konnte lediglich die Puppe nicht dazu bringen, sich zu dem Gewehr zu bewegen ... Ich versuchte die Gliederpuppe dazu zu bringen, sich zu dem Gewehr zu bewegen. Ich war eine Art Zuschauer, ... das Ganze war so, als ob es jemand anderem passierte ... Um 16 oder 17 Uhr kamen unsere eigenen Truppen. Ich konnte sie hören und auch sehen ... Ich war ganz offensichtlich hinüber, verbrannt. Auch meine Uniform war völlig verbrannt, ich sah tot aus ... Sie steckten mich in einen Sack ... Wir wurden auf einen Karren geschichtet ... Wenn ich jemanden von ihnen [den Soldaten] hinterher gesehen hätte, hätte ich ihn identifizieren können ... Wir wurden zu einen LKW geschafft und in die Leichenhalle gebracht. Ich erinnere mich daran, dass ich auf dem Tisch lag und dass der Kerl Witze über die Truppenbetreuerinnen erzählte ... Alles, was ich damals anhatte, war meine blutige Unterhose. Ich beobachtete, wie er mir die mit einem Griff herunterriss, wie er mir das Bein abspreizte und wie er mich [in die linke Leiste] schnitt [um zur Einspritzung von Einbalsamierungsflüssigkeit die Oberschenkelvene freizulegen] ... Er hatte bereits einen leichten Einschnitt gemacht, als er plötzlich zu lachen aufhörte, er war erstaunt darüber, dass die Wunde noch so stark blutete. Er prüfte noch einmal meinen Puls und meinen Herzschlag, ich konnte das alles sehen, wie man einen dritten sieht ... Er prüfte den Puls und da er sich nicht sicher war, fragte er jemand anders. Etwa an diesem Punkt setzte meine Wahrnehmung aus ... Sie schafften mich offensichtlich in einen anderen Raum und amputierten mir die Hand, und vielleicht ein paar Minuten nach dieser Operation war der Kaplan bei mir und sagte, alles werde in Ordnung kommen ... Ich sah die Dinge nicht mehr von außerhalb meines Körpers, ich bildete wieder eine Einheit.« (Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 111 f.)
Dr. Sabom weiter:
„Als mir dieser Mann seine Geschichte erzählte, fragte ich mich ununterbrochen: Konnte sich das alles so abgespielt haben? Ganz offensichtlich konnte zumindest ein Teil seines Berichts stimmen – er trug am rechten Arm eine Prothese. Was war jedoch mit dem Transport im Sack zur Leichenhalle? Ich bat ihn, seine linke Leiste untersuchen zu dürfen. Dort fand ich einen weiteren Beweis für seine Geschichte – eine gutverheilte Narbe über seiner Oberschenkelvene, die mit einiger Sicherheit vom Einschnitt eines Einbalsamierers herrührte. All dies ließ für mich den Schluss zu, dass seine Geschichte wahr sein konnte, weitere Überprüfungen waren jedoch wegen der Umstände dieses Falles nicht möglich. Ich musste also noch andere Sterbeerlebnisse untersuchen, um feststellen zu können, ob es sich bei autoskopischen Sterbe-Erlebnissen um Tatsachen oder um Phantasien handelte.
Ich wusste, als ich diese Studie begann, dass die Mehrzahl der Patienten, die ich interviewen würde, nach einem Herzstillstand wiederbelebt worden waren. Ich war damals schon an weit über hundert solcher Wiederbelebungen beteiligt gewesen und wusste ganz genau, was dabei vorging. Ich wartete deshalb schon voller Spannung auf den Augenblick, in dem ein Patient behaupten würde, er habe ›gesehen‹, was in seinem Zimmer während seiner eigenen Wiederbelebung passiert sei. Sollte es dazu kommen, so wollte ich ganz genau nach Einzelheiten fragen, die einem Nichtmediziner normalerweise unbekannt waren. Ich wollte also meine Erfahrung als ausgebildeter Kardiologe den angeblichen optischen Erinnerungen von Laien gegenüberstellen. Dabei, so war ich überzeugt, würde es zu offensichtlichen Ungereimtheiten kommen, und aus den visuellen Beobachtungen des Patienten würden sehr schnell bloße, wenn auch fundierte Vermutungen werden.“
(Sabom: Erinnerung an den Tod, S. 112 f.)
In den folgenden Jahren zeigte sich, dass eine größere Zahl von Patienten das Kriterium von Sabom erfüllt hatte:
„Fünf Jahre später waren zweiunddreißig Personen interviewt worden, die während einer nicht operationsbedingten Krise ihren eigenen Angaben zufolge Teile ihrer Wiederbelebung ›gesehen‹ hatten. Als ich mich daranmachte, die Ergebnisse zu analysieren, fragte ich mich, was wohl in all diesen Fällen unter einer ›fundierten Vermutung‹ zu verstehen sei. Wussten die zweiunddreißig Personen bereits vor ihrem Sterbeerlebnis soviel von Wiederbelebungsprozeduren, dass sie eine ungefähr der Wahrheit entsprechende Beschreibung ihrer lebensbedrohenden Krise konstruieren konnten, ohne diese Krise von einer außerkörperlichen Position aus miterlebt zu haben?
Die Patienten erinnerten sich in den meisten Fällen vor allem an Dinge, die während der kardiopulmonalen Reanimation (KPR) passiert waren. Ich wusste natürlich, dass eine KPR niemals genauso abläuft wie eine andere, ich wusste aber auch, dass es für eine KPR bestimmte Spielregeln gibt, die im Krankenhaus normalerweise befolgt werden. Jemand, der mit diesen Spielregeln vertraut ist, kann also ohne weiteres eine glaubwürdige Version seiner eigenen Wiederbelebung rekonstruieren.
Bei den meisten Leuten, die autoskopische Erinnerungen an ihren Herzstillstand hatten, handelte es sich um ›erfahrene‹ Herzpatienten, die schon mehrfach in modern eingerichteten Intensivstationen behandelt worden waren. Außerdem war nicht auszuschließen, dass sie aufgrund ihres chronischen Leidens Wiederbelebungsszenen im Fernsehen, im Kino oder sonst wo mit besonders großem Interesse verfolgt hatten. Es wäre zur Festlegung der ›Vorkenntnisse‹ natürlich ideal gewesen, jede einzelne Person vor ihrem Sterbeerlebnis zu interviewen. Die für diese Studie durchgeführten Interviews fanden jedoch ausnahmslos nach der lebensbedrohenden Krise statt. Im Verlauf des Interviews wurde jeder Patient, der autoskopische Erinnerungen an seine KPR hatte, gefragt, wie vertraut er schon vor seinem Sterbeerlebnis mit der Prozedur gewesen sei. Viele gaben zu, bereits vorher KPR-Darstellungen im Fernsehen oder anderswo gesehen zu haben, die in Einzelheiten ihrer eigenen Wiederbelebung geähnelt hätten, andere dagegen behaupteten, während ihrer lebensbedrohenden Krise zum erstenmal eine derartige Prozedur gesehen zu haben. Solche retrospektiven Festlegungen waren natürlich von zweifelhaftem Wert, da es für die Bewertung des Vorwissenstandes keinerlei objektive Maßstäbe gab. Wir versuchten deshalb, auf die folgende Weise das vorherige KPR-Wissen zumindest indirekt festzulegen:
Wir interviewten fünfundzwanzig ›Kontrollpatienten‹, die folgende Bedingungen erfüllen mussten: Ihr Lebenshintergrund musste demjenigen von Personen ähneln, die von einem autoskopischen Sterbeerlebnis berichtet hatten (siehe Tabelle III), und sie mussten bereits einmal auf einer Intensivstation gelegen sein. Bei diesen fünfundzwanzig Kontrollpersonen handelte es sich um erfahrene Herzpatienten, die im Durchschnitt schon länger als fünf Jahre an ihrer Krankheit litten und die u. a. schon wegen eines Herzanfalls (zwanzig Patienten), wegen einer Herzkatheterisierung (zwölf Patienten), wegen einer Kardioversion [Behandlung mit Stromstößen] (zwei Patienten), wegen eines Herzstillstands ohne Sterbeerlebnis (vier Patienten) und wegen der Einpflanzung eines Herzschrittmachers (ein Patient) stationär behandelt worden waren. Jeder dieser Patienten hatte auf der Intensivstation die Möglichkeit gehabt, einen Herzmonitor, an den er angeschlossen gewesen war, einen Defibrillator, intravenöse Nadeln sowie anderes Gerät aus nächster Nähe zu sehen. Weiterhin hatte jeder Patient zugegeben, zu Hause regelmäßig vor dem Bildschirm zu sitzen. Es war also nicht auszuschließen, dass sich die Gruppe durch Krankenhausaufenthalt oder durch Fernsehen KPRWissen angeeignet hatte.
Während des Interviews wurde jeder Patient gebeten, sich vorzustellen, er stehe in der Ecke eines Krankenhauszimmers und beobachte ein Ärzteteam bei der Wiederbelebung einer Person, deren Herz zu schlagen aufgehört hatte. Dann wurde er gebeten zu be