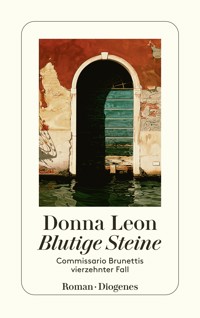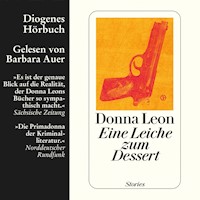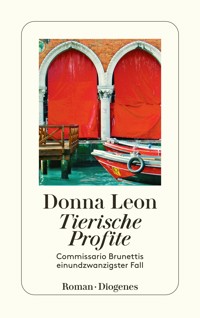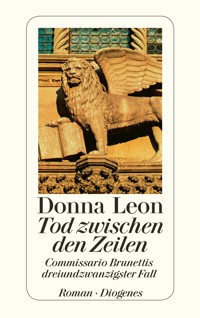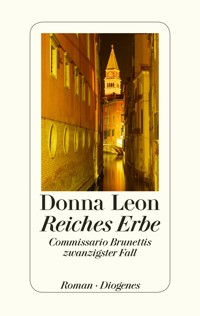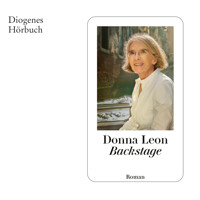10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Brunettis Bravourstück. Der Commissario ermittelt in den Tiefen der Erinnerung: Contessa Lando-Continui möchte ihren Frieden finden, doch der tragische Sturz ihrer Enkelin in den Rio di San Boldo lässt ihr keine Ruhe. Was, wenn es kein Unfall war? Brunetti nutzt seine Connections, seine Einfühlung und seine Erfahrung. Der Jubiläumsfall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Donna Leon
Ewige Jugend
Commissario Brunettis fünfundzwanzigster Fall
Roman
Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz
Diogenes
Für Megan und Martin Meyer
{5}Ahi! Perché, oh Dio!
Perché non mi lasciasti
Crudel, morir nell’acque, e mi salvasti?
Weh’ mir! Grausamer Gott,
Warum ließest du mich nicht sterben
Im Wasser, warum nur wurde ich errettet?
GEORGFRIEDRICHHÄNDEL, RADAMISTO
{7}1
Er hatte förmliche Essenseinladungen noch nie gemocht, darum litt Brunetti auch heute Abend. Es half nichts, dass er einige der Leute an dem langen Tisch kannte, und es änderte auch nichts an seiner schlechten Laune, dass die Gesellschaft im Haus seiner Schwiegereltern stattfand, in einem der schönsten Palazzi Venedigs. Er hatte sich von seiner Frau und seiner Schwiegermutter breitschlagen lassen, die ihm weismachen wollten, seine berufliche Position werde dem Abend ein Glanzlicht aufsetzen.
Brunetti hatte zwar protestiert, ein Commissario di Polizia sei wohl kaum geeignet, einem für wohlhabende Ausländer veranstalteten Benefizessen Glanz zu verleihen. Doch seine Schwiegermutter war ihm mit ihrer altbewährten Schäferhundtaktik so lange auf den Fersen geblieben, bis sie ihn dort hatte, wo sie ihn haben wollte. Als er schließlich einlenkte, hatte sie hinzugefügt: »Außerdem möchte Demetriana dich sehen, tu mir doch bitte den Gefallen, mit ihr zu reden, Guido.«
Brunetti hatte sich geschlagen gegeben und fand sich folglich nun auf der Essenseinladung wieder, der Contessa Demetriana Lando-Continui am Kopf der Tafel so entspannt vorsaß, als sei der Palazzo ihr eigener. Am anderen Ende, ihr gegenüber, saß ihre Busenfreundin Contessa Donatella Falier, welche ihr für diesen Abend das Hausrecht abgetreten hatte. Ein Wasserrohrbruch über Demetrianas eigenem Speisesaal hatte einen Teil der Zimmerdecke {8}herunterstürzen lassen und den Raum bis auf weiteres unbewohnbar gemacht. Angesichts dieser peinlichen Lage hatte Contessa Lando-Continui sich hilfesuchend an Donatella gewandt. Die tat ihrer Freundin gern den Gefallen, obwohl sie sich selbst nicht an deren Stiftung und dem Anwerben von Spenden beteiligte. Und so umrahmten nun zwei Contessas wie zwei Buchstützen die Tafel, an der außer ihnen noch acht weitere Personen Platz genommen hatten.
Contessa Lando-Continui, eine kleine Frau, sprach Englisch mit leichtem Akzent und musste ihre Stimme offenbar anstrengen, um sich im Raum Gehör zu verschaffen; sie schien öffentliche Auftritte aber gewohnt zu sein. Große Sorgfalt hatte sie auf ihr Aussehen verwandt. Das sehr kurz geschnittene mattgoldene Haar wirkte bei einer so kleinen Frau ebenso jugendlich wie natürlich. Ihr dunkelgrünes Kleid hatte lange Ärmel, die ihre schmalen, von keinerlei Altersflecken entstellten Hände zur Geltung brachten. Ihre Augen, fast vom selben Grün wie das Kleid, passten perfekt zu der von ihr gewählten Haarfarbe. Früher einmal musste sie eine attraktive Frau gewesen sein.
Als er ihr wieder zuhörte, sagte die Contessa gerade: »Ich hatte das Glück, in einem ganz anderen Venedig aufzuwachsen, nicht in diesen Touristenkulissen, die eine Stadt heraufbeschwören, die es nie gegeben hat.« Brunetti nickte, während er genüsslich seine Spaghetti mit Meeresfrüchten verzehrte, die ihn stark an die von Paola erinnerten, vermutlich weil die Köchin seiner Schwiegermutter dieselbe war, die Paola das Kochen beigebracht hatte.
»Es macht mich sehr traurig, dass die Stadtverwaltung alles Erdenkliche tut, um immer noch mehr Touristen {9}anzulocken. Während gleichzeitig«, betonte die Contessa und warf einen ernsten Blick in die Runde, »venezianische Familien, vor allem die jüngeren, aus der Stadt vertrieben werden, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können, von einem Hauskauf ganz zu schweigen.« Ihr Kummer war so echt, dass Brunetti zu seiner Frau hinübersah, die zustimmend nickte.
Zur Linken der Contessa saß ein junger blonder Engländer, der ihm als Lord Soundso vorgestellt worden war; neben ihm eine berühmte englische Historikerin, deren Buch über das Haus Savoyen Brunetti mit großem Vergnügen gelesen hatte. Dabei verdankte Professorin Moore die Einladung wohl der Tatsache, dass sie in ihrem Buch mit keinem Wort erwähnte, auf wie vertrautem Fuß die Familie des verstorbenen Gatten der Gastgeberin mit Mussolinis Regime gestanden hatte. Links von ihr saß ein weiterer Engländer, der Brunetti als Bankier vorgestellt worden war, und neben diesem, Brunetti genau gegenüber, Paola, zur Rechten ihrer Mutter.
Dass man Brunetti neben seiner Schwiegermutter und gegenüber seiner Frau platziert hatte, war bestimmt ein Verstoß gegen die Etikette. Doch Brunetti war so erleichtert, in vertrauter Nähe zu sein, dass ihn die Regeln nicht kümmerten. Zu seiner Linken saß die Gattin des Bankiers, die als Juraprofessorin in Oxford tätig war; dann ein Mann, den Brunetti vom Sehen kannte, und schließlich ein deutscher Journalist, der seit Jahren in der Stadt lebte und dabei einen solchen Zynismus entwickelt hatte, dass man ihn glatt für einen Italiener halten konnte.
Brunetti blickte zwischen Contessa Falier und Contessa {10}Lando-Continui hin und her, und wie immer, wenn er die beiden zusammen sah, staunte er darüber, welch seltsame Paare das Leben hervorbrachte. Seine Schwiegermutter hatte die andere Contessa gewissermaßen geerbt, als diese zur Witwe wurde. Locker befreundet waren sie da schon seit Jahren gewesen, doch der Tod von Conte Lando-Continui hatte sie zusammengeschweißt. Es hatte Brunetti verwundert, wie eng die Freundschaft geworden war, da Contessa Lando-Continui auf ihn so viel reservierter als seine Schwiegermutter wirkte. Sie war stets höflich zu ihm, bisweilen mit einem Anflug von Herzlichkeit, dennoch wurde er das Gefühl nicht los, nur ein Anhängsel von Paola und deren Mutter zu sein. Ob so manche Ehefrau sich ähnlich unwohl fühlte wie er?
»Ich möchte noch einmal unterstreichen«, setzte Contessa Lando-Continui von neuem an, und Brunetti wandte ihr seine volle Aufmerksamkeit zu. Während sie Luft holte, um fortzufahren, wurde sie von dem Gast neben ihrem rechten Tischherrn unterbrochen. Brunetti kannte ihn vage vom Sehen. Dunkelhaarig, knapp vierzig Jahre alt, trug er einen Kinn- und Oberlippenbart, der an den letzten russischen Zaren erinnerte.
»Meine liebe Contessa«, sagte er mit lauter Stimme und erhob sich von seinem Stuhl, »schuldig machen wir uns alle, was das Anlocken von Touristen angeht. Auch Sie.« Entsetzt, dass jemand die Worte »schuldig« und »Sie« in einem Atemzug nannte, starrte die Contessa ihn, ohne ein Wort zu sagen, an. Ob dieser Mensch womöglich auch noch einen Beweis auf Lager hatte? Sie legte die Hände mit den Handflächen nach unten zu beiden Seiten ihres Tellers auf {11}den Tisch und spannte sie an, als wolle sie, sollte das Gespräch unangenehm werden, jeden Moment das Tischtuch herunterreißen.
Die anderen schwiegen betreten. Der Mann aber lächelte der Contessa zu und erklärte in die entstandene Stille hinein, mit Rücksicht auf die Mehrheit am Tisch auf Englisch: »Wie Sie alle wissen, hat die Generosität unserer Gastgeberin – welche die Sanierung zahlreicher Bauwerke unterstützt hat – unendlich viel zum Erhalt der Schönheit Venedigs beigetragen und damit die Attraktivität der Stadt als Reiseziel für jene, die dem Faszinosum erliegen, maßgeblich gesteigert.« Triumphierend sah er in die Runde.
Der Contessa war das Wort »Generosität« nicht entgangen; ihre Miene entspannte sich, die Totenstarre ihrer Hände löste sich, und sie ließ das Tischtuch los. Sie machte eine abwehrende Geste in Richtung des Redners, wie um ihm das Wort abzuschneiden. Doch die Wahrheit, dachte Brunetti, brach sich unaufhaltsam Bahn. Der Mann hob sein Glas. Man fragte sich, ob er seine Rede auswendig gelernt hatte, so locker, wie sie ihm über die Lippen kam.
Als Brunetti sich ein Stück nach vorne neigte und den massigen Körperbau des Mannes bemerkte, fiel ihm wieder ein, woher er ihn kannte: Man hatte ihn ihm vor ein paar Jahren bei einem Treffen des Circolo Italo-Britannico vorgestellt. Das erklärte auch, warum er sich auf Englisch so flüssig ausdrückte. Und vor ein paar Wochen hatte er das bärtige Gesicht neben einer Meldung im Gazzettino gesehen: Der Mann war vom Denkmalschutz mit der Inventarisierung der marmornen Wandtafeln in der Stadt beauftragt worden. Brunetti hatte den Artikel gelesen, weil über dem {12}Eingangsportal des Palazzo Falier gleich fünf solcher Tafeln prangten.
»Verehrte Anwesende, Freunde von La Serenissima«, fuhr der Mann fort, und sein Lächeln wurde noch breiter. »Erlauben Sie mir, einen Toast auszubringen auf unsere Gastgeberin, Contessa Lando-Continui! Ganz persönlich, als Venezianer, wie auch beruflich, als jemand, der mit dem Erhalt dieser Stadt betraut ist, möchte ich der Contessa danken für alles, was sie getan hat, damit meine Stadt eine Zukunft hat.« Und mit einem Blick und einem Lächeln in Richtung Contessa: »Unsere Stadt.« Dann, um nur ja nicht den Eindruck entstehen zu lassen, er schließe die anwesenden Nicht-Venezianer aus, wies er breit lächelnd mit der freien Hand in die Runde und korrigierte sich erneut: »Ihre Stadt. Denn Sie haben Venedig in Ihr Herz und Ihre Träume aufgenommen, sind, zusammen mit uns, Veneziani geworden.« Der lang anhaltende Applaus zwang den Redner schließlich, sein Glas abzustellen, um dem Beifallssturm mit beiden Händen Einhalt zu gebieten.
Hätte Brunetti neben Paola gesessen, hätte er ihr zugeraunt, ob sie womöglich Gefahr liefen, einer Charmeoffensive zu erliegen; ein rascher Blick in ihre Richtung bewies, dass sie seine Sorge teilte.
Als wieder Stille eintrat, fuhr der Mann fort, nun direkt an die Contessa gewandt: »Wir Mitglieder von Salva Serenissima sind Ihnen, liebe Contessa, zutiefst dankbar, dass Sie um das Wohl dieser Stadt besorgt sind, die wir lieben und die aus unserem Leben und aus unseren Träumen nicht wegzudenken ist.« Er nahm sein Glas und prostete der Runde zu.
{13}Der Bankier und seine Frau erhoben sich von ihren Plätzen wie am Ende einer besonders bewegenden Vorstellung, doch als sie merkten, dass die anderen am Tisch sitzen blieben, strich er eine Knitterfalte an seiner Hose glatt und sank auf seinen Stuhl zurück, während sie sorgfältig ihren Rock zurechtzupfte, als sei sie nur deswegen aufgestanden.
Salva Serenissima, dachte Brunetti: Das also war die Verbindung zwischen den beiden. Doch bevor er in Erfahrung bringen konnte, was genau der Redner mit dieser Organisation zu schaffen hatte, rief eine tiefe Männerstimme auf Englisch: »Hört, hört!«, als seien sie im britischen Oberhaus und Seine Lordschaft müsse lautstark Zustimmung bekunden. Brunetti setzte ein Lächeln auf und hob wie die anderen das Glas, trank jedoch nicht. Er schaute zu Paola hinüber, die ihm, da sie zu der Freundin ihrer Mutter am anderen Ende des Tisches sah, ein Dreiviertelprofil zuwandte. Als spüre sie seinen Blick, drehte Paola sich zu ihm um, schloss die Augen und schlug sie langsam wieder auf wie jemand, der soeben erfahren hat, dass die Kreuzigung gerade erst begonnen habe und noch diverse Nägel fehlten.
Der Redner hatte seinen Vorrat an Lobeshymnen offenbar erschöpft; er nahm Platz und wandte sich seinem mittlerweile kalt gewordenen Essen zu. So auch Contessa Lando-Continui. Die anderen versuchten die unterbrochenen Gespräche wiederaufzunehmen. Man speiste munter plaudernd weiter, begleitet vom Klappern des Silberbestecks.
Contessa Falier hatte, wie Brunetti bemerkte, diesmal nichts von einem Schäferhund an sich; eher wirkte sie wie ein schläfriger Pudel, dekorativ, aber gelangweilt und {14}unaufmerksam. Da Paola sich mit dem Bankier unterhielt, legte Contessa Falier die Gabel ab und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. Die Frau zu Brunettis Linken sprach wiederum mit dem Mann, der den Toast auf die Contessa ausgebracht hatte. Gelegenheit für ein Gespräch mit seiner Schwiegermutter, deren Meinungen Brunetti oft ebenso verblüfften wie die entlegenen Quellen, aus denen sie sich speisten.
Sie kamen auf die jüngsten Berichte zu dem gigantischen MOSE-Projekt zu sprechen, das die Stadt eines Tages vor weiteren Hochwasserschäden schützen sollte. Wie viele Venezianer waren sie von Anfang an überzeugt gewesen, dass die Sache zum Himmel stank. Und dieser Geruch war in den letzten drei Jahrzehnten nur immer noch schlimmer geworden. Brunetti hatte zu viel gehört und gelesen, um irgendwelche Hoffnungen zu haben, dass die komplizierte und pharaonisch teure Konstruktion aus riesigen Stahlbarrieren, die das Meerwasser aus der Lagune fernhalten sollte, jemals funktionieren würde. Sicher war nur, dass die Unterhaltskosten jedes Jahr steigen würden. Federführend bei den zurzeit laufenden Nachforschungen nach wer weiß wie vielen verschwundenen Millionen war die Guardia di Finanza: Die örtliche Polizei wusste davon nicht viel mehr als das, was in den Zeitungen stand.
Nach den ersten Enthüllungen über das Ausmaß der Zweckentfremdung europäischer Fördermittel hatte man in der Stadtverwaltung rote Köpfe bekommen, erst vor Zorn, dann vor Verlegenheit, als ein hoher Beamter zunächst seine Unschuld beteuerte, dann aber doch eingestand, dass möglicherweise ein Teil der für das MOSE-Projekt {15}bestimmten Gelder in die Finanzierung seines Wahlkampfs geflossen sei. Aber niemals habe er einen einzigen Euro für sich persönlich verwendet, beteuerte er, offensichtlich in der Annahme, dass ein gekaufter Wahlsieg weniger verwerflich sei als der Kauf eines Brioni-Anzugs.
Brunetti liebäugelte kurz damit, sich entrüstet zu zeigen, aber sein gesunder Menschenverstand sagte ihm, dass Empörung fehl am Platz war. Besser, man betrachtete den Fall wie ein Neapolitaner und sah das alles als Theater, als Farce, bei der unsere Politiker ganz in ihrer Rolle aufgingen.
Mehr war dazu nicht zu sagen, das sah er auch seiner Schwiegermutter an. Brunetti wechselte das Thema. »Du kennst sie schon lange, oder?«, fragte er mit einem kurzen Blick zum Kopfende des Tischs, wo Contessa Lando-Continui mit dem deutschen Journalisten sprach.
»Seit ich in Venedig bin«, antwortete seine Schwiegermutter. »Schon viele Jahre.« In Brunettis Ohren klang das nicht sehr begeistert, einmal abgesehen davon, dass Contessa Falier hier ihre Familie hatte. Überhaupt ließ sich seine Schwiegermutter selten über jene Stadt aus, deretwegen sie ihre Heimatstadt Florenz verlassen hatte.
»Sie kann sehr fordernd sein, aber auch sehr großzügig und herzlich.« Contessa Falier nickte, wie um ihre Aussage zu unterstreichen. »Das merkt man allerdings erst, wenn man sie näher kennt. Und das tun nicht viele.«
Contessa Falier sah sich verstohlen um, bevor sie leise hinzufügte: »Dies hier ist eine Ausnahme. Sie veranstaltet solche Geselligkeiten mit potentiellen Geldgebern nur ungern.«
»Warum macht sie es dann? Die Stiftung hat doch sicher {16}eine Geschäftsstelle. Warum besorgt die nicht das Fundraising?«
»Everyone loves a lord«, erklärte Donatella leise auf Englisch.
»Wie meinst du das?«
»Sie ist eine Contessa. Die Leute wollen erzählen können, dass sie mit ihr an einem Tisch gesessen haben.«
»In diesem Fall«, meinte er mit einem Blick in die Runde, »ist es nicht einmal ihr Tisch.«
Die Contessa lachte.
»Mit anderen Worten, sie lädt die Leute an deine Tafel ein, und zum Dank spenden sie für Salva Serenissima?«, fragte Brunetti.
»So in etwa«, stimmte die Contessa zu. »Sie ist sehr engagiert. Und je älter sie wird, desto mehr ist es ihr ein Anliegen, dass junge Venezianer in der Stadt bleiben und ihre Kinder hier großziehen können. Sonst kümmert sich ja niemand darum.« Wieder sah sie sich erst um, ehe sie fortfuhr: »Was die Restaurierung der kleineren Mosaiken auf Torcello anbelangt, bin ich mir nicht sicher, wie gelungen sie ist. An manchen Stellen sind deutlich die neuen Steine zu erkennen. Aber bautechnisch wurde einiges verbessert, da hat Salva Serenissima schon viel gebracht.«
Brunetti, der seit Jahren nicht mehr in der Basilika gewesen war und sich nur noch vage an die Mosaiken erinnerte – Sünder, die in die Hölle verbannt werden, und jede Menge nackte Haut –, konnte nur seufzend mit den Schultern zucken, wie er es seit einigen Jahren immer häufiger tat.
Um den Gedanken an ewige Höllenstrafen zu vertreiben, fragte er leise: »Der da eben gesprochen hat: Wer ist das?«
{17}Contessa Falier betupfte ihre Lippen mit der Serviette und trank einen Schluck Wasser. Beide schauten zu dem Redner am anderen Tischende hinüber. Der unterhielt sich mit der Historikerin ihm gegenüber, die sich, während sie ihm zuhörte, offenbar auf einem Zettel Notizen machte. Contessa Lando-Continui plauderte angeregt mit dem Lord, dessen stark englisch eingefärbtes Italienisch alles übertönte.
Im Schutz dieser lauten Stimme beugte Contessa Falier sich zu Brunetti vor und sagte: »Sandro Vittori-Ricciardi. Ein Protegé von Demetriana.«
»Und was macht er?«
»Er ist Innenarchitekt und Restaurator von Mauerwerk und Marmor: Er arbeitet für ihre Stiftung.«
»Bei diesen Sachen, für die deine Freundin sich engagiert?«, fragte Brunetti.
»Diese Sachen«, versetzte Donatella scharf, »ersparen der Stadt jährlich drei Millionen Euro, vergiss das nicht, Guido. Plus den Betrag, der in die Renovierung von Wohnungen für junge Familien gesteckt wird.« Mit noch mehr Nachdruck fügte sie hinzu: »Von irgendwoher muss das Geld ja kommen, das die Regierung nicht mehr aufbringt.«
Brunetti spürte jemanden hinter sich, steif aufgerichtet wartete er, bis ein Diener seinen Teller und den der Contessa abgeräumt hatte. »Natürlich, du hast recht«, bemerkte er versöhnlich.
Sinn und Zweck der heutigen Veranstaltung war es ja, potentielle ausländische Spender mit gebürtigen Venezianern zusammenzubringen – er selbst war einer dieser aussterbenden Spezies. Hereinspaziert in den Zoo! Seht euch {18}die Tiere an, die dank eurer Spenden in ihrem ursprünglichen Habitat überleben. Kommt zur Fütterungszeit. Brunetti konnte sich selbst nicht leiden, wenn ihm solche Gedanken kamen, aber er wusste einfach zu viel, um sie ganz unterdrücken zu können.
Contessa Lando-Continui bemühte sich seit Jahren, bei Conte Falier Geld lockerzumachen. Aber der hatte stets ebenso freundlich wie entschieden abgelehnt. »Wenn nicht so viel Geld unterschlagen würde, Demetriana, könnte die Stadt selbst für die Restaurierung aufkommen, und wenn die Familien und Freunde der Politiker nicht auf Staatskosten wohnen würden, müsstest du keine Spenden für die Renovierung von bezahlbaren Wohnungen sammeln«, hatte der Conte ihr einmal in Brunettis Beisein erklärt.
Dennoch ließ die Contessa sich nicht davon abhalten, Conte Falier immer wieder zu ihren Abendgesellschaften einzuladen – sie hatte ihn sogar für heute in seinem eigenen Haus zu Tisch gebeten –, doch jedes Mal hatte der Conte einen wichtigen Termin, ein Meeting in Kairo oder ein Abendessen in Mailand; einmal hatte er sogar ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten ins Feld geführt. Womöglich traf er sich heute Abend mit einem russischen Waffenhändler, dachte Brunetti belustigt, denn es interessierte den Conte nicht, ob seine Ausflüchte glaubhaft waren. Er machte sich einen Spaß daraus, immer wieder neue Ausreden zu erfinden, um nicht zum Opfer der Contessa zu werden.
So saßen sie jetzt ohne ihn da, er und Paola und seine Schwiegermutter, als Schmankerl für die auswärtigen Gäste: nicht nur Contessa Lando-Continui, sondern auch {19}noch Contessa Falier, zwei echte Adlige zum Preis von einer! Und die nächste Generation noch als Dreingabe obendrauf.
Das Dessert wurde aufgetragen, eine ciambella con zucca e uvetta, die Brunetti ebenso entzückte wie der dazu gereichte süße Wein. Als das Mädchen zurückkam und Nachschlag anbot, warf Paola ihrem Mann einen mahnenden Blick zu. Er lehnte das Angebot lächelnd ab, als habe er noch nie mehr haben wollen; Paola konnte er zwar nichts vormachen, aber immerhin sich selbst.
Nach dieser Heldentat fühlte er sich mehr als berechtigt, das Gläschen Grappa anzunehmen. Er rückte seinen Stuhl ein wenig nach hinten, streckte die Beine aus und hob das Glas an den Mund.
Als seien sie nicht in ihrem Gespräch über den Protegé unterbrochen worden, fragte seine Schwiegermutter: »Interessiert er dich, weil er für sie arbeitet?« Sie schob den Grappa, den der Kellner ihr hingestellt hatte, zur Seite.
»Mich interessiert, warum er es für nötig hält, ihr so zu schmeicheln«, war das Beste, was Brunetti dazu einfiel.
Die Contessa fragte lächelnd: »Macht der Polizist in dir dich so misstrauisch?« Da auch alle anderen sich unterhielten und einzelne Stimmen in dem Gewirr untergingen, sprach sie jetzt mit normaler Lautstärke.
Brunetti blieb die Antwort erspart, denn Contessa Lando-Continui legte in diesem Moment ihren Löffel ab, sah, wie um Erlaubnis bittend, zu ihrer Freundin hinüber und erklärte dann: »Ich denke, der Kaffee wird im Salon serviert.« Sogleich sprang Sandro Vittori-Ricciardi auf, trat hinter sie und zog ihr den Stuhl zurück. Die Contessa {20}nickte dankbar, reichte ihm den Arm und ließ sich aus dem Speisezimmer in den vorderen Teil des Palazzo geleiten. Die anderen folgten in bunter Reihe.
Der Salon bot Aussicht auf Palazzi auf der anderen Seite des Canal Grande, die in Venedig als nicht sehr bemerkenswert galten. Einige Gäste, die davon nichts wussten, begannen von der Schönheit der Gebäude zu schwärmen.
Brunetti und seine Schwiegermutter gingen Arm in Arm hinüber und blieben neben Paola stehen. Der Kaffee stand auf einem Tisch mit Onyxintarsien. Zucker, bemerkte Brunetti, aber keine Milch, was erklären mochte, dass nur die anwesenden Italiener sich eine Tasse nahmen.
Vittori-Ricciardi war ins Gespräch mit dem Bankier und dessen Frau vertieft. Brunetti schlenderte an ein Fenster, von wo er ihnen unauffällig zuhören konnte.
»… ein weiterer Teil unseres Erbes, der dem Zahn der Zeit zum Opfer fällt«, sagte der Venezianer gerade.
»Wie kann denn solch eine kleine Insel so wichtig sein?«, fragte der Bankier.
»Es ist eine der frühesten Spuren menschlichen Lebens hier: Die ältesten Ruinen stammen aus dem siebten Jahrhundert. Die Kirche – jene mit den Mosaiken – ist älter als fast alle in Venedig.« Vittori-Ricciardi sagte das so lebhaft, als ginge es um Ereignisse, die voriges Jahr stattgefunden hätten, wenn nicht vorige Woche.
»Und für die Restaurierung dieser Kirche bitten Sie uns um Unterstützung?« Der Bankier schien von der Idee nicht sonderlich angetan.
»Wir bitten um einen Zuschuss für die Restaurierung, ja.« Vittori-Ricciardi stellte seine Tasse ab. »Es geht um das {21}Mosaik vom Jüngsten Gericht: In das Mauerwerk dahinter ist offenbar Wasser eingedrungen. Wir müssen herausfinden, woher es kommt, und Abhilfe schaffen.«
»Was ist daran so besonders?«, fragte der Bankier.
Die Antwort ließ lange auf sich warten. Der Venezianer mochte verbittert sein, wie jemand eine solche Frage stellen konnte, doch war ihm nichts davon anzumerken, als er schließlich sagte: »Wenn wir nichts unternehmen, könnte es für immer zu spät sein.«
»Sie sind sich dessen gar nicht sicher?«
Brunetti trat kurz beiseite, stellte seine Tasse auf einem Tischchen ab und kehrte ans Fenster zurück, um sich weiter dem Studium der Fassaden gegenüber zu widmen.
»Doch, wir sind uns sicher. Aber um es zu beweisen, müssen wir hinter das Mosaik kommen, in das Mauerwerk hinein, und bis solche Arbeiten genehmigt werden, kann eine Ewigkeit vergehen. Darüber wird in Rom entschieden«, sagte Vittori-Ricciardi und fügte, tatsächlich verbittert, hinzu: »Wir warten seit fünf Jahren auf Antwort von dort.«
»Warum dauert das so lange?«, fragte der Bankier.
Wohl zum ersten Mal in Italien?, dachte Brunetti.
»Die Genehmigung für Restaurierungsarbeiten wird vom Denkmalschutz erteilt. Ohne dessen Erlaubnis darf etwas so Kostbares nicht angerührt werden.« Vittori-Ricciardi stellte die Sache recht überzeugend dar.
»Aber Sie machen doch nichts kaputt. Das müssen die doch wissen«, beharrte der Bankier.
»Die Bestimmung soll verhindern, dass Kunstwerke unsachgemäß behandelt werden«, erklärte Vittori-Ricciardi.
{22}»Oder gestohlen werden?«, fragte die Frau. Wohl schon öfter als ihr Mann in Italien gewesen, dachte Brunetti.
Brunetti sah aus den Augenwinkeln, wie der schmale Schnurrbart Vittori-Ricciardis sich an beiden Enden aufrichtete, als er mit steifem Lächeln bemerkte: »Es dürfte recht schwierig sein, ein Mosaik zu stehlen.«
»Wann werden wir es uns ansehen können?«, fragte der Bankier.
»Noch diese Woche, wann immer es Ihnen recht ist.«
»Wann können die Arbeiten beginnen?« Der Bankier hatte anscheinend nicht richtig zugehört. Brunetti hätte zu gern gesehen, mit was für einer Miene die Juraprofessorin auf die Ignoranz ihres Gatten reagierte, hielt aber den Blick weiter auf den Kanal gerichtet, als ob diese Leute sich in einer Sprache unterhielten, die er nicht verstand.
»Sobald wir die Genehmigung haben. Wir hoffen, in ein paar Monaten ist es so weit«, antwortete Vittori-Ricciardi. Ein Engländer wie dieser Bankier, dachte Brunetti, hört bestimmt nur »ein paar Monate«, nicht aber »wir hoffen«, und hat keine Ahnung, dass die Betonung auf Letzterem liegt.
Die drei schwiegen eine Weile. Dann hakte Vittori-Ricciardi sich bei dem Bankier unter, wobei er dies, dachte Brunetti, vergeblich als spontane Geste zu tarnen suchte und den anderen lediglich damit erschreckte, der denn auch gleich seinen Arm befreite. Sie gingen, langsam gefolgt von der Frau, nebenan die bemalten Deckenbalken bewundern, eins der architektonischen Details, für die der Palazzo berühmt war.
Kaum waren sie verschwunden, kamen auch schon Paola und ihre Mutter durch dieselbe Tür. Paolas Miene ließ {23}Brunetti auf ein baldiges Entkommen hoffen, und da eilte sie auch schon mit flehender Geste auf ihn zu: »Bring mich hier raus, Guido, bitte. Sag Demetriana, du musst jemanden verhaften.«
»Dein Wunsch ist mir Befehl«, sagte Brunetti bescheiden und ging mit ihnen nach nebenan, wo Contessa Lando-Continui Hof hielt. Nachdem sie sich mit Wangenküssen verabschiedet hatten, ließen Paola und ihre Mutter ihn mit der Contessa allein.
Bevor Brunetti ihr für die Einladung danken konnte, legte die Contessa ihm eine Hand auf den Arm. »Hat Donatella mit Ihnen gesprochen?«
»Ja, das hat sie.«
»Ich muss mit Ihnen reden, als Polizist und als Mitglied ihrer Familie«, sagte die Contessa in eindringlichem Ton.
»Stets zu Diensten«, entgegnete Brunetti nur. Und während er noch rätselte, welche dieser beiden Eigenschaften ihr wohl wichtiger war, verstärkte sie den Druck auf seinen Arm und fragte: »Können Sie morgen zu mir kommen?« Undenkbar, dass eine Contessa das Vaporetto nahm und dann zu Fuß in der Questura erschien.
»Morgen Nachmittag?«, schlug er vor.
»Da werde ich zu Hause sein.«
»Gegen fünf?«
Sie nickte, reichte ihm die Hand und wandte sich dem Lord zu, der sich ebenfalls verabschieden wollte.
Wenige Minuten später gelangten Brunetti und Paola an die Brücke vor der Universität. »Ein Spaziergang nach dem Essen tut gut«, sagte Brunetti in der Hoffnung, kein {24}Wort über den Abend verlieren zu müssen und auch nicht über das Gespräch mit der Contessa. Oben auf der Brücke machten sie kurz halt und beobachteten einige Feuerwehrmänner, die aber nur tatenlos herumstanden.
Der Sommer war vorbei, die Touristenschwärme hatten ihre Winterquartiere aufgesucht. Der Campo San Polo war menschenleer; alle Bars hatten geschlossen, sogar die Pizzeria am anderen Ende.
»Was hatte der Bankier zu berichten?«, fragte Brunetti.
»Eine Menge«, antwortete Paola. »Nach einer Weile habe ich nicht mehr zugehört und nur noch genickt, wenn ich es für angebracht hielt.«
»Hat er was gemerkt?«
»O nein«, versetzte Paola schlicht. »Das tun sie nie.«
»Sie?«
»Männer, die alles wissen, und die gibt es zuhauf. Als Frau muss man nur interessiert dreinschauen und gelegentlich nicken. Ich sage dann innerlich Gedichte auf.«
»Bin ich auch so einer?«, fragte Brunetti.
Paola sah ihm ins Gesicht. »Du kennst mich seit so vielen Jahren und kannst immer noch solche Fragen stellen?« Da ihr Mann schwieg, sagte sie: »Nein, du bist nicht so einer. Du weißt sehr viel, aber du tust niemals so, als ob du alles wüsstest.«
»Und wenn ich so täte?«
»Oh«, rief sie und ging wieder weiter, »eine Scheidung ist so lästig, da würde ich lieber interessiert dreinschauen und ab und zu mal nicken.«
»Und innerlich Gedichte aufsagen?«
»Genau.«
{25}Sie bogen in die calle, die zu ihrem Haus führte. Plötzlich musste er an das Venedig seiner Kindheit denken, wo die wenigsten Leute ihr Haus verschlossen hielten, seine Familie jedenfalls nicht. Andererseits, dachte er, hatte seine Familie auch nichts besessen, wofür ein Dieb sich interessiert hätte. Er holte die Hausschlüssel hervor, doch bevor er aufschloss, legte er Paola einen Arm um die Schultern und gab ihr einen Kuss aufs Haar.
{26}2
Am nächsten Morgen nutzte Brunetti ihre Kaffeepause in der Bar am Ponte dei Greci, um mit Vianello über die Gäste der Contessa Lando-Continui und vor allem über die Contessa selbst zu reden. Brunetti ließ sich darüber aus, wie die Contessa den Verfall der Stadt beklagt hatte – bis ein Gast sie zum Schweigen gebracht hatte, indem er sie mit Lob überschüttete.
»Wer widerspricht denn schon, wenn er gesagt kriegt, wie wunderbar er ist«, meinte Vianello dazu, eine Bemerkung, der Bambola hinterm Tresen mit verständnisvollem Kopfnicken zustimmte. Nach kurzem Überlegen fragte Vianello: »Wie stehen die beiden denn zueinander? Ist er ein Verwandter? Ein Angestellter?« Er nippte an seinem Kaffee – die Brioche war längst gegessen – und fuhr dann fort: »Nur jemand, der etwas haben will, bauchpinselt einen so. Aber dazu müsste er sie sehr gut kennen.«
Darüber hatte Brunetti auch schon nachgedacht. Nur jemand, der uns näher kennt, weiß, für welche Vorzüge wir gern gelobt werden – und für welche nicht. Paola war taub für Komplimente über ihr Aussehen, ließ sich aber von jedem einwickeln, der ihre Schlagfertigkeit lobte. Und er selbst ließ sich nicht in seine Arbeit hineinreden, während jedes Lob für seine geschichtlichen Kenntnisse oder literarischen Vorlieben ihm Vergnügen bereitete.
»Er hat ihre Großzügigkeit hervorgehoben, ihre Generosität«, erklärte Brunetti, wobei man beim letzten Wort {27}die Gänsefüßchen hörte. Er hatte keine Ahnung, ob sie das Loblied verdiente. Abgesehen von dem, was am gestrigen Abend zur Sprache gekommen war, wusste er so gut wie nichts über die Aktivitäten der Contessa. Ja er wusste überhaupt wenig über sie. Generosität jedoch war eine Eigenschaft, die Venezianern, ob adlig oder nicht, selten nachgesagt wurde.
»Weißt du etwas über sie oder ihre Familie?«, fragte er.
»Lando-Continui«, murmelte der Ispettore. Er beobachtete, mit dem Rücken gegen die Theke gelehnt, die Passanten, die über die Brücke in Richtung griechische Kirche gingen. »In Mestre gibt es einen Notar Lando-Continui; bei dem war mein Cousin mal, als er seine Wohnung verkaufen wollte.« Nun begegneten sich Leute auf der Brücke, die einen verschwanden im Inneren von Castello, die anderen liefen Richtung bacino oder San Marco.
»Da war noch was, aber ich komme gerade nicht drauf«, sagte Vianello enttäuscht, und weil Pattas Sekretärin sicherlich fixer war als sein Gedächtnis: »Du könntest ja Signorina Elettra fragen, wenn es wichtig ist. Es gab da etwas Unerfreuliches, vor Jahren, aber ich komme einfach nicht drauf.«
»Ich kenne die Contessa schon länger«, sagte Brunetti, »aber wir haben immer nur über Nichtigkeiten geplaudert. Gestern Abend bekam ich zum ersten Mal einen deutlichen Eindruck von ihr. Sie ist gar nicht so steif, wie ich dachte. Allerdings«, fügte er hinzu, »ist sie frustriert.«
»Worüber?«
»Darüber, dass unsere schöne Stadt zur Kasbah verkommen ist«, säuselte Brunetti spöttisch. »Nicht mehr die {28}Stadt, in der ich als Kind gespielt habe.« Dann wieder mit normaler Stimme: »Man kennt das ja.«
»Klingt nicht viel anders als das, was wir selber auch sagen, oder?«, meinte Vianello, und Bambola wandte sich grinsend ab.
Brunetti unterdrückte eine leichte Verstimmung und sagte: »Schon möglich.« Hatten ihn die Klagen der Contessa etwa deswegen so genervt, weil er sich unbewusst darin wiedererkannte?
Er griff in die Tasche und legte zwei Euro auf den Tresen. Sergio, der Besitzer der Bar, hatte den Kaffeepreis auf einen Euro zehn angehoben, jedoch nicht für die Mitarbeiter der Questura. Die zahlten weiterhin nur einen Euro, »bis«, wie Sergio zu sagen pflegte, »der Euro wieder abgeschafft wird und wir zur Lira zurückkehren und alles billiger wird«. Niemand in der Questura besaß den Mut, dies mit Sergio zu diskutieren, alle ließen sich den Vorzugspreis gefallen.
Zurück im Büro fand Brunetti auf dem Schreibtisch einen großen Umschlag vor, über dessen zugeklebte Lasche seine Kollegin Claudia Griffoni ihren Namen gekritzelt hatte.
Er riss ihn auf und zog sechs Plastikmappen mit den neuesten Berichten jener Beamten heraus, die befugt waren, bezahlte Informationen einzuholen. Brunetti wusste, andere Beamte unterhielten inoffizielle, durchaus nicht immer koschere Beziehungen zu Kriminellen und bezahlten sie mit Gefälligkeiten oder Zigaretten oder, fürchtete er, mit Drogen, die sie bei Razzien beschlagnahmt hatten. Die sechs Beamten hingegen – fünf Männer und eine Frau –, deren Berichte er alle zwei Monate las, bezahlten mit Geld {29}vom Innenministerium: Die Quittungen waren an die Berichte geheftet, jeder Euro war sorgfältig verzeichnet, auch wenn die ausgewiesenen Beträge natürlich nicht auf ihre Angemessenheit überprüft werden konnten.
Nur schon die erste: eine Restaurantquittung über 63,40 Euro, darunter in Schönschrift »6,60 Euro Trinkgeld«. Siebzig Euro für die Information, dass afghanische Flüchtlinge auf Lastwagen aus Griechenland nach Italien gebracht wurden – was man auch gratis an jeder Straßenecke in Mestre oder aus Il Gazzettino erfahren konnte. Derselbe Beamte berichtete, ein Freund, Betreiber eines tabacchi in Mogliano, habe von einem (namentlich genannten) Kunden Schmuck zum Verkauf angeboten bekommen unter der Bedingung, dass dessen Herkunft ein Geheimnis bleibe. Preis: zwanzig Euro.
Die anderen hatten kaum Besseres zu bieten. Immerhin hatten nur wenige mehr als fünfzig Euro ausgegeben. Brunetti beschlich ein ungutes Gefühl bei der Vorstellung, dass Verrat für so wenig zu haben war.
Er ging nach unten in Signorina Elettras winziges Büro. Sie saß am Computer, beide Hände reglos über der Tastatur – wie eine Pianistin, die sich zum letzten Satz einer Sonate bereitmacht. Ihr Innehalten, bevor sie in die Tasten griff, zog sich in die Länge. Offenbar war sie in einen Text auf dem Bildschirm vertieft. Als sie sich dann doch zu Brunetti umdrehte, schien sie ihn nicht zu erkennen. Endlich ließ sie die Hände sinken, lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust.
Brunetti kam näher. »Probleme?«, fragte er, da Signorina Elettra immer noch nicht auf ihn reagierte.
{30}Sie blickte auf. Kein Lächeln. Nachdenklich legte sie den Zeigefinger an die Lippen, dann glitt ihre Rechte auf die Tasten. Sie tippte etwas, wartete, tippte weiter, sank zurück und starrte auf den Bildschirm.
Sie rührte sich so lange nicht, dass Brunetti die Geduld verlor: »Was Ernstes?«
Signorina Elettra musterte den Bildschirm mit ungewohnt argwöhnischem Blick, als habe der sie böse angeknurrt. Dann stützte sie die Ellbogen auf den Tisch und legte das Kinn in die Hände. Erst dann antwortete sie: »Schon möglich.«
»Geht das etwas genauer?«
»Unter den heutigen E-Mails an den Vice-Questore war eine mit einem Anhang. Der Absender war mir bekannt, die Adresse nicht. Also habe ich den Anhang nicht geöffnet.«
Sie hielt inne. Da Brunetti keine Ahnung hatte, wovon sie überhaupt redete, beschränkte er sich auf ein knappes »Merkwürdig«. Er nahm an, dass dies eine passende Antwort war.
»Allerdings.«
»Was haben Sie stattdessen getan?«
»Was jeder tun würde«, sagte sie, was ihm auch nicht weiterhalf. Und dann: »Ich habe die Mail samt Anhang als gelesen markiert und gehofft, damit wäre die Sache erledigt.«
Sie sah Brunetti forschend an, ob er ihr folgen könne; anscheinend verriet seine Miene zumindest einen Teil der Wahrheit. Also erklärte sie es ihm: »Damit können die in fremde Systeme eindringen: Wenn man so einen Anhang öffnet.«
{31}»Woher kam die Mail?«, fragte Brunetti.
»Ich habe sie zu einer Adresse des Innenministeriums zurückverfolgt«, sagte sie.
Die Antwort machte ihn sprachlos. Herrgott, sie arbeiteten für das Innenministerium! Warum sollte dort jemand danach trachten, in ihr System einzudringen, wo jede von der Questura gesendete oder empfangene Mail oder SMS ohnedies dort erfasst und gespeichert wurde?
Während Signorina Elettra wieder in die Betrachtung des Bildschirms versank, dachte Brunetti über mögliche Motive nach. Dass ihre Korrespondenz und Telefonate dienstlich überwacht wurden, war nichts Neues: Er glaubte schon lange, dass sowieso jeder von irgendwem abgehört wurde. Wenn allerdings so viele Leute spionierten, statt zu arbeiten, erklärte dies vielleicht, warum es heutzutage so schwierig geworden war, etwas zum Abschluss zu bringen. Auch Brunetti hatte immer den heimlichen Lauscher im Hinterkopf, wenn er telefonierte, und den heimlichen Leser, wenn er eine Mail abschickte. Kein Wunder, dass man nichts mehr erledigt bekam, wenn man ständig neugierige Augen und Ohren berücksichtigen musste.
Aber Spionage auf diesem Niveau war doch hoffentlich die Sache von Experten? Eine Sekretärin im Büro eines Vice-Questore di Polizia in einer kleinen Stadt wie Venedig sollte nicht in der Lage sein, einen solchen Angriffsversuch zu bemerken, oder? Versierte Schnüffler wären nicht so ungeschickt.
»Wissen Sie, aus welchem Büro das gekommen ist?«
Sie sah zum Fenster hinaus. Schließlich verneinte sie mit {32}einem widerwilligen Kopfschütteln: »Die Adresse war gefälscht.«
»Und die echte?«
»Keine Ahnung«, gab sie zu. »Ich habe alles einem Freund geschickt und ihn gebeten, sich das mal anzusehen.«
Dieser Freund war mit Sicherheit nicht autorisiert, einen Hacker einer E-Mail-Adresse des Innenministeriums durch eine gefälschte E-Mail-Adresse des Innenministeriums auszuforschen – Brunetti gab erschöpft auf, weiter darüber nachzudenken, und fragte lieber nicht nach der Identität des Freundes.
Er musste ohnehin aufpassen, wie er seine Fragen formulierte, um nicht als vollkommen ahnungslos dazustehen. »Was könnte diese Leute denn interessieren?«
»Vielleicht hoffen die, dass wir unsere Bürocomputer für private E-Mails benutzen. Wenn sie einmal drin sind, können sie alles mitlesen.« Erschauderte sie?
»Ich habe keine private E-Mail-Adresse«, sagte Brunetti.
»Sie haben keine private E-Mail-Adresse?«, echote Signorina Elettra in einem Ton, als habe er gestanden, er könne nicht mit Messer und Gabel umgehen.
»Nein«, sagte er mit derselben Unschuld, mit der er Leuten zu erklären pflegte, er habe kein telefonino. »Ich benutze die von Paola; aber für alles Berufliche nehme ich die, die man mir hier gegeben hat«, sagte er mit einem Blick in die Runde. »Ich habe Paola versprochen, ihr Konto niemals von der Questura aus aufzurufen.«
»Verstehe.«
»Ich rufe die Leute sowieso lieber an«, sagte er.
{33}»Natürlich.« Sie hob den Blick gen Himmel: dass noch jemand Telefone für sicher hielt!
»Was haben Sie nun vor?«, wollte Brunetti wissen.
Dies schien sie aufzurütteln, als ob seine Frage sie zum Handeln zwang. »Wenn mein Freund den Absender der Mail ermitteln kann, sehen wir weiter. Vielleicht handelt es sich ja bloß um harmloses Phishing, irgendeinen jungen Computerfreak, der Polizist spielen will. Hoffen wir das mal.«
Brunetti fragte lieber nicht, um was es sich sonst noch handeln könnte. Er wechselte das Thema. »Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.« Ihr Blick wirkte aufmunternd. »Könnten Sie sich nach einer Contessa Lando-Continui umsehen? Demetriana?«, bat er und wies dabei, wie um sein Anliegen zu unterstreichen, auf ihren Computer.
Ihre Augen begannen zu leuchten. »Wenn ich dieselbe Contessa meine wie Sie, dann ist sie mindestens achtzig.«
»Richtig«, sagte Brunetti. »Sie ist eine gute Freundin von Paolas Mutter, deshalb muss ich mit Bedacht vorgehen. Sie hat mich um eine Unterredung gebeten.«
Signorina Elettra bemerkte nachdenklich: »Ich erinnere mich dunkel an irgendetwas Schlimmes, das in ihrer Familie passiert ist.« Sie kramte in ihrem Gedächtnis, und dann fiel es ihr ein. »Ihre Enkelin. Vor langer Zeit. Ertrunken, oder zumindest beinahe.«
»Nie davon gehört«, meinte Brunetti überrascht. »Vianello wusste auch, dass da etwas Unerfreuliches war, konnte sich aber an nichts Genaues erinnern.«
»Ertrinken gehört sicherlich dazu.«
»Allerdings.« Wenn so etwas in seiner Familie passieren {34}würde – Brunetti musste den Gedanken gewaltsam beiseiteschieben. »Könnten Sie dem mal nachgehen?«
»Natürlich. Ist es eilig?«
»Die Sache kann warten, bis Sie mit den Nachforschungen im Innenministerium weitergekommen sind«, antwortete er.
Sie nickte und ließ das Kinn wieder auf ihre Hände sinken. Brunetti sah sie in Trance verfallen und ging in sein Büro zurück.
{35}3
Brunetti meldete sich bei niemandem ab, bevor er sich auf den Weg machte. Er nahm die Nummer eins nach San Stae, von wo er zu Fuß den Palazzo Bonaiuti ansteuerte, den Wohnsitz von Contessa Lando-Continui. Ein Dienstmädchen öffnete das Tor und führte ihn über den im Fischgrätmuster gefliesten Innenhof, an dessen Ostwand noch Chrysanthemen blühten.
Die Außentreppe zum Piano nobile musste noch das Original sein, denn die Löwenköpfe am Geländer waren glatt vom Alter und Regen und jahrhundertelangem Streicheln. Das Dienstmädchen trat in die riesige Eingangshalle und hielt ihm die Tür auf.
»Die Contessa wird Sie im kleinen Lesezimmer empfangen«, sagte sie und ging ihm voraus durch den Korridor. Vor der dritten Tür links machte sie halt und trat ein, ohne anzuklopfen. Brunetti folgte ihr.
Er hatte schon viele solche Zimmer gesehen: schwere Mahagonitische, bedeckt mit Büchern und Blumenvasen, an den Wänden Porträts mit Patina, hohe Regale, deren Bücher seit Jahrhunderten niemand mehr angerührt hatte, und bedrohlich tiefe, unbequeme Sessel.
Das Licht kam von drei Fenstern in der hinteren Wand, doch worauf gingen sie hinaus? In der Ferne sah er die hohe Rückwand aus Backstein eines großen Palazzo im Licht der tiefstehenden Sonne leuchten. Dank derselben Fähigkeit, mit der angeblich Tauben gesegnet sind, kam Brunetti {36}augenblicklich zu dem Schluss, dass die Fenster auf den Hof des Fondaco del Megio zeigten. Um sich zu vergewissern, ging er dichter heran: Die Bäume hatten schon die ersten Blätter verloren. Als er mit dem Gesicht fast die Scheiben berührte, erkannte er linker Hand einen kleinen, mit einer Mauer eingefassten Sportplatz.
Da hörte er hinter sich eine Frauenstimme: »Commissario?«
Er fuhr herum. Contessa Lando-Continui stand in der Tür. Sie wirkte nicht so eindrucksvoll wie am Abend zuvor in dem geborgten, feierlichen Rahmen, den ihr der geschmackvoll eingerichtete, jahrhundertealte Palazzo geboten hatte. Brunetti musste noch einmal hinsehen: Eine kleine alte Frau stand dort in einem schlichten blauen Kleid.
»Guten Tag, Contessa«, grüßte er. Dann wies er aus dem Fenster. »Ich glaube, da unten habe ich früher immer Fußball gespielt.« Ihr Blick folgte seinem Zeigefinger, doch sie selbst kam keinen Schritt näher. »Vor langer Zeit«, bemerkte er lächelnd, indem er auf sie zuging. Sie reichte ihm die Hand, viel kleiner als seine, aber zupackend.
Ihre Miene war zu angespannt, um freundlich zu wirken, Brunetti sah nur ein aufgesetztes Lächeln. »Danke, dass Sie gekommen sind.«
»Keine Ursache«, antwortete er automatisch, fügte aber, vielleicht angesichts der Elogen vom Vorabend, rasch hinzu: »Ich helfe gern, wenn ich kann.«
»Es war sehr nett von Donatella, dass ich meine Gäste in ihrem Haus bewirten durfte: Nur wenige Menschen in der Stadt sind so hilfsbereit. Noch netter war es, Sie und {37}Paola zum Kommen zu bewegen.« Brunetti wollte abwiegeln, doch er kam nicht zu Wort. »Ich bin Ihnen beiden wirklich zu Dank verpflichtet. Meine anderen Gäste, die Nicht-Venezianer, sollten Gelegenheit haben, ein paar Menschen kennenzulernen, deren Leben durch eine großzügige Spende bereichert werden könnte.«
Bevor Brunetti etwas erwidern konnte, wies die Contessa auf die Sessel am Fenster. Als sie Platz genommen hatten, fragte der Commissario: »Inwiefern bereichert, Contessa?«
»Weil es dann doch noch venezianische Kinder und Enkel geben wird, mit denen die Ihren zur Schule gehen können, und die ganze Stadt vielleicht nicht gar so bald zusammenbrechen wird.«
»Das klingt nicht gerade optimistisch, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.«
Es klopfte leise an die Tür. Das Mädchen kam herein und fragte: »Möchte Ihr Gast einen Tee, Contessa?«
Die Contessa sah Brunetti an. »Lieber einen Kaffee«, sagte er.
Das Mädchen nickte und verschwand.
»Was sollte mich an Ihrer Bemerkung stören, Commissario?«, nahm die Contessa das Gespräch wieder auf. »Wie könnte ich optimistisch sein? Dazu besteht weiß Gott kein Anlass.«
»Und doch machen Sie sich die Mühe und bitten reiche Ausländer zu Tisch, in der Hoffnung, dass sie Ihrer Stiftung etwas spenden?«, fragte Brunetti.
»Donatella hat mir gesagt, dass Sie sehr direkt sind«, sagte die Contessa. »Das gefällt mir. Ich habe keine Zeit zu verschwenden.«
{38}»Und war Ihre Zeit gestern Abend verschwendet?«, fragte er, obwohl ihn das eigentlich nichts anging.
»Nein, ganz und gar nicht. Der Bankier wird sich an einem Restaurierungsprojekt beteiligen.«
»Die Mosaiken?«, fragte Brunetti.
Sie sah ihn mit offenem Mund an. »Woher wissen Sie das?«