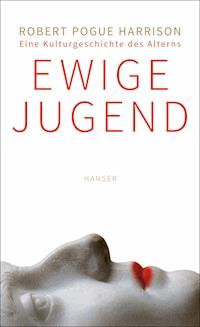
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Man ist nur so alt wie man sich fühlt – stimmt das? Unser Geburtsjahr sagt noch lange nichts darüber aus, wie es um unseren Körper steht oder wie wir selbst und andere Menschen uns wahrnehmen. Unser Alter, so Robert P. Harrison, hängt von der Welt ab, in der wir leben. Unsere Welt treibt einen verhängnisvollen Kult um die Jugend. Wenn eine alternde Gesellschaft die ewige Jugend für sich reklamiert, gibt es am Ende überhaupt keine Jugend mehr. Literatur und Philosophie liefern Harrison reiches Material für originelle Denkanstöße, immer ist bei ihm die Lust am Lesen auch die Lust zu denken. Sein Buch ist eine Kulturgeschichte des Alterns und meinungsstarke Gegenwartsdiagnose zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Wir vergöttern die Jugend und verstecken das Alter. Das war nicht immer so. Die wechselvolle Geschichte der bevorzugten Lebensphasen verändert den Blick aufs Älterwerden. Unser Alter, so Robert Pogue Harrison, hängt immer von der Welt ab, in der wir leben, und unsere Welt treibt einen verhängnisvollen Kult um die Jugend.
Junge Menschen sind wichtig, um neue Ideen zu entwickeln. Wenn aber auch die Älteren die ewige Jugend für sich reklamieren, gibt es am Ende überhaupt keine Jugend mehr. Literatur und Philosophie liefern Harrison reiches Material für eine Kulturgeschichte des Alterns, aus der zu lernen ist, wie wichtig und produktiv die unterschiedlichen Lebensalter für eine Gesellschaft sind. Gelehrt und meinungsstark – wieder verbindet sich bei Robert Harrison die Lust am Lesen mit der Lust zu denken.
Hanser E-Book
Robert Pogue Harrison
EWIGE JUGEND
Eine Kulturgeschichte
des Alterns
Aus dem Englischen von Horst Brühmann
Carl Hanser Verlag
Titel der Originalausgabe:
Juvenescene: A Cultural History of Our Age First published in the United States by The University of Chicago Press Chicago, Illinois, 2015
Das Motto aus Epikur, Wege zum Glück wird zitiert in der Übersetzung von Rainer Nickel, Mannheim: Artemis & Winkler 2011, Seite 131 und 261.
Die im Text zitierten Gedichte stammen aus:
Bonnefoy, Yves, Beschriebener Stein und andere Gedichte, übers. v. Friedhelm Kemp, München Wien: Hanser 2004./Eliot, T. S., Werke 4. Ges. Gedichte 1909–1962, übers. v. Nora Wydenbruck, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988./Hopkins, Gerard Manley, Gedichte, Schriften, Briefe, übers. v. Ursula Clemen, München: Kösel 1954./Larkin, Philip, Mich ruft nur meiner Glocke grober Klang, übers. v. Vera Thrân, Berlin: Volk und Welt 1988./Lawrence, David H., Der Atem des Lebens, übers. v. Ernst Schönwiese, Wiesbaden München: Limes 1981./Poe, Edgar Allan, »Allein«, übers. v. Theodor Etzel, Die Zeit vom 6. 10. 1949./Pound, Ezra, Personae, übers. v. Eva Hesse, Zürich-Hamburg: Arche Literatur 2012./Wordsworth, William, Gedichte, übers. v. Wolfgang Breitwieser, Heidelberg: Lambert Schneider 1959./Yeats, William Butler, Die Gedichte, übers. v. Marcel Beyer u. a., München: Luchterhand 2005.
ISBN 978-3-446-25013-0
© 2014 by Robert Pogue Harrison
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2015
Umschlag und Foto: Peter-Andreas Hassiepen, München, Motiv © Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Wangen im Allgäu
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für Andrea Nightingale
INHALT
Vorwort
Erstes Kapitel Anthropos
Zweites Kapitel Weisheit und Genie
Drittes Kapitel Neotene Revolutionen
Viertes Kapitel Amor mundi
Epilog
Danksagung
An den Leser
Anmerkungen
Literatur
Namenregister
VORWORT
Dieses Buch plagt sich mit einer einfachen Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt: Wie alt sind wir? Mit »wir« meine ich diejenigen von uns, die dem Zeitalter der Verjüngung angehören, das im Amerika der Nachkriegszeit begann und sich allmählich ostwärts ausbreitete, entgegen der Westdrift der Zivilisation, die die Alten translatio imperii nannten.
Man kann diese Frage nicht behandeln, ohne dem Phänomen des menschlichen Alters in seiner ganzen verwirrenden Vielschichtigkeit nachzugehen; denn neben ihrem biologischen, evolutionären und geologischen Alter haben die Menschen noch ein kulturelles Alter, weil sie Teil einer Geschichte sind, die vor ihrem Auftreten auf der Erde begann und nach ihrem Verschwinden weitergehen wird. Wie andere irdische Lebensformen unterliegen wir Menschen einem organischen Alterungsprozess, doch die geschichtliche Ära, in die wir hineingeboren werden, hat auf den Verlauf dieses Prozesses, selbst auf seiner biologischen Ebene, einen nicht unwesentlichen Einfluss. Wir sind eine Spezies, die auf Gedeih und Verderb die Evolution in Kultur (und umgekehrt) verwandelt hat. Daher versetzt uns eine scheinbar einfache Frage – Wie alt sind wir? – in ein unbekanntes Gebiet, in dem wir – als Einzige unter allen Lebensformen auf der Erde – allein und orientierungslos sind.
Das überdrehte Tempo, mit dem die kulturelle Evolution gegenwärtig fortschreitet, führt zu einer tiefgreifenden Verwandlung unserer Gattung. Genetisch haben sich die Menschen seit ein paar hunderttausend Jahren nicht verändert, so heißt es jedenfalls. Und doch macht eine dreißigjährige Frau auf den Tennisplätzen von San Diego eher den Eindruck einer Tochter als den einer Schwester von Balzacs femme de trente ans. Im College-Jahrbuch meines Vaters blicke ich in Gesichter gereifter Erwachsener, wie ich ihnen unter meinen Anfangssemestern niemals begegne. In früheren Zeiten sahen zwölfjährige Jungen wie kleine Erwachsene aus, in deren Gesichter die Zeit bereits ihre Furchen gegraben hatte. Dagegen bleibt das Gesicht heute in der ersten Welt unfertig, unreif, selbst wenn es mit den Jahren welkt, ohne jemals die markanten Züge des Alters anzunehmen, die in anderen Kulturen oder Epochen für Greise charakteristisch sind. Der Unterschied liegt nicht nur in unserer besseren Ernährung, Gesundheitsvorsorge und Absicherung gegen Naturgewalten, sondern in einer umfassenden biokulturellen Transformation, die größere Teile der menschlichen Population in eine »jüngere« Spezies verwandelt – jünger im Aussehen und Verhalten, in Mentalität und Lebensstil, vor allem aber in ihren Wünschen und Sehnsüchten.
Wie ist eine solche Verjüngung möglich? Gibt es ein biologisches Substrat in unserer gattungsspezifischen Existenz, das sie fördert? Wie können wir – als Individuen ebenso wie als Gesellschaft – jünger werden, wenn wir doch weiterhin altern? Und welche Zukunft, sofern wir denn eine haben, hält diese Verjüngung für uns bereit? Das sind Probleme, die unsere unter einem historischen Blickwinkel gestellte Kernfrage, wie alt wir sind, umkreisen und durchqueren. Um sie zu behandeln, habe ich mich für einen facettenreichen Ansatz entschieden, der die relevanten biologischen und evolutionären Faktoren berücksichtigt, dabei aber vor allem die großen Linien der abendländischen Kulturgeschichte verfolgt. In der Tat schien es mir notwendig, auf den folgenden Seiten so etwas wie eine Philosophie der Geschichte im allgemeinen sowie einer Philosophie des Alters im besonderen zu liefern, denn solange es Menschen gibt, bleiben Alter und Geschichte untrennbar miteinander verbunden.
Dieses Buch steht der beispiellosen Verjüngung, die über die westliche Kultur und ebenso über viele andere Kulturen hinwegfegt, bestenfalls ambivalent gegenüber. Zumindest versuche ich die Risiken abzuschätzen, die sie für unsere Zukunft – gesetzt, wir hätten eine – mit sich bringt. In dem Maße, wie unsere Epoche das historische Kontinuum immer heftiger erschüttert, wird die Welt all denen fremd, die nicht in ihre Neuerungssucht hineingeboren wurden – die sozusagen in der neuen Zeit nicht heimisch sind. Zu Beginn seines »Doggerel by a Senior Citizen« schrieb W. H. Auden: »Our earth in 1969/Is not the planet I call mine.« Dieses Gefühl einer Weltenteignung hat sich für viele Bürger unseres Planeten seit 1969 erheblich verschärft. Ein Älterer hat keine Vorstellung, was es bedeutet, im Jahr 2014 ein Kind, ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener zu sein. Er wird deshalb jungen Leuten kaum irgendeinen Rat geben können, wenn es um die Wege der Reifung oder um ihren Eintritt in den öffentlichen Raum der Gesellschaft geht, einer Gesellschaft, für die die jungen Leute irgendwann die Verantwortung übernehmen müssen – oder die Konsequenzen zu tragen haben, wenn sie an dieser Aufgabe scheitern. Es ist noch nicht abzusehen, ob eine Gesellschaft, die ihre intergenerationale Kontinuität in solchem Maße verliert, lange überleben kann.
Eine der Thesen dieses Buches lautet, dass unsere jugendbesessene Gesellschaft faktisch Krieg gegen die Jugend führt, der sie angeblich huldigt. Es mag so scheinen, als gehörte die Welt heute vor allem den jüngeren Generationen mit ihrer eigenwilligen Mentalität und ihren technischen Spielereien, doch in Wahrheit entzieht das Zeitalter als Ganzes wissentlich oder unwissentlich den jungen Leuten das, was sie am meisten brauchen, wenn sie sich entfalten sollen. Sie nimmt ihnen die Muße, den Schutz und die Einsamkeit, also die Quellen der Identitätsbildung, von der schöpferischen Einbildungskraft ganz abgesehen. Sie beraubt sie der Spontaneität, des Staunens und der Freiheit zu scheitern. Sie enthält ihnen die Fähigkeit vor, Bilder mit geschlossenen Augen entstehen zu lassen, also über die Magie des Kinos, des Fernseh- oder des Computerbildschirms hinaus zu denken. Sie beraubt sie einer umfassenden Beziehung zur materiellen Natur, ohne die es kein Gefühl der Verbundenheit mit der Welt gibt und ohne die das Leben im Grunde ohne Sinn bleibt. Sie nimmt ihnen die Kontinuität mit der Vergangenheit, deren Zukunft zu sichern sie bald aufgerufen sein werden.
Wir fördern die Sache der Jugend nicht, wenn wir ihr Begehren infantilisieren, statt es zu erziehen, und dann aus seiner schlechten Unendlichkeit Kapital schlagen; wenn wir die relative Stabilität der Welt zerrütten, auf der kulturelle Identität beruht; oder wenn wir die jungen Leute dazu nötigen, eine Gegenwart ohne historische Tiefe oder Dichte zu bewohnen. Der größte Segen, den eine Gesellschaft ihrer Jugend erteilen kann, besteht darin, sie zu Erben, nicht zu Waisen der Geschichte zu machen. Und das ist auch der größte Segen, den die Gesellschaft sich selbst spenden kann, denn Erben verjüngen die Vergangenheit, indem sie deren Vermächtnis schöpferisch erneuern. Waisen hingegen beziehen sich, wenn überhaupt, auf die Vergangenheit wie auf einen fremden, unnahbaren Kontinent. Unser Zeitalter scheint fest entschlossen, die ganze Welt in ein Waisenhaus zu verwandeln, aus Gründen, die niemand wirklich versteht – der Autor dieses Buches am allerwenigsten.
Diesem Buch geht es nicht darum, eine apokalyptische Zukunftsvision zu verkünden. Ich mache hier keine Prophezeiungen, schon deshalb nicht, weil es unser Zeitalter unmöglich macht, das Ergebnis der Umbrüche, die es unaufhörlich hervorruft, vorauszusagen. Gegenwärtig vermag niemand zu sagen, ob der Sturm des Jugendkults, der uns erfasst hat, zu einer echten Verjüngung oder bloß zu einer Verjugendlichung der Kultur führen wird. Alles wird davon abhängen, ob wir Möglichkeiten finden, neue und jüngere Formen der kulturellen Reife hervorzubringen. Nichts ist in dieser Hinsicht wichtiger, als dass wir uns unserem Alter gemäß verhalten. Ich meine: unserem historischen Alter gemäß. Die Vergangenheit hört nicht einfach auf zu existieren, nur weil wir die Erinnerung an sie verlieren. Eine vieltausendjährige Geschichte schlummert in uns, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wir mögen die »jüngste« Gesellschaft in der Geschichte der menschlichen Zivilisation sein, doch gleichzeitig sind wir auch die älteste – und altern mit jedem Jahrzehnt, jedem Jahrhundert und jedem Jahrtausend.
Als ich das Buch zu schreiben begann, standen mir zwei Möglichkeiten vor Augen: einen schwerfälligen Wälzer zu verfassen oder es gnädig bei einem schlanken Band zu belassen. Ich wählte die letztere. Da ich aber auch entschlossen war, die Dinge nicht übervereinfacht darzustellen, ist dabei ein Buch entstanden, das in seiner essayistischen Behandlung eines komplexen Problemzusammenhangs vielleicht manchmal befremdlich erscheint. Doch ich würde es dem Leser nicht übergeben, hätte ich das Gefühl, dass es darin an narrativer Logik und innerer Kohärenz mangelte. Es ist ein Buch, das seinem Leser zutraut, Kurs zu halten, wie gewunden der Weg auch sein mag.
Ein törichtes Leben ist undankbar und angsterfüllt: Es ist ganz auf die Zukunft gerichtet.
Wer an das Gute, das ihm widerfuhr, nicht mehr denkt, ist schon heute ein Greis.
Epikur
ERSTES KAPITEL
ANTHROPOS
Das faszinierende Phänomen des Alters
Nichts im Universum, und wäre es ein Neugeborenes oder das Universum selbst, ist ohne Alter. Ein Phänomen, das nicht altert, ist nicht von dieser Welt. Und wenn es nicht von dieser Welt ist, ist es auch kein Phänomen.
Im Grunde ist unser Verständnis vom Wesen des Alters recht bescheiden, vielleicht weil sich unser Verstand eher in der Auseinandersetzung mit Gegenständen im Raum entwickelt hat als mit den verborgenen Feinheiten von Wachstum, Dauer und Akkumulation. Gewiss fällt es uns leichter, Zeit zu verräumlichen – sie als lineare oder chronologische Abfolge von Jetzt-Momenten zu denken –, als die vieldimensionalen, einander überlagernden Zäsuren des Alters zu ergründen. In der Tat neigen wir beharrlich dazu, Alter auf »Zeit« zurückzuführen, aber was ist Zeit anderes als eine ungeheure Abstraktion, ein flatus vocis? Erst das Alter liefert der Zeit ein Maß für Realität.
Die scharfsinnigsten Philosophen denken Alter als eine Funktion der Zeit; eine sorgfältige phänomenologische Analyse zeigt jedoch, dass wir Zeit als eine Funktion des Alters denken sollten. Immerhin ist noch jeder bisherige Zeitbegriff in gewisser Weise gealtert, also einem Alterungsprozess unterworfen. Gleiches gilt für die Ewigkeit, die ebenfalls der allgemeinen Sterblichkeit der Phänomene unterliegt. Ewigkeit erscheint uns heute nicht mehr als das, was sie für Platon war, als er und seine griechischen Zeitgenossen den Blick zu den Sternen erhoben. Ebenso wenig empfinden wir sie wie Dante, wenn er und die Christen seiner Zeit die himmlischen Sphären betrachteten. In der Tat ist Ewigkeit eine Vorstellung, die in unserem sich immer weiter ausdehnenden Kosmos keinen Platz hat, in einem Kosmos, von dem wir heute annehmen, dass er einen Anfang hatte und schließlich auch ein Ende haben wird. Insofern können wir sagen, dass Ewigkeit im Grunde aus unseren phänomenologischen Horizonten verschwunden ist, dass sie sich existentiell überlebt hat.
In seinem Buch L’Évolution creatrice (1907) hat der französische Philosoph Henri Bergson überzeugend nachgewiesen, dass die traditionelle Philosophie dazu neigt, Zeit eher geometrisch als organisch zu denken. Doch trotz all seiner tiefen Gedanken über la durée und die organische Form hat Bergson niemals eine Philosophie des Alters vorgelegt. Er entwickelte lediglich eine andere Philosophie der Zeit – eine, die eher auf biologischen als auf chronologischen Mustern beruhte. Sein Beitrag war ohne Zweifel ein bedeutsames Korrektiv, doch das Phänomen des Alters ist umfassender als das, was die Biologie dazu beisteuern kann. Denn Menschen sind biologische Wesen, die transbiologische Institutionen erschaffen; mit den Institutionen aber kommen kulturelle und historische Elemente ins Spiel, die bei Bergson und den meisten anderen Philosophen weitgehend außer acht blieben.
Alle Lebewesen gehorchen dem organischen Gesetz von Wachstum und Verfall, und in dieser Hinsicht stellen Menschen keine Ausnahme dar. Dem Rätsel der Sphinx zufolge gehen wir am Morgen auf vier Beinen, mittags auf zweien und, wenn wir lange genug leben, am Abend auf dreien. Ödipus jedoch entdeckte, kaum dass er in der Gewissheit, das Rätsel gelöst zu haben, in Theben angekommen war, dass die Dinge weit komplizierter liegen. Schließlich beginnt die Geschichte bereits vor der Geburt und geht nach dem Tod weiter. Anders gesagt, im Unterschied zu anderen Lebewesen wird anthropos in menschengeschaffene Welten hineingeboren, deren historische Vergangenheit und Zukunft weiter reichen als die Lebensspanne des einzelnen. Diese Welten, deren Gesamtheit die Griechen als polis bezeichneten, gründen auf einem institutionellen und kulturellen Gedächtnis, das ihren Bewohnern ein historisches Alter verleiht, welches seiner Natur nach ein ganz anderes ist als das biologische Alter. Da kein menschliches Wesen außerhalb solcher Welten mit ihren Vermächtnissen und Traditionen lebt, können wir sagen, dass die Menschen ihrer Natur nach »heterochron« sind, also über verschiedene Arten von Alter verfügen: ein biologisches, ein historisches, ein institutionelles, ein psychologisches. Nach und nach werden wir sehen, wie diese verschiedenen »Alter« miteinander verschränkt sind – sowohl auf der Ebene der Individuen als auch der Kulturen; halten wir hier einfach fest, dass in dem Moment, in dem anthropos die Bühne betritt, das Phänomen des Alters an Komplexität mindestens ebenso zunimmt wie in dem Moment, als das Leben auf unserem Planeten zum ersten Mal eine Spur hinterließ.
Derjenige Denker, von dem man eine brisante Philosophie des Alters erwarten würde, zumal was ihre menschliche Komponente angeht, ist Martin Heidegger. Heidegger dachte über Zeit radikaler nach als jeder Philosoph vor oder nach ihm. Doch auch er hatte – wie die metaphysische Tradition, an deren Überwindung er arbeitete – wenig über das Alter zu sagen. Heidegger lehrte uns, dass Zeit zeigend ist – dass sie einer Art Bewegung oder kinesis entspricht, die es dem Phänomen ermöglicht, zu erscheinen und von Gedanken und Worten erfasst zu werden. Er lehrte uns ebenfalls, dass die entbergende Dynamik der Zeit in der endlichen Zeitlichkeit des Daseins gründet. Weshalb er keine Anstrengung unternahm, die Zeitlichkeit des Daseins mit seinem Alter zu verknüpfen, und sei es in der nächstliegenden Bedeutung von Lebensphasen, ist schwer zu ergründen; denn wenn es um die existentialen Bestimmungen des Daseins geht, ist das Alter ebenso grundlegend wie Geworfenheit, Entwurf, Verfallenheit, Sein zum Tode und Mitsein. Gleichwohl bleibt das Dasein aus unerfindlichen Gründen in Sein und Zeit wie auch in Heideggers späterem Denken seinem Wesen nach alterslos.
Ich finde das verwunderlich, denn man könnte doch sagen, das Alter verhalte sich zur Zeit wie der Platz zum Raum. Nirgendwo in seinem Werk ist Heidegger überzeugender als dort, wo er aufzeigt, wie der Platz in seiner situierten Begrenztheit dem Raum vorausgeht. In musterhaft phänomenologischer Manier führt er vor, wie der wissenschaftliche Begriff eines homogenen Raumes aus der Öffnung des Daseins auf das »Da« seiner eigenen Hingehörigkeit hervorgeht oder von ihr ermöglicht wird. Man hätte von Heidegger eine ähnliche Analyse dazu erwartet, wie das Alter in seiner existentialen und historischen Ursprünglichkeit als Maßstab, wenn nicht als Quelle der endlichen Zeitlichkeit des Daseins und des chronologischen Begriffs der Zeit figuriert. Eine solche Analyse hätte ihm Gelegenheit geboten, zu zeigen, dass das stets endigende Wirken der Zeit in der Entfaltung des Alters und durch sie stattfindet, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Ära für Ära und Epoche für Epoche. Leider erwägt Heidegger nirgendwo in seinem Werk das Alter als die Grenze der Endlichkeit, die es der Zeit erlaubt, in ihrem Zeigecharakter die Welt der Phänomene zu entbergen.
Lassen Sie mich kurz den Versuch machen, zu verdeutlichen, was alles, phänomenologisch gesprochen, außer acht bleibt, wenn es uns nicht gelingt, Zeit in Alter zu fundieren oder erstere aus letzterem herzuleiten.
Ich möchte mit der Feststellung beginnen, dass jedes Phänomen sein Alter oder, besser gesagt, seineAlter hat. Weshalb der Plural? Weil Entitäten erst zu Phänomenen werden, wenn sie wahrgenommen, intendiert oder begriffen werden. Daher bringt das Phänomen mindestens zwei voneinander unabhängige, aber miteinander verschränkte Alter zusammen: das Alter der Entität und das Alter des Begreifenden. Ein Junge und sein Großvater mögen in einem Urwald an der nordwestlichen Pazifikküste ihre Augen auf denselben Riesenmammutbaum richten, sie werden gleichwohl nicht dasselbe Phänomen sehen. Aufgrund ihres unterschiedlichen Alters erscheint es dem Jungen anders als dem Älteren. Der Himmel über mir bietet heute mehr oder weniger das gleiche blaue Schauspiel wie von jeher, doch seinem Alter nach ist es nicht derselbe Himmel. Als ich sieben war, war er das Band zwischen meinem Körper und dem Kosmos; mit zwanzig erschien er mir als eine Abstraktion; heute ist er die Kuppel zu einem Haus, von dem ich weiß, dass ich es nicht mehr allzu lange bewohnen werde; in Kürze wird er die Antwort darauf sein, was heute noch eine Frage bleibt.
Es führt zu nichts, wenn man sagt, ich »projizierte« mein Alter auf die Phänomene. Der Himmel ist mir immer als etwas Altersloses erschienen; und doch erscheint mir seine Alterslosigkeit, während ich altere, jeweils anders. Mein einziger Zugang zum Himmel und zur Welt der Phänomene überhaupt geht von meinem eigenen nichthimmlischen Alter aus. Wenn Identität Selbstgleichheit in der Zeit meint, dann ist das Alter das latente Element, das ein Differential in die Identitätsgleichung und damit in die Erscheinung der Dinge einbringt. Um denselben Gedanken etwas anders auszudrücken: Ich verleihe nicht dem Phänomen mein Alter; vielmehr erreicht mich das Phänomen vermittels der Rezeptions- und Perzeptionsformen, die zu meinem Alter gehören. Man könnte es auch kantischer ausdrücken und sagen, dass Zeit in der Kindheit und im Erwachsenenalter nicht dieselbe Anschauungsform ist oder dass die Einbildungskraft Zeit in der Jugend anders schematisiert als im Alter.
Gerard Manley Hopkins’ Gedicht »Spring and Fall«/»Frühling und Herbst«, in dem sich ein älteres lyrisches Ich an ein junges Mädchen wendet, drückt poetisch aus, was ich prosaischer über den Altersunterschied in der Selbstbekundung des Phänomens dargelegt habe:
Margaret, are you grieving
Over Goldengrove unleaving?
Leaves, like the things of man, you
With your fresh thoughts care for, can you?
Ah! as the heart grows older
It will come to such sights colder
By and by, nor spare a sigh
Though worlds of wanwood leafmeal lie;
And yet you wíll weep and know why.
Now no matter, child, the name:
Sorrow’s springs are the same.
Nor mouth had, no nor mind, expressed
What heart heard of, ghost guessed:
It is the blight man was born for,
It is Margaret you mourn for.
In der Übersetzung von Ursula Clemen:
Margaret, härmst du dich über
Goldenhain, der sich entblättert?
Blätter, wie Menschendinge, dein
Frischer Sinn, sag, mag er sich sorgen darum?
Ach, wie das Herz älter wird,
Fühlt es solchen Anblick kälter
Nach und nach, gönnt keinen Seufzer mehr,
Ob auch Welten von Welkwald blattweis fallen;
Und doch wirst du weinen und wissen, warum.
Was aber, Kind, gilt hier der Name:
Leides Ursprung ist immer der gleiche.
Kein Mund fand, nein, noch Geist je Wort
Für das, was Herz vernommen, Seele sah:
Es ist Welknis, für die wir geboren,
Es ist Margaret, um die du trauerst.
(Hopkins, Gedichte, Schriften, Briefe, S. 117)
Auch wenn es Margarets Emotionen hier an Glaubwürdigkeit mangelt – ein junges Mädchen vergießt normalerweise keine Tränen über fallendes Herbstlaub –, so lenkt das Gedicht doch die Aufmerksamkeit auf zwei wichtige phänomenologische Tatsachen. Erstens wirkt sich der Prozess des Alterns auf die Wahrnehmung der Phänomene aus. Zweitens ist menschliche Wahrnehmung auf einer bestimmten Ebene stets auch Selbstwahrnehmung. Der Unterschied zwischen dem Kind und dem Erwachsenen in dem Gedicht besteht darin, dass der Erwachsene vermutlich weiß, »weshalb« er weint, während Margaret dies vermutlich nicht weiß. Sie muss erst noch begreifen lernen, dass »Leides Ursprung […] immer der gleiche« ist.
Die letzte Behauptung mag tatsächlich zweifelhaft oder gar schlicht falsch sein – die Quellen des Leids sind nicht immer die gleichen –; jedoch liegt die Wahrheit des Hopkinsschen Gedichts nicht in seinem propositionalen Gehalt, sondern in der Entdeckung, dass mit dem Älterwerden des Herzens dem Phänomen eine andere Bedeutung zuwächst, eine Bedeutung, die eng mit dem Alter des Wahrnehmenden verbunden ist.
Auch der Dichter Giacomo Leopardi war der Meinung, dass sich die Gegenstände der Wahrnehmung mit zunehmendem Alter anders darbieten. Seiner pessimistischen Weltsicht zufolge neigt die Jugend dazu, in den Naturphänomenen ein unendliches Versprechen zu sehen. Herbstlaub, Mondlicht, offenes Meer – all dies sind Andeutungen künftigen Glücks. Doch indem sie die Jugend dazu einlädt, ihre Schönheit als Versprechen zu erfahren, erweist sich die Natur als unbeschreiblich grausam, denn dieses Versprechen ist und war stets un inganno, eine Täuschung. In seinem Gedicht »A Silvia« drückt er dies so aus: »O natura, o natura./Perchè non rendi poi/Quel que prometti allor? Perchè di tanto/Inganni i figli tuoi?« »O Natur, o Natur,/warum hältst du nicht ein,/was du versprachst, und täuschst mit betörendem Schein/die eigenen Kinder nur?« (Leopardi, Gesänge und Fragmente, S. 147) Bei Hopkins offenbart das Alter mit der Zeit die implizite Wahrheit, die ein junges Mädchen in dem Phänomen naiv wahrnimmt; bei Leopardi offenbart es mit der Zeit die Täuschung, die in der naiven Wahrnehmung der Jugend verborgen ist. Noch einmal: Weder die eine noch die andere Vorstellung muss empirisch »wahr« sein. Wenigstens für unsere Zwecke jedoch ist wichtig, dass, im Unterschied zur Geschichte der Philosophie, die Geschichte der Dichtung eine Fülle von phänomenologischen Einsichten bietet, auf welchem Wege sich Wahrheit im Altern und durch das Altern offenbart.
Wenn Zeit, wie Heidegger behauptete, Wahrheit entbirgt und wenn Wahrheit wiederum, wie ich behaupte, altersgebunden ist, dann ist das, was in einer Lebensphase absolut wahr ist, in einer anderen bestenfalls relativ wahr. Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal die Eingangsverse von T. S. Eliots »The Four Quartets«/»Vier Quartette« las, war ich zutiefst davon überzeugt, auf die zeitlose Wahrheit der Zeit selbst gestoßen zu sein:
Time present and time past
are both perhaps present in time future
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
all time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation.
In deutscher Übersetzung:
Jetzige Zeit und vergangene Zeit
Sind vielleicht gegenwärtig in künftiger Zeit
Und die künftige Zeit enthalten in der vergangenen.
Ist alle Zeit auf ewig gegenwärtig
Wird alle Zeit unerlösbar.
Was hätte sein können ist eine Abstraktion
Und bleibt als unentwegte Möglichkeit bestehn
Nur in einer Welt spekulativen Denkens.
(Eliot, Werke 4, S. 279)
Für einen jungen Menschen klingen Eliots Verse über das, »was hätte sein können«, wie die unheilvolle Wahrheit eines Orakels. Sie üben enormen Druck auf ihn aus, Nietzsches Lehre der ewigen Wiederkehr ernst zu nehmen (nach der wir vom Schicksal dazu verurteilt sind, alle Augenblicke unseres Lebens immer wieder, ewig, zu wiederholen) oder Rilke beim Wort zu nehmen, wenn er in seiner neunten »Duineser Elegie« (Sämtliche Werke 1, S. 717) schreibt: »Uns, die Schwindendsten. Ein Mal/jedes, nur ein Mal. Ein Mal und nichtmehr. Und wir auch/ein Mal. Nie wieder.« Diese Thesen – die ewige Wiederkehr und das »ein Mal« – sind insofern eng miteinander verbunden, als sie beide versichern, Realität erfülle sich im Realen und nur im Realen. Jedoch erschüttert die Wahrheit dieser Aussage einen jungen Menschen sehr viel mehr als einen älteren, denn jener steht weit mehr unter dem Imperativ, sein Potential zu verwirklichen, als der ältere, dessen Leben sich, wie auch immer, bereits einem narrativen Abschluss entgegenschlängelt, auch wenn es sein biologisches Ende noch nicht erreicht hat.
Während ich der Auffassung bin, dass das Wirkliche als die Krone des Möglichen erstrahlt, bin ich, anders als zu dem Zeitpunkt, als ich Eliots Verse zum ersten Mal las, nicht mehr davon überzeugt, dass das Mögliche lediglich in der Verwirklichung eingelöst wird. Ich bin in einem Alter angelangt, in dem die Verbindung zwischen Zeit und Wirklichkeit eine Verschiebung erfahren hat, die mich für die Vorstellung empfänglicher macht, dass unsere gelebten Augenblicke in ihrer Punktförmigkeit gleichsam Funken sind, die aus einer unendlichen Quelle hervorgehen und in diese wieder zurückfallen, einer Quelle, die der Vorsokratiker Anaximander als apeiron bezeichnete, als unbegrenzten Urstoff. Dieses apeiron ist nicht nichts. Noch ist es »eine Abstraktion«, die »als unentwegte Möglichkeit« bestehen bleibt »in einer Welt spekulativen Denkens«. Seine überwältigende Potentialität durchdringt das Phänomen, gibt ihm Tiefe, Dichte und Opazität und durchflutet es mit der abnehmenden Latenz des unverwirklichten Potentials. Ich könnte denselben Gedanken auch anders ausdrücken, indem ich sage, dass der riesige Ozean der Potentialität, auf deren Oberfläche die Aktualität wie eine durchsichtige Welle treibt, unserer Erfahrung des Wirklichen Auftrieb und Tiefe verleiht.
Es gibt noch weitere Komplikationen, die an den Wendepunkten des menschlichen Alters am Werk sind. Wenn ich sage, dass ich sechzig Jahre alt bin, was meint das dann genau? Was oder wer ist dieses Ich? Ist es ein Körper, ein Geist, eine Seele oder die Summe aller drei? Selbst wenn wir es, der Einfachheit halber, lediglich als einen Körper bezeichnen, haben wir es nicht mit einer bloßen Summe zu tun. Mein Körper ist sechzig und zugleich einige Milliarden Jahre alt, denn alle seine Atome, die ein paar Sekunden nach dem Urknall entstanden sind, sind mithin so alt wie das Universum selbst. Darüber hinaus altert der Körper nicht in allen seinen Teilen gleichmäßig. Das Alter eines schwachen Herzens ist nicht das einer gesunden Niere. Man kann in einem Körperteil alt werden und in einem anderen über Jahre hinweg jung bleiben. So äußert der Protagonist in John Banvilles Roman Caliban (S. 11) über die italienischen Frauen: »Sie altern von oben nach unten […], denn diese Beine […] hatten sie wohl auch schon mit zwanzig oder noch davor.« Kurz, der Körper ebenfalls ist heterochron.
Mein Körper enthält ein Gehirn. Ist mein Gehirn genauso alt wie mein Geist? Mit Sicherheit nicht, denn anders als das Gehirn ist mein Geist durch Wahlverwandtschaft und Vererbung mit dem Geist anderer, Toter wie Lebender, verbunden. In Yeats’ »A Prayer for My Daughter«/»Ein Gebet für meine Tochter« lesen wir: »My mind, because the minds that I have loved,/The sort of beauty that I have approved,/Prosper but little, has dried up of late […].« »Mein Denken, weil das Denken, das ich liebte,/Die Art von Schönheit, darin ich mich übte,/So schwach gedeihn, dörrt aus in jüngster Zeit.« (Yeats, Die Gedichte, S. 214) Wie Yeats habe ich Denker geliebt, die so alt sind wie Anaximander und Platon. Also ist mein Denken, das von dem ihren geprägt ist, über zweitausend Jahre alt. Ob es deshalb nun älter oder jünger ist als mein Gehirn, weiß der Himmel.
Was meine Seele anbetrifft – oder das, was wir gewöhnlich Seele nannten, ehe sie zusammenschrumpfte und von der Bühne der Geschichte verschwand –, so bin ich mindestens so alt wie Moses, Homer und Dante, deren Vermächtnisse einen Teil meines psychischen Selbst ausmachen. Und sollte es mich je dazu treiben, die Tiefen meines Unbewussten zu ergründen, so werde ich höchstwahrscheinlich entdecken, dass ich so alt bin wie die Archetypen prähistorischer Mythen.
Wir schreiben das Jahr 2014. Gehöre ich – oder das Kompositum, das an meiner ersten Person Singular befestigt ist – meinem historischen Alter an? Sicherlich liegt in meinem Naturell mehr neunzehntes als einundzwanzigstes Jahrhundert, und gewiss enthält meine Vorstellung des Universums mehr Himmelssphären als allgemeine Relativitätstheorie, meine Kulturgeographie mehr antikes Athen als World Wide Web. Wenn ich umgekehrt bedenke, wie tief die westliche Kultur immer noch im Sumpf von Atavismen steckt, in welchem Schneckentempo unsere Anstrengungen vorankommen, die Torheiten der Vergangenheit zu überwinden und das Versprechen der Moderne zu erkennen, dann habe ich das Gefühl, historisch noch gar nicht geboren zu sein, dann bin ich sechzig minus ein oder zwei Jahrhunderte. Trotz aller Unzeitgemäßheit kann ich nicht leugnen, dass auch ich ein Kind meiner Zeit bin, denn ich kann nicht ganz einer Welt angehören, in der es so etwas wie Radiohead nicht gibt.
Wenn man sagt, Alter sei »relativ«, stellt man das Problem zu einfach oder gar falsch dar. Natürlich ist die eigene gelebte Erfahrung des Alters abhängig von Rasse, Klasse, Gender, Kultur, Nation und Bildung. In manchen Gesellschaften vermag sich ein fünfzehnjähriger Junge kaum vorzustellen, was es bedeutet, ein fünfzehnjähriges Mädchen in derselben Gesellschaft zu sein, oder was es bedeutet, ein gleichaltriger Junge in einer anderen Gesellschaft zu sein. Jenseits dieser speziellen Relativitäten sind wir jedoch mit einer noch viel allgemeineren Relativität konfrontiert. Fünfzehn Jahre alt zu sein bedeutet zu Beginn des dritten Jahrtausends etwas ganz anderes als zu Beginn des zweiten oder ersten, von der Vor- und Frühgeschichte ganz zu schweigen. Relativität, ob nun spezielle oder allgemeine, als Grundbegriff kann uns nur bis zu dem Punkt bringen, an dem es um die Bestimmung der komplexen Mannigfaltigkeit geht, die das wahre Alter eines Menschen ausmacht. Ich meine die Mannigfaltigkeit von Körper, Geist und Seele, wobei jedes einzelne Element einer eigenen verborgenen Dynamik folgt. Der Begriff der Relativität trägt dazu bei, jenen verwirrenden Nexus, der diese Mannigfaltigkeit geheimnisvoll in einer einzelnen Person zusammenhält, ebenso sehr zu verdunkeln wie zu erhellen – zumal sich diese Mannigfaltigkeit in beständigem Fluss befindet und ihre Einheit sich in dem entfaltet, was wir, vage genug, als Zeit bezeichnen.
Der in Frage stehende menschliche Nexus bleibt mit einer ersten Person Singular verknüpft und diese wiederum mit einer jeweiligen historischen Ära (Geschichte, so könnte man sagen, zwängt sich durch den Trichter der ersten Person Singular). Historische Epochen wiederum entfalten sich innerhalb des größeren Rahmens dessen, was man traditionell als Zeitalter der Kultur bezeichnet hat. In der Antike beispielsweise sprach man vom goldenen, silbernen, bronzenen Zeitalter etc. Giambattista Vico unterschied das Zeitalter der Götter von dem der Heroen und dem der Menschen. Später in diesem Buch werden wir mit Vicos Hilfe sehen, dass die Erscheinung eines Phänomens vom kulturellen Zeitalter einer Gesellschaft ebenso abhängt wie vom existentiellen Alter eines Individuums; mit anderen Worten: Die Veränderungen, denen die kulturelle Mentalität einer Gesellschaft in der historischen Zeit unterliegt, spielen eine prägende Rolle dabei, wie sich das Phänomen denen zeigt, die diese Mentalität teilen. All dies bekräftigt meine These: Was in einem bestimmten Lebensstadium oder in einem bestimmten historischen Stadium wahr ist, kann in einem anderen bestenfalls teilweise wahr sein. Kurz, Wahrheit hat ihr Alter oder, besser gesagt, mehrere.
Anthropos
Wir neigen zu dem Glauben, das rationale Denken – seine Fähigkeit zu abstraktem Denken, seine Fähigkeit, die Naturkräfte zu berechnen und zu beherrschen, sein Vermögen, Dinge zu ersinnen, zu entwerfen und zu entdecken – sei bis heute die größte Errungenschaft der Evolution, doch sollten wir Folgendes bedenken: Wir haben Computer gebaut, die imstande sind, die klügsten Schachspieler der Welt zu schlagen; doch wenn es darum geht, eine Maschine zu bauen, die es mit der Fähigkeit eines Tiers aufnehmen kann, sich mühelos durch einen Raum zu bewegen, ohne auf ihrem Weg Gegenstände anzurempeln, sind wir kläglich im Rückstand. Unsere Fähigkeiten zu rationalem Schlussfolgern lassen sich relativ leicht künstlich reproduzieren, während Sensomotorik, Tiefenwahrnehmung, Reflexe und Körperkoordination für die Roboterwissenschaft eine fast hoffnungslose Herausforderung darstellen. Warum?
Die Antwort hat wiederum mit dem Alter zu tun. Auf der Zeitskala der Evolution ist unser Verstand etwas völlig Neues – seine Fähigkeiten zu rationalem Schließen sind erst vor ein paar tausend Jahren aufgetaucht –, während die Evolution Milliarden von Jahren zur Verfügung hatte, das kinetische Funktionieren lebender Organismen zu vervollkommnen. Aus evolutionärer Sicht ist das rationale Denken so jung, dass man sagen könnte, wir Menschen würden in einer Weise denken und urteilen, wie sich analog das Neugeborene bewegt und verhält – unbeholfen, tastend, um die Beherrschung und kontrollierte Wirkung seiner Motorik kämpfend. Das ist ein Argument unter vielen dafür, dass wir vorsichtig damit sein sollten, unseren kognitiven Kräften die Gestaltung unserer Welt zu überlassen, und dass wir die Verantwortung für unser künftiges Schicksal keinesfalls aus der Hand geben sollten.
Abgesehen davon, dass er unter evolutionärem Gesichtspunkt »jung« ist, steht der menschliche Verstand von Anfang an mit dem Jungsein in einer genuinen Verbindung. Die ungewöhnlich lange Kindheit des Menschenjungen hat es uns gestattet, unsere Intelligenz zu entwickeln, ebenso wie unsere Intelligenz es uns erlaubt hat, unsere Kindheit zu verlängern. Nichts ist kostspieliger, aufwendiger in einem »jugendlichen« Sinne als der menschliche Verstand. Er ist die Quelle unserer Furchtsamkeit ebenso wie unserer Kühnheit. Er hat uns befähigt, Gefahren ebenso zu vermeiden wie herauszufordern. Er hat die Segnungen und die Ungeheuerlichkeiten der Zivilisation begünstigt und hat uns zu der schreckhaftesten und zugleich schrecklichsten Spezies werden lassen, die sich je auf der Erde herumtrieb.
Das Leben stürzt alles Lebendige in Risiko, Gefahr und Ungewissheit. Das Biotische verharrt unsicher schwankend an der Grenze von Chance und Untergang. Zwar ist alles Leben verletzlich, doch die Menschen sind aufgrund ihrer Existenzweise viel gefährdeter als jede andere lebende Art, denn wir wohnen in der Offenheit des Möglichen, einschließlich der Möglichkeit der Vernichtung, und haben einen Weg gefunden, diese Offenheit in bewusste Erkenntnis zu verwandeln. Auf einer fundamentalen Ebene tritt Erkenntnis als Reaktion des Menschen auf die Neuheit und Fremdheit auf, die uns unsere exponierte Stellung in der Welt um uns und in uns deutlich macht. Die Welt in ihrer Unheimlichkeit ist dem Homo sapiens für immer neu und fremd, so wie sie es für das Menschenjunge ist.
In der Fröhlichen Wissenschaft fragt sich Nietzsche, was die Menschen wirklich wollen, wenn sie nach Erkenntnis suchen. Seine Antwort:
Nichts weiter als dies: etwas Fremdes soll auf etwas Bekanntes zurückgeführt werden. Und wir Philosophen – haben wir unter Erkenntniss eigentlich mehr verstanden? Das Bekannte, das heisst: das woran wir gewöhnt sind, so dass wir uns nicht mehr darüber wundern, unser Alltag, irgend eine Regel, in der wir stecken, Alles und Jedes, in dem wir uns zu Hause wissen: – wie? Ist unser Bedürfniss nach Erkennen nicht eben dies Bedürfniss nach Bekanntem, der Wille, unter allem Fremden, Ungewöhnlichen, Fragwürdigen Etwas aufzudecken, das uns nicht mehr beunruhigt? Sollte es nicht der Instinkt der Furcht sein, der uns erkennen heisst? Sollte das Frohlocken des Erkennenden nicht eben das Frohlocken des wieder erlangten Sicherheitsgefühls sein?
(§ 355)
In dieser psychologischen Erklärung des Willens zum Wissen liegt viel Bedenkenswertes, doch sollten wir Nietzsches These, dass uns »der Instinkt der Furcht […] erkennen heisst«, mit Vorsicht behandeln; denn könnte Furcht allein den Willen zum Wissen motivieren, würde alle lebende Natur nach Erkenntnis suchen. Es bedarf einer eigentümlichen Form von Angst – eines Risses im Gewebe von Instinkt, Reflex und Routine –, um einer Spezies den Anstoß zu begrifflicher Vermittlung, Verstehen und Sprache zu geben. Mit einem Wort: den Anstoß zum Bewusstsein. Der Riss muss aus dem inneren Sein des Homo sapiens kommen, derart, dass seine Wunden ein Gewahrwerden seiner selbst hervorrufen, das die umgebende Welt in ihrer Rätselhaftigkeit zur Kenntnis nimmt. Genau das nahmen die Alten an, als sie erklärten, das menschliche Bewusstsein entspringe zuerst dem Staunen, das die Form von Verwunderung, Ratlosigkeit oder Furcht annehmen kann. In der einen oder anderen Form entsteht es als Reaktion auf die überwältigende Fremdheit der Welt, vor allem den befremdlichen Umstand, dass wir uns in ihr befinden.
Es gibt kein Staunen ohne Gewahrwerden unserer selbst, und wo das Staunen überwiegt, hat das Diktum »Nichts Neues unter der Sonne« keine Geltung. Menschliches Bewusstsein in seinem gesteigerten Selbstgewahrwerden erzeugt Neuartiges, auf das es reagiert. Das Neue schreckt auf. Es verstört. Es erweckt. Es fordert Aufmerksamkeit, Verständnis und Anpassung. Wo Leben ist, ist auch Neophobie, denn in der natürlichen Welt zieht das Neue gewöhnlich Störungen und Gefahren nach sich. Doch auch hier bildet der Mensch eine Ausnahme, denn neben unserer natürlichen, selbsterhaltenden Neophobie existiert zugleich eine Gegenstrebung, die Neophilie. Menschen verweilen inmitten des Neuen, so wie Kinder von Neuartigem angezogen werden und es zugleich argwöhnisch betrachten. Wäre unsere Spezies nicht von Anbeginn mit dieser neophilen Gegenstrebung ausgestattet gewesen, wären wir wohl kaum bis ans äußerste Ende der Welt gezogen, wir hätten wohl kaum Werkzeuge erfunden, das Reich der Intelligibilität erschlossen und auf die natürliche Welt die letztlich überirdischen Kräfte des menschlichen Denkens losgelassen.
Solche überirdischen Kräfte können nur in einer Spezies auftauchen, die zugleich überschwenglich und gequält ist. Menschen haben eine Neigung zu lieben, wovor ihnen graut, anzugreifen, was sie lieben, und aufzusuchen, wovor sie zurückweichen. Treffend formulierte der Renaissance-Humanist Francesco Bonciani in seiner Abhandlung Lezioni sopra il comporre delle novelle von 1574:
Viel erstaunlicher [als die Wunder der natürlichen Welt] ist der menschliche Geist, besonders in den Momenten seiner Verirrung: Aus Liebe können wir den Gegenstand unserer Liebe zerstören, so wie Deianeira Herakles vernichtete; bei Ödipus finden wir ein Vernunftvertrauen, das ihn ins eigene Verderben stürzt; es ist, als läge im menschlichen Geist eine lebendige Kraft, welche die Vernunft dieses Geistes und die Argumente, die sie aufbieten könnte, einer solchen Verirrung nicht zu verfallen, zunichtemacht.
Ob sie nun im menschlichen Geist oder anderswo liegt – diese »lebendige Kraft« ist so seltsam, so großartig und schrecklich, dass kein noch so umfassendes Wissen ihre Verirrung eindämmen kann. So wird jedes »Frohlocken des wieder erlangten Sicherheitsgefühls«, das die Erkenntnis verschafft, unweigerlich neuen Formen der Furcht weichen, denn der Schrecken liegt nicht so sehr in der Welt wie in uns selbst.
Das ist der Kern der anthropologischen These, die das berühmte zweite Chorlied in der Antigone des Sophokles eröffnet, bekannt auch als »Ode an den Menschen« (S. 37f.): »Ungeheuer ist viel. Doch nichts/ungeheurer als der Mensch.« Das griechische Wort deinos kann »seltsam«, »großartig« oder »schrecklich« bedeuten. Alle drei Konnotationen kommen hier ins Spiel. Der Mensch (anthropos), erläutert der Chor, segelt mitten im Winter auf berghohen Wellen, reißt die Erde mit seinem Pflug auf, fängt die »leichtträumenden Vögel« und zieht Fische aus der Tiefe des Meeres; dem Hengst und dem unbezähmten Stier hat er das Joch um den Nacken geworfen; »[u]nd die Rede und den luftigen Gedanken […] hat erlernet er«. Er weiß, wie man Schutz vor Kälte, Heilung für Krankheiten findet, und schafft Recht und Gesetz. Doch bei all seiner Findigkeit kommt er durch seine Unbedachtheit (tolma) oft auf Schlimmes und findet sich apolis, ohne Heimatstadt. Wie sehr er es auch versucht, er hat nicht die Macht, dem zu entfliehen, was schließlich Anspruch auf alles Leben erhebt: nämlich der Tod. »Allbewandert,/Unbewandert. Zu nichts kommt er.«
Wenn der Mensch großartig und seltsam ist, dann ist es auch diese Ode, die sein Lob singt, denn sie endet damit, dass der Chor sich mit Schrecken vom anthropos abwendet, der dem Abgrund trotzt, mutwillig die Mächte herausfordert, die ihn leicht überwältigen könnten, und sich zum Herrn über alle Dinge erhebt, obschon er kaum sich selbst noch andere Männer und Frauen zu beherrschen vermag (was sowohl an den Machtkämpfen als auch an der tragischen Handlung der Antigone abzulesen ist). Nachdem er eine großartige Schilderung dessen geboten hat, was die Menschheit so einfallsreich, wagemutig und schöpferisch macht, erklärt der Chor: »Nicht sei am Herde mit mir,/noch gleichgesinnt,/wer solches tut.« Warum diese Zurückweisung?
Mit seinem Schaudern leiht der Chor, aus den Ältesten Thebens bestehend, seine Stimme der Weisheit des Alters, die über dem (und gegen den) jugendlichen Leichtsinn steht. Ich sage »jugendlich«, weil die junge Antigone in ihrer Auflehnung gegen die Mächte, die sie so leicht vernichten könnten, in dem Stück als Paradebeispiel für den geschilderten anthropos auftritt. Ihr Onkel Kreon ist älter als sie, doch auch er ist, ideologisch gesprochen, ein »jugendlicher« Hitzkopf, denn in seiner Eile, Recht und Ordnung herzustellen, setzt er sich über eine Reihe alter Wahrheiten hinweg, darunter die, dass unbestattete Leichen offene Fragen bedeuten. In seinem übereifrigen Eintreten für eine neue Satzung der Stadt, für eine neue raison d’état, lässt er es zu, dass sein »Vernunftvertrauen […] ihn ins eigene Verderben stürzt«, wie Bonciani in der angeführten Passage sagt. Es ist kein Zufall, dass die Ältesten des Chors zu Beginn des Stücks Kreon zweimal besorgt als den »neuen« König Thebens bezeichnen. Das griechische Wort neos bedeutet sowohl »jung« wie »neu«.
Wenn wir unter anthropos die menschliche Gattung verstehen, könnten wir sagen, dass die Ode an den Menschen in ihren ablehnenden Schlussversen die innere Bedächtigkeit zum Ausdruck bringt, die mit der unvorsichtigen Neophilie der Menschheit einhergeht. Ich meine jene Neophilie, die den Menschen dazu treibt, sich beim Erforschen, Entdecken, Herausfordern, Überwältigen in beispiellosen Trotzhandlungen selbst zu überschätzen. Die Ältesten Thebens erschrecken darüber, dass der Mensch aus unbekannten Gründen seine Unternehmungen unter vorsätzlicher Missachtung all dessen ins Werk setzt, was die menschliche Gesellschaft – mit ihren Traditionen, Bräuchen und selbstbewahrenden Institutionen – mühsam abwehrt, nämlich Katastrophen und den Nihilismus der Todes. Vielleicht ist anthropos, was seine Waghalsigkeit anbelangt, nicht »alt« genug, um die lauernden Abgründe des Todes in den Meeren, Gebirgen und bei den Völkern, in deren Gebiete er vordringt, zu fürchten.
Nach seinem kraftvollen, heroischen Porträt des Menschen wirkt die Vorsichtsethik des Chors durch und durch antiheroisch. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass die menschliche Gattung durchaus hätte untergehen können, wenn ihr diese Art von Beklommenheit gefehlt hätte, die das Gegengewicht zu ihrer Neigung darstellt, sich entsetzlichen Gefahren und Herausforderungen mutwillig auszusetzen. Vielleicht war neuerungssüchtige Kühnheit die notwendige Bedingung dafür, den Weg zur Rede und zum »luftigen Gedanken« des alles verstehenden menschlichen Verstandes zu finden, doch ist sie als solche nicht zureichend. Wenn es zutrifft, was die Ode verkündet – dass »nichts/ungeheurer [sei] als der Mensch« –, dann spricht alles für die Annahme, dass drückende Angst und anthropologische Scheu, wie sie der Chor zum Ausdruck bringt, eine ebenso wichtige, wenn nicht wichtigere Rolle beim Selbstgewahrwerden des Menschen spielen. Keine äußere Gefahr kann dieses Gewahrwerden auslösen. Nur der Mensch in seiner frevlerischen Selbsttranszendenz kann durch ein Erschrecken vor sich selbst zum Selbstbewusstsein vorstoßen. Nur aus der Kluft zwischen Vorsicht und unbesonnener Kühnheit kann anthropos in all seiner Ungeheuerlichkeit und Größe ins Reich der Bedeutung vordringen.
Was hat das »Alter« des Menschen mit seinem Durchbruch ins Offene des Sinns zu tun? Ungeheuer ist vieles, doch nichts ungeheurer als das Alter des Menschen. Die sophokleische Ode gehört ja zu einem Stück über eine junge Frau, die zugleich Schwester und Tochter des Ödipus ist. Der Bruder, den sie beerdigen will, Kreons Anordnung missachtend, ist auch ihr Onkel. Es bedarf in der Tat eines ungeheuren Menschen, um die Sphinx herauszufordern und sie zu nötigen, sich selbst in den Abgrund zu stürzen – eines Menschen, der viel ungeheurer ist als der gewöhnliche anthropos, der am Morgen auf vier, mittags auf zwei und am Abend auf drei Beinen geht.
Ödipus betritt die Stadt Theben in der Gewissheit seines vermeintlichen Sieges über die Sphinx, nur um zu gegebener Zeit zu entdecken, dass das Leben einer perverseren Erzählweise folgt, als er erwartet hatte. Erst später zieht ihn das Rätsel, das er gelöst zu haben meinte, in den Strudel seiner Verwicklungen, und in den Wendungen und Windungen seiner weiteren Lebensgeschichte offenbart es ihm, dass das Alter des Menschen mehr ist als eine geradlinige Stufenfolge. Nehmen wir Ödipus als Warnung, dass zwei Beine nicht immer sind, was sie zu sein scheinen, besonders wenn eines davon ein Klumpfuß ist, und dass die Linie, die sich von der Kindheit bis zum Greisenalter erstreckt, nur einen der Fäden bildet, die das menschliche Dasein in das ausgespannte Netz des Alters einflechten, in dessen Mittelpunkt ein Knoten liegt. Auf diesen Knoten müssen wir nun unsere Aufmerksamkeit richten.
Neotenie
Wie alt ist die menschliche Spezies nun genau? Bei dieser Frage geht es mir nicht darum, wie lange es her ist, dass sich der Homo sapiens zu seiner heutigen Form entwickelt hat. Die Chronologie der Hominisierung hat gewiss ihre eigene Faszination, doch hier beschäftigt uns am meisten der »Altersunterschied« zwischen den Menschen und ihren Vorfahren, den Primaten. Mit Fragen zur Anatomie dieses Altersunterschieds werde ich mich im weiteren beschäftigen.
Wir, die wir zu dem beängstigenden Geschöpf geworden sind, das Sophokles’ Ode an den Menschen beschreibt – wir, die wir uns mit unserer Intelligenz praktisch über das Tierreich hinaus entwickelt haben –, sind wir zur »fortgeschrittensten« Spezies auf der Erde geworden, indem wir über die adulten Stufen hinaus fortgeschritten sind, die unsere Vorfahren in ferner phylogenetischer Vergangenheit erreicht hatten? Gewiss dachten viele so, nachdem der deutsche Biologe Ernst Haeckel im neunzehnten Jahrhundert seine berühmte Rekapitulationstheorie aufgestellt hatte. Haeckels »biogenetische Grundregel« klingt immer noch vertraut: »Die Ontogenese rekapituliert die Phylogenese«, das heißt, die Individuen wiederholen oder durchlaufen in ihrer fetalen Entwicklung die verschiedenen Stufen der Evolution ihrer Spezies. So stellen die zeitweiligen kiemenähnlichen Spalten des menschlichen Embryos Rudimente des alten erwachsenen Fischs dar, aus dem wir uns vor vielen Millionen Jahren entwickelt haben, ebenso wie seine Schwimmfüße und die Anlagen eines Schwanzes Überreste unserer Abstammung von den Amphibien und frühen Säugetieren darstellen. Nach Haeckel entwickelte sich der Mensch zu seiner gegenwärtigen Form durch Anpassungen auf der Grundlage früherer morphologischer Stufen. Mit anderen Worten, der menschliche Embryo rekapituliert zunächst und überholt dann in seiner ontogenetischen Entwicklung die Formen der erwachsenen Vorfahren seiner Evolutionsgeschichte.





























