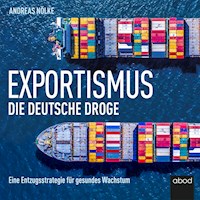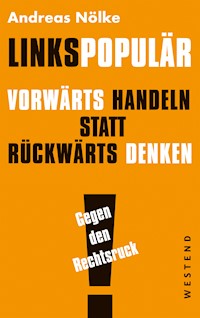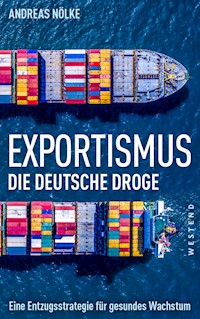
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das deutsche Wirtschaftsmodell ist unausgewogen und hochgradig riskant. Der Grund: Die starke Abhängigkeit von der Droge Exportismus. Andreas Nölke zeigt die aktuellen Gefahren der Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft und liefert ein fulminantes Plädoyer für ein neues Wirtschaftsmodell, das nachhaltiger, stabiler und im globalen Kontext ausgewogener balanciert ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ebook Edition
Andreas Nölke
Exportismus
Die deutsche Droge
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-807-5
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2021
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Vorwort
Deutschland ist abhängig von einer Droge. Diese Droge besteht aus einem extrem hohen Niveau von Exporten, viel höher als bei jeder anderen großen Ökonomie. Ohne dieses Exportniveau würde das Wirtschaftswachstum in Deutschland einbrechen, hohe Arbeitslosigkeit könnte die Folge sein. Wie bei anderen Drogen muss die Dosis immer weiter erhöht werden, damit der »Kick« noch wirkt, die Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft ist seit Jahrzehnten deutlich gestiegen.
In den nächsten Jahren wird es den deutschen Unternehmen allerdings schwerfallen, ihre Droge im ausreichenden Maße zu beschaffen. Die Corona-Krise trifft die deutschen Exportmärkte hart. Die Bundesregierung kann zwar die eigene Wirtschaft mit hohem Mittelaufwand stabilisieren, aber im europäischen Ausland, in den USA und in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern ist sie weitgehend machtlos. Unsere Wirtschaft wird daher weitaus härter getroffen, als angesichts der Haushalts-»Bazooka« zu erwarten ist, zumal die Exportwirtschaft schon in den Jahren vor der Corona-Krise in der Krise steckte (Kapitel 1).
Aber auch jenseits der Corona-Krise droht der deutschen Wirtschaft Entzug. In den vergangenen Jahrzehnten hat das einseitige Exportmodell zwar leidlich funktioniert, insbesondere angesichts des Booms der Exporte nach Südeuropa und nach China. Der Aufschwung in Südeuropa ist jedoch schon lange vorbei und China kann als Absatzmarkt schnell ausfallen, wenn sich der Systemkonflikt mit den USA intensiviert. Auch sonst sind die Aussichten für die deutschen Exporte nicht rosig, vom Brexit über die Spannungen mit Osteuropa und den USA bis hin zu den Auswirkungen des Klimawandels. Die Abhängigkeit von der Exportdroge stellt in Zukunft daher ein großes Risiko dar (Kapitel 2).
Drogenabhängigkeit ist nicht nur in Bezug auf die Beschaffung neuen »Stoffs« ein Problem. Sie ist auch sonst nicht gesund. Im Fall des extremen deutschen Exportmodells führt sie unter anderem zu einer mageren Lohnentwicklung, der Aushöhlung der sozialen Sicherungssysteme, dem Zwangsverzicht vieler Haushalte auf eine eigene Immobilie, einem Verfall der öffentlichen Infrastruktur, stark steigender Vermögensungleichheit und zu einer Deformierung des deutschen Finanzsektors (Kapitel 3).
Im Gegensatz zu anderen Suchtkrankheiten ist die deutsche Drogenabhängigkeit aber vergleichsweise leicht zu kurieren. Das Beispiel Chinas hat gezeigt, dass eine Ausbalancierung extremer Exportmodelle durch die Medizin einer höheren Binnennachfrage gut funktionieren kann. Notwendig sind einerseits Lohnerhöhungen in der Wirtschaft und andererseits verstärkte staatliche Investitionen, beispielsweise zur Verhinderung des Klimawandels. Damit die Exportwirtschaft die Nebenfolge eines drohenden Verlustes an preislicher Wettbewerbsfähigkeit leidlich verkraften kann, muss sie allerdings in Bezug auf Investitionen in neue Technologien deutlich mehr unterstützt werden (Kapitel 4).
Aufrechterhalten wird die Drogenabhängigkeit – trotz vieler schädlicher Nebenwirkungen und einer vergleichsweise leichten Therapie – durch die gefährliche Ideologie des Exportismus. Der Exportismus redet uns ein, dass die extreme Abhängigkeit von der Nachfrage aus dem Ausland in unser aller Interesse liegt, obwohl sie nur einem kleinen Teil von Dealern (den schwerreichen Clans der deutschen Familienunternehmer) wirklich nützt. Diese Ideologie hat sich in den letzten Jahrzehnten tief in unserer Gesellschaft verbreitet, gestützt auf Komponenten wie der Neigung zur Lohnmäßigung, der Angst vor Hyperinflation, der Verehrung der schwäbischen Hausfrau und dem Kult der (Währungs-)Unterbewertung. Aber die Chancen des Drogendezernats zur Bekämpfung dieser verhängnisvollen Sucht sind in letzter Zeit gestiegen. Die Dealer zeigen sich uneinig, die Junkies weniger fanatisch. Der Zeitpunkt für eine Hinwendung zur dauerhaften Abstinenz ist günstig (Kapitel 5).
Jetzt ist der Moment, um über eine dauerhafte Abwendung von der Droge der extremen Exportorientierung zu reden. Warum und wie, zeigt dieses Buch.
1 Warum Deutschlands Wirtschaft von der Corona-Krise so hart getroffen wurde
Deutschland ist im Frühjahr 2020 relativ glimpflich durch die gesundheitlichen Herausforderungen der ersten Corona-Welle gekommen, insbesondere im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern. Trotzdem ist die deutsche Wirtschaft von der Krise hart getroffen worden. Das liegt aber nicht daran, dass die Bundesregierung zu wenig Geld zur Stabilisierung ausgegeben hat – im Gegenteil, das deutsche Krisenpaket ist deutlich größer ausgefallen als in anderen europäischen Ländern.
Die im internationalen Vergleich besondere Ursache für den Einbruch der deutschen Wirtschaft während der Corona-Krise liegt in den Exporten. Die deutsche Wirtschaft ist extrem exportlastig, ihre Abhängigkeit vom Außenhandel ist wesentlich stärker als jene aller anderen großen Industrieländer. Da die meisten der wichtigsten Absatzländer für die deutschen Produkte in der Corona-Krise stärker eingebrochen sind als Deutschland, konnte das Rettungspaket die Wirtschaft nicht grundlegend stabilisieren, obwohl es stark auf die Unterstützung der Industrie ausgerichtet war.
Um die extreme Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft zu verstehen, bietet sich besonders die Differenzierung verschiedener nationaler Wachstumsmodelle an. Aus dieser Perspektive hat sich die deutsche Ökonomie in den letzten Jahrzehnten zu einem Wirtschaftsmodell entwickelt, in dem Wachstum weit überproportional von Exporten abhängt.
Auch politisch dominiert in Deutschland eine breite soziale Koalition, die sehr stark auf das Exportmodell ausgerichtet ist. Dementsprechend war das Rettungspaket auch besonders darauf ausgerichtet, die Industrie zu unterstützen. Die politisch schwächer organisierten Verlierer der Corona-Stabilisierungsmaßnahmen finden sich vor allem in den Binnensektoren, von den kleinen Selbständigen über eine Vielzahl von Dienstleistern bis hin zu den Kulturschaffenden.
Auch unabhängig von diesen sehr problematischen Verteilungswirkungen in der Corona-Krise stellt sich die Frage nach der Zukunft des deutschen Export-Wirtschaftsmodells. Bereits vor Ausbruch der Pandemie befand es sich in der Krise. Durch die Schwächung unserer Exportmärkte wird sich diese Krise vertiefen. Es steht daher zu befürchten, dass die extreme Exportlastigkeit sich in Zukunft noch mehr als Achillesferse der deutschen Wirtschaft herausstellen wird. Das gilt umso mehr, als Deutschland auf Wirtschaftskrisen und wachsende Arbeitslosigkeit in der Vergangenheit regelmäßig mit einer noch weiteren Intensivierung des Exportmodells reagiert hat, insbesondere durch Lohnmäßigung und Kostensenkung (Kapitel 5).
Auch nach Überwindung der Corona-Krise ist mit einer Intensivierung des Exportmodells zu rechnen, insbesondere über eine schnelle Reduktion der stark gewachsenen staatlichen Defizite durch Austerität (begrenzte öffentliche Ausgaben) sowie über den Verzicht auf Lohnerhöhungen. Gesamtmetall hat im Oktober 2020 schon einmal mitgeteilt, dass höhere Löhne weder dieses noch nächstes Jahr realistisch und stattdessen Mehrarbeit ohne vollen Lohnausgleich geboten seien.
Da Austerität und Lohnverzicht in der Zukunft aber genau der falsche Weg wären, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine grundlegende Debatte über die Ausrichtung des deutschen Wirtschaftsmodells zu führen.
Deutschlands Gesundheitssystem in der Corona-Krise
Aber fangen wir in der Gegenwart an: Ein Vergleich zwischen der gesundheitlichen und der ökonomischen Auswirkung der Corona-Krise verdeutlicht exemplarisch, wie stark die Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft für deren aktuelle Krise verantwortlich ist.
Die Exportlastigkeit ist kein neues Phänomen und sie ist auch nicht nur im Kontext der Corona-Krise ein gravierendes Problem, sondern seit einigen Jahrzehnten. Aber die Entwicklung während der Corona-Krise zeigt die Probleme der deutschen Wirtschaft besonders anschaulich und aktuell.
Im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern waren die gesundheitlichen Folgen der Corona-Krise – während deren ersten Welle (Frühjahr 2020) – in Deutschland relativ milde. Die Anzahl der Infizierten in Relation zur Bevölkerung war im europäischen Vergleich gering. Noch geringer fielen die Todeszahlen in Relation zur Bevölkerung im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aus. Deutschland ist nach diesen Indikatoren in der ersten Welle weitaus weniger von der Krise getroffen worden als beispielsweise Belgien, Großbritannien, Spanien, Italien, Schweden, Frankreich oder die Niederlande, so eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der Privaten Krankenversicherungen (WIP) aus dem Juli 2020.
Erreicht wurden die geringeren Fallzahlen vor allem – neben dem Glück einer Vorwarnung durch den früheren Ausbruch in Ländern wie China, Italien und Spanien – mittels eines vergleichsweise gut finanzierten Gesundheitssystems, nicht durch einen härteren Lockdown als in den Nachbarländern. Das deutsche Gesundheitssystem ist im europäischen Vergleich relativ solide ausgestattet, auch wenn selbst in Deutschland bereits vor der Corona-Krise große Teile des Pflegepersonals und der Ärzte am Rande ihrer Kapazität arbeiteten.
Nach Indikatoren wie der Anzahl der Krankenhaus- oder der Intensivbetten auf 100 000 Einwohner liegt Deutschland nach der WIP-Studie europaweit vorne, in Bezug auf die personellen Kapazitäten immer noch über dem Durchschnitt. Gerade in Ländern wie Griechenland, Italien und Spanien hatte die von den europäischen Institutionen seit der Eurokrise vorgegebene Sparpolitik zu erheblichen Kürzungen geführt. Nur in Bezug auf die Arbeitsbelastung ist die Situation in Deutschland im europäischen Vergleich ausgesprochen kritisch – aber hier konnten in der Corona-Krise durch Verschiebung nicht akuter Operationen erhebliche Kapazitäten freigesetzt werden.
Der Lockdown war (zumindest in der ersten Welle der Krise bis Mai 2020) in vielen Nachbarländern härter als in Deutschland, so die WIP-Studie. Belgien, Frankreich, Italien und Spanien beispielsweise hatten wesentlich gravierendere Einschränkungen. Der Lockdown begann in den Nachbarländern auch früher, insbesondere in Italien. Dort wurde am 21. März 2020 die Stilllegung aller nicht direkt lebensnotwendigen Betriebe verordnet, während in Deutschland nur Teile des Einzelhandels, die Gastronomie und einige Dienstleistungssparten betroffen waren; die deutsche Industrie hingegen durfte weiter produzieren.
Die Maßnahmen der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Stabilisierung
Obwohl Deutschland vergleichsweise milde durch die erste Welle der Gesundheitskrise gekommen ist und auch die Wirtschaft nicht so stark im »Lockdown« eingeschränkt hat wie viele andere Länder, hat die Bundesregierung umgehend ein präzedenzlos umfangreiches Bündel von Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft in der Corona-Rezession vorgelegt.
Zu diesem ersten Paket (»Corona-Schutzschild für Deutschland«) gehören als wichtigste geplante Ausgaben zunächst 100 Milliarden Euro für staatliche Beteiligungen, 23,5 Milliarden für die Verlängerung des Kurzarbeitergelds (in 2020) und 18 Milliarden Soforthilfen für kleine Unternehmen (maximales Budget 50 Milliarden, allerdings bis November nur zum kleinen Teil abgerufen).
Im Juni 2020 wurden im Rahmen eines Konjunkturprogramms als wesentliche zusätzliche Maßnahmen Überbrückungshilfen für mittelständische Unternehmen (25 Milliarden) und eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer (20 Milliarden) hinzugefügt, neben einigen kleineren Maßnahmen wie einem Kinderbonus oder einer Senkung der Stromkosten. Das Gesamtvolumen der geplanten Ausgaben aller staatlichen Ebenen in beiden Paketen beziffert der Brüsseler Thinktank Bruegel mit 284 Milliarden Euro.
Hinzu kommen umfangreiche Garantien für Kredite, insbesondere 400 Milliarden für direkte staatliche Garantien und 356 Milliarden über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ergänzt werden sowohl Ausgaben als auch Garantien des Bundes durch Maßnahmen der Bundesländer, mit einem Volumen von 18 (Ausgaben) beziehungsweise 75 Milliarden Euro (Garantien). Das Gesamtvolumen der Garantien aller staatlichen Ebenen liegt nach Bruegel bei 832 Milliarden Euro. Hinzu kommen noch etwa 250 Milliarden an Steuerstundungen; letztere können aber nur sehr grob geschätzt werden.
In einer europäischen Vergleichsstudie von Bruegel ragt das deutsche Paket in Bezug auf sein Finanzvolumen (zumindest bis zum Herbst 2020) deutlich heraus. Das direkte deutsche Fiskalpaket (also staatliche Ausgaben) beträgt 8,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und liegt damit wesentlich höher als jenes aller anderen westeuropäischen Staaten, etwa in Belgien (1,4 Prozent), Frankreich (4,4 Prozent), Italien (3,4 Prozent), die Niederlande (3,7 Prozent) und Spanien; nur Großbritannien stößt mit 8 Prozent der Wirtschaftsleistung hier grob in diese Dimensionen vor.
Hinzu kommen die Kreditgarantien, die nach Bruegel-Berechnungen nochmals 24,3 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung umfassen. Auch hier hat Deutschland wesentlich mehr Geld (potenziell) in die Hand genommen als die Nachbarstaaten, etwa im Vergleich zu Frankreich (14,2 Prozent), den Niederlanden (3,4 Prozent), Spanien (9,2 Prozent) und Großbritannien (15,4 Prozent); nur in Italien liegen diese Garantien mit 32,1 Prozent höher.
Die deutlich höheren deutschen Corona-Hilfen haben bei der EU-Kommission bereits zu der Sorge geführt, dass damit der Wettbewerb in der Europäischen Union erheblich zugunsten Deutschlands verzerrt wird. EU-Vizepräsidentin Margrethe Vestager zeigte sich bereits im Mai 2020 darüber irritiert, dass die Hälfte der von der Kommission für ganz Europa genehmigten Corona-Hilfen allein auf Deutschland entfällt.
Die deutsche Wirtschaft in der Corona-Krise: viel härter getroffen als erwartet
Ausgehend von den Gesundheitsdaten, dem im internationalen Vergleich relativ späten und milden Lockdown und dem besonders umfangreichen Konjunkturpaket sollte man annehmen, dass Deutschlands Wirtschaft weitaus besser durch die erste Welle der Corona-Krise gekommen ist als jene der Nachbarländer. Dem ist aber nicht so.
Der Einbruch der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2020 – dem Kernquartal der ersten Corona-Welle – betrug nach Eurostat-Angaben 9,7 Prozent, das ist höher als in den Niederlanden (8,5 Prozent) und nur unwesentlich geringer als in Belgien (12,1 Prozent), Italien (12,8 Prozent) und Frankreich (13,8 Prozent); nur in Spanien (18,5 Prozent) und Großbritannien (20,4 Prozent) fällt der Einbruch deutlich stärker aus. Die meisten Wirtschaftsbeobachter hatten einen solch starken Einbruch nicht erwartet und mussten ihre Prognosen mehrfach korrigieren.
Außerdem ist der Zeitpunkt der wirklichen Abrechnung noch lange nicht gekommen, zumal die erste Welle nicht die einzige Welle blieb. In vielerlei Hinsicht ist die deutsche Wirtschaft quasi »eingefroren« worden, um sie durch die Corona-Krise zu bringen. Das gilt besonders für das Kurzarbeitergeld und die Aussetzung der Insolvenzregelungen. Beide Maßnahmen sind inzwischen bis Ende 2021 verlängert worden. Erst danach kann man sehen, wie tief die Schäden in der Wirtschaft wirklich sind – sowohl eine große Insolvenzwelle als auch ein sprunghaftes Ansteigen der Arbeitslosigkeit sind immer noch möglich.
Die Ursache für den starken Einbruch der deutschen Wirtschaft in der ersten Welle der Corona-Krise liegt eindeutig in der Krise des Exportsektors.
Die stärkere Belastung der deutschen Wirtschaft durch das Ausland im Vergleich zum Inland während der ersten Corona-Welle wird bei der Analyse der Komponenten der volkswirtschaftlichen Nachfrage deutlich. Laut Statistischen Bundesamt brachen die Exporte im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um rund 22 Prozent ein und die (vor allem in der Exportindustrie wichtigen) Investitionen in Ausrüstungen – insbesondere Maschinen und Fahrzeuge – sogar um 28 Prozent, während die privaten Konsumausgaben nur um 13 Prozent zurückgingen und jene des Bausektors (1,4 Prozent) und des Staates sogar leicht stiegen (3,8 Prozent).
Außenwirtschaftliche Probleme gab es zunächst durch eine Unterbrechung der Lieferketten der deutschen Industrie, etwa durch das Fehlen von Vorprodukten aus China oder Italien. Viel gravierender allerdings waren die Einbrüche bei den Exporten, im April 2020 etwa um 30 Prozent im Vergleich zum April 2019, die stärkste Reduktion seit Beginn der Außenhandelsstatistik 1950, so das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Wertschöpfung in Deutschland fiel um ein Viertel, in der Automobilindustrie wurde im April 2020 die Produktion sogar um 75 Prozent gedrosselt.
Mit den USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien sind die meisten der wichtigen deutschen Exportmärkte ganz besonders stark von der Pandemie betroffen; nur China bietet durch die relativ schnelle Erholung etwas Hoffnung. Eine systematische Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) schätzt, dass Exporte in Höhe von gut 160 Milliarden Euro in Hochrisikoländer und weitere 490 Milliarden in Länder mit einem mittleren Risiko – einem deutlich höheren Risiko als in Deutschland – gehen, also ein erheblicher Teil der deutschen Exporte (1 200 Milliarden Euro in 2019). Besonders relevant sind Risiko- und Hochrisikoländer als Exportmärkte für die Automobil-, Maschinenbau- und Elektroindustrie.
Neben den Corona-Krankheitsfällen ist auch die generelle wirtschaftliche Situation in den Exportländern wichtig für eine Einschätzung der Folgen für die deutsche Wirtschaft. Auf der Basis der im April 2020 veröffentlichten – und noch relativ optimistischen – Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) schätzt das IW, dass 52,3 Prozent der deutschen Exporte in Länder gehen, die 2020 einen Einbruch der Wirtschaftsleistung von mehr als 6 Prozent erwarten, 34 Prozent in Länder mit einer Schrumpfung zwischen 3 und 6 Prozent und nur 13,3 Prozent in Länder mit einer geringen oder gar keiner Schrumpfung.
Für den Einbruch der deutschen Exporte in (und nach) der Corona-Krise gibt es aber noch viel mehr Gründe als die Gesundheitsfolgen und die unmittelbare wirtschaftliche Krise, wie Heiner Flassbeck verdeutlicht. Die Währungen von Entwicklungs- und Schwellenländern (und selbst der US-Dollar gegenüber dem Euro) werden deutlich abgewertet, sodass deren Kaufkraft in Bezug auf deutsche Güter deutlich reduziert ist. Diese Länder werden nun auch wieder mehr auf ihre Auslandsverschuldung achten müssen, was ihre Optionen zum Erwerb deutscher Produkte verringert.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Preise für Rohstoffe – die wichtigsten Exportgüter vieler Entwicklungs- und Schwellenländer – in der Wirtschaftskrise sinken. Zudem verkauft die deutsche Industrie vorzugsweise Güter, deren Anschaffung in den nächsten (Krisen-)Jahren eher nicht prioritär ist, etwa Oberklasse-Automobile oder neue Maschinen (schon die existierenden werden nicht ausgelastet sein). Das sind sehr schlechte Aussichten für die deutsche Exportindustrie.
Das Problem der deutschen Exportlastigkeit
Die meisten anderen Ökonomien werden von einem Einbruch im internationalen Handel nicht so aus der Bahn gebracht wie Deutschland. Egal, welche Kennzahl man anwendet, die deutsche Wirtschaft ist viel stärker von Exporten geprägt als alle anderen Ökonomien vergleichbarer Größe. Wenn man die heutige deutsche Ökonomie verstehen will, geht kein Weg an ihrer Exportlastigkeit vorbei.
Gemessen werden wird die Exportorientierung einer Wirtschaft konventionell durch die Exportquote, also das Verhältnis der Exporte zum Bruttoinlandsprodukt. Die Maßzahl ist zwar problematisch (im BIP ist nur der Saldo aus Exporten und Importen enthalten), aber die extreme Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft wird trotzdem im internationalen Vergleich deutlich. So lag der Wert der exportierten Güter und Dienstleistungen in Relation zum BIP in Deutschland 2019 bei 46,9 Prozent und damit deutlich höher als bei unseren europäischen Nachbarn Frankreich (31,3), Großbritannien (31,5), Italien (31,6) oder Spanien (34,9), in Relation zu Japan (17,5) und den USA (11,7) sogar etwa dreimal so hoch. Auch bei anderen Maßzahlen wie dem »Außenhandels-Abhängigkeitsindex« der Bertelsmann Stiftung und beim vom Wirtschaftsministerium dokumentierten »Offenheitsgrad« liegt Deutschland deutlich vor allen diesen Ländern. Allerdings kann man von diesen groben Indikatoren nicht direkt auf die Relevanz des Exportsektors für Wirtschaft und Arbeitsmarkt schließen. Andrä Gärber und Markus Schreyer verweisen hier auf die Exportabhängigkeitsquote in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die zeigt, welcher Anteil des Bruttoinlandsprodukts durch den Export induziert wurde. Diese liegt in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei etwa 27 Prozent.
Nach Schätzungen der Bundeszentrale für politische Bildung liegt auch der Anteil der Arbeitsplätze, die insgesamt vom Export abhängen, in den letzten Jahren bei einem guten Viertel, in Übereinstimmung mit der vom Statistischen Bundesamt berechneten Exportabhängigkeitsquote der Erwerbstätigen, allerdings mit langfristig steigender Tendenz. Früher lang sie deutlich niedriger, 1993 beispielsweise gerade einmal bei 16 Prozent, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Trotz der im internationalen Vergleich sehr ausgeprägten und zudem stark gewachsenen Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft arbeitet also auch heute nur etwa ein Viertel der Wirtschaft für den Export (und drei Viertel für die Binnenwirtschaft). Warum schlägt dann die Eintrübung der Exporte trotzdem so stark auf die gesamte Wirtschaft durch?
Um die inzwischen extreme Exportlastigkeit und die starke Beeinträchtigung der deutschen Wirtschaft im Rahmen der Corona-Krise – aber auch ihre langfristige Perspektive – zu verstehen, bietet sich vor allem eine neue Richtung in der polit-ökonomischen Vergleichenden Kapitalismusforschung (also der Disziplin, die sich mit den Unterschieden zwischen nationalen Wirtschaftsmodellen beschäftigt) an, die unter dem Stichwort der Unterscheidung von »Wachstumsmodellen« firmiert.
Wachstumsmodelle zwischen Exportorientierung und Binnenkonsum
Der Kern der Unterscheidung unterschiedlicher Wachstumsmodelle, wie sie etwa von Lucio Baccaro, dem Direktor des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, Engelbert Stockhammer, King’s College London, Eckhard Hein von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin oder Anke Hassel von der Hertie School verfolgt wird, besteht darin, nationale Volkswirtschaften hinsichtlich ihrer wesentlichen wirtschaftlichen Antriebskräfte zu differenzieren. Insbesondere die »growth model perspective« innerhalb der Vergleichenden Kapitalismusforschung, die maßgeblich von Lucio Baccaro und seinem politikwissenschaftlichen Kollegen Jonas Pontusson von der Universität Genf formuliert wurde, kann uns sehr gut dabei helfen, die aktuellen Probleme der deutschen Wirtschaft zu erklären.
Ein genereller Vorteil der Vergleichenden Kapitalismusforschung besteht darin, dass sie das komplexe Zusammenwirken verschiedener politischer Maßnahmen und Institutionen in Bezug auf eine Nationalökonomie analysieren kann, anstatt sich eng auf einen ökonomischen Teilaspekt zu fokussieren, wie große Teile der modernen Wirtschaftswissenschaften. Während frühere Ansätze der Vergleichenden Kapitalismusforschung (»Varieties of Capitalism«) den Fokus einseitig auf die Angebotsseite der Ökonomie legten, wird von dieser Forschungsrichtung nun auch die Nachfrageseite einbezogen. Und als Teil der Politischen Ökonomie geht es der Vergleichenden Kapitalismusforschung nicht nur um die richtigen wirtschaftspolitischen Rezepte, sondern auch um die politischen Hintergründe und Realisierungschancen.
Ausgangspunkt der Forschung von Baccaro und Pontusson ist, dass in den heutigen Volkswirtschaften der Industrieländer die von Investitionen und Löhnen stammende wirtschaftliche Nachfrage nicht mehr für ein ausreichendes Wachstum sorgt, im Gegensatz zu den ersten drei Jahrzehnten der Nachkriegszeit. Um das Wachstum trotzdem zu stimulieren, haben die modernen Ökonomien Ersatzstrategien entwickelt. Eine dieser Strategien beruht darauf, die Wirtschaft in erster Linie durch den Konsum der Haushalte anzutreiben. Da die Löhne heute für einen ausreichenden Konsum nicht mehr genügen, erlaubt man den Haushalten eine relativ leichte Verschuldung, etwa zum Erwerb von Immobilien. Die Alternativstrategie hingegen sieht vor, dass die notwendige Nachfrage aus dem Ausland mobilisiert, also sehr stark auf Exporte gesetzt wird.
Europäische Staaten haben sich laut Baccaro und Pontusson diese Strategien in unterschiedlichem Maße zunutze gemacht. Großbritannien hat in den vergangenen Jahrzehnten voll auf die Strategie des schuldenfinanzierten Konsums gesetzt, Deutschland ebenso eindeutig auf die Exportstrategie, Schweden hat beide Strategien im Rahmen eines eher balancierten Wachstumsmodells kombiniert und Italien hat weder über den schuldenfinanzierten Konsum noch über die Exporte das Wachstum forciert. Die Strategien der Länder sind zueinander komplementär – Deutschland (und Schweden) hätten weit weniger exportieren können, wenn nicht Länder wie Großbritannien diese Exporte durch ihre Konsumstrategie aufgenommen hätten.
Ein exponiertes Export-Wachstumsmodell wie in Deutschland (spätestens seit Ende der 1990er-Jahre) erfordert eine Reihe von ineinandergreifenden Elementen, um erfolgreich zu sein. Zu den Kernelementen gehört ein großer Industriesektor, ein System der institutionalisierten Lohnmäßigung und ein System fester Wechselkurse. Die beiden letztgenannten Institutionen sind essenziell, um dauerhaft über niedrige Exportpreise erfolgreich zu sein. Löhne und Preise hängen faktisch eng zusammen, Lohnmäßigung führt daher zu niedrigen Preisen, auch für Exporte. Ohne ein System fester Wechselkurse würden erfolgreiche Exporte zu einer hohen Nachfrage nach der nationalen Währung führen, diese dann gegenüber anderen Währungen aufwerten und über die entsprechend höheren Preise in internationalen Währungen die Exporterfolge wieder zunichtemachen.
Der Nachteil eines klar exportlastigen Wachstumsmodells (für große Teile der Bevölkerung) liegt darin, dass wegen der für den Export preissensibler Güter notwendigen Lohnmäßigung die Binnennachfrage relativ schwach ausfällt. Es gibt hier einen klaren Zielkonflikt zwischen Konsum und (preissensiblen) Exporten. Ein extremes Exportmodell ist notwendig mit Phänomenen wie Lohnmäßigung und fiskalischer Austerität verknüpft. Bei preissensiblen Exporten würde eine Stimulierung der Binnennachfrage – etwa über höhere Löhne oder über kreditfinanzierte Investitionen – ansonsten dafür sorgen, dass diese Ausfuhren einbrechen würden, da sie zu teuer werden.
Ganz besonders getroffen von der Lohnmäßigung in extremen Exportmodellen sind jene Arbeitnehmer, die in einfachen Dienstleistungen (beispielsweise im Einzelhandel oder der Gastronomie) arbeiten. Durch die Auskopplung solcher Dienstleistungen aus Industrieunternehmen und Tarifverträgen – und der damit einhergehenden Lohnreduktion – konnten die hochqualifizierten Arbeitnehmer in den Exportbranchen überzeugt werden, sich mit mäßigen Lohnsteigerungen zufriedenzugeben, da ihre Kaufkraft trotzdem gleich blieb oder sogar stieg.
Ein balanciertes Wachstumsmodell vermeidet diese Probleme weitgehend. Es stimuliert die Wirtschaft sowohl über die Binnennachfrage als auch über die Exporte. Hier sind also neben starken Exporten auch durchgehend solide Löhne und hohe staatliche Ausgaben machbar. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn die Exporte vergleichsweise wenig preissensitiv sind. Baccaro und Pontusson gehen davon aus, dass das in Schweden der Fall ist, wo sie in jüngerer Zeit zunehmend auf hochwertigen wissensintensiven Dienstleistungen und dem IT-Sektor beruhen.
Um längerfristig stabil zu sein, müssen die – historisch eher zufällig gefundenen – Wachstumsmodelle politisch und institutionell abgesichert werden. Institutionell erfolgt das über Institutionen wie das System der Lohnaushandlung oder die Wechselkurse. Politisch geben aus der Sicht von Baccaro und Pontusson Leitsektoren die Richtung vor, im Falle Deutschlands besonders die Automobilindustrie und der Maschinenbau, basierend auf einer klassenübergreifenden Koalition von Arbeitgebern und Gewerkschaften.
Aus dieser Perspektive können wir das Schicksal der deutschen Wirtschaft in der Corona-Krise gut erklären. Da das deutsche exportgetriebene Modell sich seine Wachstumsimpulse überwiegend aus dem Ausland holt, musste es in einer Krise, die die wichtigsten Handelspartner erfasst, hart getroffen werden. Das gilt selbst in einer Situation, in der der Bund viel Geld für die Stabilisierung der Exportwirtschaft aufgewendet hat – und eindeutig überproportional viel, wenn man bedenkt, dass nur etwa ein Viertel der Deutschen im Exportsektor tätig sind.
Die ökonomischen Verlierer der Corona-Rettungspakete in Deutschland
Wie aus der Perspektive der Wachstumsmodelle – und ihrer politischen Unterstützungskoalition – nicht anders zu erwarten, lag der Schwerpunkt des Nutzens der von der Bundesregierung 2020 in der ersten Welle der Corona-Krise verabschiedeten Wirtschaftspakete (»Schutzschild« und Konjunkturprogramm) auf der Unterstützung der Industrie, insbesondere den Exportsektoren.
Es gibt im internationalen Vergleich eine innere Logik zwischen Wachstumsmodell und Fokus des Rettungspakets, so Mark Blyth. Während im konsumgetriebenen britischen Wachstumsmodell der Fokus des Rettungspakets darauf lag, die Binnennachfrage zu stabilisieren (über die allgemeine Garantie von 80 Prozent der Gehälter), lag der Fokus im deutschen Fall auf einer Stabilisierung der Exportindustrie. Das war schon in der globalen Finanzkrise 2008/09 so, bei der die »Abwrackprämie« zugunsten der Autoindustrie der Kern des Rettungspakets war.
Viele der finanziell aufwendigsten Maßnahmen können auch jetzt wieder am stärksten von den großen Unternehmen der Industrie genutzt werden, sei es der Beteiligungsfonds oder die Kreditgarantien. Auch das Kurzarbeitergeld nützt den gut bezahlten Beschäftigen in der Exportindustrie viel mehr als den mäßig bezahlten Arbeitnehmern in vielen Dienstleistungsbranchen. In schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs bringt der mit dem Kurzarbeitergeld verbundene Einkommensausfall – ersetzt werden nur 60 beziehungsweise 67 Prozent des Nettogehalts – dagegen viel eher das Familienbudget in Schwierigkeiten.
Besonders viel Kurzarbeit findet sich zudem in den klassischen Exportbranchen Metallverarbeitung, Maschinenbau und Autoindustrie in den reichen Südländern Bayern und Baden-Württemberg, so ein Bericht des Spiegels. Ganz besonders profitieren von dieser Maßnahme allerdings die Besitzer der entsprechenden Exportunternehmen, die so die Beschäftigung flexibel der Nachfrage anpassen können, wie Thomas Sablowski argumentiert.
Kleine Unternehmen, Freiberufler und Solo-Selbständige in den Binnensektoren, die viel schneller in der Existenz bedroht sind, gehen bei vielen Hilfsprogrammen der ersten Runde leer aus, wie auch die Minijobber, sie sind die »Alleingelassenen«, so Michael Kröger und Anne Seith. Das trifft auch ganz besonders lokale Dienstleistungsbranchen, bei denen ein verlorener Umsatz nicht nachgeholt werden kann, im Gegensatz zur Industrie, die immerhin auf Halde produzieren kann.
Trotz fehlender Einnahmen blieben während der Corona-Schließung für diese Unternehmer viele laufende Kosten bestehen, etwa für Personal, Miete oder Leasing des Geschäftsautos. Die für Kleinstunternehmen in der ersten Runde zur Verfügung stehenden Zuschüsse (9 000 beziehungsweise 15 000 Euro) sind dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein, zumal die bürokratische Abwicklung auch häufig chaotisch läuft.
Zudem fehlt dann immer noch das Geld für die tagtägliche Lebenserhaltung des Selbständigen (sein »Unternehmergehalt«), seine Krankenversicherung oder seine Altersversorgung. Die verbleibenden Alternativen, Kredite aufzunehmen, bei denen unklar ist, ob man sie jemals zurückzahlen kann, oder Hartz IV zu beantragen, sind auch nicht sonderlich attraktiv, sodass viele dieser Unternehmer ihr Geschäft eher einstellen werden.
Auch Frauen und ihre Beschäftigungsfelder gehören zu denjenigen, die in den ersten Corona-Rettungspaketen des deutschen Staats eher vernachlässigt werden (von der Belastung durch zusätzliche Sorgearbeit noch ganz abgesehen). Während die eher männlich geprägten Branchen der (Export-)Industrie relativ gut bedacht wurden, fehlt ein analoger Mitteleinsatz für die von Frauen dominierten Gesundheits- und Pflegeberufe, worauf beispielsweise ein Positionspapier des Rats für Nachhaltige Entwicklung hinweist. Hinzu kommt, dass Frauen ganz besonders von der steigenden Arbeitslosigkeit erfasst werden – vier der fünf besonders betroffenen Berufe werden überproportional von Frauen wahrgenommen (Verkauf, Reinigung, Speisenzubereitung und Sekretariat), so Andre Wolf im Wirtschaftsdienst.
Wenig bedacht sind auch die Kommunen, die nicht nur für die Finanzierung vieler solcher Dienstleistungsjobs zuständig sind, sondern auch für den Großteil der öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, beispielsweise in Schulen, Straßen und den Klimaschutz. Diese Unterstützung der Binnennachfrage unterbleibt, obwohl solche Investitionen gerade in Krisen besonders hohe Multiplikator-Effekte sowie positive Erwartungseffekte für private Unternehmen zeigen, worauf Tom Krebs hinweist.
Kommunale Gewerbesteuereinnahmen werden zudem in den nächsten Jahren drastisch einbrechen, wie ein Gutachten für den Deutschen Städtetag zeigt, auch wenn sie für 2020 noch im Paket abgesichert sind. In der Folge – und wegen des Einbruchs bei Gewerbeimmobilien – droht die Baubranche ebenfalls in die Krise zu geraten, auch wenn diese derzeit noch insbesondere von der guten privaten Immobilienkonjunktur zehren kann.
Zu den klaren Verlierern der ersten beiden Corona-Pakete gehören also die binnenorientierten Wirtschaftssektoren. Für die Binnennachfrage relevant ist im Rahmen der Rettungspakete vor allem die Mehrwertsteuersenkung. Letztere umfasst mit 20 Milliarden Euro weniger als zehn Prozent der im Frühjahr/Sommer 2020 beschlossenen fiskalischen Maßnahmen für die deutsche Ökonomie (wenn man Bürgschaften und Steuerstundungen einbezieht sogar weniger als 1,5 Prozent), obwohl drei Viertel der Deutschen im Binnensektor arbeiten.
Die Wirksamkeit der Mehrwertsteuersenkung in Bezug auf die Kaufkraft ist zudem ungewiss, da die Steuersenkung von den Unternehmen nur teilweise weitergegeben wird. Zudem ist fraglich, ob sie als Kaufreiz ausreicht. Erste Befragungen durch das IMK verweisen darauf, dass nur ein Viertel der Haushalte darauf mit Mehrkonsum reagieren wird. Schließlich kommt sie zu einem nicht geringen Teil auch ausländischen Unternehmen zugute, beispielsweise Amazon.
Bei vielen Menschen sind aufgrund der Krise die Einkommen gesunken, sie können im täglichen Leben nun deutlich weniger Geld ausgeben. Hinzu kommt das »Angstsparen«: Die Menschen verzichten auf einen kleinen Luxus im Alltag, weil sie nicht wissen, ob sie in ein paar Monaten noch über eine Stelle verfügen. In der Folge droht die weitere Verödung der Innenstädte. Wenn Gastronomie, Clubs und Kultureinrichtungen dauerhaft schließen müssen, geht ein großer Teil an Lebensqualität verloren. Gleiches gilt für den stationären Einzelhandel, der zudem immer stärker durch den Onlinehandel abgelöst wird.
Wenn die deutsche Politik in der ersten Welle der Corona-Krise in ihrer Perspektive nicht so stark durch die Exportsektoren dominiert gewesen wäre, hätte sie schon lange viel größere Unterstützungsmaßnahmen für die Binnensektoren aufgelegt. Möglichkeiten gab es viele. In vielen anderen Ländern werden die Gastronomie und der Einzelhandel durch vom Staat (oder der Kommune) ausgegebene Konsumgutscheine unterstützt, die nur vor Ort eingelöst werden können. Diese könnten zudem mit einem im Zeitablauf sinkenden Wert (Schwundgeld) versehen werden, um einen Anreiz für eine zügige Einlösung vorzugeben, wie es Michael Hüther, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, 2020 vorgeschlagen hat.
Andere von Hüther zur Belebung der Binnennachfrage vorgeschlagene – und bisher nicht realisierte – Maßnahmen wären etwa eine befristete Absenkung der Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer (jene sind bisher nur gedeckelt) oder Steuergutschriften als Kopfpauschale wie in den USA (»Trump-Schecks«). Die Befragungen des IMK zur Konsumwirksamkeit des Kinderbonus im Konjunkturpaket – gerade einmal vier Milliarden Euro – verweisen darauf, dass solche Maßnahmen recht gezielt die Binnennachfrage stimulieren.
Das IMK selbst regt weitere Maßnahmen an, die in einem Konjunkturpaket die Binnennachfrage stimulieren könnten, etwa eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds für kleinere Einkommen, ein höheres und längeres Arbeitslosengeld I und Hilfen für Minijobber, zumal jene beim Kurzarbeitergeld leer ausgehen.
Musikclubs, Konzerthallen und Diskotheken, die aus gesundheitlichen Gründen vollkommen geschlossen bleiben müssen, benötigen eine pauschale Unterstützung, bis sie wieder öffnen können. Im November 2020 eingeführt wurde endlich ein Zuschuss in Anlehnung an ihren früheren Umsatz. Gleiches gilt für Unternehmen in Bereichen wie Kultur, Sport, Tourismus und anderen Unterhaltungssparten, die in der Corona-Krise nur mit einem Bruchteil ihrer Kapazitäten operieren können. Hier hätte viel energischer und früher gegengesteuert werden können, damit unsere Gesellschaft nach der Gesundheitskrise nicht wesentlich ärmer dasteht als vorher.
Jenseits der Corona-Krise: Welche Zukunft hat das deutsche Wirtschaftsmodell?
Jenseits der konkreten Gestaltung aktueller Maßnahmen, um die Wirtschaft besser gegen die Corona-Krise zu schützen, stellt sich die Frage nach der langfristigen Tragfähigkeit des deutschen Wirtschaftsmodells. Krisensituationen sind regelmäßig Phasen, in (und nach) denen intensiv über die die künftige Ausrichtung der Ökonomie diskutiert wird.