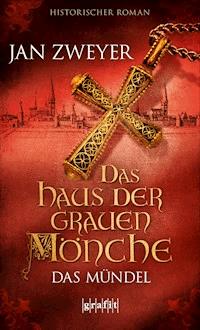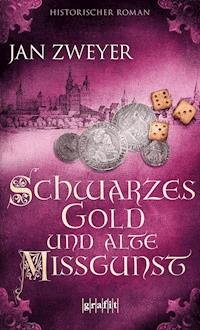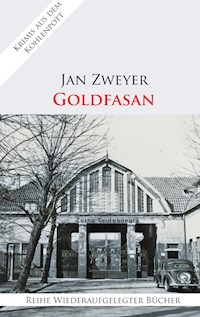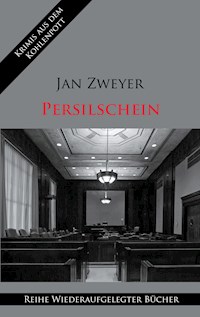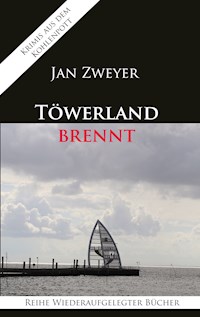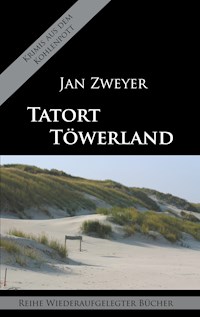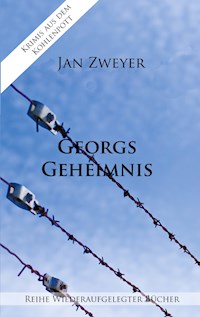11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lago
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Reihe von Terroranschlägen erschüttert Deutschland. Bekennerschreiben bestätigen, was bereits vermutet wird: Islamisten sind schuld an den Verbrechen. Während das LKA ermittelt, bricht im Land das Chaos aus – Politiker sind verunsichert, Medien verbreiten haltlose Spekulationen, Rechtspopulisten heizen die Stimmung mit ausländerfeindlichen Parolen an. Aber sind tatsächlich islamistische Terroristen für die Anschläge verantwortlich? Oder handelt es sich um geschickt inszenierte Fake News und es steckt etwas ganz anderes dahinter? Nach seinem Debütroman Der vierte Spatz liefert Jan Zweyer einen weiteren vielschichtigen Thriller, der den Leser bis zur letzten Seite in seinen Bann zieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jan Zweyer
FAKE NEWS
Jan Zweyer
FAKE NEWS
Thriller
LAGO
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2021
© 2021 by LAGO, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© Jan Zweyer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Textbaby Medienagentur, www.textbaby.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Matthias Teiting
Umschlaggestaltung: Marc-Thorben Fischer
Umschlagabbildung: shutterstock/MidSummerDay
Satz: Christiane Schuster | www.kapazunder.de
Druck: CPI books GmbH, Leck
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-95761-206-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-95762-294-5
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95762-295-2
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.lago-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1
Seinen richtigen Namen kannten nur wenige.
Natürlich seine Familie in Wisconsin, einige Freunde und auch die Leute, die ihn mit dieser Mission betraut hatten.
Alle anderen nannten ihn kurz Ben oder bei formellen Anlässen Mister Schelsky.
Schelsky war im eigenen Porsche Cabrio unterwegs, einem weißen 911er von 1974. Er liebte diesen Wagen und fuhr mit offenem Verdeck zu schnell durch die milde Nacht.
Der Deutsch-Amerikaner drehte die Musik lauter und ließ sich von einem Springsteen-Song einlullen.
Er sah das Blaulicht hinter sich näher kommen und verringerte seine Geschwindigkeit. Der Polizeiwagen überholte, und Schelsky bremste etwas zu heftig, als ihn eine rote Kelle zum Anhalten aufforderte. Die Glock rutschte vom Beifahrersitz in den Fußraum.
Shit.
Zu spät, sie zu verstecken.
Zwei Typen stiegen aus dem Wagen vor ihm aus und kamen langsam über die Landstraße auf den Porsche zu.
Schelsky beugte sich rechts herunter, um die Glock aufzuheben und sie in das Schulterhalfter zu schieben. Nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte, blendete ihn der Schein einer Taschenlampe.
Hatte der Polizist die Waffe gesehen?
Das Blaulicht schleuderte zuckende Blitze in die Nacht.
Schelsky schob sich das Sakko vor den Bauch und kletterte aus seinem Auto.
Schnell realisierte er, dass die zwei Typen, die vor ihm standen, keine Zivilpolizisten waren.
Auf der Stirn des Kleineren perlten feine Schweißperlen. Kein Bulle schwitzte nachts um kurz vor drei bei Temperaturen um die fünfzehn Grad am Rand einer Landstraße im Nirgendwo. Niemand schwitzte überhaupt um diese Zeit.
Das vermeintliche Polizeifahrzeug entpuppte sich als altersschwacher Ford und das Blaulicht auf dessen Dach als billiger Nachbau aus dem Internet.
Der Kleine warf einen neugierigen Blick auf das Nummernschild des Porsches und dann ins Innere.
Einen zu neugierigen Blick.
Der andere, ein groß gewachsener Schlaks, wedelte mit einer eingeschweißten Plastikkarte vor Schelskys Nase herum, wohl in der Annahme, der würde ihm abnehmen, dass es sich um einen Polizeiausweis handelte. Der Kerl zitterte, seine Augen tränten.
Schelsky hatte keinen Zweifel. Die beiden waren auf Turkey und planten, sich die Kohle für den nächsten Schuss zu verdienen.
»Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben?«, fragte der Kleinere. Seine Stimme klang verwaschen. »Sie sind zu schnell gefahren.«
Schelsky seufzte. Er wusste, was nun kam, und hasste die zwei dafür, dass sie ihm keine Wahl ließen.
Die beiden Möchtegernganoven würden ihm einen fingierten Strafzettel präsentieren und ihn, sobald er seine Geldbörse gezückt hatte, mit einer Spielzeugpistole bedrohen und ausrauben, um dann feixend und voller Vorfreude in ihre Karre zu steigen und zu flüchten.
Gerne hätte er sie mit fünfzig Euro abhauen lassen.
Das Dumme war nur, er hatte zehntausend in seiner Brieftasche. Geld, das ihm nicht gehörte. Viel zu viel, um es den Junkies zu schenken.
Und sie hatten ihn gesehen. Möglicherweise auch die Glock.
Sie könnten ihn vielleicht identifizieren.
Außerdem kannten sie das Kennzeichen des Porsches.
Zu viele Gründe.
Fuck.
»Wären Sie mit einer Verwarnung von zwanzig Euro einverstanden?«
Der Kleinere grinste.
Schelsky nickte, griff in sein Sakko und zog die Glock mit dem Schalldämpfer hervor.
Sein Gegenüber hörte auch dann nicht auf zu grienen, als ihn der Schuss zwischen die Augen traf.
Mit eingefrorener Miene fiel er mit dem Gesicht auf den Asphalt.
Der Größere blieb wie erstarrt stehen. Schelsky sah, wie es in ihm arbeitete.
Doch er dachte zu langsam.
»Sorry«, meinte Schelsky und erschoss auch ihn.
Ein dritter Schuss zertrümmerte das verräterische Blaulicht.
Schelsky ließ die Leichen, wo sie lagen, und hielt sich abseits vom Ford.
In der Ferne bellte ein Hund.
Donner grollte und Wetterleuchten zuckte. Erste Tropfen fielen.
Der Regen würde seine DNA-Spuren hoffentlich wegspülen. Wenn nicht, war es auch nicht tragisch. Einen Ben Schelsky gab es in Deutschlands Polizeicomputern nicht. Eigentlich gab es ihn nirgendwo.
Er kehrte zum Porsche zurück, schloss das Verdeck und fuhr ohne Eile los.
Ein ärgerlicher Zwischenfall, nicht mehr.
Schelsky entsorgte die Glock nach einer gründlichen Reinigung und mit einem gewissen Bedauern in einem Baggersee, an dem er dreißig Minuten später vorbeifuhr.
Es war eine gute Waffe.
Er würde sich wieder ein identisches Modell beschaffen.
Der Obdachlose war zitternd vor Angst liegen geblieben. Eine Ewigkeit später kroch er hinter dem Gebüsch hervor, wo er sich beim Herannahen der Fahrzeuge versteckt hatte. Bullen ging man besser aus dem Weg.
Er lief über die Straße, durchsuchte die beiden Toten, fand ein Smartphone und eine Geldbörse mit einigen Scheinen. Er steckte das Telefon und die Kohle ein und ließ das Portemonnaie achtlos fallen. Dann hastete er zurück zu seinem Versteck, griff sein Bündel und verschwand in der Nacht.
2
»Bist du endlich fertig?« Margarethe Halla stützte sich mit der rechten Hand am Treppengeländer ab. Sie rief nun schon zum zweiten Mal nach ihrem Sohn, der oben in seinem Zimmer herumkramte. Es war kurz vor sechs Uhr morgens. »Wir müssen los. Der Flieger geht in drei Stunden.«
»Meine Digitalkamera. Hast du sie gesehen?«, kam es prompt zurück. »Ich kann doch nicht ohne die Kamera ...«
»Sie liegt hier unten im Flur auf der Vitrine«, antwortete Margarethe genervt. Ihr Sohn hatte die Angewohnheit, alles und jedes im Haus an den unmöglichsten Plätzen zu verstreuen. Irgendwann hatte es Margarethe aufgegeben, dem Jungen hinterherzuräumen. Da ihre Ermahnungen nichts nutzten, sondern nur Auseinandersetzungen provozierten, hatte sie sich dazu durchgerungen, seine verlegten Sachen dort zu lassen, wo sie waren. Sie hoffte, dass dem Vierzehnjährigen die ständige Sucherei lästig werden und er Ordnung halten würde. Bis heute hatte sich diese Strategie jedoch als völliger Fehlschlag erwiesen. »Ich stecke sie ein. Jetzt beeil dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit.«
Sie warf einen prüfenden Blick in den Flurspiegel. Ihr gefiel nicht, was sie sah: Die dunklen Ringe unter ihren Augen zeugten von unzureichendem Schlaf, der leichte Bauchansatz von zu wenig Sport und falscher Ernährung.
Fünf Minuten später steuerte Margarethe Halla die Limousine ihres Vaters in Richtung Autobahn. Sie fuhr vorsichtig, überholte kaum und ignorierte die spöttischen Bemerkungen ihres Sohnes. Der wies mehrmals darauf hin, dass sie bei ihrem Fahrstil nie im Leben den Flughafen in Düsseldorf rechtzeitig erreichen würden.
Schließlich platzte ihr der Kragen. »Du weißt, dass ich Opas Benz nur ungern fahre. Der Wagen ist mir zu unübersichtlich. Meiner ist in der Inspektion. Wenn du nicht die Klappe hältst, nimmst du beim nächsten Mal die S-Bahn. Verstanden?« Mit ihrer barschen Reaktion maskierte sie ihre Bedenken, Jens allein in einen Flieger zu setzen.
Nach der Trennung von Jens’ Erzeuger war Margarethe mit ihrem Sohn zurück in ihr Elternhaus in Recklinghausen gezogen. Ihr Vater hatte sich darüber gefreut. Schon lange hatte er erwogen, das Haus aufzugeben, das ihm nach dem Tod seiner Frau zu groß und vor allem fremd geworden war. Nun aber, da Margarethe und Jens mit ihm unter einem Dach wohnten, lebte er gern in dem großzügigen Gebäude im Norden der Stadt.
Trotz ihrer zurückhaltenden Fahrweise erreichten sie rechtzeitig ihr Ziel. Margarethe Halla lenkte das Auto in eines der Parkhäuser. Sie hasste solche Bauwerke. Dunkel, enge Kurven, eigenwillige Verkehrsführung. Besonders ungern fuhr sie in die Hochgaragen am Düsseldorfer Flughafen. Schon die Zufahrten dorthin waren eine Zumutung. Hinweisschilder mit kryptischen Bezeichnungen. Hupende, drängelnde Taxen.
»Hier ist ein freier Platz«, rief Jens. Seine gespielte Selbstsicherheit war dem Reisefieber gewichen. Er rutschte aufgeregt auf seinem Sitz hin und her.
»Der ist mir zu eng«, erwiderte Margarethe. »Wir fahren weiter nach hinten. Da ist es nicht so voll.«
»Aber Mama. Dann müssen wir ja kilometerweit latschen. Und das mit dem Gepäck.«
»Du hast einen Trolley und einen Rucksack. Mehr nicht. Also stell dich nicht so an.« Sie lenkte den Wagen fast bis ans Ende des Parkhauses. Hier standen nur wenige andere Fahrzeuge. Margarethe Halla hoffte, dass dies auch bei ihrer Rückkehr so sein würde.
Sie hatte den Motor noch nicht abgestellt, da sprang Jens schon aus dem Benz. »Beeil dich«, bettelte er. »Sonst kommen wir zu spät.«
»Keine Panik«, lachte Margarethe. »Wir haben noch jede Menge Zeit.«
Heute begannen die Sommerferien, und Jens würde gleich nach London reisen. Allein. Das erste Mal stieg er ohne Begleitung in ein Flugzeug. Sein Großvater hielt sich seit einigen Tagen in der englischen Hauptstadt auf, um dort einen alten Freund zu besuchen. Ihr Sohn wollte mehrere Wochen bei ihnen bleiben und dann mit seinem Opa wieder nach Deutschland zurückkehren.
Die Warteschlange am Schalter war kurz, weshalb das Einchecken wenig Zeit in Anspruch nahm. Wenige Minuten später hielt Jens seine Bordkarte in der Hand.
Margarethe, die ihrem Sohn das Prozedere erklärt hatte, beobachtete ihn, wie er die Sicherheitskontrolle passierte. Danach drehte er sich um, winkte ihr zu und stapfte in Richtung Abfluggate.
Unschlüssig blieb sie noch einen Moment vor der Sicherheitsschleuse stehen, um sich dann wieder auf den Weg zu ihrem Fahrzeug zu machen. Was sollte denn passieren, beruhigte sie sich. In London wartete ihr Vater, und in der Düsseldorfer Abflughalle würde Jens sicher nicht verloren gehen. Außerdem hatte sie ihm mehrmals eingeschärft, sich am Gate sofort an eine der Mitarbeiterinnen des Bodenpersonals zu wenden, was ihr Sohn murrend akzeptiert hatte. Er sei kein Kind mehr, hatte er gemeint.
Die Parkboxen links und rechts neben dem Benz ihres Vaters waren glücklicherweise nicht belegt. Sie würde problemlos ausparken können.
Einige Meter entfernt stiegen zwei Männer aus einem dunklen Transporter. Margarethe schenkte ihnen keine Aufmerksamkeit, sondern suchte in ihrer Handtasche nach dem Wagenschlüssel. Als sie ihn nicht fand, schob sie ihre Hand in die Tasche ihrer Jacke. Natürlich war der Schlüssel dort. Aber noch etwas steckte darin: die Digitalkamera ihres Sohnes.
Was für ein verdammter Mist! Sie hatte nicht daran gedacht, Jens die Kamera zu geben. Der Junge hatte sich so über das Geschenk seines Großvaters gefreut. Die erste Reise, die er allein unternahm. Was hatte er für Bilder schießen wollen: den Tower, Piccadilly Circus, Trafalgar Square. Für einen Moment erwog sie, zurück in das Flughafengebäude zu laufen. Doch was hätte das genutzt? Der Sicherheitsbereich bliebe ihr ohne gültiges Flugticket verwehrt. Ob man den Jungen wegen einer vergessenen Digitalkamera ausriefe, erschien ihr mehr als fraglich.
Ihr fiel ihre Freundin Marlies ein, die als Flugbegleiterin arbeitete. Hauptsächlich flog sie auf den innereuropäischen Strecken. Vielleicht kam Marlies ja in den nächsten Tagen nach London und konnte sich mit Jens’ Großvater am Londoner Flughafen treffen? Sie griff zum Handy und wählte Marlies’ Bochumer Nummer. Sie hatte Glück. Marlies war zu Hause.
»Du musst dich beeilen«, meinte ihre Freundin, nachdem Margarethe das Malheur geschildert hatte. »Ich bin nur bis zum Nachmittag in meiner Wohnung. Um sechs Uhr muss ich in Köln sein. Dann geht es erst nach Barcelona, und morgen Mittag bin ich in Heathrow. Ich bleibe bis Mittwoch in London. Wenn du willst, nehme ich die Kamera mit. Aber dein Vater muss sie in meinem Hotel abholen. Zeit, um sie ihm zu bringen, habe ich nicht.«
»Das ist kein Problem. Danke. Ist es dir recht, wenn ich kurz nach Mittag komme? Ich wollte mir in Düsseldorf ein paar neue Schuhe kaufen. Wo ich schon einmal in der Stadt bin ...«, entschuldigte sie sich. »Ich könnte gegen halb zwei in Bochum sein.«
»Dann schwing die Hufe.«
Margarethe verstaute ihr Handy wieder in der Handtasche. Sie wollte die Kamera dazulegen. Da fiel ihr das leuchtende Display auf. Das Teil war nicht ausgeschaltet. Hatte Jens daran gedacht, das Ladegerät mitzunehmen? Und wenn nicht? Was nützte ihm ein Fotoapparat, dessen Akku erschöpft war? Sie suchte nach einer Möglichkeit, das Gerät abzuschalten, konnte jedoch ohne ihre Brille die Buchstaben auf dem Gehäuse nicht entziffern. Sie musterte die Kamera genauer, sah einen großen Knopf und drückte. Der Blitz flammte auf. Sie erschrak und sah sich um. Weiter hinten schauten Männer zu ihr hinüber, scheinbar ebenso überrascht wie sie. Sie hob entschuldigend einen Arm. Das war nicht der Ausschaltknopf gewesen. Aber direkt daneben befand sich ein zweiter, kleinerer. Sie legte den Zeigefinger darauf. Es piepste kurz und das Display wurde dunkel.
Sie stieg ein und startete den Wagen. Gegen halb acht hatte sie das Flughafenlabyrinth verlassen.
3
LH 832 war um 9.30 Uhr in München gestartet und pünktlich um 10.40 Uhr in Düsseldorf gelandet. Nachdem die Anschnallzeichen erloschen waren, stand der Passagier auf Platz 3d auf und zog aus der Gepäckklappe einen schwarzen Lederrucksack hervor, den er lässig über seine Schulter hängte. Dann wartete der Mann, der unter dem Namen Abdul Moussa reiste, dass sich die vordere Tür öffnete.
Beim Aussteigen nickte er der Stewardess zum Abschied zu. Reisende der Businessklasse gehörten zu den Ersten, die die Maschine verlassen durften. Er wandte sich direkt Richtung Ausgang. Da LH 832 ein Inlandsflug war, waren die Pass- und Zollkontrollstellen unmittelbar vor der Ankunftshalle nicht besetzt. Abdul Moussa passierte die automatischen Schiebetüren und verließ, ohne aufgehalten zu werden, den Sicherheitsbereich des Flughafens. Aber selbst eine gründliche Kontrolle hätte ihn nicht erschreckt. Seine Papiere waren erstklassig, und in seinem Rucksack lagerten lediglich einige englischsprachige Dokumente, die sich mit dem Im- und Export von Bekleidung beschäftigten, und ein Laptop, der nichts Bemerkenswertes enthielt.
Abdul Moussa war hochgewachsen und schlank. Er trug einen gepflegten, kurz geschnittenen Bart. Sein dunkelgrauer Anzug saß perfekt und passte vorzüglich zu dem hellblauen Hemd und der gestreiften Krawatte.
Für einen Moment blieb Moussa an der noch offenen Tür stehen. Er sah sich um. In der Ankunftshalle standen Wartende. Einige von ihnen streckten ihre Hälse und versuchten, Freunde oder Angehörige im Sicherheitsbereich auszumachen, bevor sich die Schiebetür hinter Moussa schloss.
Moussa wandte sich wie abgesprochen nach rechts und ging zu einem knapp hundert Meter entfernten Kaffeestand. Dort setzte er sich auf einen Barhocker, bestellte auf Englisch einen Espresso und ein Glas Mineralwasser. Er bezahlte unmittelbar, nachdem die Getränke serviert worden waren.
Es dauerte nicht lange, bis sich ein zweiter Mann neben ihn stellte und ebenfalls einen Espresso orderte. Auch er beglich die Rechnung sofort.
Die Barfrau widmete sich einem neuen Gast. Der Neuankömmling flüsterte: »As-salamu alaikum. Das Geschenk muss heute geliefert werden.«
»Wa alaikum as-salam. Ich bin bereit«, antwortete Abdul Moussa ebenso leise.
Der andere nickte, griff in seine Tasche und schob diskret einen Briefumschlag in Moussas Richtung. »Der Schlüssel und die Parkkarte für den Wagen. Er steht im Parkhaus drei auf Platz einhundertfünfundsechzig. Ein schwarzer Mercedes-Transporter. Die Anschrift steckt ebenfalls im Umschlag. Gib sie in das Navigationssystem ein. Der Computer wird dir den Weg zeigen. Du hast genug Kleingeld für den Parkautomaten?«
Abdul Moussa nickte.
»Gibt es noch irgendwelche Fragen, Bruder?«
»Nein.«
»Gut. Dann handle, wie abgesprochen.« Abdul Moussas Gesprächspartner stand auf. »Möge Allah mit dir sein, möge er dir Erfolg geben, auf dass du ins Paradies gelangst«, murmelte er.
»Inschallah — dort werden wir uns treffen«, erwiderte Moussa und sah seinem Glaubensbruder hinterher.
Den Transporter fand Abdul Moussa ohne Probleme. Der Wagen stand allein in einer Ecke, fast am Ende des Parkhauses und rund fünfzig Meter vom nächsten Fahrzeug entfernt. Moussa schloss auf, öffnete die Tür, warf seinen Rucksack trotz des Computers achtlos auf den Beifahrersitz und stieg ein.
Mehrere Kartons standen mit Klebeband aneinander befestigt auf der Ladefläche. Abdul Moussa schaute in einen von ihnen, sah den blauen Plastikbehälter mit dem aufgedruckten Totenkopf, dem Wort: Explosiv und die Kabel, die zur nächsten Kiste führten.
Befriedigt nahm er seinen Platz hinter dem Lenkrad ein und zog den Zettel heraus, auf dem die Anschrift seines Ziels stand. Dann schob er den Schlüssel ins Zündschloss und drehte ihn herum.
Das Letzte, was er sah, war ein helles Licht, das ihn vollständig umhüllte. Die unerträgliche Hitze des Feuerballs und den Explosionsknall nahm er nicht mehr wahr.
4
»Mein Gott, das sieht ja aus wie nach einem Bombeneinschlag.« Hauptkommissar Manfred Kollmar vom Landeskriminalamt Düsseldorf zückte seinen Dienstausweis.
Peter Schaubert, ein Kollege der örtlichen Kripo, warf einen flüchtigen Blick darauf. »Hat der Staatsschutz den Knall in seinen Büros gehört und ist sofort ausgerückt?«, erwiderte er mit leisem Spott. »Sie sind aber schnell gekommen.«
»Finden Sie? Da war ein Stau im Flughafentunnel. Ich ...« »Nein, das meinte ich nicht«, unterbrach ihn Schaubert. »Die Meldung über die Explosion ist nicht älter als eine Stunde, und schon steht das LKA auf der Matte. Seid ihr jetzt zuständig?«
»Das ist noch nicht entschieden. Aber bei der politischen Großwetterlage will sich keines der hohen Tiere in die Nesseln setzen. Ich soll lediglich sondieren und einen Bericht schreiben. Darf ich mich ein wenig umsehen?«
»Klar.« Schubert wusste, dass die Frage seines Kollegen rein rhetorischer Natur war. Selbst wenn er gewollt hätte, konnte er Kollmar den Zutritt nicht verwehren.
Rauchgeschwärzte Metallteile fanden sich noch Meter entfernt von dem Fahrzeugwrack. Löschschaum tropfte von dem leicht qualmenden Schrotthaufen. Männer in weißen Overalls untersuchten den Tatort nach Spuren. Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge schickten blaue Blitze in das Halbdunkel des Parkhauses.
»Mit der Bombe liegen Sie fast richtig«, meinte Schaubert, der an die Seite seines Kollegen getreten war. »Der Wagen ist in der Tat in die Luft gesprengt worden. Es war allerdings kein Bombeneinschlag, sondern der Sprengsatz befand sich im Inneren des Fahrzeugs.«
»Was ist mit den Opfern?«
»Zwei Tote, ein Schwer- und ein Leichtverletzter. Ein Toter im Wagen ...« Er schluckte und zeigte auf einen der Betonpfeiler. »Der andere ist ein Junge, dem ein Stück Metall den Kopf zertrümmert hat. Die Leiche liegt unter der Plane. Ein Unbeteiligter, so wie es aussieht.«
»Scheiße.« HK Kollmar griff zur Zigarettenschachtel. »Der Schwerverletzte?«
»Ihn trafen ebenfalls Trümmerteile. Er lag nicht weit von dem Knaben entfernt. Sein Arm wurde abgetrennt. Es ist nicht klar, ob er überlebt.«
»Haben Sie seine Personalien?«
Schaubert nickte. »Er heißt Hawar Kaymaz.«
»Ein Türke?«
»Türkischstämmig. Er wurde in Duisburg geboren und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.«
Kaymaz. So hieß ein früherer Kollege von ihm. In den letzten Jahren hatten Kollmar und er sich aus den Augen verloren. »Und der Junge?«
»Vielleicht sein Sohn. Aber das ist Spekulation. Das Gesicht ...« Schaubert sprach nicht weiter.
»Verstehe. Sonst noch etwas?«
»Nicht viel. Zunächst mussten wir den Sicherheitsdienst des Flughafens verscheuchen. Die Jungs waren der Meinung, sie hätten auch etwas zu melden, da sich die Explosion auf dem Flughafengelände ereignete.« Schaubert verzog das Gesicht. »Sie helfen jetzt bei der Verkehrsregelung unten an der Parkhauszufahrt und halten uns die Presse vom Hals. Die waren fast noch schneller am Tatort als wir.«
»Woher haben die denn Wind von der Sache bekommen?«
»Es hat kräftig geknallt. Das war noch Hunderte von Metern entfernt zu hören. Dann die Rauchentwicklung ...« Der Hauptkommissar zuckte mit den Schultern. »Oder irgendjemand hat denen einen Tipp gegeben.«
»Sie mögen recht haben. Was weiter?«
Schaubert zeigte auf den Explosionsort. »Die Trümmer waren mal ein Mercedes-Transporter. Die Kriminaltechnik wird sich damit beschäftigen. Eines der Nummernschilder ist noch lesbar. Ein in Düren zugelassener Wagen.«
»Was ist mit dem Toten im Fahrzeug?«
»Vollständig verbrannt. Glücklicherweise hat die Flughafenfeuerwehr das brennende Wrack schnell gelöscht. Sonst wäre wohl außer Asche nichts von dem Opfer übrig geblieben.«
»Und die Bombe?«
»Die Explosion muss heftig gewesen sein, so wie es den Mercedes zerfetzt hat. Außerdem war die Hitzeentwicklung enorm. Da ist mehr in die Luft geflogen als ein Zünder und der Benzintank. Aber Details wissen wir erst nach der chemischen Analyse.«
Kollmar nickte. »Andere Zeugen außer dem Schwerverletzten?«
Schaubert zeigte auf einen der Krankenwagen in der Nähe. »Ein älterer Mann. Er wurde leicht von einem Metallsplitter am Oberarm verletzt.«
»Was sagt er?«
»Bis jetzt nichts. Der Arzt wollte ihn zunächst versorgen. Er war eben noch ziemlich geschockt.«
»Ich versuche mein Glück. Haben Sie etwas dagegen?« Dieses Mal wartete er die Antwort seines Kollegen nicht ab und wandte sich dem Rettungswagen zu.
Auf einer Liege im Wageninneren saß ein etwa sechzigjähriger Mann mit dunklem, erstaunlich vollem Haar und einer fahlen Gesichtsfarbe. Ein Arzt war damit beschäftigt, medizinische Utensilien zu verstauen.
Manfred Kollmar sprach ihn an. »LKA Düsseldorf. Könnte ich mich einen Moment mit dem Zeugen unterhalten?«
Der Notarzt warf einen fragenden Blick auf seinen Patienten. Der nickte müde.
»Bitte nicht zu lange«, betonte der Mediziner. »Seine Verletzung am Oberarm ist zwar nur eine kleine Fleischwunde, aber ich habe ihm eine Beruhigungsspritze gegeben. Wir werden ihn für eine Nacht unter Beobachtung halten, um ganz sicher zu sein, dass ihm nichts fehlt.«
Der Notarzt sprang aus dem Fahrzeug und machte eine einladende Handbewegung.
»Ich beeile mich.« Der Hauptkommissar kletterte ins Innere und setzte sich mit einem leisen Stöhnen auf einen Schemel. Sein Rücken schmerzte vom langen Stehen. »Hat der Doktor Ihre Personalien aufgenommen?«
»Ja.«
»Dann werde ich sie mir von ihm geben lassen. Sind Sie so freundlich und nennen mir trotzdem Ihren Namen?«
»Gerd Meier.«
»Danke. Ich bin Manfred Kollmar vom Düsseldorfer Landeskriminalamt. Was haben Sie gesehen?«
»Eigentlich nicht viel«, erwiderte Meier mit schwacher Stimme. »Da war ein Mann, der in den Wagen gestiegen ist und die Tür zugezogen hat. Dann hat es auch schon geknallt.«
»Wie sah der Mann aus?«
Meier legte die Stirn in Falten. »Wie der aussah? Normal. Wie Geschäftsreisende eben aussehen. Dunkelgrauer Anzug, Krawatte.«
»Groß? Oder eher klein? Schlank?«
»Groß. Über einen Meter achtzig, würde ich sagen. Dunkler Teint, dunkle Haare. Bart.«
»Vollbart?«
»Nein. Kurz und gepflegt. Ein südländischer Typ. Ach ja, er hatte einen Rucksack dabei. So einen, in dem man üblicherweise einen Computer transportiert.«
»Sonst kein Gepäck?«
»Nein.«
»Dieser Mann ging zu dem Fahrzeug dort hinten und ist eingestiegen?«
»Ja. In den schwarzen Transporter. Ich habe mich gewundert, dass er einen solchen Wagen fährt.«
»Warum?«
»Er sah eben aus wie ein Geschäftsmann. Eigentlich bevorzugen die andere Modelle.«
Da hat Gerd Meier nicht unrecht, dachte Kollmar. »Sie waren auf dem Weg zu Ihrem Pkw?«
»Ja.« Meier zeigte auf die parkenden Fahrzeuge. »Der blaue Golf mit dem Essener Kennzeichen. Das ist meiner. Ich hatte gerade den Koffer verstaut, als es gekracht hat.«
»Waren Sie im Urlaub?«
»Nein, ich war in München, um meine Schwester im Krankenhaus zu besuchen. Ich habe in der gleichen Maschine wie der arme Kerl da gesessen.«
»Im selben Flugzeug?« Kollmar war elektrisiert. Wenn Meier sich nicht irrte, würden sie den Toten schnell identifizieren können.
»Ja. Er saß weit vorn. In der Businessclass. Ist wohl nur mit Handgepäck gereist. Ich musste dagegen noch zum Gepäckband. Hat ziemlich gedauert, bis mein Koffer kam. Ich habe den Mann später in der Ankunftshalle wiedergesehen. Er kam aus einer der Kaffeebars und hat vor mir das Parkhaus betreten.«
»Mit welcher Fluggesellschaft sind Sie geflogen?«
»Lufthansa.« Dann fiel Meier etwas ein. »Warten Sie, ich habe in der Tasche meine Bordkarte.«
Der Verletzte suchte einen Augenblick und streckte Kollmar die Karte entgegen. »Hier. LH 832.«
»In welcher Reihe hat der Mann gesessen?«
»In der ersten, glaube ich. Es könnte aber auch die zweite Reihe gewesen sein. So genau habe ich nicht darauf geachtet.«
»Links oder rechts?«
»Von wo aus gesehen?«
»Von der Flugrichtung aus.«
»Rechts, glaube ich. Am Gang.«
»Als Sie den Mann wiedergesehen haben, hat er sich da mit jemand in der Ankunftshalle unterhalten? Wurde er vielleicht abgeholt?«
Meier schüttelte den Kopf. »Das weiß ich wirklich nicht.«
»Haben Sie lange auf Ihr Gepäck warten müssen?«
»Bestimmt fünfzehn, zwanzig Minuten.«
Kollmar rechnete: Der Weg vom Gepäckband zur Ankunftshalle nahm etwa fünf Minuten in Anspruch. Also hatte sich der Unbekannte eine knappe halbe Stunde in der Halle aufgehalten. Was hatte er da gemacht? Natürlich konnte diese Verzögerung durch völlig banale Ursachen wie beispielsweise einen Toilettenbesuch verursacht worden sein. Trotzdem mussten sie dem Hinweis nachgehen.
Der Arzt unterbrach die Vernehmung. »Der Patient braucht Ruhe. Sie können ihn, wenn alles gut geht, morgen sprechen. Aber jetzt ist Schluss.«
Kollmar stand auf. »Wir melden uns wieder bei Ihnen, Herr Meier. Vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben. Sie haben uns wirklich weitergeholfen. Gute Besserung.«
Der Kommissar verabschiedete sich und kehrte zu seinen Kollegen zurück.
»Was sagt der Zeuge?«, erkundigte sich Peter Schaubert.
»Möglicherweise hat der Tote in einem Flieger aus München gesessen. Der Zeuge ist sich ziemlich sicher, mit ihm in derselben Maschine geflogen zu sein.«
»Großartig. Wenn er sich nicht irrt, dürfte uns das die Arbeit erleichtern. Übrigens, der Staatsanwalt ist eingetroffen. Er möchte Sie sprechen.« Schaubert zeigte auf drei Männer, die das Autowrack von jenseits der Absperrbänder begutachteten.
»Wer ist da bei ihm?«, fragte Kollmar.
»Presse.«
Staatsanwalt Wieland Strubbe war Anfang dreißig. Das, was ihm an Erfahrung fehlte, machte er durch forsches Auftreten wett. Er war grundsätzlich davon überzeugt, als Jurist keinen Fehler zu begehen. Fehler machten nur die anderen. Mit dieser Haltung ging der Staatsanwalt allen, die mit ihm arbeiteten, gehörig auf die Nerven. Das Dumme war nur, dass Strubbe in seinem Job wirklich gut war. Er beherrschte sein Metier. Deshalb war es für ihn völlig unverständlich, dass er nach drei Jahren als Staatsanwalt immer noch nicht befördert worden war.
Manfred Kollmar näherte sich der kleinen Gruppe. Er hörte, wie der Staatsanwalt den Journalisten erklärte, dass der Flugverkehr nur für wenige Minuten unterbrochen worden war und er sich völlig sicher sei, dass den Fluggästen und Besuchern nun keine weitere Gefahr mehr drohe.
»Hauptkommissar Kollmar.« Strubbe streckte jovial die Hand aus, als er den Kommissar erkannte. Dann wandte er sich an seine Begleiter. »Vielen Dank, meine Herren. Wenn Sie uns bitte entschuldigen würden. Ich stehe Ihnen später zur Verfügung. Jetzt muss ich mich um diesen Fall kümmern.« Er griff Kollmar am Arm und zog ihn mit sich. »Also?«
Kollmar setzte ihn über Meiers Aussage in Kenntnis.
»Ich habe eben mit Ihrem Vorgesetzten gesprochen. Ein Attentat, ohne Zweifel. Vielleicht ist etwas schiefgegangen?« Er erwartete keine Antwort. »Ihre Abteilung hat übernommen. Was haben Sie jetzt vor?«
»Ich habe angenommen, die Entscheidung, ob das LKA ermittelt, würde erst nach meinem Bericht ...«
»Ihren Bericht können Sie vergessen. Das ist ab sofort Ihr Fall. Nun?«
Kollmar nickte. »Wir sollten den Flughafen räumen lassen. Möglicherweise gibt es weitere Sprengkörper.«
Strubbe schaute ihn entgeistert an. »Sind Sie wahnsinnig? Wir befinden uns in der Hauptreisezeit. Da können Sie doch nicht Tausende Fluggäste nach Hause schicken. Und dann die Kosten. Nein, suchen Sie nach Bomben, aber diskret. Das Parkhaus sperren Sie meinetwegen, bis Ihre Untersuchungen beendet sind.« Er registrierte Kollmars skeptisches Gesicht und meinte: »Ich übernehme die Verantwortung.«
Der Hauptkommissar nickte. »Wie Sie meinen.«
»Und Ihre nächsten Schritte?«
»Ich wende mich an die Lufthansa, um die Passagierlisten einzusehen. Und an den Leiter des Sicherheitsdienstes natürlich.«
»Sie müssen sich nicht bemühen. Siegfried Sewering kommt da hinten«, meinte Strubbe und machte eine Kopfbewegung zu einem korpulenten Mann von Mitte fünfzig, der sich schimpfend mit einem Ausweis wedelnd einen Weg durch die Polizeiabsperrung bahnte.
»Sie kennen ihn?«, wunderte sich Kollmar.
»Flüchtig. Etwas impulsiv, aber eigentlich ein netter Kerl.«
Kurz darauf stand Sewering vor ihnen. »Haben Sie meine Leute zu Parkplatzwächtern degradiert, Herr Strubbe?«, fragte er mit rotem Kopf.
Der Staatsanwalt warf dem Hauptkommissar einen fragenden Blick zu.
»Ermittlungen sind Sache der Polizei«, erwiderte Kollmar scharf. »Nicht die eines privaten Sicherheitsdienstes.«
»Wir sind kein ...«
»Selbstverständlich kommen wir auf Ihre Expertise zurück, Herr Sewering«, vermittelte Strubbe. »Sie müssen verstehen, dass Sie in der Tat über keine Polizeibefugnisse verfügen. Hauptkommissar Kollmar wurde durch mich aufgehalten. Er war bereits auf dem Weg zu Ihnen.«
Kollmar atmete tief ein und nickte zustimmend. Er brauchte dringend die uneingeschränkte Kooperationsbereitschaft des Sicherheitsdienstes.
Auch Sewering lenkte ein. »Was kann ich für Sie tun, Herr Kollmar?«
»Ich möchte die Aufnahmen der Überwachungskameras einsehen.«
Der Chef der Security nickte.
»Wann können Sie diese Videos bereitstellen?«
»Das hängt davon ab, welche Sie genau benötigen.«
»Alle relevanten.«
Sewering lachte trocken. »Da müssen Sie viel Zeit mitbringen.«
»Weshalb?«
»Wir haben ...«
Erneut schaltete sich der Staatsanwalt ein. »Besprechen Sie das bitte nachher. Herr Kollmar wird Sie später in Ihrem Büro aufsuchen. Eine gute Nachricht habe ich für Sie: Der Flughafen wird nicht gesperrt, von dem Parkhaus hier abgesehen.«
Die Erleichterung stand Sewering buchstäblich ins Gesicht geschrieben.
»Trotzdem sollten Sie Ihre Security verstärkt einsetzen. Das beruhigt die Leute. Wenn Sie uns jetzt entschuldigen würden? Ich muss noch etwas mit dem Hauptkommissar besprechen und meine Zeit ist leider begrenzt.« Er drehte sich um und zog Kollmar mit sich.
Nach einigen Schritten meinte er: »Ich begleite Sie zur Lufthansa. So kann ich mich von der Pressemeute loseisen.«
Kollmar atmete tief ein. Das hatte ihm gerade noch gefehlt.
5
Die vier hohen Ministerialbeamten und Abteilungsleiter des Düsseldorfer Innenministeriums diskutierten mit dem zuständigen Staatssekretär Brandler die neuesten Vorschläge zu einer EUVerordnung über den Austausch sicherheitsrelevanter Daten.
Die Tür zum Sitzungszimmer wurde aufgerissen, und ein Referent trat ein, ohne anzuklopfen. Die Anwesenden schauten unwillig auf.
»Bitte entschuldigen Sie die Störung.« Der Beamte sah sich kurz suchend um, eilte zu seinem Vorgesetzten, reichte ihm einen Zettel und verließ den Raum wieder. Der Abteilungsleiter faltete das Papier auseinander, las, runzelte die Stirn und bat um das Wort.
»Ich muss unsere Diskussion leider unterbrechen. Am Düsseldorfer Flughafen hat es vor Kurzem eine Explosion gegeben. Wie es scheint, handelt es sich um ein Attentat.«
»Was?« Der Staatssekretär streckte fordernd die Hand aus. »Lassen Sie sehen.«
Der Beamte schob ihm den Zettel zu. »Mehr, als ich gesagt habe, steht dort nicht.«
»Dann sollten Sie uns weitere Informationen beschaffen«, schnappte Brandler und warf einen flüchtigen Blick auf die Nachricht. »So schnell als möglich. Ich muss den Minister informieren.«
Schmallippig zog der Abteilungsleiter sein Handy hervor und ging zum Fenster, um zu telefonieren.
»Macht den Fernseher an«, meinte Brandler derweil und schaute fordernd in die Runde. »Irgendeinen der Nachrichtenkanäle.«
Einer der Anwesenden griff zu der Fernbedienung, die am unteren Ende des Tisches lag.
Kurz darauf sahen sie Aufnahmen aus dem Flughafenparkhaus, die ein zerstörtes Fahrzeug, Polizisten und jede Menge Blaulicht zeigten. Dann folgte ein Schnitt, und die Kamera dokumentierte den normalen Betrieb an den Abfertigungsschaltern.
»Jetzt machen Sie doch endlich den Ton lauter«, forderte Brandler.
»... hielt die Polizei eine Räumung des Flughafens für nicht erforderlich, obwohl bei ähnlichen Attentaten in anderen Ländern nach der ersten Explosion weitere folgten, sobald die Rettungsarbeiten angelaufen waren. Die Sicherheitsbehörden ermitteln, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte, in alle Richtungen. Ein islamistischer Anschlag könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen. Weitere Informationen über das Attentat in unseren Nachrichten um fünfzehn Uhr.«
Der Staatssekretär bemühte sich selbst, schaltete das Fernsehgerät aus und warf dem Abteilungsleiter einen fragenden Blick zu.
»Sehr viel mehr weiß die Polizei auch nicht. Gegen 11.20 Uhr ist die Bombe in dem Parkhaus hochgegangen. Zwei Tote, der Fahrer des Transporters, möglicherweise der Attentäter, und ein türkisches Kind. Ein Schwerverletzter, bei dem nicht klar ist, ob er durchkommt. Vermutlich der Vater des getöteten Jungen. Und ein leicht verletzter Deutscher.«
»Verdammt«, murmelte Brandler. »Hat sich jemand zu dem Anschlag bekannt?«
»Bis jetzt noch nicht.«
»Islamisten?«, fragte einer der Ministerialdirektoren.
»Möglich, aber nicht gesichert. Obwohl: Der vermutliche Täter trägt einen arabischen Namen.«
Brandler schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Das ist Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten. Ich höre schon ihr Mantra im Landtag: Einwanderung stoppen, zusätzliche Stellen für die Polizei, Gesetze verschärfen, politischen Islamismus bekämpfen.« Er stand auf und marschierte an der Fensterfront auf und ab. »Bereiten Sie eine Stellungnahme für den Minister vor. Verbrecherisches Attentat, Mitgefühl bei den Opfern und ihren Familien, schnellstmögliche Aufklärung, volles Vertrauen in die Polizeibehörden, Täter werden zur Rechenschaft gezogen und so weiter. Das Übliche halt. Wir müssen die Deutungshoheit behalten.«
»Zu spät.« Der Abteilungsleiter zeigte auf das Display seines Handys. »Die AfD-Fraktion hat bereits in einer Presseerklärung reagiert.«
»Was schreiben sie?«, knurrte Brandler.
»Dasselbe wie immer. Ohne eine Öffnung der Grenzen hätte es das Attentat und damit die Opfer nicht gegeben. Sie machen die Bundesregierung mitverantwortlich.«
»Dieser Schwachsinn wird auch dann nicht intelligenter, wenn man ihn ständig wiederholt«, erwiderte Brandler.
»Er setzt sich aber in den Köpfen der Menschen fest«, konterte der Abteilungsleiter.
»Leider wahr. Und das wenige Monate vor der nächsten Bundestagswahl.«
6
Auf dem Weg nach Bochum klingelte Margarethes Handy. Sie überlegte, konnte aber weder im Rückspiegel noch vor sich etwas entdecken, was nach Polizeifahrzeug aussah, und nahm deshalb das Gespräch entgegen. Am Apparat war Thomas Grieg, den alle nur Tom nannten.
»Hallo Greti. Wie geht es dir?«
»Du sollst mich nicht so nennen. Ich heiße Margarethe.«
»Früher hat dir das nichts ausgemacht.«
»Aber heute macht es mir etwas aus«, erwiderte sie schroff. »Was willst du?«
»Jens fliegt irgendwann nach London, hast du mir erzählt.«
»Ja, habe ich.«
»Ich wollte euch doch zum Flughafen bringen. Wann genau war gleich der Termin?«
Margarethe seufzte. Erst vor einer Woche hatte sie mit Tom über Jens’ Urlaub gesprochen und ihren Ex gebeten, mit ihr und ihrem gemeinsamen Sohn nach Düsseldorf zu fahren. Sie hatten vereinbart, dass er sie und Jens abholen sollte. Dabei war es geblieben. Tom hatte wie so häufig den Termin vergessen. Glücklicherweise hatte sie Jens vorher nichts davon erzählt, dass sein Vater sie nach Düsseldorf begleiten wollte. Sie kannte Tom und seine Unzuverlässigkeit. Einer der Gründe, warum sie ihm den Laufpass gegeben hatte.
»Das war heute. Ich komme gerade vom Flughafen.«
»Mist. Das hatte ich vergessen.«
»Stimmt.«
»Was meinte Jens dazu?«
»Was sollte er sagen?«
»Na ja, schließlich war ich nicht da.«
»Du bist nie da, wenn man dich braucht. Außerdem habe ich ihm vorher nichts gesagt. Ich wollte der Enttäuschung vorbeugen. Wie sich herausgestellt hat, die richtige Entscheidung.«
»Du hättest mich anrufen können«, meinte Tom vorwurfsvoll.
»Ich hätte dich anrufen sollen?«, erwiderte sie eine Spur zu laut. »Du hast mir während unseres letzten Gesprächs mitgeteilt, dass du in nächster Zeit telefonisch nicht zu erreichen wärest. Deshalb wolltest du dich ja bei mir melden.«
»Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass jede unserer Unterhaltungen innerhalb von Minuten zu einem Streit führt?«, antwortete Tom.
»Ja, ist es.«
»Woran liegt das deiner Meinung nach?«
»Das fragst ausgerechnet du?«
»Ja.«
Sie wollte zu einer heftigen Erwiderung ansetzen, entschied sich dann aber anders. Die ewigen Auseinandersetzungen mit Tom führten zu nichts. Deshalb log sie: »Tut mir leid. Da kommt die Polizei. Ich möchte kein Strafmandat riskieren und lege jetzt auf. Tschüs.« Sie drückte die rote Taste, ohne auf seine Entgegnung zu warten, und warf das Handy wütend auf den Beifahrersitz.
Als Tom und sie sich kennengelernt hatten, war sie knapp über zwanzig gewesen und er einige Jahre älter. Tom besuchte die Polizei-Führungsakademie Hiltrup und hatte sich nach seinem erfolgreichen Abschluss für die Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamts in Berlin beworben. Er absolvierte die harte Spezialausbildung, ließ sich aber dann, nachdem Jens geboren worden war, zurück ins Ruhrgebiet versetzen, um mit Margarethe in eine kleine Wohnung in Bochum zu ziehen. Geheiratet hatten sie nie.
Kurz nach seiner Rückkehr begannen die Probleme. Tom war oft gereizt, trank mehr, als ihm guttat, und ihre Streitereien häuften sich. Es waren meist nichtige Ursachen, die sie beide zu großen Konflikten aufbauschten. Bald bekam Tom zusätzlich Ärger in seinem Beruf, der darin gipfelte, dass ihm von seinen Vorgesetzten nach einem anonymen Hinweis nicht nur Kokainmissbrauch, sondern auch die Annahme von Bestechungsgeld vorgeworfen worden war. Das gelegentliche Koksen räumte er ein, wies aber energisch zurück, bestechlich zu sein. Schließlich quittierte er, um dem bevorstehenden Rausschmiss zu entgehen, den Polizeidienst.
Das verbesserte seine Situation nicht, im Gegenteil. Er wechselte seine Jobs wie andere Menschen ihre Hemden, arbeitete als Privatdetektiv, Kurierfahrer, Kellner und Straßenarbeiter, bis er am Ende als Rausschmeißer eines Nachtklubs anheuerte.
Irgendwann war der Punkt erreicht, an dem Margarethe sein Selbstmitleid, seine aggressiven Wutanfälle und die darauf folgenden depressiven Phasen nicht länger ertragen konnte. Sie packte ihre Sachen, verließ die gemeinsame Wohnung und beendete die Beziehung.
Für etwa ein Jahr mied sie jeden Kontakt mit dem Vater ihres Kindes. Sie hatte, obwohl Tom dazu verurteilt worden war, auf Unterhaltszahlungen verzichtet. Dafür sollte er sich von Jens fernhalten. Auch wenn Tom diese Vereinbarung nicht passte, hielt er sich daran. Margarethe blieb in den Folgejahren allein. Ihr genügten ihr eigener Vater sowie ihr Sohn als Familie. Ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigte sie in gelegentlichen unverbindlichen Affären.
Später hörte Margarethe von gemeinsamen Freunden, dass Tom für eine amerikanische Sicherheitsfirma arbeitete, die undurchsichtige Aufträge in der Grauzone der Geheimdienste und mit Billigung und Unterstützung der amerikanischen Regierung ausführte.
Irgendwann hatte er wieder vor ihrer Tür gestanden. Braun gebrannt, sportlich, durchtrainiert. Seit dieser Zeit hielten sie sporadischen Kontakt. Tom, der anscheinend jede Menge Geld verdient hatte, bestand darauf, sich finanziell an der Ausbildung seines Sohnes zu beteiligen, ohne auch nur die geringsten Ansprüche zu stellen. Ihr Verhältnis normalisierte sich, blieb aber gespannt. Sie stritten sich wie früher beim kleinsten Anlass.
7
Geldern war keine Insel der Friedfertigkeit, aber ein Doppelmord ereignete sich im Stadtgebiet nun auch nicht alle Tage. Entsprechend ehrgeizig nahm die Mordkommission ihre Arbeit auf. Ein solches Verbrechen wollten sie so schnell als möglich aufklären.
Die Leitung des Teams aus zehn Beamten hatte Kriminalhauptkommissar Markus Förster vom KK1 übernommen, der von Kalkar aus die Todesermittlungen im Kreis Kleve führte.