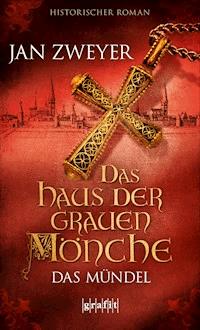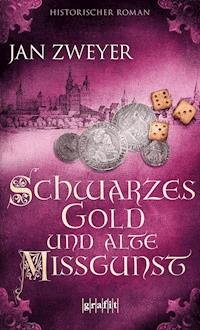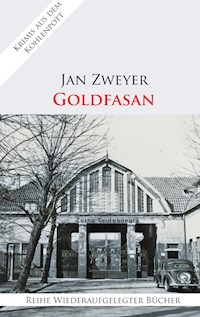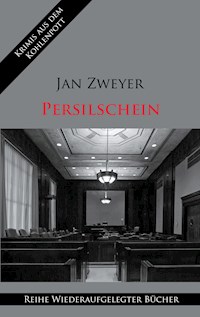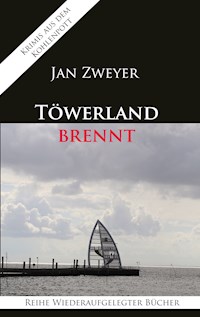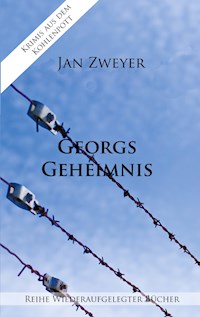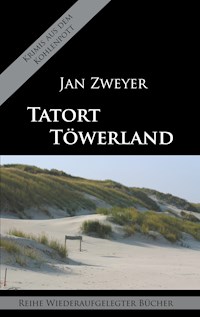
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kurz vor Weihnachten auf der Insel Juist: Rund um einen geplanten Golfplatzbau streiten Spekulanten um Grundstücke und mit Naturschützern. Da wird eine tote Frau in den Dünen gefunden. Zwei Festland-Kommissare lernen das Inselleben kennen und Rechtsanwalt Rainer Esch gerät in einen Interessenkonflikt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne. Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie (Franzosenliebchen, Goldfasan, Persilschein) das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte die fünfbändige Linden-Saga, eine historische Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet, ein Thriller zur Flüchtlingsproblematik (Starkstrom) und 2020 ein Ökothriller (Der vierte Spatz).
In der Reihe Wiederaufgelegter Bücher werden verlagsseitig vergriffen Texte von Jan Zweyer als Buch und eBook neu veröffentlicht. Der Originaltext unterliegt jetzt den neue Rechtschreibregeln. Inhaltliche Veränderungen wurden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.
Die nächste Flut verwischt den Weg im Watt.
Und alles wird auf allen Seiten gleich;
die kleine Insel draußen aber hat
die Augen zu; verwirrend kreist der Deich.
Rainer Maria Rilke
Fast alle der beschriebenen Örtlichkeiten gibt es tatsächlich auf Juist, nur waren sie nie Schauplatz der in diesem Buch beschriebenen Ereignisse. Diese sind, wie auch alle Personen, frei erfunden und ohne jedes reale Vorbild.
Ich danke der Polizei von Juist für ihre freundlichen Hinweise.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Prolog
»Es ist aus!«
Die drei Worte trafen ihn wie Keulenschläge. Ungläubig blickte er sie an.
»Hast du mich verstanden? Aus und vorbei.«
Er hatte nicht verstanden, wollte nicht verstehen. Mit hängenden Schultern stand er vor ihr, Tränen schossen in seine Augen. Langsam schüttelte er den Kopf. »Können wir nicht …?«
»… Freunde bleiben?«, beendete sie den Satz. »Was für ein Klischee!«
»Nein, ich meine … Können wir es nicht noch einmal versuchen?«
»Schlag dir das aus dem Kopf. Ich werde nicht länger auf dieser Insel bleiben. Nicht nach dem, was passiert ist.«
»Aber ich dachte …«
Die junge Frau lachte bitter. »Du dachtest, du dachtest. Was du schon denkst!« Sie machte eine abweisende Handbewegung und sagte herablassend: »Es ist nicht mehr zu ändern. Finde dich damit ab.«
»Das kann ich nicht«, stieß er hervor. Dann heftiger: »Ich liebe dich!«
»Was weißt du denn schon von Liebe?«
Er griff nach ihrer rechten Hand. »Bitte …«, flehte er. »Bitte.«
Sie entzog sich ihm. »Lass mich. Ich möchte nicht, dass du mich anfasst.« Ihre Stimme war kalt.
Seine Trauer und Verzweiflung mischten sich mit Zorn, und der Zorn verwandelte sich in Wut. »Früher hast du das aber gemocht.«
»Früher, früher. Wie kommst du darauf? Vielleicht war ja nur kein Besserer da.« Sie wandte sich ab. »Ich gehe jetzt.«
Er zog sie zurück und umklammerte ihren linken Oberarm mit beiden Händen. »Bitte bleib.«
»Lass sofort los.«
Er zog sie an sich, hielt ihren Kopf fest und versuchte sie zu küssen. Sie sträubte sich und stieß ihn von sich. »Wenn du das noch einmal machst …« Ihre Drohung stand im Raum.
Ihr Gegenüber näherte sich. »Was dann?«
Die Frau sah ihn an und begann plötzlich unmotiviert zu lachen. »Wenn du dich sehen könntest! Der betrogene Liebhaber. Was für eine Witzfigur.«
»Wieso betrogener Liebhaber? Gibt es da etwa noch jemanden?«
»Was hast du denn gedacht?«
Er schüttelte erneut den Kopf. »Nein. Nein, bitte … Ich glaube es nicht …« Seine Stimme erstarb. »Wir haben uns doch …« Plötzlich trat er einen Schritt nach vorne, umarmte sie, drückte seinen Körper gegen ihren und versuchte, seine Zunge gewaltsam in ihren Mund zu zwängen.
Sie keuchte vor Überraschung und drehte ihren Kopf, so weit es ging, zur Seite. Die Frau wand sich heftig unter seinem Griff. Dann gelang es ihr, den rechten Arm freizubekommen. Sie verkrallte ihre Finger in seinen Haaren und riss den Kopf des Mannes mit aller Kraft nach hinten. Er stöhnte und gab sie wieder frei.
»Mistkerl«, fluchte sie und schlug ihm ins Gesicht.
Er weinte, kam aber wieder näher und streckte seine Hände aus. »Ich wollte doch nur …«
Sie wich zur Wand zurück. »Bleib stehen!«
»Bitte bleib bei mir. Du darfst nicht gehen«, schluchzte er. »Ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht leben.«
»Bleib sofort stehen!«
Er ignorierte ihren Befehl, packte sie an der Schulter und schüttelte sie heftig.
»Hör auf, sofort!«
»Du darfst nicht gehen, hörst du? Du darfst nicht!« Seine Hände rutschten höher. Sie sah ihn mit aufgerissenen Augen an. »Du darfst nicht gehen, niemals!« Seine Finger umschlossen ihren Hals.
Die Frau geriet in Panik. Sie zog ihr Knie an und rammte es ihm in den Unterleib. Der Mann zuckte zusammen, drückte aber weiter zu. »Du darfst mich nicht verlassen, das geht nicht.«
Ihr blieb die Luft weg. Mit der rechten Hand versuchte sie, die Umklammerung zu durchbrechen, ihre linke ruderte auf der Suche nach etwas, das sie als Waffe benutzen konnte, durch die Luft. Sie röchelte heiser, als er den Druck verstärkte.
»Ich lass dich nicht gehen.«
Mit der Kraft der Verzweiflung schlug sie ihm wieder und wieder ins Gesicht. Ihre Fingernägel hinterließen blutige Kratzspuren auf seiner Stirn.
»Du darfst mich nicht verlassen … Du musst bei mir bleiben!«
Der Körper der Frau erschlaffte.
»Du musst bei mir bleiben!«
Erst Minuten später lockerte er seinen Griff. Verblüfft sah er, wie die tote Frau langsam an der Wand hinunter auf den Boden rutschte. Sein Mund blieb vor Erstaunen und Erschrecken offen. Mit dem Handrücken wischte er sich das Blut aus dem Gesicht, blickte auf die roten Spuren auf seiner Linken und fiel auf die Knie, als würde ihm erst jetzt klar, was geschehen war.
»Das, das habe ich nicht gewollt«, stammelte er entsetzt. »Das habe ich nicht gewollt.«
Er stierte auf die vor ihm liegende Tote. Nach einigen Minuten hob er sie hoch und bettete sie auf eine Liege. Unter ihren Kopf schob er ein Kissen und bedeckte sie mit einer Wolldecke. Ihr blondes, langes Haar floss auf das Sofa. Auch im Tod war ihr Gesicht noch wunderschön. Dann streichelte er zärtlich über ihre Wangen. Tränen liefen über sein Gesicht. Warum hatte sie ihm das angetan?
Schließlich zog er die Decke langsam über ihre verkrampften Züge, setzte sich in einen Sessel und wartete.
Die junge Frau stellte ihr Weinglas auf den Couchtisch und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Dann stand sie seufzend auf, schaltete das Fernsehgerät aus und öffnete die Terrassentür. Sie blieb an der Tür stehen und genoss die feuchtkalte Luft, die vom Meer heraufzog, bis sie fröstelte. Die Frau ging zurück ins Haus, stieg die Treppe nach oben und betrat das Badezimmer.
Zehn Minuten später hatte sie ihre Abendtoilette beendet. Sie wollte gerade zum Lichtschalter greifen, als die Beleuchtung ohne ihr Zutun ausging. Ihr Herz schlug schneller. Sie atmete einige Male tief durch und versuchte so, die aufkommende Panik zu verscheuchen.
»Ein Stromausfall«, murmelte sie leise, während sie sich durch den dunklen Flur zur Treppe tastete. »Nur ein Stromausfall. Das kommt vor.«
Durch ein Fenster schaute die Frau auf das Nachbarhaus. Es war hell erleuchtet. Sie schüttelte verwundert den Kopf. Dann kam ihr ein Gedanke: die Hauptsicherung, natürlich!
Langsam gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit, so dass sie ihre Umgebung schemenhaft erkennen konnte. Vorsichtig stieg sie die Treppe hinab. Auch im Erdgeschoss funktionierte das Licht nicht.
Aus dem Wohnzimmer blies ihr ein eiskalter Hauch entgegen. Der Wind hatte die Terrassentür weit aufgedrückt. Die Vorhänge flatterten gespenstisch. Sie schloss die Tür und versuchte sich an den genauen Standort des Sicherungskastens zu erinnern. Die Frau griff zu ihrem Einwegfeuerzeug, das auf dem Tisch lag. Ein kümmerliches Flämmchen warf einen trüben Lichtschein. Sicher hatten ihre Eltern Kerzen im Haus, aber wo? Die Flamme des Feuerzeuges erlosch. Hektisch drehte die Frau am Zündrad.
Ein leises Knarren im Flur ließ sie erschaudern. Sie fuhr herum und starrte auf die dunkle Türhöhle. Sie sah nichts. Endlich brannte das Feuerzeug wieder. Zitternd streckte die Frau ihren rechten Arm mit dem funzeligen Licht in die Höhe und machte einen langsamen Schritt nach vorn. Es knarrte wieder. Die Panik kehrte zurück. Die Frau zwang sich erneut zur Ruhe. Jetzt wusste sie, woher das Geräusch stammte. Erleichtert atmete sie auf. Der Deckel des Briefkastenschlitzes in der Eingangstür saß seit einigen Tagen locker und bewegte sich im Wind.
Dann nahm sie eine Bewegung hinter sich wahr. Ehe sie reagieren konnte, wurde ihr Kopf brutal nach hinten gerissen. Ihr Hals straffte sich. Sie sah, dass etwas den flackernden Lichtschein des Feuerzeuges reflektierte. Etwas Blitzendes, Metallisches. Etwas Scharfes.
1
»Na, was halten Sie von meinem Vorschlag?«
Der Mann platzierte seine rechte Hand auf dem Schreibtisch, beugte seinen Oberkörper etwas vor und sah mit stechenden Augen hoch. In seinem linken Ohrläppchen funkelte ein Brilli. Er trug einen perfekt sitzenden anthrazitgrauen Zweireiher italienischen Zuschnitts, dazu ein weißes Hemd und eine dunkelgraue Krawatte mit roten Punkten. Seine breiten Schultern und der durchtrainierte Körperbau ließen darauf schließen, dass er sich durch regelmäßiges Bodybuilding fit hielt. Das kurze, dunkle Haar war tadellos frisiert.
»Was ist nun?« Zur Bekräftigung seiner Frage ließ er auch seine linke Hand auf den Tisch fallen. Das Armband einer schweren goldenen Uhr klapperte auf der Buchenplatte. »Ist es das Finanzielle?«
Rainer Esch schüttelte schweigend den Kopf. Schon seit Minuten rekapitulierte er überschlägig die Kosten der Sozietät und seines nicht immer vorbildlichen Lebenswandels und überlegte, ob er das generöse Angebot von Marian Dezcweratsky ablehnen konnte. Aber so sehr er auch sein Gehirn zermarterte – er konnte nicht.
Vor etwa zwanzig Minuten hatte die gepflegte Erscheinung mit dem unaussprechlichen Namen ohne Terminabsprache die Büroräume der Kanzlei in der Herner Innenstadt betreten und sich von Martina, der Bürovorsteherin und einzigen Angestellten, bei Rainer anmelden lassen. Da Mandanten ein Manko in der Anwaltssozietät Schlüter und Esch waren und Rainer keine anderen Verpflichtungen hatte, durfte Marian Dezcweratsky sein Anliegen vortragen.
Und das war ebenso lukrativ wie simpel: Dezcweratsky wollte, dass die Sozietät die juristische Beratung und Vertretung der gesamten wirtschaftlichen Aktivitäten seiner Unternehmen übernahm.
Seine Gastritis meldete sich. Rainer hoffte, dass es wirklich nur eine Gastritis war und nichts Schlimmeres. Seit einigen Wochen quälte ihn ein bohrender Schmerz im Oberbauch. Trotzdem war er noch nicht zum Arzt gegangen. Angst und tief sitzendes Misstrauen gegenüber den Halbgöttern in Weiß ließen ihn diesen Besuch immer wieder verschieben.
Esch sollte also der Justiziar der Dezcweratsky-Gruppe werden. Zu einem monatlichen Festhonorar von 3.000 Mark. Zuzüglich Mehrwertsteuer. Vertretungskosten vor Gericht extra. Abgerechnet nach der Gebührenordnung.
Ein solches Angebot ließ normalerweise in jeder Anwaltskanzlei ihres Zuschnitts die Sektkorken hochgehen. Auch Rainer hatte nicht übel Lust, seine Partnerin und Lebensgefährtin Elke nach Abschluss seiner Verhandlungen zum Essen einzuladen, wenn da nicht die Branche gewesen wäre, in der Marian Dezcweratsky tätig war.
Esch war zwar nicht kleinlich und auch kein Heiliger, aber das Betreiben von Bordellen und Nachtklubs gehörte nun nicht gerade zu den Geschäften, die er moralisch für unangreifbar hielt. Und was Elke davon halten würde …?
Aber 3.000 Schleifen! Plus Honorar!
Er gab sich einen Ruck. »Sagen wir 3.500. Und Sie können nicht erwarten, dass ich mich an irgendwelchen krummen Geschäften beteilige.«
Dezcweratsky lächelte verstehend. »Keine Angst. Alles streng legal. Ich bin Geschäftsmann, kein Krimineller. Einverstanden. 3.500.«
Rainer seufzte tief. Wie weit wirtschaftliche Not unbescholtene Bürger doch treiben konnte. »Dann müssen wir uns nur noch über die genauen Vertragsmodalitäten einigen. Ich würde vorschlagen, dass wir …«
Eine weitere Stunde später hinterließ der im Lustgewerbe tätige Marian Dezcweratsky in dem Büro an der Viktor-Reuter-Straße einen unterschriebenen Vertrag und einen Scheck über 3.500 Mark. Und einen Rainer Esch, der sich den Kopf darüber zerbrach, wie er die Geschichte seiner Freundin erklären sollte.
Im ersten Moment war sie eher verblüfft als verärgert. »Sag das noch einmal! Du hast einen Vertrag mit einem Bordellbetreiber unterschrieben?« Sie schüttelte ihr braunes, halblanges Haar. »Hast du sie nicht alle?«
»Mit dem Vertrag sind wir aus dem Gröbsten raus«, verteidigte er sich. »Die Miete für die Kanzlei, das Gehalt von Martina …«
»Aber deshalb lässt man sich doch nicht mit einem Loddel ein!«
»Dezcweratsky ist kein Zuhälter. Er vermietet lediglich Zimmer.« Rainers Widerspruch war eher zaghaft.
»Aha. Vermietet lediglich Zimmer. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Dir scheint wirklich jemand etwas in den Kaffee getan zu haben. Und die Nachtklubs? Wird da Canasta und Bridge gespielt?«
Elke kam langsam in Fahrt und Rainer entschied sich dafür, den Mund zu halten.
»Und worin sollst du ihn vertreten? In Zivilverfahren wegen Mietwucher vielleicht? Oder in Strafprozessen wegen Förderung der Prostitution? Sehr nett wären auch Anklagen wegen Menschenhandels. Was hältst du von schwerer Körperverletzung gegenüber minderjährigen Frauen aus der Ukraine? Oder wie wäre es mit Vergewaltigung? Ich habe gehört, dass die mit falschen Versprechungen ins Land gelockten Frauen nicht immer ganz freiwillig hier bleiben. Da würde sich Freiheitsberaubung gut machen.« Die letzten Sätze schrie sie Rainer ins Gesicht. »Wie würdest du dich in einem solchen Prozess entscheiden? Etwa auf Freispruch plädieren?«
»Wenn Dezcweratsky unschuldig ist, ja.«
»Wie kann jemand unschuldig sein, der mit der Ausbeutung von Frauen sein Geld verdient? Diese Typen behandeln Frauen als Ware«, wütete Elke. »Das ist entwürdigend!«
»Mag sein. Aber selbst wenn es so wäre, wie du unterstellst: Auch solche Leute haben das Recht auf einen fairen Prozess. Außerdem soll es auch Frauen geben, die sich freiwillig prostituieren.«
»Wenn du damit auf die so genannten Sexarbeiterinnen anspielst, vergiss es. Diese Art von Feminismus konnte ich noch nie nachvollziehen.«
»Versteh ich nicht.«
»Ich bezweifle, dass Frauen freiwillig ihren Körper verkaufen. Und wenn sie das tun, dann nur deswegen, weil wirtschaftliche Not oder meinetwegen auch der irrige Glaube an die schnelle Mark sie antreibt. Aber auch wirtschaftliche Not kann Gewalt sein!«
»Das schon. Trotzdem haben aber auch Bordellbetreiber Anspruch auf rechtlich einwandfreie Verfahren.«
»Sicher.« Elke wirkte enttäuscht. »Aber musst ausgerechnet du sie vertreten?«, fragte sie leise.
»Unsere Vereinbarung …«
»Unsere? Deine Vereinbarung!«
»Unser Vertrag. Wir sind ’ne Sozietät«, knurrte Rainer. »Die Abmachung mit Dezcweratsky sieht in erster Linie juristische Beratung vor: Mietrecht, Arbeitsrecht, allgemeines Vertragsrecht und so. Vorfälle, wie die von dir erwähnten, sind schlecht fürs Geschäft. Und deshalb möchte Dezcweratsky so etwas vermeiden.«
»Behauptet er. Ich glaube, der macht dir was vor. Und selbst wenn nicht: Mit solchen Geschäften, so legal sie auch sein mögen, will ich nichts zu tun haben. Auch dann nicht, wenn eine Million Kerle täglich für die schnelle sexuelle Befriedigung bezahlen.«
»Brauchst du auch nicht. Das ist mein Mandat. Und wenn sich Dezcweratsky nicht an die Abmachung hält, werfe ich ihm die Brocken vor die Füße. Aber«, Rainer wedelte mit dem Scheck, »für einen Monat bin ich sein Berater. Mindestens für diese Zeit. Vertrag ist Vertrag.«
»Leider.« Elke stand auf und sah ihrem Partner in die Augen. »Versprich mir, dass du dich nicht kaufen lässt.«
»Versprochen.«
»Hoffentlich.« Ohne weitere Worte verließ sie sein Büro. Und Rainer war sich wieder einmal nicht sicher, ob er nicht einen Fehler gemacht hatte.
2
Aus Süden, vom Festland her, versuchte schon seit Tagen eine Nebelwand die Insel zu verschlucken. Der leichte Nordostwind, manchmal etwas auffrischend, kämpfte gegen die Nebelfront und schlug immer wieder neue Breschen in die Wolken. Da keiner der beiden Gegner entscheidende Vorteile erlangen konnte, blieb das Wetter, wie es war: diesig und feucht.
Die Fähren, die Juist mit Norddeich verbanden, pendelten planmäßig zwischen der Insel und dem Festland. Nur der Flugverkehr der zweimotorigen Propellermaschinen vom Typ Britten Norman Islander war eingestellt. Die Insulaner und die wenigen Urlauber, die sich über Weihnachten in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen verkrochen hatten, nahmen von der fehlenden Flugverbindung nur deshalb Notiz, weil ihre Post und die Zeitungen später als gewöhnlich eintrafen. Die Druckerzeugnisse kamen erst mit der Fähre, die um kurz nach halb drei am Nachmittag im Hafen anlegte.
Die meisten Fahrgäste der Frisia Neun waren Einheimische. Der Dampfer war zu hören, bevor man ihn sah. Dumpf ertönte seine Sirene durch die Nebelschwaden. Erst als das Schiff die Containerverladung an der südlichen Spitze der Hafenanlagen passierte, waren vom Kai aus schemenhaft die Aufbauten der Fähre zu erkennen. Mit langsamer Fahrt näherte sie sich. Das Schiff drehte und schob sich mit dem Heck voran an die Anlegestelle. Die mahlenden Schrauben wühlten das graubraune Wasser im Hafenbecken auf. Gurgelnd schlug es an die Spundwände.
Mit einem sanften Ruck legte Frisia Neun endlich an. Taue wurden an den Pollern festgemacht, rasselnd öffnete sich die Heckklappe. Auf dem Sonnendeck der Fähre standen, in dicke Jacken gehüllt, einige Fahrgäste und hielten Ausschau nach Freunden oder Bekannten. Eine kleine Zugmaschine schleppte die Wagen, in denen das Gepäck der Besucher verstaut war, von der Fähre und stellte sie auf dem Kai ab. Erst dann konnten die Fahrgäste das Schiff verlassen, die Ticketkontrolle passieren und ihre Gepäckstücke einsammeln.
Die meisten Ankömmlinge packten ihre Taschen und Koffer auf die Fahrradanhänger der Abholer, andere nutzen die Pferdefuhrwerke, die auf Juist die Taxis ersetzten. Einige näherten sich zielstrebig einem kleinen Platz gut fünfzig Meter von der Anlegestelle entfernt, auf dem luftbereifte Karren auf autorisierte Nutzer warteten. Der Name ihrer Besitzer oder der der Hotels und Pensionen prangte unübersehbar auf den Seitenwänden.
Als alles umgeladen worden war und die wenigen neuen Fahrgäste das Schiff betreten hatten, nahm die Fähre wieder Kurs auf Norddeich. Bald darauf dämmerte es. Juist versank erneut in die beschauliche Ruhe der Vorweihnachtszeit.
Auf dem Weg ins Dorf, direkt neben dem Hafengebäude, passierten die Ankömmlinge einen ausgeklappten Tapeziertisch, hinter dem ein junger Mann mit Nickelbrille und Vollbart fröstelnd von einem Bein auf das andere stampfte. Er trug Jeans, einen selbst gestrickten Wollpullover und eine gelbe Regenjacke. Eine dunkelblaue Pudelmütze bändigte nur unzureichend seine zerzausten, halblangen Haare.
Vor dem Tisch hing ein Transparent, selbst gefertigt aus einem alten Bettlaken, bemalt mit einer kleinen, stilisierten gelben Sonne, die eine geballte Faust von sich streckte, und der Aufschrift: Kein Golfplatz auf Juist. Erhaltet die Insel. Schützt die Natur. Auf dem Tisch lagen, durch Steine vor dem Wegfliegen gesichert, einige Stapel Flugblätter und zwei Unterschriftenlisten, die jeweils nur wenige Namen enthielten.
»Unterstützen Sie unseren Kampf gegen die Bodenspekulation! Gegen den Ausverkauf unserer Insel! Kein Golfplatz auf Juist. Solidarisieren Sie sich mit Ihrer Unterschrift. Juist muss Töwerland bleiben. Wir brauchen kein zweites Sylt!«, rief der Mann mit verschnupfter Stimme den Ankommenden zu, von denen die meisten jedoch achtlos vorbeigingen.
Eine starker Windstoß drohte, die Flugblätter ihrer wortwörtlichen Bestimmung zuzuführen. Hastig beugte sich der Mann vor und rückte den Sicherungsstein in eine bessere Position.
»Moin, Christian. Jetzt geht’s gegen den Golfplatz?« Ein junger Mann war stehen geblieben.
Der Bärtige schreckte hoch. »Ach, du bist es. Moin, Hendrik. Willst du deinen Vater besuchen?«
Hendrik Altehuus nickte. »Und was machst du?« Er deutete mit dem Kopf auf die Listen.
»Siehst du doch. Ich sammle Unterschriften.« Der leicht trotzige Unterton war nicht zu überhören.
»Scheinbar aber nicht sehr erfolgreich, oder?«
»Kein Wunder, bei dem Wetter«, räumte Christian Hanssen ein. »Unterschreibst wenigstens du?«
»Was hast du gegen den Golfplatz?«, fragte Altehuus zurück.
»Lies das.« Hanssen drückte seinem früheren Schulkameraden ein Flugblatt in die Hand. Der gab es ihm jedoch postwendend zurück. »Erzähl es mir lieber.«
»Wann? Jetzt?«
»Warum nicht? Mein Vater sitzt ohnehin noch in seinem Büro.« Altehuus sah sich um. Mit Ausnahme der Hafenarbeiter, die die Frisia Neun zur Abfahrt vorbereitet hatten, war der Kai menschenleer. »Hier unterschreibt doch niemand mehr. Komm, lass uns etwas klönen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Im Sommer?«
Christian Hanssen nickte bestätigend und begann wortlos, Flugblätter und Unterschriftenlisten in einer Tüte zu verstauen und den Stand abzubauen. Er packte die Sachen und die Reisetasche seines Schulfreundes in seinen Fahrradanhänger. »Wohin?«
»Wer hat auf?«, kam die Gegenfrage.
»Kompass?«
Von ihrem Platz im Schankraum sahen sie auf den kleinen Kurplatz. Der stärker gewordene Nordostwind zerrte an den wenigen Passanten, die im nahe gelegenen Supermarkt ihre Einkäufe erledigt hatten und bepackt mit Körben und Taschen nach Hause eilten. Es begann leicht zu schneien.
»Scheint noch kälter geworden zu sein«, bemerkte Hendrik Altehuus.
»Sieht so aus«, antwortete Christian und schlürfte seinen Eierpunsch. Hendrik wartete geduldig. Sein Freund setzte das Glas ab und schaute wieder aus dem Fenster. Dann begann er zu erzählen.
»Schon seit einigen Jahren beabsichtigt ein Konsortium schwerreicher Hamburger und Bremer Geschäftsleute, auf unserer Insel einen Golfplatz zu bauen.«
»Klingt doch nicht schlecht?«
»Zunächst nicht. Die Investitionen lohnen sich aber nur dann, wenn die potenziellen Golfer auch ihre Ferienhäuser hier bauen dürfen. Dafür brauchen sie Grundstücke. Und wie du weißt, ist der Platz auf Juist begrenzt. Deshalb dürfen Neubauten hier nur erstellt werden, wenn darin auch Unterkünfte für Urlauber vorhanden sind. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein reicher Hamburger in seiner Villa auch noch Feriengäste einquartiert. Du?«
»Nee.«
»Eben. Der Gemeinderat hat bisher immer versucht, die Entstehung von Gettos für Reiche und die damit verbundene Bodenspekulation zu verhindern. Aber die Investorengruppe hat schon viel Knete in die Planungen gesteckt, diese Ausgaben müssen sich irgendwann auszahlen. Die Pläne liegen seit geraumer Zeit fertig in den Schubladen. Die brauchen nur noch die Zustimmung der Gemeinde. Dann rollen die Bagger an.«
»Und? Wird der Gemeinderat nun zustimmen?« Altehuus steckte sich eine Zigarette an und bestellte noch ein Pils.
»Ich hoffe nicht. Hinter den Kulissen findet ein heftiges Tauziehen statt. Im Moment gibt es eine Art Patt unter den zwei, nein, eigentlich sind es drei Fraktionen. Ich meine nicht die politischen Parteien. Die Angelegenheit ist überparteilich. Da ist zum einen die Gruppe um Peter Ahrndt …«
»Der Apotheker und Heimatforscher? Das ist doch der Enkel von Ehmine Ahrndt, oder?«
»Genau. Die sind strikt gegen den Golfplatz. Wie ich. Dann ist da Wilhelm Steiner. «
»Der die Kneipe im Loog hat? Den kenne ich nicht näher.«
»Hast du auch nichts versäumt. Kam mit seiner Familie nach dem Zweiten Weltkrieg als Vertriebener, ist hier hängen geblieben. Steiner leidet bis heute darunter, dass ihn die alteingesessenen Familien nicht als Juister akzeptieren.«
Hendrik Altehuus lachte. »Ist ja auch schwer. Es müssen mindestens drei oder vier Generationen an der Mittelstraße begraben liegen, bis man nicht mehr als Zugereister gilt.«
»Ich glaube nicht, dass Steiner bei dem Gerangel um den Golfplatzbau die treibende Kraft ist. Im Hintergrund zieht da ein Bremer Teehändler namens Hans Wübber die Fäden. Der hat im Loog ein luxuriöses Ferienhaus. Er ist gemeinsam mit Steiner in einer Bürgerversammlung aufgetreten und hat den Abbau von Investitionshemmnissen, wie er es nannte, gefordert. Steiner scheint der Strohmann von Wübber zu sein. Und schließlich gibt es im Rat noch einige Unentschlossene. Die schlagen sich mal auf die eine, mal auf die andere Seite. Bis jetzt hat keine Fraktion eine eindeutige Mehrheit. Deshalb landet die Änderung der Bauvorschriften auch nicht auf der Tagesordnung einer Ratssitzung. Keine Seite kann sich sicher sein, die Abstimmung zu gewinnen. Sie suchen unter den Unentschiedenen nach weiteren Verbündeten. Das geht jetzt schon seit Monaten so.« Hanssen trank noch einen Schluck Eierpunsch. »Und weißt du, wo sie den Golfplatz bauen wollen?«, beendete er seinen Bericht.
»Keine Ahnung.«
»Am Deich zwischen Loog und Hammersee! Und direkt daneben die Villensiedlung. Nach den Planungen der Investoren soll lediglich der Weg zur Domäne Bill und der Strand für die Öffentlichkeit frei bleiben. Die Domäne Loog wird das Klubhaus.«
»Oh!« Hendrik war überrascht. Die gesamte Insel war Bestandteil des Nationalparks Wattenmeer und der Hammersee lag bereits in der Ruhezone, in der die Natur weitgehend sich selbst überlassen war. Es war gerade diese ungestörte Natur, die die meisten Urlauber auf die Insel zog.
»Verstehe. Ihr befürchtet nicht nur Beeinträchtigungen des Nationalparks, sondern auch Nachteile für den Tourismus.«
»Genau. Nur wenige Restaurants und Geschäfte würden vom Zuzug der Reichen profitieren. Andere würden Einbußen erleiden.«
»Und Steiner hat sein Restaurant im Loog, in der Nähe des Golfplatzes.«
»Eben. Und Wübber gehören dort Grundstücke.«
»Also daher weht der Wind!«
»Genau.« Christian drehte sich zur Theke. »Noch einen Eierpunsch, bitte.«
3
Frierend und ziemlich schlecht gelaunt stapfte Karl-Heinz Schwiebus durch das Schneetreiben. Auf seiner Visitenkarte stand: Immobilienmakler. Er besaß ein kleines Büro in Wanne-Eickel, in das sich nur selten Kunden verirrten, da er sich regelmäßige Zeitungsanzeigen nicht leisten konnte. Die letzte Mietwohnung hatte er im Oktober vermittelt, den einzigen Hausverkauf seiner Karriere vor mehr als zwei Jahren realisiert. Seinen Lebensunterhalt bestritt er im Wesentlichen durch den Verkauf von Hausratversicherungen und gelegentliche Serviceleistungen für einen der Großen im Immobiliengewerbe des Ruhrgebietes.
Diese Geschäftsbeziehung war auch der Grund dafür, dass er sich auf Juist herumtrieb.
Was hatten ihm seine Freunde nicht alles vorgeschwärmt vom Winter auf Juist: stundenlange Spaziergänge unter sonnigem, wolkenlosem Himmel am endlosen Sandstrand in eiskalter Luft; gemütliche Abende mit blonden, hochbeinigen Inselschönheiten in einer der zahlreichen Kneipen bei Grog, Glühwein und Eierpunsch; feuchtfröhliche Ausflüge in Pferdekutschen zu den Sehenswürdigkeiten der Insel; faszinierende Eisbarrieren im Wattenmeer – und was war?
Die meisten Kneipen und Restaurants nahmen ihren Betrieb erst am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag wieder auf; Touristen befanden sich kaum auf der Insel, und wenn, dann waren die wenigen Blondinen fest in der Hand ihrer Ehemänner und Freunde und auch noch so dick in Wattejacken verpackt, dass selbst sein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen nicht ausreichte, das Darunter zu erahnen. Zwar hatte er schon ein paar jungen Damen das eine oder andere Getränk an der langen Theke der Spelunke ausgeben dürfen, aber es war trotz einiger viel versprechender Ansätze leider nur beim Bezahlen des Eierpunsches geblieben.
Die Wintersonne hatte er seit seiner Ankunft auch noch nicht gesehen, dafür aber schon mehrfach die Erfahrung gemacht, wie sich Schnee- und Graupelschauer, vom stürmischen Wind fast waagerecht über den Strand gepeitscht, auf der ungeschützten Gesichtshaut anfühlten.
Als er sich gestern Abend am Telefon darüber bei einem seiner Freunde beschwerte, hatte der nur eine Binsenweisheit zum Besten gegeben: »Charly, es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung.«
Und jetzt war auch noch das Sportgeschäft mit der richtigen Kleidung geschlossen. Einem kleinen Schild an der Eingangstür entnahm Schwiebus, dass er zwischen 17 und 18 Uhr eine gewisse Chance hatte, den Laden betreten zu dürfen.
Trotzdem hatte sein Aufenthalt auf der Insel auch etwas Gutes: Er kostete ihn nicht nur keinen Pfennig, sondern warf auch noch ein kleines Honorar ab. Schwiebus war sich allerdings nicht ganz sicher, ob sein Auftraggeber mit den bisherigen Ergebnissen seiner Arbeit zufrieden sein konnte.
Er schlug seinen Mantelkragen höher und machte sich auf den Weg zur Spelunke, eine der wenigen Kneipen, die geöffnet hatten.
Charly Schwiebus bestellte ein Bier und sah sich um. Wie immer um diese Zeit waren kaum Gäste im Lokal. Lediglich am hinteren Ende der Theke entdeckte er ein Paar, das in eine intensive Unterhaltung vertieft war. Die Reihe schmaler Tische gegenüber war bis auf einen einsamen Trinker leer. Schwiebus erinnerte die Sitzanordnung an die Bestuhlung im britischen Unterhaus.
Die Thekencrew spülte Gläser und bereitete sich auf den Abend vor. Ab zehn, elf Uhr ging nach Charlys Erfahrungen in der Spelunke die Post ab. Allerdings war das Gedränge dann so groß und der Lautstärkepegel so hoch, dass an ein gemütliches Tête-à-Tête nicht zu denken war.
Schwiebus orderte ein zweites Pils und blickte zur Uhr. Zeit für seinen täglichen Bericht. Er griff zum Handy und wählte die Nummer seines Geldgebers.
»Schwiebus hier.«
»Ja?«, kam die knappe Antwort.
»Leider bin ich immer noch nicht sehr viel weiter.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Na ja, ich habe Steiner noch nicht erreichen können. Er geht nicht ans Telefon.«
Die Stimme am anderen Ende der Verbindung schwieg. Dann sagte sie ungehalten: »Sie haben es nur über das Telefon versucht? Das kann ich auch von hier aus. Ich bezahle Sie nicht dafür, dass Sie auf Juist Urlaub machen!«
»Nein, natürlich nicht«, beeilte sich Schwiebus zu versichern. »Ich war jeden Tag bei seinem Haus. Nachbarn haben mir erzählt, dass er erst am 23. oder Heiligabend wieder zurückkommen wird. Er macht mit seiner Familie Urlaub bei Verwandten. Die Nachbarn wussten aber nicht …«
»Also übermorgen.«
»Oder einen Tag später. Heiligabend.«
»Sie bleiben, bis Sie mit Steiner geredet haben. Was haben Sie sonst in Erfahrung bringen können?«
»Heute hat am Hafen ein Mann Unterschriften gegen den Bau des Golfplatzes gesammelt.«
»Und?«
»Ich dachte, das interessiert Sie.«
»Haben viele unterschrieben?«
»Soweit ich sehen konnte, nicht.«
»Gut. Bis morgen.«
»Äh, Herr …«
»Was denn noch?«
»Meine Spesen … Ich will damit sagen, hier haben Heiligabend nur die großen Hotels und das Kurhaus geöffnet. Da muss ich reservieren … ich muss doch auch eine Mahlzeit …«
»Sie reden mit Steiner, verstanden? Und, zum Teufel, gehen Sie Heiligabend, wohin Sie wollen.«
»Danke. Ich werde mein Möglichstes tun.«
»Das ist zu wenig.«
Die Verbindung war unterbrochen.
4
»Unser neuer Großkunde für dich«, teilte Martina Spremberg ihrem Chef mit, bevor sie das Telefonat durchstellte. »Ich mach dann übrigens Feierabend.«
»Wenigstens benutzt du den Plural«, knurrte Esch. Es knackte in der Leitung. »Was machst du?«, fragte er empört nach.
»Was sagten Sie gerade?«
»Oh, Herr Dezcweratsky.« Rainer hatte etwas geübt, um den Namen annähernd fehlerfrei aussprechen zu können. »Was kann ich für Sie tun?«
»Verreisen.«
»Wie bitte?«
»Fahren Sie für mich auf die Insel Juist.«
»Juist? Was soll ich da?«
»Grundstücke kaufen. Sie sollen in meinem Namen die Verhandlungen führen und die Verträge vorbereiten. Ich bin leider im Moment in Bochum unabkömmlich.«
»Was für Grundstücke?«
»Baugrundstücke, Felder, Wiesen, was auch immer. Wenn’s sein muss, auch im Watt. Ich faxe Ihnen gleich die Vollmacht, einen Plan von der Insel und die Unterlagen des Katasteramtes zu. Die infrage kommenden Grundstücke sind dick umrahmt. Sie haben freie Hand bis 1.000 Mark pro Quadratmeter. Für jede Mark, die Sie den Verkäufer herunterhandeln, erhalten Sie 20 Prozent Provision. Alles klar?«
»Die Unterbringungskosten …«
»… übernehme ich. Spesen natürlich auch. Im Hotel Achterdiek ist ab morgen ein Zimmer für Sie reserviert.«
»Morgen? In zwei Tagen ist Weihnachten!«
»Weiß ich. Haben Sie etwa familiäre Verpflichtungen?«
»Familiäre nicht gerade, aber persönliche. Ich meine …«
»Nehmen Sie sich ein Doppelzimmer. Das dürfte kein Problem sein. Über Weihnachten ist nicht besonders viel los auf der Insel.«