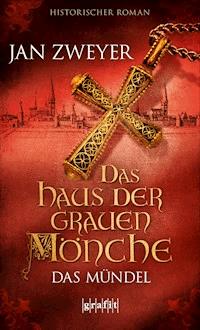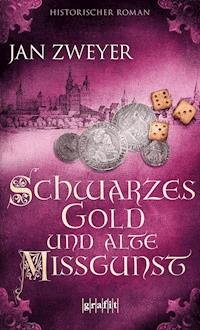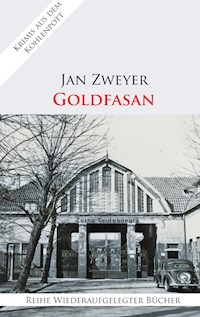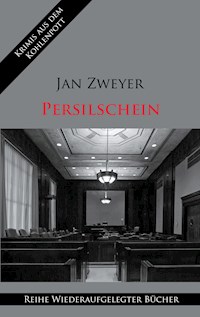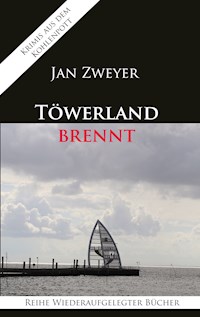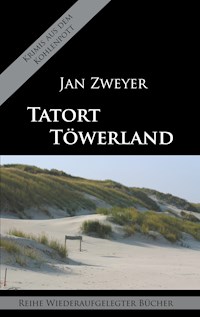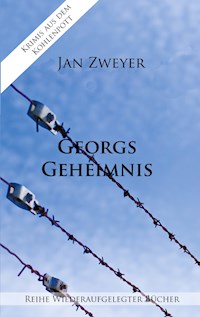7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rechtsanwalt Rainer Esch mag es nicht glauben: Selbst mit den Lebensversicherungen Todkranker werden noch Geschäfte gemacht. Als der Mandant, der ihm davon erzählt hat, sehr überraschend stirbt, stößt Rainer auf noch mehr unglaubliche Vorgänge im Gesundheitswesen und auf sehr kreative Apotheker...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne.
Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie Franzosenliebchen, Goldfasan und Persilschein das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte die von Linden-Saga, eine Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet (bisher fünf Bände, zuletzt: Schwarzes Gold und Alte Missgunst, Ein Königreich von kurzer Dauer, beide Grafit-Verlag).
In der Reihe Wiederaufgelegter Bücher werden verlagsseitig vergriffen Texte von Jan Zweyer als Buch und eBook neu veröffentlicht. Der Originaltext unterliegt jetzt den neue Rechtschreibregeln. Inhaltliche Veränderungen wurden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.
Natürlich sind auch in diesem Buch alle Namen und Ereignisse frei erfunden. Deshalb wäre jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen völlig zufällig. Das gilt insbesondere für die Namen der beschriebenen Apotheken und ihrer Inhaber.
Sollte trotzdem wider Erwarten einer der rund 21.500 Apotheker der Bundesrepublik Deutschland meinen, sich oder seine Apotheke an der einen oder anderen Stelle wiederzuerkennen, rate ich ihm freundlich zu einer Überprüfung seiner Geschäftspraktiken.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Epilog
Prolog
Der Mann sah nicht so aus, als ob er nur noch weniger als ein Jahr zu leben hätte: knapp dreißig Jahre alt, schlank und hoch gewachsen, leicht gebräunter Teint, volles dunkelbraunes Haar.
Horst Mühlenkamp saß seit fünf Minuten vor dem Schreibtisch Rainer Eschs und hatte mit seinem Anliegen tiefe Bestürzung bei dem Anwalt ausgelöst.
Nervös zog Esch an seiner Zigarette. »Es gibt also keinen Zweifel, dass Sie …« Ihm fehlten die Worte.
Sein neuer Mandant schüttelte den Kopf. Dabei zeigte er ein resignierendes Lächeln. »Ich verstehe Ihre Reaktion. Aber Sie brauchen mich nicht mit Samthandschuhen anzufassen. Ich wurde eine Woche in einer Spezialklinik untersucht. Meine Ärztin hat mir vor einigen Tagen den Befund mitgeteilt. Leukämie im Endstadium. Da ist nichts mehr zu machen. Wenn ich Glück habe, kann ich mit meinen Freunden noch Weihnachten verbringen.«
Der Anwalt schluckte. Vor drei Wochen hatte er mit Elke und anderen Freunden Sylvester gefeiert. Kein Jahr mehr bis zum nächsten Heiligabend! Er versuchte, sich in die Gefühlswelt seines Gegenübers zu versetzen. Wie würde er selbst reagieren? Zunächst vermutlich mit seinem Schicksal hadern. Und dann? Könnte er sich mit einer solchen Diagnose abfinden? Unheilbarer Blutkrebs. Ein Todesurteil. Nein, er hatte nicht die geringste Ahnung, wie Horst Mühlenkamp empfand. Und wenn er ehrlich war, wollte er den Gedanken an seinen eigenen Tod lieber unterdrücken. Eine Überlegung drängte sich ihm auf. Konnte Rauchen eigentlich auch Leukämie auslösen? Plötzlich schmeckte ihm die Reval nicht mehr. Esch zerdrückte die Königskippe im Aschenbecher und erinnerte sich an seinen in der Sylvesternacht gefassten Vorsatz, die Qualmerei sein zu lassen. Bis zum Neujahrsabend hatte er tatsächlich keine Zigarette angerührt. Das lag zum einen an seinem Kater, zum anderen hatten Elke und er bis spätnachmittags im Bett gelegen. Aber dann hatte doch wieder das Verlangen nach Nikotin gesiegt. Kleine persönliche Niederlagen. Same procedure as every year.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll … Es tut mir Leid«, presste Rainer zwischen den Zähnen hervor und vermied es, seinem Mandanten in die Augen zu schauen.
Mühlenkamp winkte ab. »Danke. Aber ich habe mich schon fast damit abgefunden. Mir geht es jetzt darum, die mir verbleibende Zeit so gut wie möglich zu nutzen.«
Das verstand Rainer. »Was kann ich denn genau für Sie tun?«
Mühlenkamp griff zu einem Aktendeckel, den er vor sich deponiert hatte, und holte ein Schriftstück heraus.
»Wie ich Ihnen eben schon sagte, bin ich allein stehend. Und: Ich brauche Geld, um das zu tun, was ich schon immer machen wollte.«
Esch vermutete, dass Mühlenkamp über Immobilien oder Aktien verfügte, die er jetzt so effektiv wie möglich versilbern wollte. »Nachvollziehbar.«
»Ich besitze eine Lebensversicherung über fünfzigtausend Euro. Begünstigte war meine Mutter. Sie ist aber vor zwei Jahren verstorben.«
Der Anwalt rekapitulierte, was er über Lebensversicherungen wusste. Damit war er schnell fertig. Da er selbst noch nie über ein ausreichendes und vor allem regelmäßiges Einkommen verfügt hatte, um Prämien bezahlen zu können, bezog er seine Kenntnisse aus dem oberflächlichen Studium diverser Presseorgane. Juristisch war ihm diese Thematik ebenso fremd wie ein Anhänger von Borussia Dortmund. Rainer meinte, sich zu erinnern, dass eine solche Versicherung nach einigen Jahren kündbar war. Wenn er das richtig im Kopf hatte, führte ein solcher Schritt allerdings meistens zu erheblichen Verlusten.
»Vor einiger Zeit habe ich das Kleingedruckte meiner Police genauer gelesen und festgestellt, dass es jederzeit die Möglichkeit gibt, den Begünstigten zu wechseln«, setzte Mühlenkamp seine Erläuterung fort.
Rainer ging in Gedanken seine nicht sehr umfangreiche juristische Bibliothek durch. Wo, zum Teufel, konnte er mehr darüber erfahren? Er versuchte, ein wissendes, leicht gelangweiltes Gesicht zu machen. »Hm.«
»Haben Sie schon mal etwas von der FürLeben GmbH gehört?«
»Nein.« Esch erinnerte der Firmenname an einen Kampfruf katholischer Bischöfe gegen Abtreibung und vorehelichen Geschlechtsverkehr.
»Wenn ich meine Lebensversicherung kündigen würde, bekäme ich, wenn ich Glück habe, nur meine eingezahlten Beiträge heraus.«
»Klar.«
»Sobald ich sterbe, ist allerdings die volle Versicherungssumme fällig. Nur habe ich dann nichts mehr davon.«
»Aber Ihre Erben«, warf Rainer ein. »Oder Sie machen ein Testament. Damit können Sie das Erbe für Angehörige ersten Grades auf das Pflichtteil reduzieren.« Das war gut. So musste ein Anwalt agieren.
»Das wäre mein Bruder.«
»Der nicht. Nur Kinder oder Eltern erhalten ein Pflichtteil«, korrigierte Rainer.
»Egal. Ich habe mit ihm schon über meine Absichten gesprochen. Er stimmt mir völlig zu. FürLeben bietet Folgendes an: Die Gesellschaft vermittelt todkranke Menschen, die eine Lebensversicherung abgeschlossen haben und keine Erben absichern müssen oder wollen, an Investoren. Es wird ein notarieller Vertrag geschlossen und die Investoren lassen sich als Begünstigte in die Versicherungspolice eintragen. Im Gegenzug überweisen die Geldgeber bis zu fünfundsiebzig Prozent der Versicherungssumme an FürLeben, die eine Provision von fünf Prozent abzieht und mit dem Rest den Kranken befriedigt.«
Hektisch griff Rainer zu einer weiteren Zigarette und steckte sie an. »Verstehe ich Sie richtig: Sie verkaufen quasi die Option, Begünstigter Ihrer Lebensversicherung zu werden?«
»Genau. Natürlich darf die Lebenserwartung des Versicherten nicht mehr allzu hoch sein, da sich das Investment für die Anleger sonst nicht rechnet.«
»Lebenserwartung … darf nicht … hoch sein…«, echote Rainer völlig konsterniert und verschluckte sich am Rauch.
»Wenn Sie das Modell durchdenken, werden Sie feststellen, dass es keinen Grund gibt, so schockiert zu sein. Es ist für viele Todkranke die einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen, und für die Anleger ist es, wenn der Versicherungsnehmer eher als geplant stirbt, ein wirklich gutes Geschäft. Die Rendite ist dann auf jeden Fall höher, als wenn das Kapital zu üblichen Zinsen angelegt worden wäre.«
Mühlenkamp erklärte Rainer das Geschäft mit seinem Tod so, als ob er einen Kleinkredit aufnehmen wollte.
»Sehen Sie es doch von meiner Seite. FürLeben bietet mir fünfundzwanzigtausend Euro, wogegen ich mich sonst mit bestenfalls fünfzehntausend zufrieden geben müsste.«
Der Anwalt gewann nur mühsam seine Fassung wieder. »Und was erwarten Sie von mir?«
»Dieses Vertragsmodell stammt aus England. FürLeben ist erst seit kurzem auf dem deutschen Markt. Ich möchte sichergehen, dass die Verträge nicht sittenwidrig sind. Ich möchte keinen Prozess führen müssen, dessen Ausgang ich vermutlich nicht mehr erleben werde. Dann würde ich meine Versicherung lieber einfach kündigen.«
»Woher weiß der Investor, dass er nicht betrogen wird?«
»Der Kranke muss natürlich seine Lebenserwartung durch ärztliche Gutachten belegen. Von der restlichen Lebenszeit hängt die prozentuale Höhe der Zahlung ab. Bei mir würde der Höchstsatz gezahlt. Fünfundsiebzig Prozent. Mindestens einmal im Jahr müssen alle ärztlichen Gutachten, Untersuchungsergebnisse et cetera an den Anleger geschickt werden, damit der weiß, wann er mit der Rendite rechnen kann.«
Rainer klappte der Unterkiefer herunter. »Das heißt, der Anleger kennt Sie und wartet auf Ihren Tod?«
»So ist es. Wie auf die jährliche Wohnungsbauprämie.«
Jetzt war Esch völlig bedient. »Entschuldigen Sie mich einen Moment«, sagte er und stürmte aus seinem Büro in das Vorzimmer. Dort holte er zur Überraschung der Rechtsanwaltsgehilfin der Anwaltssozietät Schlüter und Esch die Brandyflasche aus dem Schrank hervor, die normalerweise nur bei Abschluss wirklich lukrativer Mandate zum Einsatz kam und deshalb noch fast voll war. Rainer goss sich mit zitternder Hand ein halbes Glas ein und kippte es mit einem Schluck.
»Rückfall in frühere Zeiten?«, spottete Martina Spremberg.
»Halt die Klappe«, knurrte Rainer und kehrte, die Alkoholfahne ignorierend, zu seinem Mandanten zurück.
»Übernehmen Sie die Sache?«, fragte Mühlenkamp, als Rainer wieder hinter seinem Schreibtisch saß.
»Natürlich. Haben Sie denn irgendwelche Unterlagen, aus denen ich ersehen kann …«
»Bitte.« Mühlenkamp reichte dem Anwalt das Schriftstück, das er bis jetzt in der Hand gehalten hatte. »Das ist eine Kopie des Mustervertrages. Natürlich habe ich noch nicht unterschrieben. Wie Sie sehen werden, steht auch weder mein Name noch der des Investors in den Papieren.«
Esch blätterte den Vertragsentwurf flüchtig durch. »Ich werde das prüfen.« Er schob eine Vollmacht über den Tisch. »Bitte füllen Sie das hier aus.«
Und ganz im Gegensatz zu seinen üblichen Gepflogenheiten verzichtete er auf einen Vorschuss.
1
Theo Bauer genoss auf seinem Balkon die spätnachmittägliche Sommersonne. Zugegeben, der Ausblick von hier oben war nicht gerade umwerfend. Aber jetzt, drei Stunden nach Feierabend, war der asphaltierte Hof, auf dem die Angestellten und Kunden der Heiligen-Apotheke ihre Fahrzeuge abstellten, leer. Kein aufheulender Motor und Abgasgestank störten ihn mehr an diesem frühen Samstagabend in seiner grünen Oase, wie er den gut zehn Quadratmeter großen Balkon bezeichnete. Das, was dem Parkplatz, auf den er herabblickte, an Pflanzen fehlte, wucherte in seinem Refugium umso heftiger. Sah man von dem Klappstuhl, der schmalen Liege, dem Tischchen und dem dreibeinigen Rundgrill ab, stand auf fast jedem freien Zentimeter ein Kübel oder ein Blumentopf. An den Wänden waren Kletterhilfen befestigt, an denen wilder Wein und Rosen der Sonne entgegenrankten. Wenn sich Theo Bauer auf die Liege zwischen seine Pflanzen legte, konnte er beinahe vergessen, dass er auf einem Balkon im ersten Stock eines Geschäftshauses im Recklinghäuser Stadtteil Suderwich ruhte.
Er war vierundsechzig Jahre alt, Rentner und lebte schon seit knapp vier Jahren in der Zweizimmerwohnung über der Heiligen-Apotheke. Kurz nach dem Tod seiner Frau im Frühjahr 1996 war er hier eingezogen. Seine alte Wohnung in der Innenstadt war für ihn allein zu groß geworden. Die beiden Kinder waren schon lange aus dem Haus und gingen ihre eigenen Wege. Deshalb hatte er das Angebot des Hausbesitzers und Apothekers Klaus Lehmann gern angenommen. Er musste keine Miete bezahlen. Als Gegenleistung spielte er den Hausmeister und führte kleinere Reparaturen durch, sorgte im Winter dafür, dass die Verkehrsflächen schnee- und eisfrei blieben, pflegte die Blumen in den großen Waschbetoncontainern vor dem Eingang und half manchmal mit, größere Lieferungen von Fruchtsäften und andere Waren in die Lagerräume im Keller zu tragen.
Der Hauptgrund aber, warum er hier mietfrei wohnen durfte, war, dass sich jemand nachts und an den Wochenenden im Haus aufhalten sollte. Früher wohnten die Lehmanns in der anderen Wohnung, die sich auf derselben Etage befand. Bauers Zimmer hatten damals als Büroräume gedient. Dann aber bezog das Apothekerehepaar einen Neubau in Datteln und es wurde mehr Platz für das Büro und zusätzliche Lagerkapazitäten benötigt. Kurzerhand wurden die alten Büroräume umfunktioniert und die frühere Wohnung diente nun geschäftlichen Zwecken.
Für Theo Bauer war das ein wirklicher Glücksfall. Er kam mit seiner Knappschaftsrente mehr als gut aus und konnte nun sogar einen kleinen Sparvertrag bedienen, den er für seine Enkelkinder abgeschlossen hatte. Er hatte keinen Grund, unzufrieden zu sein.
Der Rentner hörte ein Geräusch vom Garagenhof. Er erhob sich ächzend von der Liege, beugte sich über das Geländer und sah nach unten. Er konnte nichts Ungewöhnliches entdecken. Er wollte sich gerade wieder hinlegen, als er erneut etwas wahrnahm. Ein Scharren, dann ein dumpfes Klacken, so als ob vorsichtig eine Tür zugezogen wurde. Die Kellertür, dachte er. Er machte sich noch länger. Zu sehen war immer noch nichts. Doch, da. Zwischen den Büschen des Nachbargrundstücks, etwa fünfzig Meter von ihm entfernt, registrierte er eine Bewegung. Und da war auch wieder ein Geräusch, diesmal etwas lauter. Dann erkannte er den Verursacher. Eines der Nachbarkinder schlug mit einem Messer Äste ab und riskierte damit vermutlich erheblichen Ärger mit seinen Eltern. Nicht sein Problem.
Das Telefon schellte. Am Apparat war Kirsten, Bauers Tochter, die in der Nähe von Dülmen wohnte. Kirsten feierte morgen ihren dreißigsten Geburtstag.
»Willst du es dir nicht noch überlegen?«, fragte sie.
»Wenn du den nächsten Bus zum Hauptbahnhof nimmst, kannst du den Zug noch erreichen. Stefan würde dich in Dülmen am Bahnhof abholen.«
Kirsten hatte ihn eingeladen, das Wochenende mit ihnen gemeinsam zu verbringen. Er hatte erst zugesagt und seine Abwesenheit Lehmanns schon angekündigt, dann aber die Einladung seiner Tochter doch wieder abgelehnt. Natürlich erwarteten seine Vermieter nicht von ihm, dass er sich ständig im Haus aufhielt. Sein Sinneswandel hatte andere Gründe. Theo Bauer kannte den Rummel, den seine Tochter und ihr Mann bei Geburtstagsfeiern veranstalteten. Fünfzig Gäste und mehr, die bis in die frühen Morgenstunden lautstark feierten, waren der Normalfall. Und für solche Feste mit Musik, Tanz und Alkohol fühlte er sich zu alt. Da zog er es vor, den Sommerabend auf seinem Balkon zu verbringen, leise seine alten Schlager zu hören und das eine oder andere Bierchen zu zwitschern.
»Nein, feiert lieber ohne mich. Außerdem habe ich bereits den Grill angezündet«, log er. »Viel Spaß.«
»Wie du meinst.« Kirsten war nicht wirklich enttäuscht. »Was ist mit nächstem Freitag? Kommst du?«
»Vielleicht.«
Als sie ihr Gespräch beendet hatten, warf er einen Blick in das Fernsehprogramm. Trotz der dreißig Kanäle wurde nichts ins Kabelnetz eingespeist, was ihn interessierte.
Vielleicht sollte er seine Notlüge von eben in die Tat umsetzen. In seiner Tiefkühltruhe lagerten noch Bratwürstchen, die er in der Mikrowelle auftauen konnte. Zudem war gestern etwas Salat übrig geblieben, Grillkohle befand sich noch im Keller.
Theo Bauer holte die Würstchen aus der Truhe. Bis sie aufgetaut waren, konnte er sich noch einen Moment auf seiner Liege gönnen. Zwei Minuten später war er fest eingeschlafen.
Als er erwachte, dämmerte es bereits. Er sah auf die Uhr. Kurz vor neun. Aber immer noch war die Luft sehr warm. Also blieb es beim Grillen.
Theo Bauer schlüpfte in seine Sandalen und griff zum Wohnungsschlüssel. Der Rentner verzichtete darauf, das Dielenlicht einzuschalten. Er konnte noch genug erkennen. Er stieg die Treppe hinab und ging durch den unteren Flur nach hinten, wo sich der Eingang zum Keller befand. Dort war es merklich finsterer. Deshalb benötigte Bauer einen Moment, um den richtigen Schlüssel zu finden, schenkte sich aber den Weg zurück nach vorn, zum Lichtschalter für die Kellerbeleuchtung. Er hätte den Weg mit verbundenen Augen gehen können.
Als er die Treppe hinunterstieg, schnupperte er. Es roch seltsam. Ein bisschen wie nach faulen Eiern. Und etwas zischte leise. Ein Wasserrohrbruch?
Theo Bauer beschloss, nun doch das Licht anzuschalten, um der Sache nachzugehen. Er ging Richtung Hinterausgang, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Dabei stieß er mit dem Fuß gegen ein Teil, das metallisch klappernd über die Fliesen rutschte. »Verdammt«, fluchte der Rentner und griff zum Schalter. »Können die Mädchen denn nicht …«
Das war das Letzte, was Theo Bauer in seinem Leben sagte. Die Explosion hörte er sowieso nicht mehr.
2
Hauptkommissar Rüdiger Brischinsky von der Kriminalpolizei Recklinghausen haderte mit seinem Schicksal, den Dienstplänen und seinen Vorgesetzten. Seit seiner Scheidung vor einigen Jahren war er nicht mehr im Theater gewesen. Für diesen Samstagabend aber hatte er sich endlich eine Karte für Starlight Express in Bochum besorgt, um sich das Musical anzuschauen, bevor es abgesetzt wurde. Er hatte sich für diesen Anlass sogar ein paar neue Schuhe gegönnt und seinen besten Anzug in die Reinigung gebracht. Um sechs Uhr wollte er losfahren. Um fünf vor klingelte das Telefon.
Und er Idiot musste ja den Hörer abnehmen. Jemand aus dem Präsidium. Zwei Kollegen hatten auf einer Dienstfahrt einen Unfall gehabt. Nichts Ernstes, meinten die Ärzte des Knappschaftskrankenhauses, aber die beiden Beamten mussten über das Wochenende zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Das allein hätte genügt, die Dienstpläne durcheinander zu kegeln. Aber es war Urlaubszeit und die Personaldecke dementsprechend dünn. Und vermutlich waren alle anderen Hauptkommissare schlauer als er gewesen und hatten das Telefon Telefon sein lassen und ihre Piepser im Büro vergessen.
Deshalb saß Brischinsky nun in seinem Ausgehanzug in seinem Büro und schob zähneknirschend Notdienst. Seine Füße mit den neuen Schuhen ruhten auf der einzigen freien Fläche auf seinem Schreibtisch und er blätterte missmutig in der erstbesten Kochzeitschrift, die er an einer Tankstelle erworben hatte. Aber auch die konnte ihn nicht ablenken. Mit jeder Minute verschlechterte sich seine Laune. Sein Dienst würde erst morgen Mittag enden. Das Wochenende war gelaufen.
Kommissar Heiner Baumann, sein Assistent und ohnehin
planmäßig im Einsatz, versuchte, Brischinsky keine Angriffsfläche zu bieten. Baumann war der berechtigten Auffassung, sich nur bedingt als Ventil für die Wutausbrüche von Hauptkommissaren zu eignen.
Brischinskys Telefon klingelte. Es war halb zehn.
»Geh schon ran«, maulte er.
Baumann musste einige Verrenkungen machen, um an den Akten und den Schuhen seines Vorgesetzten vorbei das Telefon erreichen zu können.
»In Ordnung. Wir kommen sofort«, sagte er und legte auf.
»Was ist?«, wollte Brischinsky wissen, machte aber keine Anstalten, seine Körperhaltung zu verändern, obwohl Baumann schon mit der Türklinke in der Hand auf ihn wartete.
»Eine Gasexplosion. In Suderwich.«
»Und? Was haben wir damit zu tun?«
»Ist sonst keiner da«, stellte Heiner Baumann lakonisch fest.
Brischinsky schwenkte seine Beine vom Schreibtisch. Sein Stuhl knirschte unter der Belastung der fast zwei Zentner.
»Gasexplosion«, schnaubte der Hauptkommissar.
»Demnächst helfe ich bei der Verkehrspolizei aus.« Er stand langsam auf. »Na gut. Du fährst.« Er warf seinem Assistenten die Schlüssel für den Passat zu. »Aber vernünftig.«
Baumann schenkte sich eine Entgegnung.
Die Schulstraße war vor und hinter dem Explosionsort weiträumig abgesperrt. Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen schleuderten blaue Blitze in die Nacht. Uniformierte Polizeibeamte hielten die zahlreichen Schaulustigen auf Distanz.
»Kaum kracht es irgendwo, strömt das sensationsgeile Volk auf die Straße«, knurrte Brischinsky, während sie im Schritttempo durch die gaffende Menge fuhren. »Wie im alten Rom. Brot und Spiele. Und am interessantesten ist es, wenn Menschen ums Leben kommen. Daumen runter, Rübe ab. Widerwärtig.«
Baumann stoppte den Wagen nach fünfzig Metern. Weiter konnten sie nicht fahren, ohne in der engen Straße die Arbeit der Rettungstrupps zu behindern.
Helle Scheinwerfer tauchten die Unglücksstelle in ein unwirkliches Licht. Es sah aus wie nach einem Bombeneinschlag. Die vordere Hausfront fehlte fast vollständig, sodass man in das Innere des Gebäudes blicken konnte. Die Apotheke im Erdgeschoss war verwüstet. Brischinsky identifizierte umgestürzte, noch leicht qualmende Regale. Die zerfetzte Verkaufstheke lag halb auf der Straße. Und im hinteren Teil des Ladenlokals klaffte im Boden ein großes Loch. Dagegen erschien der erste Stock seltsam unberührt, wenn man von der fehlenden Fassade absah. Selbst die Aktenordner in dem Büroraum standen, Rücken an Rücken, noch in den Regalen.
Steinstaub hing in der Luft. Der Hauptkommissar spürte ihn zwischen den Zähnen. Seinen Anzug würde er postwendend wieder der Reinigung übergeben müssen. Wenn nur die Schuhe nicht …
»Herr Hauptkommissar?«
Er drehte sich zu dem Feuerwehrmann hin, der ihn angesprochen hatte. »Ja?«
»Hauptbrandmeister Meier.«
Sie gaben sich die Hände.
»Die Explosion hat sich im Keller ereignet. Die Seitenwände und Teile der Rückwand stehen noch. Sonst wäre hier nur noch ein Schuttberg zu sehen. Trotzdem müssen meine Leute extrem vorsichtig sein. Hier vorn«, der Brandexperte zeigte auf die Überreste des Hauses, »scheint alles standfest zu sein. Was man so standfest nennen kann. Hinten sieht es schon anders aus. Wir müssen erst die Decken abstützen und sichern, bevor wir das Gebäude betreten können. Nach der Explosion ist ein Brand ausgebrochen, den meine Leute jedoch schnell unter Kontrolle hatten. Die Gasleitung, die die Straße versorgt, ist gesperrt. Um diese Zeit wird sich sowieso keiner mehr ein Mittagessen zubereiten wollen.«
Zehn Meter entfernt von ihnen waren Beamte damit beschäftigt, Fotoreporter am weiteren Vordringen auf das Gelände zu hindern.
»Personenschäden?«, erkundigte sich der Hauptkommissar.
»Bis jetzt noch nicht. Glücklicherweise. In dem Haus war nur eine Wohnung bewohnt. Da oben, im ersten Stock. Ein Mann namens Theo Bauer ist dort gemeldet. Wir können nicht sagen, ob er sich noch im Gebäude befindet. Seine Räumlichkeiten wurden verhältnismäßig wenig in Mitleidenschaft gezogen. Wenn er sich dort aufgehalten hat, kann er die Explosion überlebt haben. Möglicherweise steht er unter Schock und hat das Gebäude fluchtartig verlassen.«
»Konnte er das denn?«
»Ja. Die Treppe wurde nicht zerstört.«
»Und die Explosionsursache?«
Der Hauptbrandmeister zuckte mit den Schultern.
»Das ist noch zu früh. Wir müssen erst in den Keller hinein.«
»Wie lange brauchen Sie?«
»Etwa eine halbe Stunde. Vielleicht etwas länger.«
Die Männer betraten den Parkplatz hinter der Apotheke.
»Passen Sie auf. Hier liegen überall Steine und Gebäudeteile herum«, warnte der Feuerwehrmann.
Brischinsky nickte. In diesem Moment wurde ein weiterer Scheinwerfer in Betrieb genommen. Für einige Sekunden war der Hauptkommissar geblendet. Er hielt sich eine Hand vor die Augen und ging weiter. Prompt stieß er mit dem rechten Fuß gegen einen Stein und geriet ins Straucheln. Um nicht zu fallen, machte er zwei, drei hektische Ausfallschritte nach vorn, spürte plötzlich einen kurzen, stechenden Schmerz im Außenrist und schrie auf: »Verdammter Mist!«
Der Hauptkommissar hob das Bein und hüpfte einige Meter zurück, bis er sich an einem der Fahrzeuge abstützen konnte. Er besah sich den Schaden. Ein spitzer Gegenstand hatte das Leder seines Schuhs aufgerissen und den Fuß verletzt. Die Wunde blutete.
Zwei Feuerwehrleute griffen Brischinsky unter die Arme und wuchteten ihn ins Fahrzeuginnere. Kurz darauf kam ein Rettungssanitäter.
»Nicht weiter schlimm«, beruhigte der Mann den Hauptkommissar, als er den Schnitt verband. »Zwei, drei Tage tut es beim Gehen etwas weh. Den Schuh allerdings können Sie wegschmeißen. Wann haben Sie Ihre letzte Tetanusimpfung erhalten?«
»Woher soll ich das wissen?«, blaffte Brischinsky los. »Ich …«
Der Sani war die Ruhe selbst. Schlecht gelaunte Hauptkommissare waren das kleinste Problem, mit dem er fertig werden musste. »Machen Sie Ihren Oberarm frei. Ich gebe Ihnen eine Spritze.«
Nach fünf Minuten packte der Sanitäter seine Sachen und Rüdiger Brischinsky war bedient. Er zwängte seinen bandagierten Fuß in den zerstörten Schuh. Vierhundert Euro zum Teufel! Dabei hatte er die handgefertigten italienischen Treter heute zum ersten Mal getragen.
Gern hätte er jetzt eine geraucht. Seit sechs Monaten – oder in Gewichtseinheiten ausgedrückt: seit zehn Kilo rauchte er nicht mehr. Während der ersten drei Wochen seines Nikotinentzuges hatten ihn Baumann und seine Kollegen auf Knien angefleht, sein Laster wieder aufzunehmen. Das hatte sich in den letzten Monaten gegeben. Brischinskys Gemütslage war nun dauerhaft so mies, dass die vor Beginn seiner Zeit als Nichtraucher geradezu als Hochgefühl bezeichnet werden musste.
»Baumann!«, brüllte er erfolglos gegen den Lärm der Aggregate an, die den nötigen Strom für das schwere Räumgerät und die Beleuchtung lieferten. »Baumann!«
Sein Assistent blieb verschwunden. Vorsichtig versuchte er, seinen Fuß zu belasten. Es ging halbwegs. Er humpelte zu dem zerstörten Haus zurück. Dieses Mal achtete er aber darauf, wohin er trat.
Mittlerweile hatten die Rettungskräfte das Gebäude so weit gesichert, dass ein Betreten der Ruine ohne größere Gefahr möglich war. Die Männer begannen, das Kellergeschoss zu durchsuchen. Nach einigen Minuten kehrten zwei Feuerwehrleute ins Freie zurück, um kurz darauf mit einer Trage wieder im Inneren zu verschwinden.
Brischinsky wandte sich an Hauptbrandmeister Meier, der einige Meter von ihm entfernt in sein Funkgerät sprach.
»Was ist los?«
»Wir haben einen Toten gefunden. Beziehungsweise das, was von ihm noch übrig ist.«
»Den Bewohner?«
»Möglich.«
Heiner Baumann bog um die Hausecke.
»Wo hast du gesteckt?«, wollte der Hauptkommissar wissen.
Baumann hob entschuldigend beide Hände. »Bei der Feuerwehr in Recklinghausen wurde heute Abend um fünf vor zehn ein Anruf aufgezeichnet. Der Anrufer gab an, vor dem Gebäude der Heiligen-Apotheke in der Schulstraße den Geruch von ausströmendem Gas wahrzunehmen.«
»Sag das noch einmal!«
»Um fünf …«
Brischinsky winkte ab. »Quatsch. Das war nicht wörtlich gemeint. Wann war die Explosion?«
Hauptbrandmeister Meier schaltete sich ein: »Gegen neun. Wir wurden von Anwohnern um drei Minuten nach verständigt.«
Brischinsky sah Baumann an. Der nickte verstehend. »Wenn jemand behauptet, dass Gas aus einem Haus austritt, das eine Stunde zuvor in die Luft geflogen ist, dann ist er entweder ein Spinner …«
»… oder es handelt sich um eine Warnung, die dummerweise zu spät gekommen ist«, ergänzte der Hauptkommissar.
»Dann sind wir ja wirklich zuständig«, stellte Baumann fest.
3
»Das darf doch wohl alles nicht wahr sein.« Frustriert schmiss Rainer das Handbuch auf den Schreibtisch.
»Von wegen Plug and Play. Dass ich nicht lache! Nichts funktioniert. Gar nichts. Ich werde die Telekom auf Schadensersatz verklagen. Uns geht wertvolle Arbeitszeit mit diesem Mist verloren. Ich …«
»Jetzt bleib ruhig. Ich kriege das schon hin. Außerdem ist Samstagabend. Ich kann mich nicht erinnern, dass ihr da jemals Mandanten hattet.« Cengiz Kaya versuchte, die Netzwerkkarte des Computers zur Zusammenarbeit mit der Telefonanlage der Kanzlei Schlüter und Esch zu bewegen.
»Na und? Aber wir könnten welche haben. Wir könnten. Und darauf kommt es an. Telekom!« Rainer spukte das Wort förmlich aus. »Kein Wunder, dass deren Aktien auf Talfahrt sind.«
Cengiz schmunzelte. Er wusste, was er von diesen leicht cholerischen Anfällen seines Freundes zu halten hatte. Nach fünf Minuten waren sie wieder Geschichte.
Rainer und Elke Schlüter, Rainers Lebensgefährtin und Mitinhaberin der gemeinsamen Anwaltssozietät, hatten beschlossen, nicht nur die drei Computer zu vernetzen, sondern auch die Telefonanlage auf ISDN umzustellen und die Rechner an das Internet anzuschließen. Nach erfolgter Umstellung war Rainer sofort in den nur wenige Meter entfernten Verkaufsladen der Telekom gelaufen und hatte dort die entsprechende Hardware gekauft. Eine Stunde später stand der Anwalt wieder in seinem Büro, war um zweihundert Euro ärmer und kurz darauf um die Erfahrung reicher, dass zwischen Werbung – Einfach nur anschließen – und der Realität – Fehlermeldung: Capi-Treiber nicht gefunden – häufig eine sehr große Lücke klafft.
Deshalb bastelte sein Freund nun schon seit etwa zwei Stunden an den vorsintflutlichen Computern der Kanzlei herum. Rainer kannte Cengiz schon seit Jahren. Der Türke war ursprünglich Bergmann auf der Recklinghäuser Zeche Eiserner Kanzler gewesen, bis er sich vor zwei Jahren mithilfe eines Förderprogramms seines ehemaligen Arbeitgebers mit einem Computerfachgeschäft selbstständig gemacht hatte. Rainer war damals trotz seines angeborenen Optimismus davon überzeugt gewesen, dass Cengiz nach wenigen Monaten aufgeben und entnervt das Handtuch werfen würde, musste sich aber vom Gegenteil überzeugen lassen. Sein Freund hatte seinen Laden vergrößert, in den fußläufigen Teil der Recklinghäuser Innenstadt in die Nähe des Alten Marktes verlegt und beschäftigte mittlerweile drei Angestellte.
»Für was braucht eigentlich ein geistig gesunder Mensch das Internet?«, fragte Rainer, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten, und blätterte wieder in den Unterlagen. »Cengiz, was ist ein TAE-Stecker?«
»Das Ding am Telefonkabel, das du in die Dose steckst.«
»Aha. Und eine NTBA?«
»Rainer, du nervst. Reich mir den Kreuzschlitzschraubenzieher. Ich bin gleich fertig.«
»Dann läuft alles?«
»Hardwareseitig. Ich muss aber die Software noch installieren.«
Esch steckte sich eine Reval an. »Ich habe Hunger. Wann bist du fertig?«
Nach weiteren zwei Stunden betraten Cengiz und Rainer Elkes Büro. Sie hatte es sich mit Kaffee und einem Buch auf dem Besprechungssofa bequem gemacht.
Cengiz ließ sich in den einzigen Sessel fallen. »Erledigt. Eure Anlage läuft.«
»Auch das Netzwerk?«, erkundigte sich Elke.
»Klar. Internet funktioniert, elektronische Briefchen schreiben klappt, kurz: Ihr seid drin.«
»Toll. Vielen Dank.«
»Nur …«
»Was?«
Cengiz grinste sein breitestes Grinsen und zeigte auf Rainer. »Ihm würde ich einen Arbeitsplatz weit weg von einer Computertastatur geben. Sonst werde ich in eurer Praxis Dauergast.«
Bemerkungen dieser Art überhörte Rainer aus Prinzip. »Gehen wir nun essen? Es ist gleich zehn.«
»Wer zahlt?«, fragte sein Freund.
»Ich«, meldete sich Rainer ohne Zögern.
»Du?«, wunderten sich Cengiz und Elke wie aus einem Mund.
Das Neo-Kyma war noch gut gefüllt, als die drei das griechische Lokal in der Herner Innenstadt betraten. Rainer hatte natürlich keinen Tisch reserviert und so machten sie erst ziemlich lange Gesichter, weil nichts frei war. Aber Vasili, der Wirt, verhandelte kurz mit anderen Gästen, schob zwei Tische nebeneinander, platzierte einen Einzelsitzenden um und schaffte so eine Sitzgelegenheit für die drei direkt neben der Theke. Die mit sanftem Zwang Umgesiedelten erhielten einen Ouzo als Entschädigung und die Angelegenheit war kurz darauf vergessen.
Als sie fertig gegessen hatten, war es schon nach zwölf. Die meisten Gäste waren längst gegangen. Die Busukiklänge von der Konserve waren verstummt und Vasili und sein Koch unterhielten die noch Anwesenden mit dem Spiel ihrer Gitarren.
Rainer schlürfte seinen Brandy. »Gestern war übrigens Horst Mühlenkamp bei mir.«
»Muss ich den kennen?«, fragte Cengiz.
»Du nicht, aber Elke.«
Die Angesprochene machte ein erstauntes Gesicht.
»Ich?«
»Ja. Einer unserer Mandanten.«
»Von dir oder von mir?«
»Von mir. Ich habe dir von ihm erzählt. Er war im Januar zweimal bei uns. Der Leukämiekranke, der seine Lebensversicherung verkaufen wollte und nur noch etwa ein Jahr zu leben hatte.«
»Ich erinnere mich. Und?«
»Er wollte eigentlich nichts Besonderes. Der Verkauf seiner Police ist über einen Treuhänder abgewickelt worden, so wie ich es ihm geraten hatte. Er hat eine Weltreise gemacht und einen kleinen Teil des Geldes in ziemlich waghalsigen Aktienoptionsscheinen investiert. Spielgeld, nannte er das. Als er von seiner Reise zurückkam, hatte sich der Wert der Optionsscheine vervielfacht. Er verfügt jetzt über ein fast doppelt so hohes Vermögen wie vor seiner Reise.«
»Und?«
»Ich habe ihm für die damalige Beratung nur das Mindesthonorar abgeknöpft. Er tat mir Leid. Und als über Mühlenkamp nun dieser unverhoffte Geldsegen niedergegangen ist, fiel ihm sein damaliger Gönner wieder ein.« Rainer tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Brust. »Ich. Er hat mein Honorar verdoppelt. In bar.«
Elke nickte. »Deshalb deine Einladung. Ich habe mich schon gewundert, woher du die Knete hast. Seit einer Woche bist du doch notorisch klamm.«
Ihr Freund winkte ab. »Das Schönste kommt aber noch. Mühlenkamp muss natürlich wegen seiner Krankheit regelmäßig zum Arzt, um sich untersuchen zu lassen. Dazu ist er vertraglich verpflichtet.«
»Verstehe ich nicht«, warf Cengiz ein. »Wieso verpflichtet? Der muss doch auch so zum Doc, oder?«
»Erkläre ich nachher. Das jüngste Untersuchungsergebnis liegt mittlerweile vor. Die neuen Medikamente, die man ihm verschrieben hat, haben geholfen. Seine Blutwerte sind deutlich besser geworden. Es sieht so aus, als ob er den Krebs besiegen kann.«
Elke fing an zu lachen. »Er wird wieder gesund?«
»Wahrscheinlich.«
»Und die Investoren, die auf seinen baldigen Tod gesetzt haben, gucken in die Röhre?«
»So ist es. Stellt euch deren Gesichter vor.« Jetzt lachte auch Rainer.
Cengiz schaute etwas erstaunt von einem zum anderen.
»Wie viel hat Mühlenkamp denn nachgezahlt?«, wollte Elke wissen.
»Dreihundert.«
Elke drehte sich um und rief: »Vasili, bringst du uns bitte drei Gläser Sekt?« Und dann sagte sie: »Lasst uns auf ein langes Leben Horst Mühlenkamps anstoßen. Die Investoren müssen sich noch etwas gedulden. Wenn’s nach mir geht, noch hundert Jahre.«
4
Brischinsky malträtierte den Automaten im Flur der ersten Etage des Polizeipräsidiums. Nicht nur Baumanns Kaffeemaschine hatte den Geist aufgegeben, jetzt schien auch dieser altersschwache Apparat das Zeitliche zu segnen. Ungehalten schlug der Hauptkommissar mehrmals mit der flachen Hand gegen die Seitenwand. Plötzlich fing es im Inneren der Maschine an zu rumoren und tröpfelnd lief Kaffee in Brischinskys Plastikbecher. Als dieser halb gefüllt war, gab der Automat ein Geräusch von sich, das entfernt an einen Seufzer erinnerte, und dann war Ruhe. Kein Laut mehr. Und kein Kaffee.
»Verdammter Mist!«, schimpfte Brischinsky und begutachtete das Ergebnis seiner bisherigen Bemühungen. Das Zeug im Becher war tiefschwarz und roch etwas seltsam. Vorsichtig probierte er einen Schluck.
»Brr.« Er schüttelte sich. Das Gesöff war zwar stark, schmeckte aber wie ausgekochte Strümpfe.
Er sah sich um. Kein Kollege auf dem Flur. Die Plörre landete im Topf der alten Yuccapalme, die schon seit Menschengedenken ein eher tristes Dasein neben dem Kaffeeautomaten fristete. Brischinskys schlechtes Gewissen hielt sich in Grenzen. Kaffeesatz, hatte er gelesen, sei ein guter Dünger. Warum dann nicht auch Kaffee?
Auf dem Rückweg zu seinem Arbeitsplatz kam er an einer offen stehenden Tür vorbei. Das Büro der Kollegen Pauly und Kossler, der eine im Krankenhaus, der andere im Sommerurlaub. Und gut sichtbar, fast zum Greifen nah, befand sich deren nagelneue Kaffeemaschine. Brischinsky zögerte keinen Moment. Sonntagmorgen und kein Kaffee. Dieser Zustand musste geändert werden.
Baumann sah erstaunt auf, als sein Vorgesetzter mit der Kaffeemaschine unterm Arm ihr Büro betrat. »Woher hast du das Ding?«
»Kurzzeitig ausgeliehen.«
»Von wem?«
»Das Gerät stand in Paulys Büro und fühlte sich einsam.«
»Das ist doch nur zwei Türen weiter. Warum kochst du den Kaffee nicht dort?«
»Willst du ständig mit der Kanne zwischen den Büros pendeln?«
»Wieso ich?«, fragte Baumann, bekam aber keine Antwort.
Brischinsky stellte sein Beutestück auf dem Schreibtisch ab und sah sich suchend nach einer freien Steckdose um. Er fand keine. Kurz entschlossen riss er den nächsten Stecker heraus und versorgte die Maschine mit Strom. »So.« Er drückte Baumann die Kanne in die Hand. »Hol du bitte das Wasser. Ich fülle den Kaffee ein.«
Der Kommissar schüttelte energisch den Kopf. »Nee. Ich trinke Tee, wie du siehst. Du willst doch das Zeug.« Er stellte die Kanne wieder hin. »Dann mach ihn dir auch selbst.«
Brischinsky zeigte auf den Pantoffel, der seinen verletzten Fuß zierte. »Ich bin verwundet.«
»Aber gerade konntest du …«
»Deshalb tut mir auch jetzt alles weh. Wenn du dann so freundlich wärst …« Er schob die Kanne wieder zurück zu Baumann. Murrend machte sich der auf den Weg.
Zehn Minuten später lehnte sich Brischinsky in seinem Stuhl zurück, vor sich einen Pott dampfenden Kaffee und eines der Sonntagsblättchen. Der Hauptkommissar gähnte herzhaft. Er verspürte den schwer zu bekämpfenden Drang, eine Zigarette zu rauchen.
»Gibt es schon etwas Neues von der Spurensicherung?«, fragte er Baumann.
»Ja. Der Verdacht einer Gasexplosion hat sich bestätigt. An der Gasleitung im Keller wurde manipuliert. Der Prüfstutzen am Zähleranschluss ist abgeschraubt worden.«
»Wozu dient so ein Teil?«
»Bin ich Installateur? Steht hier so.«
»Aha. Und womit macht man das? Mit Spezialwerkzeug?«
»Würdest du einen Maulschlüssel oder eine Pumpenzange als Spezialwerkzeug bezeichnen?«
»Nee. Eigentlich nicht.«
Baumanns Telefon klingelte. Als er das Gespräch beendet hatte, sagte er: »Das war die Einsatzzentrale der Feuerwehr. Der Anruf gestern Abend wurde von einer Telefonzelle am Hauptbahnhof geführt. Wir bekommen den Mitschnitt im Laufe des Tages.«
»Hm. Und der Tote?«
»Ich habe telefonisch bei den Hauseigentümern nachgefragt. Das Haus gehört den Apothekern. Eine Familie Lehmann aus Datteln. Der Mieter, dieser Theo Bauer, wollte an diesem Wochenende zu seiner Tochter nach Dülmen fahren.«
»Und?«
»Nichts ›und‹. Lehmanns wussten nicht, wie die Tochter heißt.«
»Wieso?«
»Sie ist verheiratet«, erklärte Baumann.
»Verstehe. Und sonstige Verwandte?«
»Soweit wir wissen, Fehlanzeige. Ich habe alle Bauer, die ich im Recklinghäuser Telefonbuch gefunden habe, angerufen. Ohne Ergebnis.«
»Was sagt die Gerichtsmedizin?«
»Im Moment noch nichts.«
Brischinsky gab sich einen Ruck. »Dann fahren wir zur Schulstraße. Wenn die Spurensicherung in das Gebäude darf, gilt das ja wohl auch für uns. Wir sehen uns die Wohnung von Bauer an. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis auf den Nachnamen der Tochter.«
»Sofort?«
»Wann sonst?«, fragte Brischinsky zurück.
»Was ist mit deiner Verletzung?«
»Schon wieder besser.«
»Und dein Kaffee?«
»Kann warten.«
Baumann verstand die Welt nicht mehr. Kopfschüttelnd folgte er seinem Chef auf den Flur.
Die vollständige Sperrung der Straße war mittlerweile aufgehoben worden. Nur unmittelbar vor dem halb zerstörten Gebäude blockierte ein Absperrzaun eine Fahrbahnhälfte. Die Besatzung eines Polizeifahrzeuges sicherte den Unglücksort. Hinter dem Gebäude waren Bauarbeiter damit beschäftigt, Schutt zu räumen, um einem Kranwagen freie Fahrt zu verschaffen.
»Was machen die hier?«, erkundigte sich der Hauptkommissar bei einem seiner uniformierten Kollegen und zeigte auf den Kran.
»Die brauchen das Gerät, um Hydraulikstützen aufzustellen«, antwortete der Beamte. »Der Sachverständige, der die Statik beurteilt, hat gemeint, dass das Haus nicht abgerissen werden muss. Aber die Decken müssen sicherheitshalber abgestützt werden, bis die tragenden Teile wieder aufgemauert sind.«
»Aha. Wo ist der Gutachter?«
»Schon wieder gefahren. Es sei schließlich Sonntag, hat er gemeint.«
»Wie wahr. Können wir in das Gebäude rein?«
Der Beamte warf einen skeptischen Blick auf Brischinskys Pantoffel und zuckte mit den Schultern. »Die Spurensicherung und die Feuerwehr haben das Haus betreten. Der Sachverständige auch. Er hat uns aber angewiesen, keinen hineinzulassen.«
»Das gilt nicht für uns.« Brischinsky humpelte schon in Richtung Hauseingang. Baumann, der dem Gespräch mit wachsendem Unbehagen zugehört hatte, folgte seinem Chef nur zögernd. »Meinst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, uns in dieser baufälligen Ruine umzusehen?«, fragte er.
»Das Haus ist nicht baufällig. Du hast es ja eben gehört.«
»Aber es muss noch abgestützt werden.«
»Reine Vorsichtsmaßnahme.« Der Hauptkommissar hatte den Hauseingang erreicht und bemühte sich, den vielen Glasscherben auszuweichen. Baumann blieb in sicherer Entfernung stehen.
»Was ist?«, fragte Brischinsky erstaunt. »Brauchst du eine schriftliche Einladung?« Er sah seinen Mitarbeiter forschend an. »Du hast doch nicht etwa Muffensausen?« Als Baumann nicht sofort antwortete, spottete Brischinsky: »Tatsächlich. Er hat Muffensausen. Du arbeitest bei der Kriminalpolizei und nicht als Sozialarbeiter bei der Bahnhofsmission. Das bisschen Risiko ist in dein monatliches Gehalt eingerechnet. Und jetzt hör auf, dir unnötige Gedanken zu machen, und beweg endlich deinen Arsch.«
Baumann war anderer Meinung. Nach seiner Auffassung hätte die Gefahrenzulage für das Betreten dieses Baus rund das Doppelte von dem betragen müssen, was er am Monatsende von seinem Dienstherrn auf sein Konto überwiesen bekam. Und deshalb …
»Baumann!« Brischinsky hatte die Treppe nach oben schon halb bewältigt und war von Baumanns Position aus nicht mehr zu sehen. Dafür hörte er seinen Chef umso deutlicher. »Los, komm! Sonst kannst du einen Versetzungsantrag zur Streifenpolizei schreiben.«
Das überzeugte Baumann. Mit schlotternden Knien folgte er seinem Chef.
Die Tür zu Theo Bauers Wohnung war aus der Angel gerissen und lag im Flur. Die Fensterscheiben waren zersprungen. Überall befanden sich Glassplitter und alles war gleichmäßig von einer feinen Staubschicht überzogen. Aber ansonsten sahen die Zimmer noch relativ intakt aus.
Brischinsky hob den Hörer des Telefons ab. »Funktioniert sogar noch«, sagte er, als er das Freischaltsignal wahrnahm.
»Leg wieder auf«, bat ihn sein Assistent. »Wenn hier noch Gasreste sind, genügt ein Funke und …«
»Quatsch. Wir sind im ersten Stock. Gas ist schwerer als Luft und sammelt sich immer unten.«
»Sagst du.«
»Sagt die Physik. Außerdem wäre das Telefon nicht mehr in Betrieb, wenn noch Explosionsgefahr bestehen würde. Dafür hätten die Kollegen von der Feuerwehr schon gesorgt.«
Baumann war nicht sonderlich beruhigt. Er hatte schon zu viele interne Dienstanweisungen gelesen, die zum Ziel hatten, Versäumnisse auszuschließen. Und wenn es bei der Kripo Versäumnisse gab, würde das bei der Berufsfeuerwehr …
»Wie heißt Bauers Tochter mit Vornamen?« Brischinsky störte die düsteren Gedanken seines Mitarbeiters.
Baumann zückte sein Notizbuch. »Kirsten, meint Lehmann. Er war sich aber nicht hundertprozentig sicher.«
Der Hauptkommissar blätterte in einem Telefonverzeichnis. »Unter welchem Buchstaben würdest du die Nummer deiner Tochter notieren?«
»Vermutlich überhaupt nicht. Ich hätte sie im Kopf.«
Sein Vorgesetzter ignorierte die Bemerkung. »Sicher unter K.« Er suchte weiter. »Treffer. Hier ist eine Kirsten.« Er las die Nummer vor. »Ist das die Vorwahl für Dülmen?«
»Keine Ahnung.«
»Egal. Ich versuche es.« Brischinsky griff zu Bauers Telefon, ließ den Hörer aber wieder sinken, als er Baumanns entsetzten Gesichtsausdruck bemerkte. »Jetzt arbeiten wir schon so lange zusammen und ich lerne immer noch überraschende Seiten an dir kennen«, grinste er, schnappte sich sein Handy und tippte die Nummer ein.
Baumann zuckte zusammen. Auch Akkus können Funken auslösen. Aber nichts passierte.
»Brischinsky«, meldete sich der Hauptkommissar.
»Kripo Recklinghausen. Ich möchte Herrn Theo Bauer sprechen. – Nicht da? – Wo könnte ich ihn …? – Zu Hause, verstehe. – Ja?« Er warf Baumann viel sagende Blicke zu. »Wir werden uns selbstverständlich mit Ihnen in Verbindung setzen«, sagte er dann nach einer Weile und unterbrach das Gespräch.
»Was ist?«
»Das war tatsächlich Bauers Tochter, Kirsten Schubert. Er hat seinen geplanten Besuch bei ihr abgesagt, weil er das Wochenende zu Hause verbringen wollte. Sie hat im Radio etwas von einer Explosion in Suderwich gehört, und als sie ihren Vater am Telefon nicht erreichte…Und dann auch noch mein Anruf … Sie macht sich verständlicherweise große Sorgen.«
Baumann nickte. »Dann ist der Tote im Keller vermutlich Bauer.«
»So ist es«, bekräftigte Brischinsky. »Zumindest sollten wir bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgehen.«
5
Ilse Popenka war spät dran. Aus irgendeinem Grund war heute Nacht der Strom ausgefallen und hatte ihren Radiowecker seiner Funktion beraubt. Vermutlich wurden am Netz Reparaturen durchgeführt und sie hatte den Hinweis darauf in der Zeitung übersehen. Dass ihr so etwas passieren musste! Gott sei Dank war sie nur zwanzig Minuten nach ihrer üblichen Aufstehzeit von selbst aufgewacht.
Ilse Popenka trat kräftiger in die Pedale. Es war schon fast halb vier und sie war erst auf der Höhe des Gestüts Bladenhorst. Eigentlich hätte sie schon vor zehn Minuten die Zeitungen in Empfang nehmen sollen. Seit fast zwanzig Jahren trug sie die WAZ aus. Erst in ihrer Heimatstadt Castrop-Rauxel, seit drei Jahren in Herne-Horsthausen. Noch nie war sie zu spät gekommen. Und jetzt das. Und dann noch an einem Montagmorgen! Das musste doch so aussehen, als ob sie das Wochenende durchgefeiert hätte.
Sie entschloss sich, ihre Fahrt durch das Wäldchen neben der stillgelegten Schachtanlage Teutoburgia abzukürzen. Diesen Weg nahm sie sonst nie im Dunkeln. Das war ihr zu unheimlich. Kurz hinter der Autobahnbrücke, die über den Emscherschnellweg führte, bog sie rechts in Richtung der Kleingartenanlage ab, nach weiteren hundert Metern fuhr sie wieder links, kurz darauf erneut rechts. Hier begrenzten dichte Hecken die Grundstücke mit den Datschen, sodass Zweige an ihre Arme schlugen. Der Dynamo ihres Rades summte leise. Der Weg war uneben und der dürftige Schein der Fahrradlampe tanzte auf und ab. Jetzt noch das kurze Stück Waldweg, dann am Förderturm vorbei und sie hatte es geschafft.
Sie nahm die letzte Kurve und atmete auf. Hier war es zwar am dunkelsten, der Weg aber schon deutlich breiter. Plötzlich erfasste der Lichtkegel ein Hindernis. Ihr blieb fast das Herz stehen. Sie trat heftig in die Bremsen mit dem Ergebnis, das sie kaum noch etwas sehen konnte. Für einen Moment hielt sie sich am Fahrrad fest und stierte fassungslos in die Dunkelheit. Dann hob sie das Vorderrad etwas an und drehte es. Der Trafo lieferte wieder Energie und sie konnte erkennen, was da vor ihr im Wald lag. Ilse Popenka stieß einen erstickten Laut aus, ließ ihr Fahrrad fallen und rannte, als wenn es um ihr Leben ginge.
Das erste Haus erreichte sie nach zweihundert Metern, kurz vor der Schadeburgstraße. Es brannte kein Licht. Hastig drückte sie auf die beiden Klingelknöpfe. Im oberen Geschoss wurde es in einem Zimmer hell. Kurz darauf vernahm sie eine Stimme aus der Gegensprechanlage. Sie versuchte, sich verständlich zu machen. »Urrggh.«
Verzweifelt registrierte sie, dass das Licht wieder gelöscht wurde. So war das zwecklos. Ihre kehligen Laute verstand niemand. Sie musste jemandem von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, damit sie sich verständlich machen konnte. Im Wald lag ein Mensch und kämpfte möglicherweise um sein Leben und sie konnte nicht helfen.
Ilse Popenka war seit ihrer Geburt fast völlig stumm. Aber noch nie hatte ihr diese verfluchte Behinderung so im Weg gestanden wie an diesem Morgen.
Sie lief weiter bis zur Ecke und sah sich suchend um. Schräg gegenüber verließ ein Mann ein Haus und überquerte die Straße. Sie rannte zu ihm, gurgelte, ruderte mit den Armen und zeigte in den Wald. Ihr Gegenüber sah sie verständnislos und mit einem leicht belustigten Blick an, den sie nur zu gut kannte. Er hielt sie für etwas übergeschnappt.
Schließlich kam ihr ein Gedanke. Sie machte mit der rechten Hand eine Bewegung, als würde sie sich selbst die Kehle durchschneiden, zeigte mit der linken nach hinten, nahm dann die Hand des Mannes und zerrte ihn in Richtung Wald. Nach drei ihr endlos lang erscheinenden Versuchen kapierte er, dass er es nicht mit einer Verrückten zu tun hatte, und folgte ihr zögernd. Ilse Popenka atmete auf.
»Und?«, fragte Katharina Thalbach von der Bochumer Kriminalpolizei, als der Notarzt den Rettungssanitätern mit einem knappen Nicken signalisierte, dass er seine Untersuchung beendet hatte und sie nicht mehr benötigt wurden.
»So wie es aussieht, kein Fremdverschulden. Wenn Sie das meinen.«
»Sicher?«
»Was erwarten Sie? In der Dämmerung und mitten im Wald? Der Tote muss erst genau untersucht werden. Sie kennen doch die Vorschriften.«
Die Spurensicherer begannen damit, das Gelände abzusperren. Routine, wenn eine Leiche in freier Wildbahn gefunden wurde. Auch wenn es keine unmittelbar sichtbaren Anhaltspunkte für ein Kapitalverbrechen gab. Scheinwerfer erhellten die Szenerie.
»Wären Sie trotzdem so freundlich und würden mir Ihre vorläufige Meinung mitteilen?« Die Beamtin war sauer. Ein Toter kurz vor Beendigung ihrer Nachtschicht. Und dann auch noch an der Stadtgrenze Hernes. Zweihundert Meter weiter und die Recklinghäuser Kollegen wären zuständig gewesen.
Der Arzt blieb stehen. »Nach meiner Meinung Herzschlag. Beim Joggen.« Er hob beide Hände. »Aber bitte, nageln Sie mich später nicht darauf fest.«
»Keine Angst. Wie alt ist der Tote?«
»Um die dreißig. Auf den ersten Blick in guter körperlicher Verfassung. Kein Übergewicht, sportlich. Plötzlicher Herztod erscheint mir am wahrscheinlichsten.«
»Kommt das oft vor?«
»Oft ist relativ. Eine der typischen Todesursachen für Männer in diesem Alter. Stress, zu wenig Bewegung …«
»Bewegungsmangel? Aber der Mann scheint doch regelmäßig zu joggen. Sehen Sie doch mal die Kleidung an.«
Der Arzt lachte leise. »Wissen Sie, wie viele Freunde ich habe, die sich ein sündhaft teures Fahrrad gekauft haben, um sich endlich körperlich zu ertüchtigen? Und nun steht das Gerät nutzlos im Keller.«
Katharina Thalbach verstand, was er meinte. »Wie lange liegt er schon hier?«
»Ich bin wirklich kein Experte. Erkundigen Sie sich beim Gerichtsmediziner, der …«
»… noch nicht hier ist. Deswegen frage ich Sie.«
Der Notarzt seufzte. »Also gut. Nach dem Grad der Leichenstarre zu urteilen … einige Stunden.«
»Geht es nicht etwas genauer?«
»Sicher.«
»Ja, dann bitte.« Katharina Thalbach hasste es, wenn sie Leuten die Würmer einzeln aus der Nase ziehen musste.
»Habe ich mich eben unklar ausgedrückt? Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, sondern Rettungsmediziner. Suchen Sie sich jemanden, der entsprechend ausgebildet ist, und der sagt Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Fast alles«, schränkte der Arzt ein. »Auch den vermutlichen Todeszeitpunkt. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe noch etwas anderes zu tun.« Der Mediziner drehte sich um, steckte sich eine Zigarette an und ließ die Beamtin stehen.
Thalbach widerstand der Versuchung, ihre schlechte Laune weiter an dem Kerl auszulassen. Im Grunde hatte er ja Recht.
Die Polizistin ging zu einem ihrer uniformierten Kollegen und zeigte in den Wagen. »Ist das die Frau, die die Leiche gefunden hat?«
»Ja.«
»Was sagt sie?«
»Nichts. Sie ist stumm.«
»O Gott.« Katharina Thalbach war bestürzt. »Kann sie sich verständigen?«
»Mit Zeichensprache.«
»Die keiner von uns hier versteht«, mutmaßte die Beamtin.
»Wir haben schriftlich kommuniziert«, berichtete der Uniformierte und präsentierte stolz eine Loseblattsammlung.
Thalbach ignorierte die Zettel. »Sie haben ihre Adresse?«
Der Beamte nickte.
»Gut. Bringen Sie sie auf das Präsidium. Wir müssen ihre
Aussage aufnehmen. Und lassen Sie einen Gebärdendolmetscher … Nein, warten Sie. Ich werde mich selbst darum kümmern.« Sie griff zum Handy.
Eine halbe Stunde später informierte sie einer der Spurensicherer über erste Ergebnisse. »Kein Hinweis auf die Identität des Toten. Wir haben seine Prints genommen. Es gibt keine sichtbaren Verletzungen. Es scheint in der Tat so, als ob der Mann gelaufen und plötzlich einfach umgefallen ist. Im Grunde ein schöner Tod, oder?« Der Kollege sah fast glücklich aus.
»Wie man’s nimmt. Sonst noch etwas?«
»Nichts. Ich glaube, Sie können den Aktendeckel schnell schließen.«
So sah es aus. Ein John Doe, die unbekannte Leiche. Was jetzt folgte, war Routine. Das Ergebnis der Obduktion abwarten, die Fingerabdrücke durch den Computer laufen lassen, eingehende Vermisstenmeldungen prüfen und unter Umständen das Bild des Toten in den Lokalausgaben der Tageszeitungen der umliegenden Städte veröffentlichen.
Katharina Thalbach sah auf die Uhr. Noch eine Stunde bis Schichtwechsel.
6
Rüdiger Brischinsky drückte wieder die Rücklauftaste des Kassettenrekorders, dann auf Start.
»In der Schulstraße in Recklinghausen-Suderwich riecht es nach Gas«, hörten sie scheppernd eine Stimme aus dem Lautsprecher. »Direkt vor der Heiligen-Apotheke. Kommen Sie sofort.«
»Ihren Namen bitte.« Das war der Beamte in der Einsatzzentrale, der den Anruf entgegengenommen hatte.
»Kommen Sie, schnell.« Mit einem Knacken wurde die Verbindung unterbrochen.
Der Hauptkommissar lutschte an einem Filzstift und dachte laut. »Gegen neun Uhr war die Explosion. Um zehn dieser Anruf. Wenn es wirklich jemand war, der sich einen dämlichen Scherz erlauben wollte, wie ist das abgelaufen? Was meinst du?«
»Der Spaßvogel hat die Explosion mitbekommen und dann angerufen.«
»Deine Intuition ist wirklich frappierend«, spottete Brischinsky. »Das ist alles, was dir einfällt?«
»Rüdiger, es ist Montagmorgen. Ich habe schlecht und vor allem zu wenig geschlafen. Worauf willst du hinaus?«
»Hat dich deine neue Freundin so gefordert?«
Baumann winkte ab. »Quatsch. Lass mich nicht dumm sterben.«
»Also gut. Spielen wir den Gedanken weiter. Er hat den Explosionsknall oder die Sirene gehört und ist Nachschauen gegangen. Er bleibt vielleicht zwanzig, dreißig Minuten bei den Gaffern und fährt dann zum Hauptbahnhof, um die Feuerwehr anzurufen? Das macht keinen Sinn.«
»Machen solche Telefonate je Sinn?«
»Das ist eine ganz andere Frage. Wenn der Anrufer zur nächsten Telefonzelle gegangen wäre, okay. Aber er ist zum Hauptbahnhof gefahren.«
»Vielleicht hatte er in der Innenstadt zu tun. Oder er ist zufällig in Suderwich am Unglücksort vorbeigekommen, wollte aber eigentlich zum Hauptbahnhof.«
Brischinskys Mimik ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, was er von Baumanns Erklärung hielt. Er ließ das Band noch einmal von vorne laufen.
»Liegt das an der Aufnahme, dass sich der Kerl so kehlig anhört, oder ist der Kassettenrekorder so schlecht?«
Baumann bewegte abwägend seinen Kopf. »Ich vermute Letzteres. Aber wenn der Typ sich zum Beispiel die Backen mit Tampons ausgestopft hat, würde ihn sogar seine eigene Frau am Telefon nur schwer erkennen.«
»Hm.« Der Hauptkommissar hantierte wieder am Rekorder.
»Wie oft willst du dir das eigentlich noch anhören?« Baumann schickte einen genervten Blick an die Zimmerdecke.
Unbeeindruckt spielte Brischinsky das Band erneut ab. »In der Schulstraße in Recklinghausen-Suderwich …« Der Hauptkommissar stoppte die Wiedergabe. »Fällt dir etwas auf?«
Baumann lümmelte sich auf seinem Stuhl und bastelte Figuren aus Büroklammern. »Nee, was?«
Brischinsky sah seinen Assistenten an. »Was hast du eben gesagt? Vielleicht ist er zufällig am Unglücksort vorbeigekommen?«
»In Suderwich, ja.«
»Eben. In Suderwich.«
»Ich verstehe nicht …«
»Der Mann am Telefon spricht von RecklinghausenSuderwich. Kennst du einen Recklinghäuser, der sich so ausdrücken würde?«
Baumann kratzte sich am Kopf. »Eigentlich nicht.«
»Siehste. Vermutlich kein Recklinghäuser. Erst recht keiner aus Suderwich. Für wie wahrscheinlich hältst du nun deine Erklärung?«
Heiner Baumann erwiderte nichts.
»Eben. Gehen wir also hypothetisch davon aus, dass der Anrufer keinen Scherz machen wollte, sondern nicht wusste, dass es schon geknallt hatte. Kein Mensch, der Gasgeruch wahrnimmt, fährt noch in aller Ruhe bis zum Hauptbahnhof, wartet dort ein gutes Stündchen, ruft die Feuerwehr und verschweigt dann auch noch seinen Namen. Kannst du mir bis hierhin folgen?«
Sein Assistent konnte und überlegte, wie lange er beleidigt sein wollte.
»Gut. Der Anrufer wusste, dass Gas austritt. Er war selbst in Suderwich … Nur nicht als zufälliger Passant, sondern als Beteiligter. Entweder hat er selbst diesen … diesen … Dings …«
»Prüfstutzen«, half ihm Baumann auf die Sprünge. Sein Unmut war fast verflogen. Schließlich kannte er seinen Chef seit Jahren und hatte sich an dessen Sarkasmus und Wutanfälle gewöhnt. Fast gewöhnt, schränkte er in Gedanken ein.
»… Stutzen abgeschraubt oder er wusste davon. Dann hat er sich auf den Weg in die Innenstadt gemacht, eine Zeit lang gewartet und später die Feuerwehr angerufen.«
»Das würde bedeuten, dass er nicht wollte, dass das Haus in die Luft flog. Die Explosion war ein Unfall.«
Brischinsky streckte demonstrativ seinen Zeigefinger in Baumanns Richtung. »So ist es. Und nun frage ich mich, warum jemand so handelt.«
Baumann hatte seine bequeme Haltung aufgegeben, stützte den Kopf auf beide Hände und hörte aufmerksam zu.
»Der Täter wollte jemanden warnen. Sehr eindringlich warnen. Nach dem Motto: Wenn du nicht dies oder das tust … wir können auch anders. Zum Beispiel dein Haus in die Luft jagen.«
»Dein Haus?«, hakte Baumann nach. »Du meinst, der Täter wollte den Apothekern drohen?«
»Oder Theo Bauer.«
»Der ja eigentlich an diesem Wochenende nicht da sein wollte.«
Sein Vorgesetzter grinste. »Willkommen im Klub erfolgreicher Kriminalbeamter. Nicht nur die Explosion war unbeabsichtigt, sondern auch der Tod Theo Bauers.« Er betätigte erneut den Rekorder. »Achte genau auf die Aussprache.«
Baumann lauschte. »Er spricht das R rollend aus, irgendwie hart, so wie die Leute in Süddeutschland …«
»Bayern«, triumphierte Brischinsky. »Ich bin sicher, der Anrufer stammt daher. Wir gehen folgendermaßen vor: Du schickst das Band zum LKA, die sollen eine Sprachanalyse machen. Dann entlockst du dem Computer alles, was wir über Bauer und die Lehmanns haben.«
»Und was unternimmst du?«