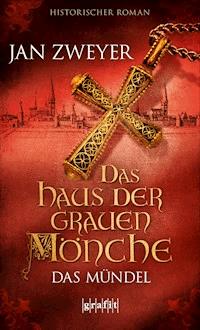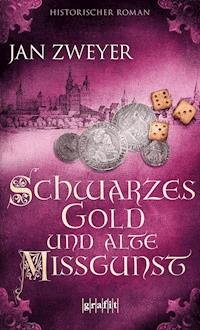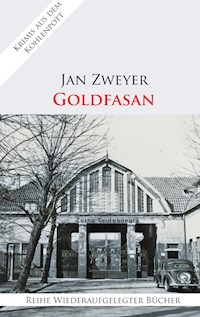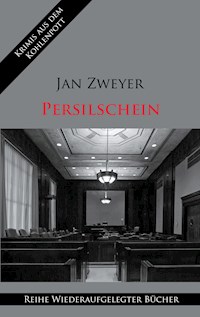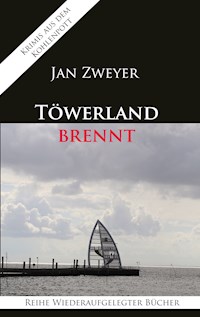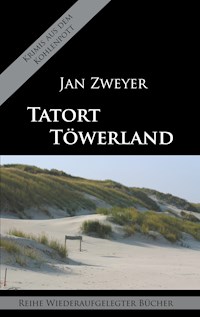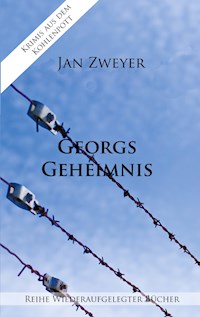7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Weimarer Republik, Januar 1923: Im französisch besetzter Ruhrgebiet wird eine junge Frau ermordet. Zwei Soldaten geraten in Verdacht, werden aber vom französischen Militärgericht freigesprochen. In Berlin will man das nicht auf sich beruhen lassen. Die oberste Polizeibehörde schickt Peter Goldstein an die Ruhr, damit er die Mörder überführt. Kein ungefährlicher Auftrag, denn sowohl die Besatzer als auch die heimlichen Widerstandskämpfer werden auf Goldstein aufmerksam ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne. Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie (Franzosenliebchen, Goldfasan, Persilschein) das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte die fünfbändige Linden-Saga, eine historische Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet, ein Thriller zur Flüchtlingsproblematik (Starkstrom) und 2020 ein Ökothriller (Der vierte Spatz).
In der Reihe Wiederaufgelegter Bücher werden verlagsseitig vergriffen Texte von Jan Zweyer als Buch und eBook neu veröffentlicht. Der Originaltext unterliegt jetzt den neue Rechtschreibregeln. Inhaltliche Veränderungen wurden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.
Schöner Gigolo
Der kleine Leutnant, er war der beste Reiter
und alle Herzen, sie flogen ihm gleich zu.
Er konnte küssen und tanzen wie kein zweiter,
er kam und sah und er siegte auch im Nu.
Viel Monde hat er gekämpft im Frankreich drüben, bald
an der Weichsel, Piave, irgendwo.
Jetzt ist ihm nichts mehr geblieben, er wurd’ ein Gigolo.
Schöner Gigolo, armer Gigolo,
denke nicht mehr an die Zeiten,
wo du als Husar
goldverschnürt sogar
konntest durch die Straßen reiten.
Uniform passé, Liebchen sagt Adieu,
schöne Welt, du gingst in Fransen.
Wenn das Herze dir auch bricht,
zeig ein lachendes Gesicht,
man zahlt und du musst tanzen.
Text: Julius Brammer, Musik: Leonello Casucci
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Epilog
1
Freitag, 26. Januar 1923
Die Glocken der nahe gelegenen Kreuzkirche schlugen zehn, als Agnes Treppmann die Haustür öffnete, ihren Schal fester um den hochgeschlagenen Kragen ihres Mantels zog und auf die Straße trat. Kaum hatte die junge Frau den Schutz des Hauseinganges verlassen, packte sie der eiskalte Wind mit aller Kraft. Sie wandte sich Richtung Bahnhof. Ihr blieb eine knappe Viertelstunde, wollte sie noch den letzten Zug erreichen, der ihr den einstündigen Fußmarsch durch die Dunkelheit zurück nach Hause ersparte.
Es war heute deutlich später geworden als üblich. Die letzte Straßenbahn war vor einer Stunde gefahren. Ihre Herrschaft, der Kaufmann Schafenbrinck und seine Frau, hatten zu einem schon lang geplanten Abendessen gebeten, an dem neben dem Oberbürgermeister, Dr. Sporleder, und dem Kommandeur der Schutzpolizei, Polizeiinspektor Reifenrath, fünf weitere Honoratioren der Stadt und des örtlichen Industrieverbandes teilgenommen hatten. Obwohl politische Fragen im Hause Schafenbrinck eigentlich bei Tische nicht diskutiert wurden, war es heute anders gewesen. An diesem Abend gab es nur ein Gesprächsthema: die schon mehr als zehn Tage dauernde Besetzung des Herner Stadtgebietes durch die Franzosen.
Immer wenn Agnes Treppmann die Speisen servierte, schnappte sie etwas von dem auf, was im Saal gesprochen wurde. Anscheinend waren die hohen Herren, die Hühnchen mit Reis verzehrten, mehr als besorgt über die Anwesenheit ausländischer Soldaten und wussten nicht, wie sie sich zukünftig verhalten sollten. Einige plädierten dafür, den Franzosen keinen Anlass für ein hartes Vorgehen zu geben, die anderen sprachen sich für eine Ausweitung des passiven Widerstandes aus. Einmütig begrüßten jedoch alle den Erlass des Reichsinnenministers, der den deutschen Behörden jede Kooperation mit der französischen Besatzungsmacht verbot, wohl wissend, dass Konflikte damit unausbleiblich waren.
Agnes Treppmann war jetzt einundzwanzig Jahre alt und stand seit zwei Jahren als Hausmädchen in den Diensten der Schafenbrincks. Sie war mehr als zufrieden mit ihrer Stelle. Das Ehepaar Schafenbrinck war kinderlos geblieben, was die gnädige Frau immer wieder mit einem tiefen Seufzer bedauerte. Es gab im Haushalt noch eine ältere Köchin, Marianne, und den Hausdiener Erwin, der bei Bedarf die meisten der erforderlichen Reparaturen auf dem Anwesen ausführte und auch den Kraftwagen der Familie wartete. Agnes reinigte vormittags das Haus, half anschließend Marianne beim Einkaufen und servierte später das Mittagessen. Da Abraham Schafenbrincks Kaufhaus nur wenige hundert Meter von dem Wohnhaus der Familie entfernt lag, pflegte die Herrschaft immer gemeinsam zu speisen. Danach folgten der Abwasch und manchmal kleinere Botengänge. Es gab Mädchen in ihrer Siedlung, die hatten es schlechter getroffen. Eine der größten Vorteile ihrer Stellung aber war, dass ihr Arbeitgeber sie seit Beginn der Inflation vor einigen Wochen mit Gutscheinen bezahlte, die sie in seinem Kaufhaus einlösen konnte. So blieben ihr die negativen Folgen der Geldentwertung weitgehend erspart und sie konnte ihre eigene Familie besser unterstützen, als wenn sie Bargeld mit nach Hause brachte, welches schon wenige Tage später nur noch die Hälfte wert war.
Atemlos erreichte Agnes den Herner Bahnhof, vor dem ein Trupp Franzosen Wache hielt. Die jungen Soldaten machten in holprigem Deutsch anzügliche Bemerkungen, als sie an ihnen vorbeieilte. Sie lächelte wissend. Die Jungen in ihrer Nachbarschaft waren auch nicht anders. Und im Übrigen konnten doch die einfachen Soldaten nichts dafür, dass sie jetzt in Herne und nicht in Marseille ihren Dienst schieben mussten. Sie befolgten Befehle, mehr nicht. Was hatten denn im Krieg die deutschen Soldaten in Frankreich angerichtet?
Hastig löste sie ihre Fahrkarte, lief zum Bahnsteigaufgang, schaute sich um, raffte entschlossen ihren Röcken, stürmte dann, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinauf und erreichte im letzten Moment den Zug, der abfahrbereit wartete. Kaum war sie in den Waggon gesprungen, schrillte der Pfiff des Aufsichtsbeamten, und schnaufend setzte sich die Dampflok in Bewegung. Erleichtert ließ sie sich auf die Holzbank fallen. Geschafft!
Der Zug brauchte nur wenige Minuten, um den Bahnhof in Börnig zu erreichen. Eigentlich war es mehr ein Haltepunkt als ein Bahnhof. Zwar gab es einen kleinen Schuppen, der als Empfangsgebäude deklariert worden war, aber der aus Schotter aufgeschüttete einzige Bahnsteig war nicht überdacht und die Strecke lediglich eingleisig. Die nahe gelegene Gemeinde Sodingen im Süden, zu der das Amt Börnig mit der Schachtanlage Mont-Cenis gehörte, die Zechen Teutoburgia im Osten und Friedrich der Große im Norden sorgten jedoch normalerweise für eine ausreichende Anzahl an Fahrgästen. Am Abend war das allerdings anders. Schon in ihrem Waggon war sie allein gewesen, und als Agnes ausstieg, musste sie feststellen, dass außer ihr niemand den Zug verließ. Auch die französischen Soldaten, die eigentlich die Gleisanlagen bewachen sollten, waren nicht zu sehen.
Der Zug fuhr ab. Es war noch kälter geworden. Der Wind kroch unter ihren Mantel. Sie fröstelte. Eilig wandte sich Agnes nach Osten, um über die Wilhelmstraße das elterliche Wohnhaus in der Schadeburgstraße zu erreichen.
Als sie die Hafenbahn Mont-Cenis passiert hatte, meinte sie, Schritte und leise Stimmen hinter sich wahrzunehmen. Die junge Frau blieb stehen, drehte sich um, sah in ein schwarzes Loch und lauschte erfolglos. Angst kroch in ihr hoch. Ärgerlich über sich selbst setzte sie ihren Weg fort. Wie ein Schulmädchen, dachte sie. Die fürchten sich auch im Dunkeln.
Links lag der kleine Kotten, in dem die Witwe Bommer mehr schlecht als recht zusammen mit zwei Ziegen und einer stattlichen Zahl Hühner hauste. Vollkommene Dunkelheit umgab ihn und nur der Wind war zu hören.
Vor Agnes lagen noch einige hundert Meter. Dann würde sie den Schutz der heimatlichen Siedlung erreichen. Sie musste nur noch die Ruine des abgebrannten Hauses passieren, welche schon bei Tageslicht einen bedrohlichen Eindruck machte. Agnes schaute sich erneut um. Irgendwo bellte ein Hund. Die junge Frau beschleunigte ihre Schritte und spähte in die Nacht. Schemenhaft konnte sie den Kamin der Ruine ausmachen, der den Brand überstanden hatte und nun wie ein ausgestreckter, knochiger Finger in den Himmel ragte. Pass auf, schien der Kaminfinger zu drohen, pass nur auf. Nun begann sie sich doch wirklich zu fürchten. Aber es war ja nicht mehr weit.
Plötzlich hörte Agnes ein Rascheln aus einem Gebüsch, das direkt am Straßenrand wucherte. Erschrocken fuhr sie herum. Sie vernahm ein Keuchen, eine dunkle Gestalt sprang auf sie zu, und ehe Agnes reagieren konnte, wurde ihr eine Art Riemen um den Hals geschlungen. Ihr Hilfeschrei erstarb zu einem leisen Röcheln.
Die junge Frau schlug und trat um sich. Aber sie konnte sich nicht befreien. Der Riemen um ihren Hals lockerte sich nicht. Für einen Moment glaubte sie, ein Gesicht zu erkennen. Oder waren es zwei? Dann aber blitzen nur noch Lichter vor ihren Augen. Sie riss den Mund weit auf, wollte tief einatmen, aber der Riemen schnitt schon tief in ihren Hals. Schwindel erfasste sie.
Agnes bäumte sich auf. Luft! Dann war es vorbei.
2
Freitag, 26. Januar 1923
Die Villa der Familie Königsgruber befand sich südlich der Recklinghäuser Innenstadt. Ein herrschaftlicher Garten umgab das Gebäude. Aus Stein gehauene Löwen bewachten links und rechts das hohe schmiedeeiserne Tor, welches die Zufahrt zum Haus versperrte. Das gesamte Anwesen gab vor allem eins zu verstehen: Hier wohnt Reichtum.
Siegfried Königsgruber war Inhaber einer Metallwarenfabrik. Fast dreißig Menschen hatten bei Kriegsende für ihn gearbeitet. Heute waren es nur noch zwölf. Schon als Fünfundzwanzigjähriger hatte Siegfried das väterliche Erbe antreten müssen. Obwohl er – anders als sein Vater – das Handwerk des Schmieds nie gelernt hatte, war es ihm durch Geschick und Umsicht gelungen, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen und die kleine Schmiede zu einer florierenden Metallfabrik auszubauen.
Ursprünglich hatte das Unternehmen vor allem Töpfe und Pfannen aus Stahl produziert, aber mit Ausbruch des Krieges auf Helme, Koppelschlösser und anderes Armeezubehör umgestellt. Eine kluge Entscheidung. Je mehr junge Männer im Trommelfeuer des Stellungskrieges als Kanonenfutter verheizt wurden, umso höher waren die Auftragsordern, die das Beschaffungsamt des Heeres an die Metallwarenfabrik Siegfried Königsgruber schickte.
Doch nach Kriegsende versickerte der unverhoffte Geldsegen. Königsgruber hatte mehr als die Hälfte seiner Leute entlassen müssen und wieder Friedensware produziert. Das Geschäft lief mehr schlecht als recht. Der Fabrikant zehrte von seinen Rücklagen und verfluchte den Frieden, die Revolution und vor allem die Demokratie.
Am heutigen Abend war sein Freund Wieland Trasse zu Gast. Zigarrenrauch hing schwer in dem Salon, in dem die Herren bei Wein und Cognac saßen. Trasse kippte den letzten Schluck Schnaps hinunter und stellte das Glas auf den Eichentisch.
»Noch einen?«, fragte Königsgruber.
Trasse, ein mittelgroßer Mittvierziger schlanker Gestalt, nickte.
Der Hausherr griff zu einer kleinen Glocke, die auf dem Tisch stand, und läutete. Wenig später klopfte es und das Hausmädchen betrat den Salon, knickste und blieb mit züchtig gesenktem Blick in der offenen Tür stehen. »Sie haben geläutet, gnädiger Herr?«
»Bring uns weiteren Cognac. Und nimm diese Flasche mit. Sie ist leer.«
Gehorsam befolgte die junge Frau die Anordnung. Als sie das Zimmer wieder verlassen hatte, fragte Trasse: »Und deine Geschäfte?«
Königsgruber, ein massiger Mann, dessen schütteres Haar wie am Kopf angeklebt wirkte, winkte ab. »Frag bitte nicht. «
»Wieso? Ich dachte, gerade du hättest am Krieg gut verdient?«
»Am Krieg, ja. Aber jetzt ...« Königsgruber griff zu dem Cognacschwenker. »Wer will im Moment neue Kochtöpfe? Die Leute geben ihr Geld für Lebensmittel aus. Zusätzlich macht mir die Konkurrenz zu schaffen.«
»Kannst du nicht etwas anderes fertigen?«
»Können schon. Aber was? Außerdem: Für die Herstellung neuer Waren benötige ich neue Maschinen. Die alten Pressen lassen sich nicht mehr umrüsten. Hast du eine Ahnung, was das kostet?«
Es klopfte erneut. Das Hausmädchen brachte eine volle Flasche.
Königsgruber schenkte sich und seinem Gast ein. »Dazu fehlt es mir an Kapital.«
Trasse prostete seinem Freund zu. »Warum sprichst du nicht mit deiner Bank?«
Siegfried Königsgruber grinste schief. »Ich bin Unternehmer, keine hoher Beamter beim Finanzamt wie du. Bei meinen Kreditanfragen geht es um andere Summen als bei der Finanzierung deines Hausanbaus. Die Zinsen fressen mich jetzt schon auf.«
»Du hast schon Schulden bei der Bank?«
»Nein.«
»Aber du sagtest doch gerade ...«
Königsgruber sprang auf und ging, das Glas in der Hand,
im Raum umher. »Du kennst doch den Kaufmann Schafenbrinck aus Herne?«
»Natürlich. Du selbst hast ihn mir ja vor einigen Monaten vorgestellt.«
»Er hat mir einen Privatkredit gegeben. Ich habe ihm einen Wechsel unterschrieben.«
»Na und?«
Königsgrubers Stimme klang erregt. »Schafenbrinck hat meine Notsituation schamlos ausgenutzt.«
»Wie soll ich das verstehen? Ich nahm an, er sei dein Freund.«
Trasse wusste, dass Schafenbrinck und Königsgruber fast gleich alt und einige Jahre gemeinsam in Recklinghausen zur Schule gegangen waren. Auch hatten beide früh ihre Väter verloren und Verantwortung für die Familie übernehmen müssen: Königsgruber mit der väterlichen Schmiede, Schafenbrinck mit einem geerbten Kolonialwarenladen in der Recklinghäuser Innenstadt. Durch die Parallelen in ihrem Lebensweg hatten sich die beiden Männer stets verbunden gefühlt.
Königsgruber lachte höhnisch auf und setzte sich wieder. »Das dachte ich auch. Vielleicht erinnerst du dich, dass meine letzte Lieferung an die Armee kurz vor Kriegsende stattfand?«
»Du hast darüber gesprochen, ja.«
»Es war einer der größten Aufträge, die mir das Beschaffungsamt je erteilt hat. Ich habe alle Termine eingehalten. Trotzdem weigerten sie sich zu zahlen. Die Stahlhelme seien nie angekommen, behaupteten sie später. Diese verdammten Sozis!« Er nahm noch einen Schluck Cognac und goss sich nach. »Ich hatte fest mit dem Geld gerechnet. Schließlich musste ich meine Leute bezahlen. Schafenbrinck hat mir damals geholfen. Der Kredit wird, zuzüglich vierzig Prozent Zinsen, im Oktober fällig. Vierzig Prozent! Für knapp vier Jahre! Der reinste Wucher! Ich weiß nicht, wie ich das Geld aufbringen soll.«
»Aber damals warst du einverstanden.« Wieland Trasse lächelte leicht.
»Sicher. Ich brauchte das Geld doch. Aber die
Zinsen ...«
»Wann hast du den Wechsel unterschrieben?«
»Sommer 1919.«
»In Gold- oder Reichsmark?«
»Reichsmark.«
Trasse griff zum Humidor. »Darf ich?«
Königsgruber nickte.
Sein Gast öffnete das Behältnis, zog eine Zigarre heraus, prüfte ihren Geruch, schnitt sorgfältig die Spitze ab, drehte die Havanna im Mund, um sie zu befeuchten, und steckte sie schließlich mit einem Streichholz an. Befriedigt lehnte sich Trasse in seinem Sessel zurück und ließ den Rauch langsam aus seinem Mund strömen. »Wenn der Wechsel in Reichsmark ausgestellt ist, solltest du dir eigentlich keine Sorgen machen.«
»Warum nicht?«
»Hast du die Reichstagsrede von Kanzler Cuno über die französische Besetzung gelesen?«
»Natürlich.« Königsgruber stand wieder auf, kramte eine Zeitung aus einem Papierstapel vom Sekretär und kehrte zu seinem Platz zurück. Dort begann er, aus der Zeitung zu zitieren. Seine Stimme war nicht mehr ganz deutlich. »Zur festesten Einigung aller Schichten unseres Volkes, zu innigster Gemeinschaft mit dem Staat, zur Weckung aller tiefen, offenen und verschütteten, sittlichen und religiösen Kräfte ruft uns die Stunde.« Mit lauter, pathetischer Stimme fuhr er fort: »Unrecht, Not, Entbehrung – unser Schicksal heute. Recht, Freiheit und Leben – das Ziel. Einigkeit – der Weg!« Königsgruber fiel in seinen Sessel zurück und griff zu seinem Glas.
»Genau.« Wieder spielte ein ironisches Lächeln um Trasses Mund. »Und dann hat Cuno noch gesagt, dass die Reichsregierung bereit sei, diesen Weg zu gehen und das Volk zu führen. Weißt du, was das bedeutet?«
»Selbstverständlich. Das bedeutet ... Eigentlich nicht. «
»Ich will es dir erklären. Du weißt, dass die Reichsregierung alle Bürger in den besetzten Gebieten zum passiven Widerstand aufgerufen hat?«
Königsgruber nickte heftig. »Wer dem Franzmann auch nur einen Finger reicht, dem soll die Hand abfaulen!«, rief er aus.
»Eben. Die ersten Betriebe werden schon bestreikt. Es wird über kurz oder lang zum Generalstreik im Rheinland und dem Ruhrgebiet kommen.«
»Woher weißt du das?«
»Ich habe so meine Beziehungen. Im Finanzministerium in Berlin jedenfalls rechnen sie schon kräftig.« Trasse hatte es in den vergangenen Jahren verstanden, sich ein Netz von Kontakten bis in die höchsten Stellen aufzubauen. Schon sein Vater hatte in verantwortungsvoller Stellung als Beamter dem Staat gedient. Von ihm hatte Wieland Trasse früh gelernt, dass Beziehungen häufig besser Macht und Einfluss sicherten als Herkunft oder Geld. Manchmal allerdings bedingte das eine auch das andere.
Das Gesichts Königsgrubers drückte Unverständnis aus. »Was hat das ...«
»Mit deinem Kredit zu tun, willst du wissen? Warte einen Moment. Die Streiks richten sich nicht gegen die deutschen Unternehmer, sondern gegen die Franzosen und Belgier. Die Gewerkschaften können diesen Streik nicht finanzieren. Ebenso wenig aber können die Unternehmen ihren Arbeitern einfach den Lohn weiterzahlen. Dann wären sie über kurz oder lang bankrott.«
»Eher über kurz.«
»Richtig. Wenn die Reichsregierung einen Generalstreik will, muss sie also dafür sorgen, dass die Streikenden Geld bekommen. Sonst fällt der Streik binnen kürzester Frist in sich zusammen. Das heißt, dass der Staat die Streikgelder bezahlen muss. Deswegen rechnen die Beamten in Berlin. Dummerweise aber ist Deutschland faktisch pleite.«
»Die uns in Versailles auferlegten Reparationskosten!«, bekräftigte Königsgruber.
»Auch. Aber nicht nur. Vier Jahre Krieg waren nicht gerade billig. Der Staat wird, um die Streikgelder zahlen zu können, neues Geld drucken müssen.«
»Na und? Das macht er doch jetzt auch schon.«
»Leider. Bei Kriegsausbruch war eine Papiermark noch tatsächlich eine Goldmark wert. Im letzten Dezember betrug dieses rechnerische Verhältnis bereits etwa eins zu eintausendsiebenhundert. Das nennt man Inflation, mein Lieber. Und man muss kein Prophet sein, sondern nur etwas von den volkswirtschaftlichen Zusammenhängen verstehen, um zu erkennen, wohin diese Politik führt. Direkt zum endgültigen Zusammenbruch unserer Währung. Verstehst du jetzt, was ich meine?«
»Ich glaube schon.« Königsgruber griff erneut zum Glas. Seine Züge waren vor Aufregung und vom Alkohol gerötet. »Du meinst also, ich könnte meinen Kredit ohne große Anstrengungen zurückzahlen?«
»Wenn der Vertrag keine Klausel enthält, dass der Kreditbetrag in Goldmarkäquivalenten zu tilgen ist, ja. Die Reichsmark ist bald das Papier nicht mehr wert, auf dem sie gedruckt ist. Das kannst du mir glauben.«
»Und wie viel müsste ich noch aufbringen?«
»Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht ein Tausendstel, vielleicht ein Millionstel der ursprünglichen Summe? Wer weiß.« Königsgruber rieb sich die Hände. »Das wäre meine Rettung. Allerdings ...«
»Ja?«
Der Fabrikant hob theatralisch beide Hände, als wollte er einen imaginären Feind abwehren, und antwortete klagend: »Schafenbrinck vertreibt in seinem Kaufhaus auch Haushaltswaren aus Metall, so wie ich sie produziere. Dummerweise bezieht er seine Produkte nicht von mir, sondern von einem meiner Konkurrenten aus Hagen. Und in Geschäftskreisen erzählt man sich, dass Schafenbrinck demnächst auch hier in Recklinghausen wieder eine Filiale eröffnen will. Der Einzelhandel, an den ich einen Großteil meiner Produktion liefere, könnte bei seinen Preisen vermutlich nicht mithalten und wird sicherlich auf den Vertrieb meiner Waren verzichten. Dann käme der Hagener zum Zuge und ich könnte einpacken.«
»Es geht doch nichts über Geschäfte unter guten Freunden.« Trasse schien wirklich amüsiert.
»Du hast gut spotten. Aber mir geht es an den Kragen.«
Nach kurzem Nachdenken antwortete Trasse: »Was wäre es dir wert, wenn ich dir dabei helfe, dieses Problem zu lösen?«
»Du willst Geld?«
Trasse wehrte ab. »Ach was. In diesen Zeiten haben nur Sachwerte bestand.«
Es dauerte einen Moment, bis Königsgruber das Anliegen seines Freundes richtig einordnen konnte. »Du willst einen Anteil an der Firma?«
Wieland Trasse nickte.
»Wie viel?«
»Dreißig Prozent, wenn ich dir einen Weg zeige, wie du Schafenbrinck aus dem Geschäft drängen kannst.« Königsgruber wurde schlagartig nüchtern. Seine Gedanken überschlugen sich. Sein Freund verfügte als Regierungsrat über exzellente Kontakte, das wusste er. Trasse im Boot zu haben, konnte für ihn vorteilhaft sein. Und wenn er ihm dann auch noch Schafenbrinck aus dem Weg räumen würde ... Sein eigenes Unternehmen war faktisch pleite. Was hatte er zu verlieren? Aber dreißig Prozent waren zu viel. »Einverstanden. Du kannst mein Teilhaber werden. Ich biete dir fünfundzwanzig Prozent. Nicht mehr.«
Als Königsgruber das Glitzern in den Augen seines Freundes bemerkte, wurde ihm klar, dass Trasse auch mit weniger zufrieden gewesen wäre. Ärgerlich über sich selbst setzte er hinzu: »Mit einer Einschränkung. Du bekommst die Anteile erst dann, wenn Schafenbrinck mit seinen Absichten gescheitert ist und sich die Auftragslage meiner Firma stabilisiert hat.«
»Einverstanden.«
Königsgruber streckte Trasse kurz entschlossen die Hand hin. Der schlug ein.
»Und jetzt verrate mir, wie du Schafenbrinck dazu bewegen willst, auf die Filiale in Recklinghausen zu verzichten.«
»Das weiß ich noch nicht«, antwortete Trasse. »Aber mir fällt schon etwas ein.«
3
Samstag, 27. Januar 1923
Wilhelm Gleisberg stürmte die drei Stufen hoch und riss, ohne anzuklopfen, die Haustür auf. Nach zwei Schritten stand er in der Küche und stieß dann aus: »Wir haben Agnes gefunden.«
Erna Treppmann fuhr herum, einen Teller in der Hand. Die Frau suchte den Blick des wesentlich jüngeren Mannes. Der stand schwer atmend im Türrahmen, senkte den Kopf und schwieg.
»Was ist mit ihr?«, fragte sie. »Was ist mit meinem Mädchen?«
Gleisberg schluckte. Seit frühester Kindheit ging er im Haus der Familie Treppmann ein und aus, war mit Agnes zur Schule gegangen und hatte mit ihr am Kanal und bei den Bahngleisen gespielt. Und jetzt musste gerade er diese Nachricht überbringen.
Erna Treppmann griff mit der Linken zur Stuhllehne. »Nun sag schon.«
»Agnes ist tot.«
Der Porzellanteller fiel zu Boden und zerbrach. Erna Treppmann wankte, drohte zu fallen, hielt sich dann aber auch mit der anderen Hand am Stuhl fest, zog sich näher Richtung Tisch und stützte sich schließlich mit beiden Händen ab. »Wo?«, fragte sie tonlos und fixierte Gleisberg, als ob sie die Antwort in seinem Gesicht lesen könnte.
»In der Ruine kurz vor der Siedlung.«
Sie nickte. »In der Ruine also.«
Im Gang waren Schritte zu hören. Ein junges Mädchen drückte Wilhelm Gleisberg zur Seite und rief mit tränenerstickter Stimme: »Mama!«
Lisbeth lief zu ihrer Mutter und umarmte sie weinend. Langsam hob Erna Treppmann ihren rechten Arm und legte ihn um ihre jüngste Tochter. Für einige Minuten war nichts außer leisem Schluchzen zu hören. Dann schob die ältere Frau ihre Tochter sanft von sich, trocknete mit einem Zipfel ihrer Schürze die Tränen der Siebzehnjährigen und sagte heiser: »Nimm Besen und Kehrblech und räume die Scherben weg. Dann holst du Brot und etwas frische Wurst. Die Männer haben die halbe Nacht gesucht. Sie werden Hunger haben. Und setz Kaffee auf. Und du ...« Sie zeigte mit ihrem Finger auf Wilhelm Gleisberg. »Du bringst mich jetzt zu meinem Mädchen.«
»Aber ...«
Erna Treppmann legte ihre Schürze ab und faltete sie sorgfältig zusammen. »Nichts aber. Ich hole meinen Mantel und dann gehen wir. Hast du verstanden?«
Wilhelm Gleisberg nickte folgsam.
Nachdem Agnes am Abend zuvor auch mit der letzten Bahn nicht nach Hause gekommen war, hatte ihr Vater einige Männer aus der Nachbarschaft mobilisiert, um nach seiner Tochter zu suchen. Nun war die Leiche des Mädchens in den Kellerräumen des abgebrannten Hauses gefunden worden, versteckt unter dreckigen, zerlumpten Kohlensäcken.
Erna Treppmann näherte sich mit schleppenden Schritten der Menschenansammlung vor der Ruine. Jemand rief in Richtung des abgebrannten Hauses: »Hermann, deine Frau.«
Die geflüsterten Gespräche der Leute erstarben.
»Lasst mich durch«, sagte Erna Treppmann leise, aber bestimmt. »Ich will zu meinem Kind.«
Gehorsam schob sich die Menge auseinander und bildete eine Gasse.
Mit vor Erregung gerötetem Kopf erschien Hermann Treppmann im Kellereingang. »Du solltest da nicht runtergehen«, sagte er mit belegter Stimme. »Wirklich nicht. «
Erna Treppmann sah ihren Mann nur kurz an und streichelte dann sein Gesicht. Er zögerte, nickte aber dann und trat beiseite, um den Weg freizugeben.
Langsam folgte Hermann Treppmann seiner Frau.
Ein Kraftwagen der Schupo fuhr knatternd vor. Ihm entstiegen zwei deutsche Uniformierte sowie ein französischer Offizier und zwei Soldaten. Die Polizisten näherten sich den Wartenden, während die Franzosen neben dem Wagen stehen blieben. Die Leute warfen den Soldaten feindselige Blicke zu.
»Hier wurde eine Tote gefunden?«, fragte der ältere Polizist grußlos und sah sich suchend um.
Einer der herumstehenden Männer, der einen stattlichen Bauch vor sich hertrug, machte eine Kopfbewegung. »Im Keller.«
Der Beamte ging in die angegebene Richtung.
»Wer hat die Tote entdeckt?«, wollte der jüngere Schupo wissen, der zurückblieb.
»Kalle und ich«, erwiderte wieder der dicke Mann.
Der Uniformierte zückte ein Notizbuch. »Und wer sind Sie und wer ist Kalle?«
Aus dem Hintergrund trat ein anderer Mann hervor. Er war groß gewachsen, schlank, fast ein wenig staksig. Über sein Gesicht zog sich eine breite, tiefrote Narbe. »Ich bin Kalle. Karl Soltau.« Er hielt einen breiten Gürtel und einen Schal hoch. »Außerdem haben wir dat hier gefunden. Aber nich hier, sondern weiter vorne im Straßengraben.«
»Dazu kommen wir gleich«, brummte der Schutzpolizist und schrieb weiter in seinem Buch. »Und Ihr Name?«, wandte er sich erneut an den Dickeren, der sich gerade eine Zigarette anzündete.
»Adolf Schneider«, antwortete der und nahm einen tiefen Zug.
»Erzählen Sie, wie Sie die Tote gefunden haben.«
»Was gibbet da schon groß zu erzählen?«, erwiderte Soltau. »Wir haben mit den anderen hier die halbe Nacht nach Agnes gesucht.«
»Agnes?«
»Agnes Treppmann, ja. Zuerst ham wer den Gürtel und ihren Schal da hinten im Graben gefunden. Dann sind Adolf und ich auch hier inne Ruine rein. Und da hat se dann gelegen.«
Erst jetzt nahm der Polizist die beiden Gegenstände zur Kenntnis, die Soltau in seiner rechten Hand hielt. »Zeigen Sie her«, befahl er.
Kalle Soltau nahm den Schal in seine Linke und hob ihn hoch. »Dat is der von Agnes. Un dat hier«, Soltau hob die Stimme, sodass ihn alle Umstehenden deutlich vernehmen konnten, und streckte seine Rechte nach oben, »dat hier is ein französisches Koppel. Un es soll mich der Teufel holen, wenn nich mit diesem Koppel unser Agnes erwürgt worden is. Verdammich noch ma!«
Er sah sich triumphierend um. Die Leute, die eben noch betreten geschwiegen hatten, fingen an zu tuscheln. Erst leise, dann lauter.
»Ihr habt Agnes umgebracht«, rief einer aus dem Schutz der Menge und zeigte auf die immer noch am Wagen wartenden Soldaten.
»Haut ab«, kreischte eine Frau. »Ihr habt hier nix verloren!«
Jetzt drehten sich alle zu den Soldaten hin und zeigten offen ihre Feindseligkeit: Fäuste wurde drohend erhoben, weitere Schmährufe ertönten.
Der französische Offizier gab einen Befehl und öffnete sein Pistolenhalfter. Die ihn begleitenden Soldaten nahmen ihre Karabiner von der Schulter, luden sie durch und richteten sie auf die langsam näher rückenden Menschen.
»Macht keinen Quatsch!«, rief jemand mit lauter Stimme vom Kellereingang her. Der ältere Schutzpolizist und die Eheleute Treppmann traten wieder ins Freie. »Reicht eine Tote nicht?«
Die Leute wandten sich um.
»Lasst es sein«, bat auch Erna Treppmann mit müder Stimme. »Davon wird mein Mädchen nicht wieder lebendig. Und ...«, sie musterte die Umstehenden, »... vielen Dank für eure Hilfe. Wer noch einen heißen Kaffee und eine Schnitte möchte, kann mit zu uns kommen. Ihr seht so aus, als ob ihr etwas Warmes im Bauch vertragen könntet.«
Die Leute beruhigten sich etwas. Trotz ihrer Trauer hielt Erna Treppmann sich aufrecht, während sie langsam davonschritt. Einige folgten ihr und ihrem Mann, andere zogen es vor, möglichst schnell in ihre eigenen warmen Häuser zurückzukehren, argwöhnisch beäugt von den Vertretern der französischen Besatzungsmacht.
Kurze Zeit später standen die Polizisten und die Soldaten allein vor der Ruine.
»Die Kleine wurde erwürgt«, berichtete der Beamte, der die Leiche im Keller in Augenschein genommen hatte.
»Hiermit?«, fragte der andere und hielt ihm das Koppel entgegen.
»Könnte sein. Wo hast du das her?«
»Zwei Männer haben es mit dem Schal der Toten in dem Graben dort gefunden.«
»Interessant.«
Mit deutlichem Akzent, aber gut verständlich sagte der französische Offizier: »Die Gegenstände sind beschlagnahmt. Händigen Sie sie mir aus.«
»Das ist ein Mordfall«, antwortete der jüngere Polizist. »Dafür ist die deutsche Polizei zuständig.«
»Jetzt nicht mehr«, stellte der Franzose fest. »Wofür Sie zuständig sind, bestimmen wir. Also?« Fordernd streckte er seine Hand aus. »Außerdem ist das tatsächlich ein Koppel unserer Soldaten. Damit ist diese Sache automatisch ein Fall für unsere Militärgerichtsbarkeit. Allez!«
Zögernd übergaben die Polizisten dem Franzosen Schal und Gürtel.
»Danke. Sie können jetzt gehen. Meine Männer werden hierbleiben und den Tatort bewachen. Wir kümmern uns um alles Weitere.«
4
Donnerstag, 1. Februar 1923
Der hochgewachsene Mann mit dem dunklen, vollen Haar betrat das Restaurant, löste seinen Schal und machte eine Bewegung, als ob er die Kälte, die draußen herrschte,
abschütteln wollte. Dann schaute er sich um, musterte misstrauisch die wenigen Gäste, die an einem der hinteren Tische saßen, und ging zum Tresen. »Alles klar?«, fragte er leise.
Der Wirt, der sein Erscheinen offensichtlich erwartet hatte, nickte. »Alle im Saal.«
Wilfried Saborski machte eine Kopfbewegung in Richtung der Tische. »Und wer sind die zwei Kerle da? Ich habe sie noch nie hier gesehen.«
»Vertreter, glaube ich. Aus Münster.«
»Sicher?«
Der Wirt hob nur die Schultern.
»Behalte sie im Auge.«
»Keine Sorge.«
Saborski verließ den Schankraum durch einen schmalen Flur, der auch zu den Toiletten und dem Hintereingang führte, und öffnete dann die Schiebetür zum Saal.
Für einen Moment blieb er in der Tür stehen und wartete, bis auch der letzte der knapp ein Dutzend Männer sein Kommen bemerkt hatte. Dann erst schloss er die Tür und grüßte: »Glück auf.«
Die Wartenden erwiderten seinen Gruß. Wilfried Saborski zog seinen Mantel aus, warf ihn über eine Stuhllehne und setzte sich.
Der Saal des Restaurants Karl der Große an der Bruchstraße wurde für Familienfeiern und als Versammlungsraum genutzt, jeden ersten Dienstag im Monat traf sich hier der Ortsverein der Sozialdemokratischen Partei. An jedem zweiten Mittwoch diskutierten die Kommunisten ihre Taktik, alle drei Wochen führte das katholische Zentrum seine Sitzungen hier durch. Und vierzehntägig schmetterte der Männergesangverein Harmonie in dem Saal seine Lieder.
Einfache Holzstühle und -tische, die je nach Bedarf gestellt werden konnten, bildeten die Einrichtung. Von der Decke baumelten farbige Girlanden, an denen lange Staubfäden hingen, Überbleibsel der letzten oder auch vorletzten Karnevalsfeier. An der Stirnwand gähnte ein zwar vergilbtes, aber im Vergleich zur übrigen Tapete deutlich helleres Rechteck. Von dieser Stelle aus hatte noch vor einigen Jahren der letzte deutsche Kaiser mit strengem Blick auf seine Untertanen herabgeschaut. Nach der Novemberrevolution 1918 war es dem damaligen Besitzer des Restaurants ratsamer erschienen, sich von Kaiser und Monarchie zu distanzieren. So war Wilhelm in den Keller gewandert und wartete dort, sorgsam verpackt, auf das Ende der Weimarer Republik.
Für den heutigen Donnerstag hatte eine Gruppe den Raum reserviert, die sich der gemeinsamen Lektüre von Gottes Wort verschrieben hatte. Aber obwohl vor jedem der Männer an dem langen Tisch eine Bibel lag, ging es in den Gesprächen um andere Themen.
»Haltet euch daran: keine Einzelaktionen!« Wilfried Saborski war aufgestanden, um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen. »Und kein Wort zu jemandem, der nicht zu uns gehört. Die Franzosen haben überall ihre Spitzel, da könnt ihr sicher sein. Auch Deutsche sind zu Verrätern geworden. Also passt auf, mit wem ihr redet.«
Er sah sich um. Viele der Anwesenden waren noch sehr jung, vielleicht gerade zwanzig Jahre alt. »Also, keine Unbesonnenheit. Es hat keinen Zweck, dass ein Einzelner sich wehrt! Ausharren, bis unsere Stunde gekommen ist. Was wir von unseren deutschen Mitbürgern verlangen, ist Würde. Mit deutschem Stolz wollen wir den Eindringlingen gegenübertreten. Nicht wir müssen den Blick senken, sondern die anderen, denn sie sind Friedensstörer, Mörder.«
Seine Zuhörer hingen an seinen Lippen.
»Wie hier bei uns, haben sich überall im besetzten Gebiet Ausschüsse gebildet. Unser Überwachungsausschuss zur Wahrung der deutschen Würde hat darauf zu achten, dass kein deutscher Mann und keine deutsche Frau mit einem Franzosen zusammengeht. Keiner! Ist das klar?«
Die Anwesenden nickten eifrig.
»Gut. Ehrensache ist es, dass jeder von uns eine kleine Taschenschere mit sich führt. Die Hattinger haben es uns vorgemacht. Dort ist von einem mutigen Mann eine Anzeige aufgegeben worden. Darin heißt es: An die Damen des Kreises Hattingen. Wir warnen hiermit die Damen, sich mit den Ausländern in engere Beziehungen einzulassen, da wir sonst mit aller Strenge vorgehen. Der Scherenclub.«
Einzelne Lacher wurden laut.
»Also, denkt an die Scheren. Ein Symbol nur, gewiss. Aber man könnte damit einem Mädchen, das die deutschen Grundsätze nicht beherzigt, sehr wohl die Haare abschneiden. Daher besorgt euch die Dinger! Lasst hier und da eine Bemerkung über den Scherenclub fallen. Es schadet auch nichts, wenn sich der eine oder der andere an das Wort Feme erinnert. Die Feme wacht, über die Getreuen und die Ungetreuen! Und die Feme straft! Geht mit gutem Beispiel voran. Für uns sind die Franzosen Luft. Wenn sie etwas wollen, so sehen wir durch sie hindurch wie durch Glas.«
Der Redner schaute in vor Begeisterung glühende Gesichter.
»Die Franzosen sind mit Tanks und Kanonen gekommen. Stimmt. Na und? Sie können nicht ein ganzes Volk erschießen! Einige fragen ängstlich: Was können wir Einzelne schon ausrichten? Ich sage es euch: Wir müssen uns auflehnen! Und das Volk wird sich auflehnen. Auflehnen gegen die Frechheit, nach vier Jahren Frieden wie Räuber ins deutsche Land einzubrechen. Das Volk will die Franzosen nicht! Und wenn der Franzoseneinfall eine Folge des Friedensvertrages sein soll, dann ist dieser nichts wert.« Saborski hob seine Stimme noch weiter an und fuhr fort: »Opfersinn, Heldentum und Freundestreue heißt die Parole in Zeiten des Kampfes. Es wird sich zeigen, wer ein richtiger Kerl ist, wer sich für das Volk einsetzt – für sein deutsches Volk! Seid ihr solche Kerle?«
Frenetisch applaudierend sprangen die Zuhörer auf. »Ja!« Saborski gab einem der Männer ein Zeichen.
Karl Soltau hob beide Arme und bat um Ruhe. Seine Narbe glühte. Dann begann er zu sprechen: »Kameraden! Es is nich genug, eine Schere in der Tasche spazieren zu tragen und von der Feme zu flüstern. Deshalb haben wir dreißig Exemplare eines Plakates organisiert, dat unsere Dortmunder Kameraden verfasst und gut sichtbar an Hauswänden angebracht haben, damit sich Franzosenfreunde nicht sicher fühlen können. Ich will es euch vorlesen.« Er griff unter seinen Pullover und zog ein großes Blatt Papier hervor. »Vaterlandsverräter! Die französische Besatzungsbehörde sichert euch Schutz und Straffreiheit! Wir – deutsche Bürger auf westfälischer Erde – erkennen die ›Hoheit‹ der Franzosen nicht an! Wir werden uns in der Verfolgung und Verurteilung von Volksverrätern nicht beirren lassen! Ihr seid nicht straffrei! Wir wachen und strafen! Die Feme. Unterschrift: Überwachungsausschuss zur Wahrung der deutschen Würde, Ortsgruppe Dortmund. Nun brauchen auch wir Freiwillige, die heute Nacht trotz der Verhängung des schändlichen Belagerungszustands diese Plakate kleben. Wer beteiligt sich daran?«
Alle Arme flogen nach oben.
»Ausgezeichnet. Die Plakate befinden sich im Versteck. Wir verteilen sie später. Den Kleister könnt ihr ...«
Plötzlich wurde die Tür aufgedrückt und der Wirt steckte seinen Kopf durch den Spalt: »Franzosen. Und Geheimpolizei!« Dann verschwand er wieder.
Hastig rollte Soltau das Plakat wieder ein und schob es sich unter den Pullover. Dann setzte er sich.
Wilfried Saborski griff zur Bibel und die anderen taten es ihm nach. Mit salbungsvoller Stimme begann Saborski aus dem Johannes-Evangelium zu zitieren: »Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde.«
Die Tür wurde aufgerissen und drei französische Soldaten betraten den Saal, begleitet von einem Zivilisten.
»Ausweiskontrolle«, rief Letzterer auf Deutsch in die Runde.
Unbeeindruckt rezitierte Wilfried Saborski weiter: »Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.«
»Die Ausweise«, forderte der Polizist erneut. »Dalli, dalli.«
»Diese ungeladenen Besucher stören das Wort des Herrn«, entgegnete Saborski ruhig, klappte die Bibel aber zu und zückte seine Papiere. Wortlos und ohne die Soldaten eines Blickes zu würdigen, legte er seinen Ausweis vor sich auf den Tisch.
Der Franzose griff danach und musterte das Dokument gründlich, während die Soldaten die anderen Anwesenden kontrollierten. »Was machen Sie hier?«
Saborski hielt die Bibel hoch. »Das sehen Sie doch«, erwiderte er. »Wir lesen die Bibel. Warum bedrohen französische Soldaten friedliebende Gläubige mit der Waffe.«
Misstrauisch beäugte sein Gegenüber die Männer. »Warum sind keine Frauen hier?«, wollte er wissen.
»Unter den Jüngern des Herrn waren auch keine Frauen, wenn ich mich recht erinnere«, erwiderte Saborski. »Oder?«
Unwirsch gab der Polizist die Papiere zurück. »Die Ausgangssperre beginnt um neun Uhr.«
»Dann sind wir selbstverständlich wieder bei unseren Familien«, antwortete Saborski. »Schließlich wollen wir ja nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Auch wenn es sich um ein aufgezwungenes Gesetz handelt.«
»Passen Sie auf, was Sie sagen!«, blaffte der Franzose. »Und beten Sie schön.«
Dann verließ er, gefolgt von den Uniformierten, den Raum.
Wenig später öffnete der Wirt erneut die Tür. »Die Luft ist rein. Sie sind weg.«
Die Anspannung der Männer machte sich in lautem Gelächter Luft.
Breit grinsend zeigte Saborski auf die Bibel. »Gottes Wort ist wirklich ein Helfer in der Not, nicht wahr?«
5
Freitag, 2. Februar 1923
Die Familie Schafenbrinck hatte den Bau ihrer Stadtvilla kurz nach der Jahrhundertwende in Auftrag gegeben. Das nach fast zwei Jahren fertiggestellte Gebäude bot auf drei Etagen großzügig Platz. Zur Straßenseite hin zierten die Fassade sorgsam ausgearbeitete Ornamente und Figuren, die Szenen aus der Bibel darstellten. Die Gartenfront war schlichter gestaltet.
Abraham Schafenbrinck hatte schwer darum kämpfen müssen, vom hiesigen Bürgertum akzeptiert zu werden. Sein Vater Samuel war wenige Jahre nach Abrahams Geburt zum
Christentum konvertiert und die ganze Familie, mit Ausnahme der schon recht betagten Großmutter, folgte seinem Beispiel. Aber unter dem unterschwelligen Antisemitismus hatte die Familie auch nach dem Religionswechsel noch zu leiden. So zum Beispiel hatte der Pfarrer, als Samuel Schafenbrinck kurz nach dem Übertritt überraschend starb, eine christliche Beerdigung mit dem Argument verweigert, dass der Verstorbene schließlich im jüdischen Glauben erzogen worden und es den übrigen Mitgliedern der Gemeinde nicht zuzumuten sei, um ihre Angehörigen an Grabstätten zu trauern, die unmittelbar neben der eines geborenen Juden lagen. So fand der Vater Abrahams schließlich seine letzte Ruhe auf dem jüdischen Friedhof im Norden Recklinghausens, wo auch schon die Ahnen der Familie begraben lagen.
Dabei empfanden sich die Mitglieder der weit verzweigten Familie ausnahmslos als deutsche Patrioten. Viele männliche Familienmitglieder hatten in den letzten Kriegen auf deutscher Seite gekämpft, nicht wenige von ihnen waren mit Tapferkeitsorden ausgezeichnet worden. Doch in den Augen ihrer christlichen Mitbürger blieben sie vor allem eins: Juden. Und damit für die meisten Deutschen ein Fremdkörper. Erst Abraham Schafenbrinck war es dank seines wirtschaftlichen Erfolges gelungen, gesellschaftliche Barrieren zu überwinden – zumindest dem äußeren Anschein nach war die Familie in der Bürgerschaft integriert.
Tränen liefen Hermann Treppmann über das Gesicht, als er nun in der Nachmittagssonne auf die religiösen Motive starrte. Seitdem Agnes sich um die Stelle beworben und er sie zu ihrem Vorstellungstermin begleitet hatte, war er nicht mehr in dem Gebäude gewesen. Er konnte sich noch genau daran erinnern, wie aufgeregt seine Kleine damals gewesen war. Und jetzt, zwei Jahre später, war sie tot. Geschändet und erwürgt mit dem Koppel eines französischen Soldaten.
Treppmann läutete. Es dauerte eine Weile, bis er Schritte hörte. Marianne, die Köchin, öffnete die Tür.
»Oh, Herr Treppmann«, begrüßte sie ihn mit erstickter Stimme. »Schrecklich. Wirklich schrecklich. Mein herzliches Beileid.«
Hermann Treppmann murmelte einen Dank.
»Sie werden schon erwartet. Wenn ich vorgehen darf?« Sie schloss die Tür und marschierte schnellen Schrittes zur Treppe, die in die darüber liegenden Etagen führte. Die Räume im Erdgeschoss dienten ausschließlich repräsentativen Anlässen. Gewohnt wurde in den oberen Stockwerken.
»Ihren Mantel bitte.«
Etwas verlegen entledigte sich Treppmann des Kleidungsstücks und reichte es der Hausangestellten.
»Wollen Sie den Schal und die Mütze ...« Marianne streckte die Hand aus.
»Ach so. Entschuldigen Sie.« Er war eine solch zuvorkommende Behandlung nicht gewohnt und fühlte sich unsicher. Das hier war nicht seine Welt.
Abraham Schafenbrinck stand auf, als sein Besucher in das Arbeitszimmer geführt wurde, und ging Treppmann ein paar Schritte entgegen.
»Herr Treppmann«, sagte er und deutete auf die Sitzgruppe in einer Ecke des Raumes. »Bitte. Einen Kaffee?« Treppmann nahm Platz und schüttelte den Kopf.
»Einen Cognac vielleicht?«
»Nein danke.« Unsicher knetete der Bergmann seine Finger. Schafenbrinck gab der Köchin, die in der offenen Tür gewartet hatte, mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass ihre Dienste nicht länger benötigt wurden. Leise schloss sie die Tür hinter sich. Die Männer nahmen Platz.
»Ich habe Ihnen ja schon vor einigen Tagen gesagt, wie sehr diese grausame Tat meine Frau und mich getroffen hat.
Agnes ist uns beiden sehr ans Herz gewachsen. Wir waren immer sehr zufrieden mit ihr. Ihr Kind war ehrlich, offen und fleißig. Sie können stolz auf sie sein.«
Treppmann nickte dankbar. Er spürte, dass seine Augen schon wieder feucht wurden.
»Ich möchte zwei Punkte mit Ihnen besprechen. Zum einen Agnes’ Lohn.« Der Kaufmann griff in die Seitentasche seines Sakkos, zog einen Briefumschlag hervor und reichte ihn seinem Besucher. »Ich habe mich entschlossen, den Betrag, der Ihrer Tochter noch zugestanden hätte, um drei Monatslöhne aufzustocken. Natürlich erfolgt die Zahlung wie bisher in Gutscheinen. Sind Sie damit einverstanden?«
»Ja, sicher.« Hermann Treppmann griff zu dem Briefumschlag. »Danke.«
»Dann wäre da noch etwas.« Schafenbrinck lehnte sich zurück. »Die französischen Besatzungsbehörden haben die beiden Soldaten, die zur Tatzeit am Bahnhof in Börnig Wache geschoben haben, vor ein Militärgericht gestellt.«
Treppmann richtete sich auf und sah sein Gegenüber gespannt an. »Woher wissen Sie das?«
»Der kommandierende General hat es unseren Behörden mitgeteilt, die dann mich informiert haben.«
»Die Mörder stehen vor Gericht. Das ist gut.«
»Sie standen, Herr Treppmann. Standen. Das Verfahren ist bereits beendet.«
»Sind die Täter verurteilt worden?« Treppmanns Gesichtsausdruck ließ erkennen, dass er nicht verstand, was Schafenbrinck ihm zu erklären versuchte.
»Wissen Sie, wie diese Gerichte arbeiten?«
Treppmann schüttelte den Kopf.
»Militärgerichte sind nicht mit der normalen Gerichtsbarkeit, so wie wir sie kennen, zu vergleichen. Richter, Ankläger und Verteidiger sind Offiziere, keine Juristen. Als Zeugen wurden nur die beiden Schutzpolizisten gehört, die dabei waren, als Ihre Tochter gefunden wurde. Und die Gerichtssprache ist Französisch.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«
»Es gab zwar einen Dolmetscher, aber auch das war ein Offizier. Wie es heißt, hat er die Aussage der Polizisten nur unzureichend übersetzt. Nach knapp einer Viertelstunde waren die Zeugen wieder entlassen. Das gesamte Verfahren hat nicht mehr als eine Stunde gedauert.«
»Wie ist es ausgegangen?«
»Machen Sie sich bitte keine allzu großen Hoffnungen auf ein gerechtes Urteil.«
Agnes’ Vater sprang auf und rief erregt: »Wie lautet es?«
Schafenbrinck seufzte. »Freispruch. Wegen erwiesener Unschuld.«
Treppmann schlug die Hände vor das Gesicht.
»Das Urteil ist endgültig. Eine Revision gibt es zwar. Aber sie hätte binnen vierundzwanzig Stunden eingereicht werden müssen. Wer hätte das tun sollen? Der französische Ankläger? Oder der Verteidiger? Außerdem kann ein Revisionsantrag eigentlich nur auf prozessuale Mängel gestützt werden. Und die lagen in diesem Fall augenscheinlich nicht vor.«
»Das heißt, die Mörder meiner Tochter laufen wieder frei herum?«
»Wenn die beiden Soldaten tatsächlich die Täter waren, ja.«
»Und da kann man gar nichts machen?«
»Leider nein.«
»Aber die Beweise ... Das Koppel ...«
Schafenbrinck zuckte mit den Schultern. »Wie es heißt,
konnten die verdächtigen Soldaten nachweisen, dass sie im Besitz ihrer Koppel waren.«
»Und die Augenzeugen? Kalle Soltau und Adolf Schneider haben die Franzosen doch an dem Abend ganz in der Nähe der Ruine gesehen.«
»Erstens wurden diese Zeugen vom Gericht nicht gehört, zweitens haben die Soldaten ausgesagt, dass sie um diese Zeit auf ihrem Posten am Bahnhof waren.«
»Die lügen doch. Hat sie dort jemand gesehen?«
»Nein. Aber sie haben ihre Aussagen gegenseitig bestätigt. Und da sie unter Eid gestanden haben, hat das Gericht ihnen geglaubt. Herr Treppmann, finden Sie sich damit ab. Eine irdische Gerechtigkeit wird die Mörder Ihrer Tochter aller Wahrscheinlichkeit nicht strafen. Vertrauen Sie auf Gott. Er wird die Schuldigen richten.«
Treppmann machte eine verächtliche Handbewegung. »Nichts für ungut, Herr Schafenbrinck. Sie haben mir und meiner Familie wirklich sehr geholfen. Aber lassen Sie mich mit Gott in Ruhe. Tot sehen will ich die Kerle, die meinem Mädchen das angetan haben. Gottes Gerechtigkeit reicht mir nicht. Aber so ist es nun mal: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.«
»Ich kann verstehen, dass Sie verzweifelt sind. Es tut mir wirklich leid, Ihnen auch noch diesen Schmerz bereiten zu müssen.«
»Können wir die Täter nicht vor unsere Gerichte stellen? Es muss doch einen Weg geben«, klagte Treppmann.
»Herr Treppmann, verstehen Sie doch: General Degoutte hat eindeutig verfügt, dass alle französischen Militärpersonen ausschließlich der französischen Militärgerichtsbarkeit unterliegen. Deutsche Gerichte sind nicht zuständig. Ich fürchte, es bleibt Ihnen tatsächlich nichts anders übrig, als auf Gott zu hoffen.«
»Das, Herr Schafenbrinck, dauert mir zu lange.«
6
Sonntag, 4. Februar 1923
Schweißgebadet wachte Peter Goldstein auf. Seine Zunge fühlte sich pelzig an. Langsam öffnete er die Augen. Auf seinem Sofakissen fanden sich Blutspuren. Einmal mehr hatte er sich im Schlaf die Lippen blutig gebissen. Warum konnte die Vergangenheit nicht von ihm lassen, warum verfolgte sie ihn unablässig in seinen Träumen?
Goldsteins Schulter schmerzte. Wie so oft war er auf dem kleinen Sofa eingeschlafen, das zusammen mit einem Sessel, einem Stuhl und einem klapprigen Eichentisch fast das gesamte Mobiliar seiner Küche bildete. In der Ecke des etwa fünfzehn Quadratmeter großen Raumes befand sich ein rundes Waschbecken aus Emaille, links daneben stand der Küchenofen, der als Kochstelle und einzige Wärmequelle diente. Peter Goldstein fröstelte. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Ofen über Nacht ausgegangen war.
Mühsam richtete sich Goldstein auf. Das Buch, in dem er bis tief in die Nacht gelesen hatte und darüber eingeschlafen war, fiel zu Boden. Er wischte sich mit der Hand über die Augen, um den Schlaf, aber vor allem die Erinnerung an den schrecklichen Traum zu verscheuchen. Er musste Feuer machen.
Eine Viertelstunde später verbreitete der Kohleofen eine wohlige Wärme. Goldstein stellte eine große Schüssel mit Wasser auf die Herdplatte, dann zog er sich aus, putzte mit kaltem Wasser seine Zähne, löste ein wenig Seife mit dem Naturhaarpinsel in einen kleinen Becher und verteilte den Schaum sorgfältig in seinem Gesicht. Er klappte das Rasiermesser auf und schabte, die Haut mit dem Zeige- und Mittelfinger der linken Hand spannend, die Bartstoppeln von Wangen und Hals. Kritisch musterte er sich im Spiegel, nickte befriedigt und spülte den restlichen Schaum ab. Anschließend prüfte er die Temperatur des Wassers in der Schüssel und wusch sich gründlich und systematisch.
In seiner kleinen Kammer, in der er üblicherweise schlief, prangten Eisblumen am Fenster. Peter Goldstein ließ die Tür zur Küche offen, um auch diesen Raum etwas zu erwärmen, und ging zum Schrank, um sich anzuziehen. Lange brauchte er nicht, sich zu entscheiden. Seine Sonntagskleidung bestand aus einer ziemlich extravaganten, mittelgrauen Oxfordhose, deren Erwerb er sich im letzten Herbst im wahrsten Sinne des Wortes vom Munde abgespart hatte, und einem farbig dazu passenden, eng geschnittenen Sakko. Darunter trug er im Winter üblicherweise einen grauen Pullover, ein weißes Hemd mit weichem Kragen und eine breite, grob gemusterte Krawatte. Diese hatten ihm im letzten Jahr ehemalige Kameraden des Freikorps zum Geburtstag geschenkt. Ansonsten bestand seine gesamte weitere Garderobe noch aus zwei groben, dunklen Stoffhosen, einem schwarzen, schon recht verschlissenen Überrock sowie einigen Hemden und Pullovern. Gegen die Kälte schützten ihn ein schwarzer, langer Mantel mit tief gezogenem Revers und seine Wolljacke. Zwei Paar Schuhe nannte er sein Eigen, beide schon ausgetreten und mit fast durchgelaufenen Sohlen. Einen Dandy konnte man Peter Goldstein also trotz der Knickerbockers nun nicht gerade nennen.
Fünf Minuten später kehrte er angekleidet in die Wohnküche zurück, warf einen Blick in den Ofen und schüttete eine weitere Lage Kohlen hinein. Das würde bis zu seiner Rückkehr reichen, hoffte er. Noch einmal betrachtete er sich im Spiegel. Er sah einen schlanken, etwa ein Meter achtzig großen Mann mit dunkelblondem, lockigem Haar. Einigermaßen zufrieden verließ er seine Behausung.
Mit quietschenden Rädern zwängte sich die Elektrische in die letzte Kurve.
»Nächster Halt«, rief der Schaffner in den an diesem Sonntagmorgen nur spärlich besetzten Waggon, »ist Potsdamer Platz.«
Peter Goldstein erhob sich von seinem Sitz und ging zur hinteren Plattform. Bremsen kreischten. Die Straßenbahn verlangsamte ihre Fahrt und hielt mit einem Ruck an.
»Potsdamer Platz. Zum Umsteigen in die Linien ...«
Den Rest der Ansage hörte er schon nicht mehr. Goldstein schloss den obersten Knopf seiner Jacke, zog den Schal fester und sprang auf die Straße, kaum dass die Straßenbahn zum Stehen gekommen war. Es hatte zu schneien begonnen. Die Kälte kroch bis unter die Haut. Eilig überquerte er die Straße und ging zum Zeitungskiosk an der Südseite des Platzes, bei dem er sich jeden Sonntag seine Lektüre besorgte. Natürlich schrien ihm die Schlagzeilen auch heute die Nachrichten von der Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen entgegen.
»Na, wieder die Presse des Erzfeindes kaufen?«, berlinerte Hans, der Zeitungsverkäufer, zur Begrüßung.
Goldstein nickte. »Und die Frankfurter Zeitung von gestern, wenn Sie noch eine haben.« Zwar waren ihm die Ansichten dieses Blatt häufig zu liberal, aber als überregionale Tageszeitung vermittelte sie eine Gesamtschau der deutschen und internationalen Politik, die die Berliner Presseerzeugnisse in der Regel nicht boten.
»Natürlich. Ich habe eine für Sie zurückgelegt.«
Goldstein nickte dankend und zahlte. Dann machte er sich auf, um in seinem Stammcafé nicht weit vom Potsdamer Platz entfernt zu frühstücken und in Ruhe zu lesen.
Goldstein genoss diese Sonntage. Zwar reichte sein Gehalt als beamteter Kriminalassistent bei der erst vor wenigen Monaten gegründeten Landeskriminalpolizeistelle Berlin-Mitte eigentlich nicht aus, um sich Woche für Woche einen solchen Luxus zu gönnen. Aber lieber ließ er das Mittagessen ausfallen, als auf frische Schrippen mit Käse, ein gekochtes Ei, süßen Milchkaffee und die Lektüre vor allem der Zeitung Le Petit Parisien zu verzichten. Zweisprachig im Elsass aufgewachsen, war das Studium dieses Blattes für ihn die einzige Gelegenheit, seine Französischkenntnisse nicht einrosten zu lassen.