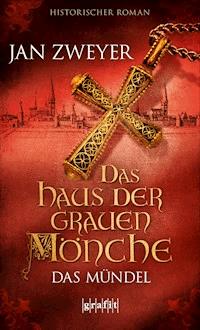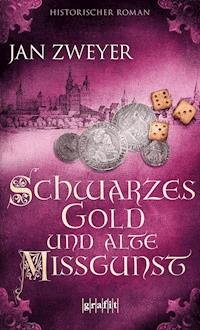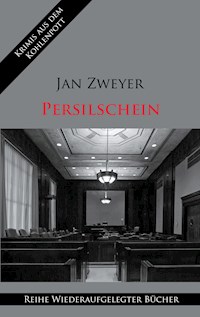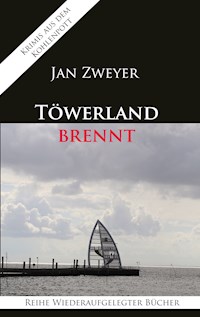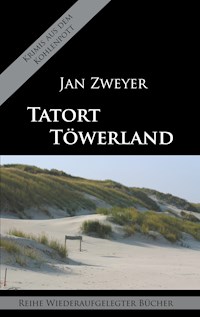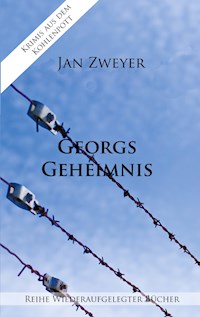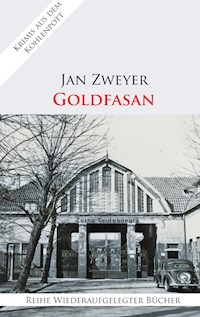
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Deutschland 1943: Die polnische Haushaltshilfe des stellvertretenden Kreisleiters der NSDAP in Herne verschwindet von einem Tag auf den anderen. Hauptkommissar Peter Golsten, der seinen Namen Goldstein früh und vorausschauend verkürzt hat, erhält den Auftrag, der Sache nachzugehen. Was Golsten nicht weiß: Es ist gar nicht erwünscht, dass er Erfolg hat, und so wird er für einige Leute schon bald sehr unbequem. Doch auch Golsten selbst gerät in eine unbequeme Situation, denn sein Schwiegervater bietet in dem gemeinsamen Wohnhaus einem Juden Schutz vor den Nazis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne. Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie (Franzosenliebchen, Goldfasan, Persilschein) das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte die fünfbändige Linden-Saga, eine historische Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet, ein Thriller zur Flüchtlingsproblematik (Starkstrom) und 2020 ein Ökothriller (Der vierte Spatz).
In der Reihe Wiederaufgelegter Bücher werden verlagsseitig vergriffen Texte von Jan Zweyer als Buch und eBook neu veröffentlicht. Der Originaltext unterliegt jetzt den neue Rechtschreibregeln. Inhaltliche Veränderungen wurden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.
Der Goldfasan (Chrysolophus pictus) ist eine Vogelart aus der Familie der Fasanenartigen (Phasianidae) und der Ordnung der Hühnervögel (Galliformes).
Der Goldfasan bewohnt Bergland im mittleren China, Ende des 18. Jahrhunderts in Großbritannien ausgesetzt, überlebte er in mindestens zwei Populationen (Südwestschottland, Südostengland) in jüngeren Lärchen- und Kiefernplantagen und Mischwald mit dichtem Unterholz. Frei lebende Goldfasane kommen vereinzelt auch in Deutschland vor. Die Art ist ungefährdet.
Goldfasan war im Nationalsozialismus auch eine Spottbezeichnung für ›Amtsträger‹ der NSDAP, insbesondere politische Leiter wegen ihrer goldbraunen Uniformen mit goldfarbenen Knöpfen.
aus: Wikipedia
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Nachbemerkung
1
Montag, 22. März 1943
Auf Flucht standen drakonische Strafen. Schon der Versuch konnte das Leben kosten. Er wollte jedoch gar nicht fliehen, sondern sie nur besuchen. Wenigstens kurz, eine halbe Stunde vielleicht. Ihr Gesicht sehen, den Geruch ihres Haares atmen. Nur für Minuten. Das war ihm das Risiko wert. Dann würde er wieder in das Lager zurückkehren.
Seit drei Jahren arbeitete er in Deutschland, dem Land, von dem seine Großmutter immer so geschwärmt hatte. Gebildet seien die Menschen dort, hatte sie ihm erzählt, wohlhabend.
Die Deutschen, mit denen er jetzt zu tun hatte, waren anders. Gleichgültig die meisten, einige brutal. Sie hatten ihn am Bahnhof seiner Heimatstadt verhaftet und ihn nur mit dem, was er auf dem Leibe trug, mit anderen in einen Viehwagen gesteckt und nach Deutschland verfrachtet. Zum freiwilligen Arbeitseinsatz, wie das die Häscher lachend genannt hatten. Dummerweise hatte er die Frage des Offiziers, ob er Deutsch spreche, bejaht. So hatte man ihn in das fremde Land geschickt.
Tagsüber schufteten sie wie Sklaven in großen und kleinen Betrieben, nachts wurden sie einkaserniert und bewacht. Wer nach Einbruch der Dämmerung auf den Straßen aufgegriffen wurde, bezahlte schwer dafür.
Das Lager nördlich des Herner Stadtparks umfasste nicht mehr als drei Baracken. In jeder schliefen fast fünfzig Männer. Ein großer Raum mit zwanzig Schlafstätten, drei Betten übereinander. Nur fünf Stühle. Ein Tisch. Geheizt wurde mit einem viel zu kleinen Ofen. Das wenige, was man ihnen als Brennmaterial zugestand, war in wenigen Stunden verbraucht. Der Abort war ein Loch in der Erde mit einem Holzverschlag darüber. Eiskalt im Winter, erbärmlich heiß und stickig im Sommer. Stand der Wind ungünstig, regnete es hinein, denn es gab keine Tür. Waschen konnten sie sich im Inneren der Baracke. Neben dem Eingang befand sich hinter einer Holzwand ein Waschbecken für fünfzig Männer.
Langsam schob er sich von seiner Pritsche. Nur kein Geräusch verursachen. Er zog die Hose an, streifte den dicken Pullover und die wattierte Jacke über. Dann lauschte er. Nichts. Nur das regelmäßige Atmen und rhythmische Schnarchen der Männer. Er schlich zwischen den Betten Richtung Fenster, das immer offen stand, solange es draußen nicht Stein und Bein fror.
Die Schuhe hielt er in der Rechten. Er würde sie erst anziehen, wenn er die Baracke verlassen hatte. Ruhig, nur ruhig.
Sein Bettnachbar zur Linken drehte sich, als er seine Schlafstatt passierte. Für einen Moment öffnete der Mann die Augen, sah seinen Kameraden, wollte zum Sprechen ansetzen. Schnell hielt er dem Liegenden den Mund zu und flüsterte: »Uspokój śię. Sei ruhig. Schlaf weiter. Śpij dalej. Niedługo bendę spowrotem. Ich bin bald zurück.«
Der andere nickte mitfühlend und lächelte.
Er machte den letzten Schritt zum Fenster, sah in die Dunkelheit und schob sich dann über die Brüstung. Draußen schlüpfte er in die klobigen Schuhe und lief Richtung Abort. Dort blieb er einen Moment stehen und klopfte prüfend auf seine Jackentasche. Ja, die Briefe waren sicher verstaut. Er vergewisserte sich, dass niemand Streife ging, und huschte in gebückter Haltung zum Stacheldrahtzaun. Erneut lauschte er in die Dunkelheit, um sich schließlich unter dem Drahtverhau durchzuzwängen. Eine Kirchturmuhr schlug zehn.
Das Lager war nicht besonders gesichert. Von zwei jüngeren Soldaten abgesehen, taten hier nur Invaliden Dienst. Und die verbrachten die Nächte lieber in der wohligen Wärme ihrer Wachstuben, nur selten kam einer von ihnen heraus, um nach dem Rechten zu sehen.
Es war nicht weit bis zu ihrer Arbeitsstelle, doch er musste sehr vorsichtig sein. Wenn er aufgriffen würde, war es um ihn geschehen. Die Verdunkelung kam ihm zu Hilfe. Keine Lampe brannte. Nur der Mond warf sein fahles Licht.
Sie versuchten, sich alle zwei Wochen zu sehen. Immer Montagnacht, kurz nach zehn Uhr. Ihre Herrschaft benötigte sie für gewöhnlich um diese Zeit nicht mehr und sie konnte sich heimlich aus dem Haus stehlen. Doch manchmal wartete einer von ihnen vergeblich auf den anderen.
Nur selten gelang ihnen ein Treffen tagsüber. Wenn sie Besorgungen zu erledigen hatte und er in der Nähe tätig war. Das konnte nur dann gelingen, wenn ein freundlicher Kollege beide Augen zudrückte und ihm diesen kleinen Freiraum verschaffte. Unter den Deutschen waren solche Menschen die Ausnahme. Und natürlich mussten sie derartige Treffen vorher verabreden können. Deshalb die Briefe. Täglich schrieben sie sich und tauschten ihre Post bei ihren Treffen aus.
Heute wartete sie schon auf ihn. Er griff ihre Hand, zog sie weg vom Haus hinter einen Busch, wo sie wenigstens für den Moment ungestört waren. Atemlos küssten sie sich. Für Minuten blieben sie regungslos stehen, sich aneinander festhaltend.
2
Mittwoch, 24. März 1943
Die schmächtige Gestalt hockte seit Stunden unter dem großen Rhododendron und spähte durch das immergrüne Gewirr von Zweigen auf das Haus, das an der anderen Straßenseite stand. Es war kalt und das Blätterdach bot nur wenig Schutz vor dem leichten, dafür aber unablässig fallenden Regen. Die Jacke des Jungen war schon lange durchnässt, Wasser lief von der Schirmmütze in seinen Nacken. Seine Glieder waren steif, aber nur ein Bombenalarm hätte ihn zur Aufgabe seines Beobachtungspostens bewegen können. Damit war allerdings nicht zu rechnen. Noch war Herne von größeren Angriffen verschont geblieben. Und bei so einem Wetter wurden in der Regel sowieso keine Angriffe geflogen.
Der höchstens Siebzehnjährige wusste nicht genau, wie spät es war. Er schätzte, dass vor etwa zwanzig Minuten vom nahe gelegenen Kirchturm neun Schläge zu hören gewesen waren. So musste er nur noch eine knappe Dreiviertelstunde ausharren.
Er schaute wieder auf das gegenüberliegende Gebäude. Im Dunkeln wirkte das Haus eher unscheinbar, trotz des Balkons über dem Eingang, der von zwei Säulen aus Sandstein gestützt wurde.
Er wechselte sich mit zwei seiner Freunde bei der Beoachtung ab. Morgens um sechs ging es los. Manchmal waren sie zu zweit. Dann konnten sie so tun, als ob sie auf der Straße vor dem Haus nur Fußball spielen wollten. Abends und des Nachts jedoch warteten sie einen geeigneten Zeitpunkt ab, um schnell unter den Busch zu kriechen. Aber sie blieben nie länger als bis zehn Uhr. Wenn sie nicht spätestens um elf zurück in der elterlichen Wohnung waren, drohten Strafen.
In der Villa, die sie seit Tagen observierten, war alles ruhig. Die Vorschriften zur Verdunklung wurden von den Bewohnern peinlichst eingehalten.
Heute war der vierte Tag, an dem sie auf der Lauer lagen. Aber sie konnten immer noch kein Muster im Tagesablauf der Bewohner des Hauses feststellen. Mal verließ der Hausherr das Gebäude bereits kurz nach sechs Uhr, dann wieder erst um neun. Auch die Rückkehr war nicht vorherzusehen. Die letzten Abende beispielsweise war er überhaupt nicht nach Hause zurückgekehrt, zumindest während des Zeitraums ihrer Überwachung nicht. Da er am heutigen Morgen die Villa auch nicht verlassen hatte, lag die Vermutung nahe, dass er woanders übernachtet hatte. Doch es gab auch ein paar Rituale. Wenn er da war, öffnete der Hausherr zu Beginn seines Tagwerks die Tür, trat zwei Schritte ins Freie, sah einen Moment nach oben, als prüfe er die Wetterlage, drehte sich anschließend wieder zur Tür, um seiner dort wartenden Frau einen Abschiedskuss zu geben. Dann durchmaß er mit weiten Schritten den Vorgarten, bis er seinen vor der Villa geparkten Wagen vom Typ Wanderer erreichte, öffnete erst die rechte Beifahrertür, um seine Aktentasche im Inneren des Fahrzeugs abzulegen, winkte seiner Gattin noch einmal zu, umrundete den Wanderer, stieg ein und fuhr los.
Möglicherweise hingen die unterschiedlichen Aufbruchtermine mit den verschiedenen Wochentagen zusammen. Aber um das herauszufinden, mussten sie ihre Beobachtung fortsetzen. Sie brauchten Gewissheit, wann der Mann genau kam und ging und welche Gewohnheiten er hatte. Außerdem sollten sie auch das Kommen und Gehen möglicher Besucher akribisch notieren. So lautete ihr Auftrag.
Gefährlich sei die Aufgabe, hatte der Rote gemahnt. Und gerade das war es, was den Jungen und seine Freunde gereizt hatte. Das war kein Räuber-und-Gendarm-Spiel, sondern Realität. Und obwohl der Rote sie eindringlich über das Risiko aufgeklärt hatte, verdrängten sie jeden Gedanken an das, was passieren könnte, würden sie geschnappt werden. Dem illegalen Widerstand helfen zu können, war zu verlockend. Und einfach spannend.
Motorengeräusch ließ den Jungen aus seinen Gedanken aufschrecken. Langsam rollte eine dunkle Limousine mit abgedunkelten Scheinwerfern die Straße entlang und hielt vor der Villa. Der Junge erkannte das Modell sofort: ein schwerer Horch, in der Pullman-Ausführung.
Der Fahrer und ein weiterer Mann stiegen aus. Ersterer wartete neben dem Wagen, der andere ging zum Haus und klopfte. Kurz darauf wurde die Tür geöffnet und leise Stimmen störten die nächtliche Stille, doch zu verstehen war nichts. Schließlich trat eine zierlichere Person ins Freie. Der Mann, der geklopft hatte, zündete sich eine Zigarette an und der Lichtschein erhellte kurz das Gesicht der Hinaustretenden. Eine Frau, vermutlich noch jung. Der Junge erinnerte sich. Er hatte sie schon gestern Nacht gesehen, als sie sich mit diesem Fremden getroffen hatte. Der, mit dem sie für einige Minuten in die Büsche verschwunden war. Der Mann hatte den Anschein erweckt, als ob er sich verfolgt fühlte. Immer wieder hatte er sich umgesehen, gehetzt gewirkt.
Der Mann, der sie jetzt zum Fahrzeug führte, war jedoch ein anderer, ihn hatte der Junge noch nie gesehen. Für einen Moment hatte er den Eindruck, dass die Frau ihrem Begleiter nicht ganz freiwillig folgte. Hatte der Mann sie nicht gerade heftig gepackt? Oder hatte er sie doch nur galant zum Wagen begleitet, ihr seinen Arm als Stütze dargeboten?
Als beide neben dem Wagen standen, wurde eine hintere Tür von innen geöffnet. Es befand sich also noch jemand im Auto. Die Frau und ihr Begleiter stiegen ein. Der Fahrer schloss hinter ihnen die Tür, begab sich zu seinem Platz, startete den Motor und der Horch verschwand in der Nacht. Dann war nur noch das leichte Plätschern des Regens zu hören.
3
Donnerstag, 25. März 1943
Walter Munder parkte den Wagen vor seinem Haus und stieg aus. Der stellvertretende Kreisleiter der NSDAP in Herne griff nach seinem Koffer auf der Rückbank, verriegelte die Wagentür und lief federnden Schrittes auf den Eingang zu.
»Ich bin wieder da!«, rief er, nachdem er die Haustür aufgestoßen hatte. Niemand antwortete.
Irritiert betrat er den Salon. Auf einem der Polster hockte seine Frau und musterte ihn gleichgültig.
»Warum antwortest du mir nicht?«, wollte er wissen und näherte sich dem Sessel, in dem es sich Charlotte Munder bequem gemacht hatte.
»Ich habe nicht gehört, dass du eine Frage gestellt hast. Du hast lediglich kundgetan, dass du wieder da bist. Schön. Ich habe das zur Kenntnis genommen.« Sie saß mit angezogenen Beinen da und schaute zu ihrem Mann hoch.
Der beugte sich vor und küsste sie auf die Wange. Verärgert runzelte er die Stirn. »Du hast wieder getrunken«, stellte er fest.
»Wie kommst du darauf?«, fragte sie zurück.
»Du riechst nach Alkohol. Wir hatten doch vereinbart …«
»Und du stinkst nach billigem Parfüm, welches nicht von mir ist«, giftete sie. »Wenn ich dich erinnern darf: Auch darüber gibt es eine Vereinbarung.«
»Es ist nicht so, wie du denkst. Ich war auf einer Dienstreise, wie du weißt. An diesen Tagungen nehmen nicht nur Männer teil, sondern auch Frauen. Ich habe den ganzen Vormittag neben einer dieser Damen gesessen und mir ziemlich langweilige Reden angehört. Und diese Dame teilt deinen extravaganten Geschmack nicht, sondern hatte zu viel von dem Zeug benutzt. Leider rieche ich immer noch danach. Das ist die ganze Erklärung. Zufrieden?«
Charlotte Munder verzog das Gesicht.
»Fang bloß nicht wieder an zu flennen«, blaffte er. »Erst saufen und dann die Selbstbeherrschung verlieren. Hat dir das deine Mutter beigebracht?«
»Lass meine Mutter aus dem Spiel«, zischte Charlotte Munder. »Was bleibt mir denn schon?«, jammerte sie dann. »Du bist nur noch unterwegs, treibst dich mit irgendwelchen Flittchen herum und …« Sie schwieg erschrocken.
Für einen kurzen Moment schien es, als ob Walter Munder die Hand gegen seine Frau erheben wollte. Doch stattdessen brüllte er: »Wie kannst du es wagen, mir Vorhaltungen zu machen? Was meinst du eigentlich, wer du bist? Wer bietet dir dieses Leben hier? Das Haus, deine Kleider und natürlich den Kognak, den du in dich hineinschüttest?«
Als sie den Mund öffnete, hob er seine Stimme noch mehr. »Ja, ich weiß schon! Dein Vater könnte dir das auch bieten. Das wolltest du doch sagen, oder? Dann geh doch zurück zu deinem Vater, wenn du meinst, dass es dir da besser geht.«
»Walter, bitte.«
»Was, bitte?«
»Lass uns nicht streiten, ja?«, flehte Charlotte Munder. »Du warst so lange fort. Und ich bin so allein gewesen.«
Etwas besänftigt setzte sich Walter Munder in einen der anderen Polstersessel und griff seinerseits zur Kognakflasche, um sich ein Glas einzuschenken. »Es waren lediglich drei Tage«, meinte er. »Na gut. Vergeben und vergessen.«
Charlotte Munder zog ein Tuch aus den Taschen ihres Hausmantels und trocknete ihre Tränen.
»Was gibt es zu essen?«, erkundigte sich Munder in einem Tonfall, der nichts mehr von seinem vorherigen Wutausbruch ahnen ließ.
»Ich habe noch nichts vorbereitet«, erwiderte seine Frau.
»Seit wann kümmerst du dich um die Zubereitung der Speisen? Das macht doch sonst immer Marta. Wo ist sie überhaupt?«
»Sie ist weg.«
Munder sah erstaunt auf. »Was heißt das: Sie ist weg?«
»Wie ich sagte. Sie ist verschwunden. Einfach so.«
»Weggelaufen?«
»Ich glaube schon.«
Walter Munder sprang auf. »Seit wann?«
»Ich habe sie vorgestern zum Schuster geschickt, um Schuhe abzuholen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen.«
»Vorgestern? Warum hast du mich nicht informiert?«
»Du warst doch nicht da.« Ihre Stimme wurde wieder leiser.
»Aber es gibt doch Telefon! Du hättest mich sofort anrufen müssen.« Munder lief auf und ab, das Kognakglas in der Hand.
»Dich interessiert die Ostarbeiterin mehr als ich«, beschwerte sich seine Frau. Nun liefen doch Tränen über ihre Wangen.
»Blödsinn. Was sagt die Polizei?«
»Ich habe das Verschwinden noch nicht gemeldet.«
Entgeistert schüttelte Munder den Kopf. »Du sitzt hier herum, trinkst Kognak und eine Ostarbeiterin, für die ich die Verantwortung trage, macht sich aus dem Staub? Einfach so?«
»Kein Wunder, dass sie gegangen ist. So wie du sie behandelt hast.«
»Du machst mir Vorwürfe? Ausgerechnet du?« Er machte eine abwertende Handbewegung. »Hast du eigentlich eine Ahnung, welche Folgen das für mich haben kann? Auf dein Drängen habe ich mich bei meinen Vorgesetzten dafür stark gemacht, dass du ein Hausmädchen bekommst, obwohl uns keins zustand. Ich habe mich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Vorschriften peinlichst genau befolgt werden. Und nun das! Du hättest ihr Verschwinden sofort anzeigen müssen. Unverzüglich!«
»Aber ich wusste doch nicht …«
»Ja, ja. Du weißt dies nicht, weißt das nicht … Zwei Tage! Diese Polin kann mittlerweile überall sein. Und ich bin dafür verantwortlich.« Munder ließ sich erneut in den Sessel fallen. »Das kann das Ende meiner Karriere bedeuten. Ich habe nicht nur Freunde in der Partei. Es gibt ein paar Leute, die warten nur auf einen solchen Fehler.«
Munder kippte den restlichen Kognak in einem Zug und schwieg nachdenklich. Schließlich fragte er: »Ist dein Vater eigentlich immer noch mit diesem Bochumer Kriminalrat befreundet?«
»Ja, warum?«
»Er muss uns helfen, die Angelegenheit diskret zu regeln.« Munder stand wieder auf. »Ich rufe ihn an.«
Sein Schwiegervater ging glücklicherweise gleich ans Telefon.
Munder erzählte ihm vom Verschwinden der Polin und schloss mit den Worten: »Natürlich muss ich den Vorfall noch heute zur Anzeige bringen. Doch könntest du mit deinen Kontakten dafür sorgen, dass der Fall auf dem kleinen Dienstweg behandelt wird und möglichst bald vom Tisch kommt?«
Für einige Sekunden war es ruhig in der Leitung.
»Hallo? Bist du noch da?«
»Natürlich. Ich habe nur überlegt. Warum rufst du nicht einfach den Kreisleiter an, gestehst das kleine Versäumnis und der Fall ist erledigt?«
»Ja, das wäre naheliegend. Aber unser Verhältnis ist in letzter Zeit etwas gespannt. Wenn er davon erfährt …«
»Verstehe. Du befürchtest, dass er dich mit seinem Wissen unter Druck setzen könnte.«
»Ja. Und nicht nur das. Vielleicht hat er nur auf einen solchen Fehler gewartet, um mich politisch kaltzustellen.«
»Was ist mit dem Gauleiter?«
»Nein, das ist mir zu riskant. Ich weiß nicht genau, wie er zu mir steht. Der Weg über deinen Bekannten bei der Polizei erscheint mir sicherer.«
»Wie du meinst. Wir werden Folgendes machen: Ich versuche jetzt sofort, meinen Freund zu erreichen. Danach melde ich mich wieder bei dir. Erst danach solltest du zur Polizei gehen und eure Ostarbeiterin als vermisst melden. Ich sage dir, wo du das am besten tust. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern.«
4
Montag, 29. März 1943
Gloria Wupperbrück stand unmittelbar vor dem Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft gegen den FC Nord. Plötzlich stoppte der Filmvorführer den Projektor und die Notbeleuchtung des Kinos Alhambra wurde eingeschaltet.
»Luftalarm! Alle in den Bunker!«, rief jemand.
Erst jetzt nahm Lisbeth Golsten das Geheul der Sirenen wahr. Ihre Freundin Marianne Berger zog sie vom Sitz hoch und gemeinsam mit den anderen Zuschauern drängten sie zum Ausgang.
»So ein Mist«, meinte Marianne, als sie endlich schräg über die Mont-Cenis-Straße in Richtung des Bunkers liefen. »Da kommt man einmal an Kinokarten und dann das. Und am Ende handelt es sich mal wieder um Fehlalarm.«
»Meinst du wirklich?«, fragte Lisbeth ängstlich.
»Klar. Das war doch meistens so.«
Die beiden Frauen waren durch Glück und Beziehungen an die Eintrittskarten für den Film Das große Spiel mit René Deltgen, Gustav Knuth und Hilde Jansen gekommen. Seit Tagen schon hatten sie sich auf die Veranstaltung im Kino Käseberg, so der Spitzname für das Lichtspielhaus im Herner Stadtteil Sodingen, gefreut.
In der Schlange vor dem Bunkereingang hoffte Lisbeth: »Vielleicht behalten die Karten ja ihre Gültigkeit und wir können uns den Film ein andermal in voller Länge ansehen.«
»Das glaubst du doch selbst nicht«, erwiderte Marianne Berger. Sie war vor Kurzem sechsunddreißig geworden und damit unwesentlich älter als ihre Freundin Lisbeth Golsten. Im Gegensatz zu dieser führte sie einen unablässigen Kampf gegen die Pfunde, selbst in diesen Zeiten, in denen Lebensmittel rationiert waren. Deshalb war sie etwas außer Atem von dem Lauf. »Der Film war doch schon fast zu Ende. Außerdem gibt’s nur ein paar Vorstellungen.«
»Schade. Jetzt wissen wir nicht, ob Grete nun den Werner oder den Jupp bekommt. Und was mit der Annemarie wird.«
Eine Frau vor ihnen mischte sich in das Gespräch ein, vom Luftalarm anscheinend ebenso unbeeindruckt wie Marianne. »Redet ihr vom Großen Spiel?«
»Ja.«
»Willze den Schluss wissen? Ich hab den Film nämlich ganz gesehen.«
Die Schlange rückte durch die Schleuse weiter vor. Von fern war ein leises Brummen zu hören.
»Zügig weitergehen!«, rief der Luftschutzordner. »In der Reihe bleiben. Und aufschließen.«
Als sie im Inneren des Bunkers angelangt waren, setzten sich die Frauen dicht nebeneinander auf eine der Holzbänke.
»Wupperbrück gewinnt drei zu zwei, Grete bleibt beim Jupp und der Werner erinnert sich wieder an seine Annemarie. Allet so, wie et sich gehört. Damit sich keiner unserer Helden anner Ostfront Gedanken um die Moral seiner Liebsten machen muss.«
Das Brummen wurde lauter. Noch immer drängten Menschen in den Schutzraum, schoben die Glücklichen, die meinten, schon einen Platz gefunden zu haben, weiter nach hinten, ließen sich, wenn sie eine freie Stelle fanden, auf den Betonboden zwischen den Bänken fallen. Schließlich hielten sich mehr als zweihundert Schutzsuchende in dem Raum auf, der eigentlich nur Platz für einige Dutzend bot.
Das Brummen wurde zum Dröhnen. Erschrocken blickten die Menschen an die Decke, so als ob sie durch meterdicken Beton die feindlichen Flugzeuge sehen könnten. Lisbeth Golsten griff den Arm ihrer Freundin.
Die deutete die Geste richtig. »Mach dir keine Sorgen. Ich hab doch gesagt, das ist ein Fehlalarm. Die schmeißen ihre Bomben nicht auf Herne. Die wollen nach Bochum. Oder zu den Treibstoffwerken nach Wanne oder Castrop.«
»Aber die Zeche …«
»Ach was. Glaub mir, ich …«
Ein dumpfer Knall war zu hören. Unmittelbar darauf erzitterten die dicken Betonmauern. Ängstliche Schreie erklangen.
»Nur Fehlalarm, wa«, giftete eine ältere Frau. »Dumm nur, dat dat der Feind nich mitgekricht hat.«
Erneut ging eine heftige Erschütterung durch das Gebäude. Das Licht flackerte, ging für einen Moment ganz aus. Eine weitere Detonation war zu hören.
»Von wegen. Gezz knallt’s.«
Einige Frauen schluchzten hysterisch. Andere schlugen verängstigt die Hände vor ihre Gesichter. Manche murmelten ein Gebet. Mütter nahmen ihre Kinder schützend in die Arme. Der Geruch von Schweiß und Urin legte sich wie eine stinkende Hundedecke über die Bunkerinsassen.
Lisbeth Golsten war zum ersten Mal in einem Hochbunker. Bei den wenigen Bombenalarmen bisher hatte sie in einem Luftschutzkeller in der Teutoburgia-Siedlung Schutz gesucht, ganz in der Nähe ihres Hauses, das sie nach dem Tod ihrer Mutter gemeinsam mit ihrem Mann Peter und ihrem Vater bewohnte. Nun hatte sie Todesangst. Ihr Herz raste. Und dann kam noch etwas anderes dazu.
»Ich muss zur Toilette«, jammerte Lisbeth Golsten.
Ihre Freundin schüttelte den Kopf. »Da stehen sie jetzt Schlange. Entweder du nimmst den Notabort«, Marianne Berger zeigte auf eine Art Mülltonne am Ende des Schutzraumes, »oder du hältst aus, bis Entwarnung kommt. Der Alarm kann ja nicht ewig dauern.«
Wieder ein Einschlag, anscheinend noch näher. Ein Soldat sprang auf und versuchte, sich durch das Menschengewirr Richtung Ausgang zu drängen, wurde aber vom Luftschutzordner und seinen Helfern daran gehindert, die Schleusentür zu öffnen.
Detonation folgte auf Detonation. Sekunden dehnten sich zu Minuten, Minuten zu Stunden. Starr vor Angst warteten die Eingeschlossenen auf das Ende der Angriffe. Dann endlich heulten die Sirenen Entwarnung. Die Bunkertüren wurden geöffnet und die Menschen strömten ins Freie.
Lisbeth Golsten und Marianne Berger gehörten zu den letzten, die den Bunker verließen. Zögernd blieb Lisbeth Golsten am Ausgang stehen.
Marianne Berger griff ihre Hand. »Was ist los?«, fragte sie. »Warum kommst du nicht? Hat dir das da drin so gut gefallen?«
Lisbeth Golsten liefen Tränen über das Gesicht. Sie flüsterte: »Ich habe mich vor Angst nass gemacht.«
Marianne Berger nickte und nahm sie tröstend in den Arm. »Da wirst du nicht die Einzige sein.«
5
Dienstag, 30. März 1943
Sein Schreibtisch bog sich vor Akten. Entgegen der landläufigen Meinung war trotz der drakonischen Strafen, die deutsche Gerichte und besonders der Volksgerichtshof verhängten, die Zahl der Kapitalverbrechen im nationalsozialistischen Deutschland nicht gesunken. Im Gegenteil: Da viel mehr Delikte unter Strafandrohung standen als früher, hatte die Zahl der Verbrechen zugenommen.
Die Zeitungen des Reichs hatten allerdings strikte Order, nicht darüber zu berichten, es sei denn, die Straftaten wurden von sogenannten Nichtariern begangen und konnten propagandistisch ausgeschlachtet werden. Peter Golsten und seine Kollegen wussten es besser.
Sie waren jedoch per Befehl zum Schweigen verpflichtet worden. Wobei so ein Befehl kaum nötig war, ohnehin beschäftigte sich nur eine kleine Minderheit der deutschen Polizisten mit solchen Gedanken. Die überwiegende Mehrheit der Angehörigen der Sicherheitspolizei stand fest zum nationalsozialistischen Staat und seinen Repräsentanten, und sei es auch nur deswegen, weil sie einen entsprechenden Eid geschworen hatten. So auch Peter Golsten, der früher Goldstein geheißen hatte.
Anlass für die Namensänderung war ein Gespräch gewesen, welches Goldsteins Vorgesetzter nach dem Zusammenschluss von Kriminalpolizei, Sicherheitsdienst der SS und der Gestapo mit ihm geführt hatte. Im neu gebildeten Reichssicherheitshauptamt, so der Oberkriminalrat damals, müsse besonderer Wert auf einwandfreie Abstammung gelegt werden. Deshalb sei es wichtig, sich von diesem kompromittierenden Nachnamen zu trennen, um zukünftig keine beruflichen Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Diese Entscheidung sei sein Bekenntnis für die Tätigkeit im Reichssicherheitshauptamt, für den nationalsozialistischen Staat und für Deutschland und seiner Karriere nur förderlich. Und so kam es, dass aus Peter Goldstein, Hauptkommissar der Bochumer Kriminalpolizei, am 3. Oktober 1939 Peter Golsten geworden war, Hauptkommissar und zusätzlich SS-Hauptsturmführer im Amt V des Reichssicherheitshauptamts mit Dienstsitz in Bochum. Ein überzeugter Nationalsozialist war er trotzdem nicht geworden. Er diente nur dem Staat und seinen Gesetzen, fand er. Keiner Ideologie. Die Bestätigung seiner SS-Mitgliedschaft war nach nur wenigen Tagen gekommen. Seine Beförderung zum Kriminalrat jedoch blieb ein uneingelöstes Versprechen.
Seit fast zwanzig Jahren lebte Peter Golsten nun schon im Ruhrgebiet. Ursprünglich stammte er aus Straßburg, wo er auch Abitur gemacht hatte. Wie viele Frontoffiziere, die desillusioniert aus dem Großen Krieg zurückgekehrt waren, war er später zur neu gegründeten Kriminalpolizei in Berlin gestoßen. Von dort war er wegen seiner französischen Sprachkenntnisse Anfang 1923 in das besetzte Ruhrgebiet gesandt worden, um den Mord an einer Bergarbeitertochter aufzuklären. Später erhielt er in Bochum eine Stelle als Kriminalkommissar. Und Lisbeth, die Schwester der Toten, war seine Frau geworden.
Zusammen mit dem Schwiegervater lebten Peter Golsten und seine Frau in einer Bergarbeitersiedlung in Herne. Bei der Übertragung des Wohnrechts für das Steigerhaus auf den Kriminalbeamten hatte sich die Wohnungsverwaltung der Zeche generös verhalten. Zwar sei er kein Bergmann, hieß es damals, aber ein Polizist sei als Mieter sehr willkommen. Könne er doch, quasi als Gegenleistung, ein wachsames Auge auf die politisch suspekten Elemente in der Siedlung werfen, die leider die doch eigentlich rechtschaffenen Bergleute immer wieder aufwiegelten. Da die Zechenverwaltung diese Bereitschaft mit einer erheblichen Mietreduzierung versüßte, hatte Golsten zugesagt. Allerdings war ihm und seiner Familie eine gute Nachbarschaft wichtiger als das Sammeln von Informationen über die mit den Verhältnissen unzufriedenen Bergleute, daher konnte die Zechenleitung mit den abgelieferten Berichten eigentlich nicht zufrieden sein.
Kinder hatten die Eheleute keine. Der Arzt, den sie konsultiert hatten, konnte keine medizinischen Gründe finden und meinte, alles läge schließlich in Gottes Hand. Peter Golsten, wie seine Frau nicht sehr religiös, hegte da so seine Zweifel. Aber mittlerweile, Golsten war Mitte vierzig und auch seine Frau Lisbeth hatte die dreißig lange hinter sich gelassen, hatten sie sich damit abgefunden.
Es klopfte und unmittelbar darauf wurde die Tür geöffnet. Kriminalinspektor Heinz Schönberger, dessen Büro sich nebenan befand, betrat den Raum.
»Morgen, Peter.«
Peter Golsten sah von seinen Unterlagen hoch. »Morgen.«
»Ich habe dir Arbeit mitgebracht.« Heinz Schönberger legte einen Aktendeckel ganz oben auf einen der Stapel.
»O nein! Was ist es denn?«, stöhnte Peter Golsten.
»Eine Vermisstensache. Eine Ostarbeiterin ist verschwunden.«
»Was haben wir damit zu tun? Das ist entweder eine Sache der Fahndung oder der weiblichen Kripo.« Er schob die Akte zurück in Richtung Schönberger. »Nicht zuständig.«
Der rundliche Mann verzog feixend das Gesicht. »Anweisung von oben. Die Polin war im Haushalt von Walter Munder beschäftigt.«
»Der Walter Munder?«
»Genau. Deshalb wünscht unser gemeinsamer Vorgesetzter, dass sich ein erfahrener Polizist um den Fall kümmert. Jemand wie du.«
Peter Golsten stöhnte erneut. »Mir bleibt nichts erspart.«
Sein Kollege lachte und ging zur Tür. »Sag das nicht zu laut.« Mit diesen Worten verließ er Golstens Büro.
Peter Golsten schüttelte resignierend den Kopf. Dann hatte ihm wohl Saborski diesen Fall aufs Auge gedrückt. Wilfried Saborski, Kriminalrat in Bochum und SS-Sturmbannführer. Parteimitglied seit den frühen Zwanzigerjahren mit einer nur vierstelligen Mitgliedsnummer. Einer der alten Kämpfer, schon im Widerstand gegen die französische Besetzung des Ruhrgebiets aktiv. Erst SA, dann SS, dann Gestapo und nun Reichssicherheitshauptamt. Sein direkter Vorgesetzter. Peter Golsten kannte ihn seit zwei Jahrzehnten. Aber Freunde waren sie nie geworden, auch keine Kollegen. Nur Parteigenossen. Aber das waren ja viele in diesen Zeiten.
Er griff zu der dünnen Akte und begann, sie zu lesen. Die vermisste Marta Slowacki war 1924 in Kulm im damaligen Polen geboren und zwei Jahre nach Kriegsbeginn als Dienstmädchen nach Deutschland verbracht worden. Den Unterlagen war nicht zu entnehmen, ob sie, bevor sie in Munders Haushalt kam, woanders gearbeitet hatte. Eines der üblichen Fotos der Meldebehörden war oben rechts angeheftet. Golsten sah eine junge Frau mit halblangen, schwarzen Haaren, die aus großen, dunklen Augen an der Kamera vorbei ins Nichts schaute. Über das Bild war ein großes P gestempelt. P für eine polnische Zwangsarbeiterin.
Am 23. März dieses Jahres hatte Frau Munder Marta Slowacki zu einem Besorgungsgang geschickt, von dem sie nicht zurückgekehrt war. Walter Munder, stellvertretender Kreisleiter der NSDAP in Herne, hatte jedoch erst zwei Tage später eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Die Kollegen, um die politische Bedeutung des Parteibonzen wissend, hatten den Vorfall unverzüglich Saborski vorgelegt. Und nun war Peter Golsten mit dem Fall befasst. Kriminalrat Saborski hatte handschriftlich auf der Vermisstenmeldung vermerkt, dass Peter Golsten jeden seiner Schritte vorab mit ihm abzustimmen habe. Wieder seufzte Peter Golsten. Ein Routinefall, der ihm seine Zeit stahl. Natürlich wusste er, dass die Polin nach nationalsozialistischer Rechtsauffassung ein Kapitalverbrechen begangen hatte. Aber hatte er nichts Wichtigeres zu tun? Er überlegte einen Moment und griff dann zum Telefonhörer.
»Vorzimmer Kriminalrat Saborski«, meldete sich Margot Schäfer sofort.
Schäfer arbeitete schon seit Jahren für Saborski und war im Amt eine Legende. Alle ihre Vorgängerinnen waren nach nur wenigen Tagen entweder entlassen, auf einen anderen Arbeitsplatz versetzt worden oder hatten von sich aus das Handtuch geworfen. Im Amt machte deshalb das Gerücht die Runde, Saborski und sie hätten eine Beziehung, die über das rein Berufliche weit hinausging. Peter Golsten hielt das Gequatsche für Blödsinn. Und vermutlich war diese Auffassung auch Margot Schäfer zu Ohren gekommen, denn er hatte bei der Sekretärin seines Chefs einen Stein im Brett.
»Golsten. Guten Morgen, Fräulein Schäfer. Ist der Chef zu sprechen?«
»Heil Hitler, Hauptsturmführer. Um was geht es denn?«
»Nun lassen Sie doch die Dienstgrade weg. So förmlich müssen wir doch nicht sein.«
»Wie Sie meinen, Herr Hauptkommissar. Also, was kann ich dem Sturmbannführer ausrichten?«
Peter Golsten lachte. »Eigentlich bezog sich meine Bemerkung auf alle Dienstgrade, Fräulein Schäfer. Ich wollte den Kriminalrat in Sachen der vermissten Ostarbeiterin sprechen.«
»Diese Polin? Wie heißt sie doch gleich … Slowacki, nicht wahr?«
»Ja.«
»Der Sturmbannführer hat mir davon erzählt.«
Peter Golsten wunderte sich. Normalerweise war es nicht Saborskis Art, mit seiner Mitarbeiterin über die Fälle zu sprechen, die über seinen Schreibtisch liefen.
»Tatsächlich?«
»Natürlich keine Details. Aber da der Parteigenosse Munder persönlich vorstellig geworden ist …«
»Munder war in dieser Angelegenheit höchstselbst bei dem Kriminalrat?«
Margot Schäfer registrierte Peter Golstens Überraschung. »Ich glaube, das hätte ich Ihnen nicht sagen dürfen. Sie verraten mich doch nicht?«
»Ach was. Sie können sich auf mich verlassen, Fräulein Schäfer.«
Ihre Erleichterung war hörbar. »Danke. Dann verbinde ich Sie jetzt mit dem Sturmbannführer.«
Es knackte in der Leitung.
»Saborski. Was gibt es, Golsten?« Saborski hielt sich nie lange mit Höflichkeitsfloskeln auf.
»Es geht um den Fall Slowacki.«
»Ja?«
»Warum haben Sie mich mit dieser Angelegenheit betraut?«
»Weil Sie einer meiner besten Leute sind.«
»Schon gut. Aber eine vermisste Person? Das ist doch keine Angelegenheit für unsere Abteilung? Wir bearbeiten Kapitalverbrechen und …«
»Ich weiß, womit Sie sich üblicherweise beschäftigen, Hauptsturmführer. In dieser Sache machen wir eine Ausnahme.«
Peter Golsten schluckte.
»Wollten Sie etwas sagen, Hauptsturmführer?«
»Mir ist nur nicht klar …«
Erneut unterbrach ihn Saborski. »Dann will ich Ihnen etwas sagen. Parteigenosse Munder ist, wie Sie wissen, ein junger, ehrgeiziger Mann. Er wird nicht ewig stellvertretender Kreisleiter bleiben, sondern Karriere machen. Spätestens nach dem Endsieg wird er mit anderen, höheren Aufgaben betraut werden. Verstehen Sie jetzt?«
Peter Golsten verstand. Saborski suchte heute die Verbündeten von morgen. »Natürlich. Sie haben angewiesen, dass Sie über jeden meiner Schritte informiert werden möchten?«
»So ist es. Bevor Sie einen unternehmen.«
»Selbstverständlich. Ich werde mich über die näheren Umstände des Verschwindens des Mädchens informieren und dazu Erkundigungen im Haushalt der Munders einholen. Außerdem sollten wir die Polin zur Fahndung ausschreiben. Dazu benötigen wir eine Beschreibung ihres Äußeren. Sind Sie damit einverstanden?«
»Das hört sich vernünftig an. Aber wahren Sie die notwendige Diskretion.«
»Sie können sich auf mich verlassen.«
»Das hoffe ich.«
Es knackte erneut. Saborski hatte aufgelegt.
Peter Golsten dachte nach. Saborskis Beweggründe konnte er nachvollziehen. Aber Munders nicht. Warum in aller Welt bemüht sich so ein hohes Tier persönlich, wendet sich sogar direkt an den Kriminalrat?, fragte sich Golsten und griff dann erneut zum Telefonhörer, um sich bei diesem Parteibonzen anzumelden.
6
Dienstag, 30. März 1943
Er erwachte aus einem unruhigen Schlaf. Ein Geräusch hatte ihn geweckt. Er lauschte in die Dunkelheit. Da war es wieder. Die Treppenstufen, die in den Keller führten, knarrten. Heinz Rosen wagte kaum zu atmen. War seine Flucht nun zu Ende? Er zählte die Schritte. Noch drei Stufen, noch zwei. Dann die wenigen Meter bis zu dem Verschlag, hinter dem er sich verborgen hielt.
»Heinz«, flüsterte zu seiner Erleichterung eine bekannte Stimme. »Ich bin’s.«
Heinz Rosen holte tief Luft. Er streckte seine tauben Glieder, so gut es ging. Viel Platz hatte er nicht in seinem Versteck hinter den Kohlen und Briketts. Der Raum war nicht einmal lang genug, um im Liegen schlafen zu können. Nur wenn im Haus alle zu Bett gegangen waren, ermöglichte ihm sein Freund Theo Mönch einige Schritte im Keller. Aber diese kleine Freiheit währte nie länger als zehn oder fünfzehn Minuten. Dann wurde Theo unruhig und Rosen kroch zurück in den stickigen Raum hinter den Kohlen.
»Mach auf«, sagte Theo leise.
Heinz Rosen schob zwei Keile beiseite. Jetzt ließen sich einige miteinander verbundene Bretter aus der Holzwand entnehmen und mit Theos Hilfe zur Seite schaffen. Heinz Rosen zwängte sich durch die schmale Öffnung.
»Hier ist frisches Wasser und drei Schnitten. Mehr zu essen haben wir im Moment leider nicht.«
Heinz Rosen griff nach dem Wasserkrug und trank in gierigen Schlucken. Dann biss er in das Brot. »Danke«, sagte er mit vollen Backen.
Schweigend sah Theo zu, wie sein Freund das wenige, was er ihm geben konnte, hinunterschlang. Dann sagte er: »Wir haben ein neues Versteck für dich gefunden. Aber wir müssen uns beeilen. Ich befürchte, bald wird uns die Gestapo besuchen. Es wäre besser für uns alle, wenn du dann nicht mehr unser Gast wärest.« Er unterdrückte ein Lachen. »Außerdem habe ich das Gefühl, dass unser Ältester beginnt, misstrauisch zu werden. Leider bin ich mir nicht sicher, ob wir uns auf ihn verlassen können. So weit ist es schon gekommen, dass wir nicht mehr wissen, wem die Loyalität unserer Kinder gehört: Hitler und seiner Bande oder den eigenen Eltern.«
Heinz Rosen antwortete nicht.
Theo gab sich einen Ruck. »Wenn es heute Abend Luftalarm geben sollte, werde ich dich zu deiner neuen Bleibe bringen. Dann laufen viele Leute zum nächsten Luftschutzkeller. Dabei fallen wir nicht so auf. Also halte dich bereit.« Er lächelte. »Soweit ich weiß, ist deine nächste Unterkunft gemessen an dieser hier geradezu luxuriös. Und jetzt wieder ab in den Verschlag.«
»Wer ist denn mein neuer Gastgeber?«, erkundigte sich Heinz Rosen noch, bevor er durch die Öffnung kroch.
»Ein alter Sozialdemokrat.«
»Ein Sozi hilft einem Kommunisten?«, wunderte sich Rosen.
»Der ja.« Theo schüttelte fast unmerklich den Kopf. »Ich bin doch auch Sozialdemokrat, wie du weißt.«
»Ja. Aber du bist mein Freund. Wie heißt er?«
»Das brauchst du nicht zu wissen. Wenn er dir seinen Namen nennt, ist das seine Sache. Von mir erfährst du ihn nicht.«
Heinz Rosen schwieg einen Moment. »Und er ist darüber informiert, dass ich …«
»Er weiß, dass du Jude bist, ja.«
Unwillkürlich schaute Rosen an die Stelle auf seiner Kleidung, an der sich eigentlich ein gelber Stern hätte befinden müssen. Aber dort war nie ein Stern befestigt gewesen. Seine Kleidung war bis auf die Unterwäsche von Theo verbrannt worden. Zu groß war die Gefahr, dass er durch sie identifiziert werden könnte. Stattdessen trug er Sachen seines Freundes, die von Helga umgenäht worden waren. Auch sein Ausweis mit dem großen eingestempelten J war im Feuer gelandet. Trotzdem konnte er seine Abstammung nicht verbergen: Heinz Rosen war beschnitten.
Mit einem leisen Stöhnen kroch er zurück in sein Gefängnis. Gemeinsam hoben sie die Tür an ihren Platz. Rosen schob die Riegel vor. Theos Schritte entfernten sich. Dann war Heinz Rosen wieder allein in der Dunkelheit.
Bisher hatte er Glück gehabt. Schon kurz bevor jeder Jude gezwungen worden war, den gelben Stern zu tragen, war er in den Untergrund gegangen. Dabei waren ihm, obwohl er keinerlei Parteifunktionen innehatte, seine Kontakte zu Mitgliedern der illegalen Kommunistischen Partei zugutegekommen. Erst später dann hatte er für die Partei kleinere Aufträge übernommen, Kurierdienste zumeist. Aber als das System der lückenlosen Überwachung immer weiter vervollständigt worden war, als nach der totalen Mobilmachung jeder jüngere Mann, der nicht Uniform trug, bis zum Beweis des Gegenteils automatisch verdächtigt wurde, war es für Heinz Rosen fast unmöglich geworden, sich frei zu bewegen. Er hatte die illegale Arbeit einstellen und sich in immer neue Verstecke begeben müssen. So war er schließlich auch bei Theo Mönch gelandet, einem Schulfreund und Arbeitskollegen aus besseren Zeiten.
Heinz Rosen war eingenickt. Er wurde wach, als im Haus lautes Stimmengewirr zu hören war. Eine Tür schlug. Für einen Moment war es still. Dann polterten Schritte die Treppe herunter.
»Heinz!«, rief Theo mit lauter Stimme. »Schnell. Luftalarm. Es ist so weit.«
Erst jetzt vernahm Rosen das entfernte Heulen der Sirenen. Eilig rückte er die Riegel beiseite und kroch ins Freie, wo sein Freund schon mit einem Mantel wartete.
»Hier. Zieh den an. Und jetzt komm.«
Theo ging die Kellertreppe hoch, lauschte einen Moment an der Tür, bevor er sie öffnete.
»Los.«
Die beiden Männer liefen durch den dunklen Flur zum Hauseingang.
»Was ist mit deiner Familie?«, wunderte sich Heinz Rosen.
»Im Luftschutzkeller.«
»Haben deine Kinder nicht gefragt, warum du nicht mitgekommen bist?«
»Doch.« Theo klopfte an die ausgebeulte Innentasche seiner Jacke. »Aber ich habe ihnen erzählt, dass ich wichtige Papiere vergessen habe.« Er nahm den Türgriff in die Hand, zögerte dann aber. »Heinz, was ich noch sagen wollte …«
»Ja?«
»Wenn wir von einer Streife angehalten werden, kenne ich dich nicht.«
Heinz Rosen verstand sofort. »Natürlich.«
»Und noch etwas. Wenn sie dich schnappen …«
»Sei still, Theo. Ich habe dir und deiner Frau viel zu verdanken. Ich werde euch nicht verraten«, versprach er. Und hoffte inständig, dass er dieses Versprechen würde halten können.
Sein Freund öffnete die Haustür und sah hinaus. Noch immer eilten Menschen durch die Straße Richtung Westen, dahin, wo ein besonders ausgebauter Keller Schutz vor fallenden Bomben versprach.
»Komm.« Theo zog den Flüchtling in die Nacht. Es war mild und roch nach Frühling. Gierig sog Rosen die frische Luft ein. Trotz der Gefahr, in der sie schwebten, war es ein gutes Gefühl, wieder unter freiem Himmel zu sein.
»Wir müssen da lang.« Theo zeigte die Straße hinunter. »Zwei Häuser weiter, dann durch die Gärten. Es ist alles verdunkelt. Drück die Daumen, dass nicht zufällig eine Streife hinter den Häusern unterwegs ist und wir ihr in die Arme laufen …«
Von fern war das rhythmische Tak-tak der Flugabwehrkanonen zu hören. Leises Brummen der anfliegenden Bomber erfüllte die Luft. Aber anscheinend war auch heute Herne nicht ihr Ziel, denn es gab keine nahen Detonationen.
Theo Mönch und Heinz Rosen hatten Glück. Zwanzig Minuten später hatten sie ihr Ziel erreicht, ein dunkel daliegendes Eckhaus. Theo zeigte auf das Buschwerk im Vorgarten, etwas abseits der Straße. »Versteck dich und verhalte dich ruhig. Ich hole dich gleich ab.«
Er verschwand in der Dunkelheit und Heinz Rosen kauerte sich unter die Blätter. Für einen Moment krochen Zweifel in ihm hoch. Was, wenn sein Freund ihn nur loswerden wollte? Ihn wie einen jungen Hund einfach ausgesetzt hatte? Dann wischte er diesen Gedanken beiseite. Theo hatte sein Leben für ihn riskiert. Und er … Schritte näherten sich.
»Komm«, flüsterte Theo. »Die Luft ist rein.«
Heinz Rosen hörte, wie ganz in der Nähe eine Tür geöffnet wurde. Ein leiser Pfiff ertönte. Heinz Rosen folgte seinem Freund und sie drängten ins Innere des Gebäudes. Die Haustür schloss sich hinter ihnen. Heinz Rosen atmete auf. Geschafft!
Vor ihnen stand ein Mann. Dessen Gesichtszüge waren in der Dunkelheit nicht auszumachen. Mit freundlicher Stimme sagte er: »Kommen Sie. Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern und es gibt Entwarnung. Dann sollten Sie in Ihrem Versteck sein.«