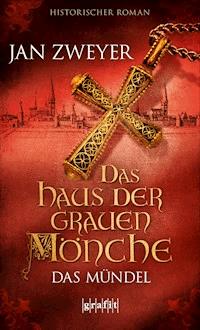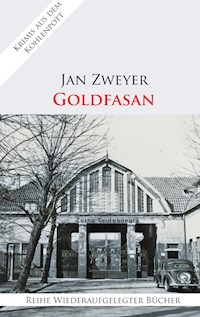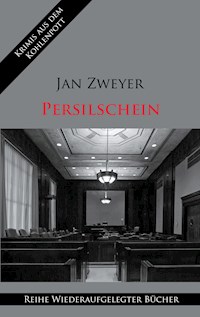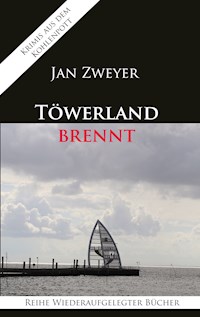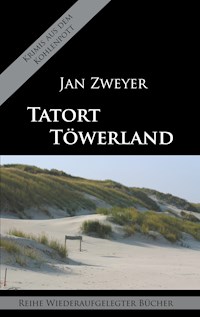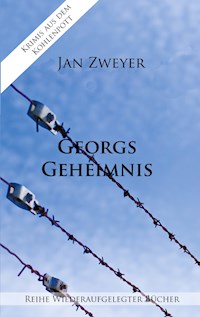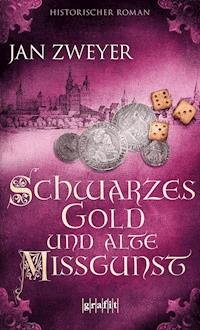
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Haus der grauen Mönche
- Sprache: Deutsch
Anno 1622: Im ganzen Reich flammt Krieg auf und die Städte an der Ruhr werden immer wieder von marodierenden Truppen überrollt. Darunter leiden nicht zuletzt Händler wie die Hattinger Familie von Linden. Als Jürgen von Linden hört, dass es auf einem Acker Steinkohlevorkommen gibt, geht er das Wagnis ein und pachtet den Grund – nicht ahnend, dass er sich damit in ein intrigantes Spiel verstrickt. Cordt von der Recke beschließt derweil, die Mitgift zu sparen und seine Tochter in ein Damenstift zu schicken, unterschätzt allerdings Ursulas Freiheitsdrang. Sie nutzt die erste Gelegenheit zur Flucht – ein gefährliches Unterfangen … Jan Zweyer erzählt die Familiensaga der von Lindens zur Zeit des dreißigjährigen Krieges weiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Zweyer
Schwarzes Gold und alte Missgunst
Historischer Roman
Die Von-Linden-Saga:Das Haus der grauen Mönche – Das Mündel.Das Haus der grauen Mönche – Freund und Feind.Das Haus der grauen Mönche – Im Dienst der Hanse.Ein Königreich von kurzer Dauer.Schwarzes Gold und alte Missgunst.
© 2018 by GRAFIT Verlag GmbH Chemnitzer Str. 31, D-44139 Dortmund Internet: http://www.grafit.de E-Mail: [email protected] Alle Rechte vorbehalten. Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/GoodWinn777 (Münzen), Anton Grachev (Würfel) E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck eISBN 978-3-89425-741-5
Über das Buch
Anno 1622: Im ganzen Reich flammt Krieg auf und die Städte an der Ruhr werden immer wieder von marodierenden Truppen überrollt. Darunter leiden nicht zuletzt Händler wie die Hattinger Familie von Linden. Als Jürgen von Linden hört, dass es auf einem Acker Steinkohlevorkommen gibt, geht er das Wagnis ein und pachtet den Grund – nicht ahnend, dass er sich damit in ein intrigantes Spiel verstrickt.
Cordt von der Recke beschließt derweil, die Mitgift zu sparen und seine Tochter in ein Damenstift zu schicken, unterschätzt allerdings Ursulas Freiheitsdrang. Sie nutzt die erste Gelegenheit zur Flucht – ein gefährliches Unterfangen …
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne.
Mit seiner Trilogie Das Haus der grauen Mönche entführte er die Leser in das deutsche Mittelalter. In Schwarzes Gold und alte Missgunst erzählt er die generationenübergreifende Geschichte der von Lindens in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges weiter.
Dramatis Personae
(Die mit einem * gekennzeichneten Figuren sind historisch belegt.)
Familie von Linden
Jürgen von Linden, Kaufmann
Gesche, seine Frau
Dirk, sein Sohn
Walter, sein Bruder, Advokat beim klevischen Rat
Frowe, seine Schwester
Trine, seine zweite Schwester
Wilhelm Mattheissen, genannt der Arzt, Trines Mann *
Alke, ihre Tochter
Familie von der Recke
Cordt von der Recke, Herr auf Burg Kemnade und der Freiherrlichkeit Stiepel *
Anna von Quadt, seine Frau *
Wennemar von der Recke, ihr Sohn *
Ursula von der Recke, ihre Tochter *
Clemens Nagel, Ursulas Ehemann *
Hattinger Bürger
Tigges Rupe, Gastwirt
Georg Pelser, Bürgermeister bis 1624 *
Arnold Kielmann, Bürgermeister ab 1624 *
Georg Kielmann, sein Sohn *
Hermann Pfannkuch, Bürgermeister ab 1624 *
Everdt Marienbaum, Schmied *
Arndt von Eicken, Bauer
Mattes, sein Knecht
Johann Anrodt zum Sünsbruch *
Steffen Hülsbeck, Goldschmied
Utz Stams, Apotheker
Fritz Trepmann, Fleischhauer
Wingert Schubbe, Totengräber *
Johan Wilstach, Richter *
Anna-Maria, Hure *
Hermann Merker, Pastor *
Veit, Lohgerber-Knecht
Soldaten
Peter de Brügg, Hauptmann der spanischen Besatzungstruppen
Don Gonzalo Fernández de Córdoba, spanischer Befehlshaber *
Wilhelm Wendt zum Crassenstein, schwedischer Obrist *
Beamte/Adelige
Jobst von Strünkede (eigentlich Jobst von Aschebrock zu Mahlenburg), genannt der Gelehrte, Droste und Amtmann von Bochum *
Adam von Schwarzenberg, Geheimer Rat Brandenburgs *
Bergmeister Cronenberg, Bergvogt im Dienst des klevischen Rats *
Mathias von Honnichen,Vertrauter Cronenbergs *
Johann von Dellwig zu Dellwig, Amtmann und Droste in Blankenstein *
Dietrich von Syberg, Landdroste in der Grafschaft Mark *
Dietrich von Diest, Bergvogt ab 1632 *
Johann von Schell und Rechen *
Caspar von Romberg von Brünninghausen *
Doktor Konradus Fabri, Kammergerichtsadvokat beim Klever Rat *
Gerd von Huck, Landadeliger
Sonstige
Doktor Beatus Moses, Prokurator am Reichskammergericht Speyer *
Winold von Büren, Salinenbesitzer und Bürgermeister in Unna *
Agatha Wettesbach, Tochter eines Klever Beamten
Jacob, Diener
Josef Faßbender, Kölner Kaufmann
Luigi, Mailänder Schauspieler
Elena, Wirtin in Genua
Karten
GÄNSEREITER
November 1622 bis Oktober 1623
1
–
Hattingen, 1. November 1622
Ich bin Hauptmann Peter de Brügg.« Der junge Offizier trug die weiße Schärpe mit dem roten Kreuz von Burgund, die Farben der spanischen Streitkräfte, mit sichtbarem Stolz.
Langsam schweifte sein Blick durch die Gaststube, die er eben betreten hatte. Ihm schien zu gefallen, was er sah: der mächtige Kamin an der hinteren Wand des Hauses, der nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Kochen genutzt wurde, die schweren, von den Ärmeln der Gäste und den Lappen der Mägde glatt geschliffenen Eichentische, die Butzenscheiben, die die Wärme im Haus und die Kälte draußen hielten, und schließlich die gusseisernen Kerzenhalter, die von der Decke hingen.
»Wie viele Zimmer hast du in deinem Gasthaus?«, fragte er den Wirt in einem Akzent, der neben seinem Namen verriet, dass er nicht aus Spanien, sondern aus Flandern stammte.
»Fünf, Herr«, antwortete Tigges Rupe eingeschüchtert und warf einen misstrauischen Blick zu den drei Musketieren hinüber, die gelangweilt vor der Eingangstür standen.
»Welches ist das größte?«
»Das, das zum Markt hinausgeht.«
»Gut. Das bekommt General Don Gonzalo Fernández de Córdoba.«
»Es ist belegt, Herr. Ein Kaufmann aus Bremen logiert dort.«
»Wirf ihn hinaus«, befahl der junge Offizier mit stoischer Miene.
»Aber er hat schon bezahlt.«
»Dann gib ihm sein Geld zurück.« De Brüggs Gesichtsausdruck zeigte, dass er keine weitere Diskussion führen würde.
»Ja, Herr«, erwiderte Rupe eingeschüchtert und senkte den Kopf.
»Die anderen Zimmer sind für Don Fernández’ Offiziere gedacht.« Der Soldat zog ein zerknittertes Blatt Papier aus der Tasche und reichte es dem Wirt. »Hier, der vom Rat der Stadt ausgestellte Quartierschein für den General und seinen Stab. Insgesamt vierzehn Offiziere. Sie werden sich die restlichen vier Zimmer teilen.«
Rupe nickte. »Wie lange werdet Ihr bleiben?«
»Den Winter über.«
Der Wirt rechnete nach. Das waren mehr als drei Taler nur für die Unterkunft. Er witterte ein gutes Geschäft.
Aber seine Träume zerstoben jäh, als Peter de Brügg fortsetzte: »Du bekommst für die Unterbringung einen Reichstaler täglich, unsere Verpflegung inbegriffen.«
Der Wirt schüttelte entsetzt den Kopf. »Davon kann ich ja kaum die Nahrungsmittel kaufen.«
»Ist das mein Problem? Wende dich an deinen Rat, der hat den Preis festgelegt.« De Brügg nahm auf einer der Bänke Platz und winkte den Musketieren zu, die sich nach mehrfachem Verbeugen an einen entfernteren Tisch setzten. »Bevor du dort deine Beschwerde vorträgst, bringst du mir und meinen Leuten roten Wein. Den besten, den du im Keller hast. Aber höre: Ich verstehe eine Menge von Wein. Wenn du versuchst, mir ein minderwertiges Gesöff unterzujubeln, wird dir das schlecht bekommen.« Peter de Brügg strich mit der Handkante an seiner Kehle entlang. »Hast du das verstanden?«
»Natürlich, Herr.« Vor Angst schlotternd, eilte der Wirt in den Keller, um die Krüge zu füllen.
Kurz darauf traf der General mit seinem restlichen Gefolge ein. Der Schankraum füllte sich mit Soldaten, die alle nach Wein und geröstetem Fleisch verlangten. Zwei Stunden später hatten die Spanier zu Rupes Entsetzen seine Vorräte fast vollständig getilgt und ein Zehnliterfass besten Weins geleert.
Tigges Rupe atmete auf, als sich die Herren in ihr neues Quartier zurückzogen. Er befahl den Mägden, aufzuräumen und beim Fleischhauer neues Fleisch zu besorgen. Dann machte er sich auf den Weg zum nicht weit entfernten Rathaus, um einem der Bürgermeister sein Leid zu klagen.
»Mir sind die Hände gebunden, Herr Rupe.« Bürgermeister Georg Pelser, ein stattlicher Mann von Anfang vierzig, schüttelte den Kopf. Sein schwarzes Wams spannte etwas über dem Bauch, den er vor sich herschleppte. Ihn schienen die Entbehrungen der vergangenen Kriegsjahre weniger getroffen zu haben als andere, den um Hilfe suchenden Wirt, der vor ihm stand, eingeschlossen.
Tigges Rupe registrierte mit einer gewissen Bitternis, dass Pelsers Trikothosen nicht wie seine aus grober Wolle bestanden, sondern aus feinstem Linnen. Und das Leder der Reitstiefel des Bürgermeisters sah aus wie mehrfach gegerbt und war damit weicher als die harten Schuhe Rupes.
Die beiden Männer standen sich im Versammlungssaal des Rathauses über der Markthalle gegenüber. Hier tagte der Rat, in den kleinen Kammern links und rechts des Saales lagerten die Stadtakten und in einem der Räume arbeitete der Stadtschreiber.
»Der Reichstaler, den Ihr bewilligt habt …«
»Nicht ich, mein lieber Herr Rupe. Der Rat hat entschieden.«
»Aber sicher auf Euren Vorschlag hin.«
Der Bürgermeister nickte zustimmend. »Nichtsdestotrotz bleibt es ein Ratsbeschluss. Der, füge ich hinzu, aus absoluter Notwendigkeit erlassen wurde. Wie Ihr wisst, ist Hattingen, von einer kleinen Unterbrechung im letzten Jahr abgesehen, seit acht Jahren durchgängig von spanischen Truppen besetzt. Die Soldaten wollen von uns untergebracht und verpflegt sein. Das kostete uns im vorletzten Jahr und den Jahren davor ein Vermögen. Für jeden fremden Soldaten wandten wir etwa zehn Albus pro Kopf und Tag auf.«
»Ich erhalte nur fünf«, warf der Wirt ein. »Außerdem bezahle ich wie jeder andere Bürger Steuern, die Ihr den Besatzern zum Fraß vorwerft.«
»Ich verstehe Euren Unmut. Aber unsere Geldtruhen sind leer, wir wissen nicht, wie wir die Abgaben an den Landesherrn aufbringen sollen. Ihr habt doch gehört, wie Einzelne über unsere Stadt spotten: Nicht Hattingen, sondern Hatnichts heiße sie.«
»Das ist mir alles bekannt. Aber ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll.«
»Lieber Herr Rupe, uns bleibt keine Wahl. Leisten wir Widerstand, wird die Stadt niedergebrannt. Dann verlieren wir alles. Wollt Ihr das?«
»Natürlich nicht.«
Sanft schob der Bürgermeister den sich nur halbherzig sträubenden Wirt Richtung Ausgang. Und ehe sich der Bittsteller versah, schloss sich die Tür hinter ihm.
Rupe schlug verzweifelt die Hände vors Gesicht. Doch nach einigen Sekunden hatte er sich wieder in der Gewalt. Irgendwie würde es weitergehen. Es musste einfach.
2
–
Hattingen, 2. November 1622
Manchmal empfand Jürgen von Linden die Bürde, die ihm seine beiden älteren Brüder mit der Führung des Familiengeschäftes auferlegt hatten, als zu schwer.
Johann, den ältesten der Brüder, hatte der schreckliche Krieg gefressen, der das Land schon über vier Jahre in Atem hielt. Die Abenteuerlust hatte ihn in das Regiment des Feldherrn Wallenstein geführt. Er ersoff bei dem Versuch, einen Fluss mit zu dünner Eisdecke zu überqueren.
Walter hingegen erfüllte den Wunsch seines Vaters, ging an die Universität in Köln und studierte nach dem Durchlaufen der Artistenfakultät die Jurisprudenz. Seit einigen Jahren arbeitete er wie sein Urgroßvater Hinrick am klevischen Hof als Advokat.
Seit über einhundert Jahren lebte die Familie von Linden in Hattingen, ihr Haus an der Gelinde war weitgehend unverändert geblieben. Am Rand des Kirchhofs von Sankt Georg stand seit einigen Jahren ein zweites Speicherhaus, welches Jürgens Vater Johann erbaut hatte. Nach wie vor fußte das Geschäft der Familie auf zwei Beinen: Zum einen handelte sie mit Stoffen und daraus gefertigten Produkten wie Kleidern oder Decken, zum anderen verfügte sie über mehrere Ochsen- und Pferdekarren, die sie nebst den erforderlichen Knechten an Kaufleute für deren Transporte vermietete.
Das Geschäftsprinzip der Familie war einfach. In Zeiten, in denen die Nachfrage gering und das Angebot groß war, kauften sie günstig ein und verkauften bei hoher Nachfrage und geringem Angebot möglichst teuer.
Bisher hatte dieses Modell gut funktioniert. Sicher, manchmal verpassten sie den idealen Zeitpunkt für einen Kauf oder Verkauf. Es kam vor, dass in den Lagerhäusern der Platz für neue Waren knapp wurde und sie entweder auf ein Geschäft verzichten oder ihr Handelsgut mit geringerem Gewinn als geplant oder gar unter Einkaufspreis veräußerten. Aber im Großen und Ganzen agierten die Mitglieder der Familie Linden in den vergangenen Jahrzehnten als erfolgreiche Kaufleute.
Anders sah es mit dem Transportgeschäft aus. Anfangs vielversprechend gestartet, machte dieser Geschäftszweig Jürgen mehr und mehr Sorgen. Das Risiko, dass Waren, die er transportierte, von Soldaten oder Banden geraubt wurden, war mit Beginn des großen Krieges deutlich gestiegen. Und da die Familie für einen solchen Verlust gegenüber ihren Kunden geradestand, hatte Jürgen die Prämien für diese Fuhren immer weiter erhöht, mit der Folge, dass er nur noch selten Aufträge erhielt, und dann verließen die Ochsenkarren nicht das Gebiet, welches unter der Kontrolle der spanischen Truppen stand. Ferntransporte kamen so gut wie nie vor. So floss immer weniger Geld in die Truhen seiner Familie.
Ein lauter Wortwechsel riss Jürgen aus seinen trüben Gedanken. Er öffnete die Tür des Kontors und betrat den Flur. Das Geschrei kam aus der Stube.
Jürgen seufzte, denn er wusste, wer da schon wieder stritt. Die hohe, etwas keifende Stimme gehörte seiner Schwester Frowe, die mit vierunddreißig nicht ganz zwei Jahre älter als er und immer noch Jungfer war. Er hatte die Hoffnung aufgegeben, sie unter die Haube zu bringen, denn kein Freier war ihr bisher gut genug gewesen.
Die andere war die seiner Frau Gesche, die Jürgen vor mehr als zehn Jahren seinen Sohn Dirk geschenkt hatte, den sie beide abgöttisch liebten. Vielleicht gerade deswegen, weil Dirk ihr einziges Kind war, ständig kränkelte, schwächlich war und in jedem Händel mit Gleichaltrigen unterlag. Dafür aber las der Junge gut, schrieb perfekt, sprach Latein und beherrschte das Rechnen fast besser als sein Vater. Jürgen lächelte unwillkürlich, als er daran dachte, wie stolz Dirk gewesen war, als er seinen Vater zum ersten Mal bei einem Rechenfehler ertappte.
Das Geschrei in der Stube wurde lauter. Leider war Zwist im Haus der von Lindens seit Jahren an der Tagesordnung. Als Gesche nach der Hochzeit eingezogen war, hatte ihre Schwägerin sich zunächst noch zurückgehalten. Später dann führten sie einen Kleinkrieg darüber, wer von ihnen zukünftig dem Haushalt vorstünde. Frowe berief sich darauf, schon immer in dem Haus gewohnt zu haben und die Ältere, Erfahrenere zu sein. Gesche pochte auf ihr Recht als Hausherrin, welches ihr mit der Eheschließung zugefallen sei.
Ihre Auseinandersetzungen entzündeten sich meist an trivialen Dingen: wessen Anweisungen die Mägde als Erstes auszuführen hätten, was mittags auf dem Tisch stehen sollte, wann gewaschen wurde.
Erst als Frowe sich in die Erziehung Dirks einmischte, hatte Jürgen eingegriffen und seine Schwester zur Ordnung gerufen. Dummerweise aber hatte diese Zurechtweisung den gegenteiligen Effekt gehabt. Zwar hatte Frowe Dirks Erziehung seitdem nicht mehr kommentiert, dafür aber ihre Anstrengungen verstärkt, die Oberhoheit im Haus zu gewinnen. So zankten sich die Frauen fast täglich wie die Besenbinder.
Verärgert riss Jürgen die Stubentür auf. »Was zum Teufel ist denn nun schon wieder los?«, blaffte er und brachte so die Kontrahentinnen für einen Moment zum Schweigen.
Aber schon kurz darauf stritten die Frauen weiter.
»Sie hat schon wieder der Magd eine Anweisung erteilt, die meiner widerspricht«, beschwerte sich Gesche.
»Weil deine Anordnung schlicht Unsinn war. Salz gehört nicht in das Wasser der Erbsen, bevor sie weich gekocht sind, sonst bleiben sie hart. Dir fehlt eben die Erfahrung, um einen Haushalt zu führen. Du bist zu jung.«
»So ein Unsinn«, erwiderte Gesche. »Lediglich die Garzeit verlängert sich, das weiß doch jedes Kind. Und außerdem bist du nur vier Jahre älter als ich. Also plustere dich nicht so auf!«
Gesche war blond im Gegensatz zu ihrer Schwägerin Frowe, die wie Jürgen rotbraune Haare hatte. Beide Frauen waren fast gleich groß und standen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Gesche wedelte, wie immer, wenn sie sich ärgerte, mit den Händen vor der Nase ihrer Schwägerin herum, während diese mit vor der Brust verschränkten Armen regungslos dastand.
»Willst du damit sagen, ich sei dümmer als ein Kind? Jürgen, hast du gehört, was deine Frau mir an den Kopf geworfen hat? Was sagst du dazu?«
Beide schauten ihn erwartungsvoll an.
Der Kaufmann seufzte tief, hob resignierend die Arme, schüttelte verständnislos den Kopf, drehte sich um und ging. Als er die Tür hinter sich geschlossen hatte, musste er zur Kenntnis nehmen, dass seine Intervention die Auseinandersetzung nicht beendet, sondern nur neu angefacht hatte.
In einem hat Gesche recht, dachte er. Dieses Haus ist zu klein für zwei so temperamentvolle Frauen. Es war lange überfällig, dass Frowe einen Ehemann bekam und auszog. Dumm nur, dass dies in ihrem Alter nicht mehr so einfach war. Und wenn wider Erwarten doch noch ein Freier an die Haustür klopfte, dürfte dieser exorbitante Mitgiftforderungen stellen. Jürgen konnte die Ersparnisse der Familie nicht dem häuslichen Frieden opfern. Er benötigte das Geld, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Aber vielleicht fand sich ja ein Kandidat, der nicht auf die Mitgift schielte, sondern Frowe um ihretwillen ehelichte. Man sollte die Hoffnung bekanntlich nie aufgeben.
3
–
Haus Kemnade, 2. November 1622
Es schneite. Mit versteinerter Miene stand Cordt von der Recke, Herr über Kemnade und die Herrlichkeit Stiepel, neben dem glühenden Kohlebecken und schaute durch die Butzenglasscheiben des Südflügels den wirbelnden Flocken zu. Trotz der vom Alter gebeugten Gestalt, den zittrigen Händen und der krächzenden Stimme stand da ein Mann, der sich seiner Macht immer noch gewiss war.
Der Hausherr verzog das Gesicht, als sein Blick auf die Ruinen des Haupthauses fiel. Zwei der Ruhrsteinmauern hielten noch einige verkohlte Teile des Dachstuhls, der aber den Stürmen des Winters wohl nicht standhalten würde. Vom gegenüberliegenden, einst das Schloss beherrschenden Hauptturm waren nur Teile des Fundaments übrig und der Nordflügel bestand lediglich aus einem Haufen Steine. Das schreckliche Feuer vor mehr als dreißig Jahren hatte ganze Arbeit geleistet.
Cordt gestand sich ein, dass Haus Kemnade zu seinen Lebzeiten nicht mehr aussehen würde wie früher. Zu wenig hatte er seit dem Brand wieder aufbauen können, es fehlte das Geld. Jahrelang hatten er und seine Gattin in einer Notwohnung auf dem Gelände gehaust, den Bauern gleich, die ihm abgabepflichtig waren. Erst seinem Sohn Wennemar war es gelungen, den erhalten gebliebenen Rundturm durch einen Trakt mit dem neu aufgebauten Südflügel zu verbinden, in dem die Familie nun ihren Wohnsitz genommen hatte. Zu mehr hatten seine finanziellen Mittel nicht gereicht.
»Hast du bezüglich Ursula eine Entscheidung getroffen?«, erkundigte sich Anna von Quadt, die Frau, mit der Cordt seit Langem verheiratet war. Sie saß auf einem Schemel in der Nähe eines weiteren Kohlebeckens und stickte das Familienwappen in eine Tischdecke. Sie trug wie ihr Mann einen Umhang aus schwerer Wolle, denn in dem kargen Raum, der ihnen als Wohnstube diente, gab es keinen Kamin. Und die Wärme der Kohlen verpuffte nach wenigen Schritten. Außerdem schlossen die Fenster nicht richtig, sodass kalte Luft durch das Zimmer zur Eichentür zog, die in das Treppenhaus führte.
»Ja«, antwortete Cordt.
»Soll ich sie dann hereinbitten?«
»Natürlich. Und Wennemar gleich dazu.«
Seine Frau erhob sich ächzend, um ihre Kinder zu rufen. Cordt ging schweren Schrittes zum Tisch, um sich Wein einzuschenken. Ihn graute vor dem kommenden Gespräch. Aber es führte kein Weg daran vorbei.
Wenig später betraten die achtzehnjährige Ursula und ihr älterer Bruder den Raum. Die junge Frau war schlank und hochgewachsen, im Gegensatz zur untersetzten Gestalt ihres Bruders. Der Hausherr und seine Frau trugen kein Gramm Fett zu viel an ihren Körpern. Das und die unterschiedliche Haarfarbe der Geschwister hatten für allerlei Getuschel auf Kemnade geführt. Auch Cordt hatte in den ersten Jahren seinen Stammhalter mit einem gewissen Zweifel beäugt, seine Frau deshalb aber nie zur Rede gestellt. Jetzt war es dafür ohnehin zu spät. Cordt hatte Wennemar, selbst wenn er ein Kuckuckskind sein sollte, als Sohn anerkannt. Schließlich war ihm kein anderer männlicher Erbe geschenkt worden.
Der Hausherr gab seinen Kindern mit einer Geste zu verstehen, sich zu ihm an den Tisch zu setzen. Dann füllte er ihre Becher. »Ich habe euch rufen lassen, weil wir etwas zu besprechen haben, was in erster Linie dich angeht, Ursula«, sagte er leise.
Die junge Frau beugte sich gespannt vor, um ihren Vater besser zu hören. Dabei fiel eine Strähne des langen, blonden Haares in ihr Gesicht, die sie mit einer schnellen Handbewegung zurück hinter ihr Ohr klemmte.
»Ursula, du hast sicherlich aus den Gesprächen in der Vergangenheit mitbekommen, dass es um unsere finanzielle Situation nicht besonders gut steht. Die Ernten der Bauern sind in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen. Andauernd fallen fremde Soldaten in Stiepel ein, plündern und fressen uns die Haare vom Kopf. Der Wiederaufbau unseres Hauses verschlingt Unsummen. Deshalb dauert er auch so lange. Du bist jetzt im heiratsfähigen Alter. Es haben bereits einige Freier bei mir vorgesprochen.«
Ursula merkte auf.
»Alles Bewerber von untadeligem Ruf, füge ich hinzu. Ihnen war jedoch eines gemeinsam: Sie forderten eine maßlos hohe Mitgift. Kein Wunder, müssen ihre Familien doch ähnliche Schwierigkeiten wie wir bewältigen. An diesen Forderungen sind die Verhandlungen allesamt gescheitert.«
»Du hättest mich verheiratet, ohne meine Meinung einzuholen?« Ursulas Stimme klang entgeistert. »Verschachert wie ein Stück Vieh, nur mit dem Unterschied, dass der Preis für mich möglichst niedrig sein soll, damit unsere Schatulle nicht über Gebühr belastet wird?« Wieder fiel ihr die Haarsträhne ins Gesicht. Aber dieses Mal pustete Ursula sie wütend mit gespitzten Lippen beiseite.
Cordt von der Recke schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Sprich nicht in diesem Ton mit mir.«
Ursula wusste, dass sie zu weit gegangen war. Obwohl es in ihr brodelte, unterdrückte sie ihren Zorn. »Entschuldige, Vater.« Gehorsam senkte sie den Kopf.
»Um es kurz zu machen: Ich kann die Mitgiftforderungen für dich nicht aufbringen.«
»Dann warten wir eben noch etwas. Irgendwann wird sicher ein Freier kommen, der mir gefällt, ich ihm und der kompromissbereiter als die anderen Herren ist.«
»Das kommt nicht infrage.« Cordt von der Recke sah seine Tochter bestimmt an. »Es schickt sich nicht für ein Fräulein im heiratsfähigen Alter, im Haus ihrer Eltern zu hocken und zu warten, bis sie alt und grau ist.«
»Das werde ich ganz bestimmt nicht tun.«
»Natürlich nicht. Glaubst du, ich lasse zu, dass die Leute schlecht über unser Haus reden, uns gar verspotten, weil ich unsere Tochter nicht zum Traualtar führe? Du wirst im Kloster Gräfrath leben.«
Ursula sah erschrocken auf. »Ich soll Nonne werden?« Sie schüttelte heftig den Kopf. »Niemals!«
»Nicht Nonne, sondern Stiftsdame. Gräfrath wurde vor einigen Jahren dank einer großzügigen Entscheidung unseres Landesherrn in ein adliges Frauenstift umgewandelt. Das Stift ist reich und verfügt über ausgedehnte Ländereien. Als Kanonissin erhältst du deine Pfründe. Dein Auskommen ist gesichert, du lebst sorgenfrei für den Rest deiner Tage in deinen Gemächern mit eigenem Mobiliar, erhältst von mir einen einmaligen Betrag, über den du frei verfügen kannst. Von dir wird lediglich ein Gelübde der Keuschheit und des Gehorsams gegenüber der Äbtissin verlangt. Außerdem musst du am Stundengebet und der heiligen Messe teilnehmen und deine Mahlzeiten mit den anderen Damen im Refektorium einnehmen.«
Mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen sah Ursula ihren Vater an. »Aber … Auch der Eintritt in ein Stift kostet Geld … Ich meine …«
»Mach dir darüber keine Gedanken, Kind. Die Äbtissin ist Maria Magdalena von Hochstaden, eine frühere Freundin deiner Mutter. Sie hat mit ihr gesprochen. In deinem Fall wird die Zustiftung deutlich reduziert.«
Ursula war wie gelähmt. »Du kannst mich nicht zwingen dortzubleiben«, stieß sie schließlich hervor.
»Doch, das kann ich. Und ich habe das Recht dazu. Morgen früh wirst du aufbrechen. Dein Bruder wird dich begleiten. Er ist dafür verantwortlich, dass du wohlbehalten im Stift ankommst. Solltest du auf den dummen Gedanken kommen fortzulaufen, ist es ihm gestattet, dich zu züchtigen oder, wenn nötig, in Fesseln zu legen. Also versuche keine Flucht. Sie wird aussichtslos sein. Und nun verabschiede dich von deinen Eltern, wie es sich für eine Tochter gehört. Dann gehst du in deine Kammer und suchst das aus, was du mitnehmen möchtest.«
Cordt von der Recke stand auf und streckte seiner Tochter die rechte Hand entgegen. Widerstrebend kniete Ursula nieder und küsste sie. Dann ließ sie sich von ihrer Mutter umarmen. Aber die junge Frau empfand keine Zuneigung, nur tiefe Verzweiflung.
Auf dem Weg zu ihrer Kammer fragte sie ihren Bruder: »Du wusstest es, nicht wahr?« Als er schwieg, setzte sie fort: »Warum hast du mich nicht gewarnt? Ich dachte, du liebst mich?«
Rote Flecken der Wut zeigten sich auf seinem pausbäckigen Gesicht. »Ich gehorche Vater«, erwiderte Wennemar kalt und öffnete die Tür zu ihrem Refugium. Als Ursula zögerte, ergriff er ihren Arm, zerrte sie hinein und stieß sie auf ihr Bett. Dann verließ er ohne ein weiteres Wort den Raum.
Erschrocken registrierte Ursula, dass ihr Bruder die Tür zu ihrer Kammer verriegelte.
4
–
Schloss Strünkede, 3. November 1622
Der Winter war in diesem Jahr früher als sonst gekommen. Der gefrorene Boden knirschte unter den Hufen von Walter von Lindens Reitpferd. Der Advokat war gestern Morgen in Kleve aufgebrochen, hatte mit einer Fähre bei Xanten den Rhein überquert, in einer Weseler Herberge übernachtet und sich dann rechtsrheinisch nach Süden gewandt, bis er Ruhrort erreichte. Nach einer unruhigen Nacht in einem kalten Zimmer, welches er sich mit zwei laut schnarchenden Hamburger Kaufleuten teilte, war er früh weitergereist, um dem Lauf der Emscher nach Osten zu folgen.
Der eisige Wind blies ihm ins Gesicht. Er zog seinen dicht gewebten Umhang aus grobem Linnen höher. Es war kalt, gewiss. Aber der gefrorene Boden verhinderte, dass sein Pferd auf dem sonst morastigen Grund ausrutschte, strauchelte oder gar stürzte.
Die Emscher war noch nicht mit Eis bedeckt. Weiden mit tief hängenden Zweigen säumten ihr Bett. An manchen Stellen fanden sich Lücken im ansonsten dichten Astwerk und ließen den Blick auf die Sümpfe des Bruchwaldes am anderen Ufer zu.
Einmal sah Walter von Linden eine Herde Emscherbrücher. Die kleinen, wild lebenden Pferde ästen die letzten Gräser und Blätter ab. Der Leithengst hob den Kopf und spitzte die Ohren, als Walter sich näherte. Als das Tier erkannte, dass von dem Reiter keine Gefahr drohte, wandte es sich wieder dem Fressen zu.
Einige Stunden später passierte der Advokat die in einer Flussschleife gelegene und mit einer Zugbrücke ausgestattete Wasserburg Crange. Jetzt würde er bald sein Ziel erreichen.
Endlich tauchte die Silhouette Schloss Strünkedes auf. Umgeben von ausgedehnten Parkanlagen, thronte das mächtige Bauwerk auf einer künstlich angelegten Insel. Der Turm, an den sich zwei niedrigere Gebäudeflügel anlehnten, erstrahlte rot im Licht der untergehenden Sonne. Schießscharten an den Außenmauern zeugten von der Wehrhaftigkeit der Anlage. Die Gräfte, die das Schloss schützte, war teilweise zugefroren. Nur in der Mitte der Wasserfläche blieben kleinere Flächen eisfrei. Dort drängten sich nun die Enten.
Walter von Linden näherte sich der Burg von Westen her. Obwohl es anfing zu dämmern, erkannte er die Zimmerleute, die am Dachstuhl eines neu errichteten Hauses im Norden letzte Hand anlegten. Vermutlich sollte das Dach fertig gedeckt sein, bevor endgültig der Winter Einzug hielt.
Er folgte der Gräfte, stieg dann ab und führte sein Reitpferd über die Brücke zum Südportal. Das Getrappel hatte einen der Wächter aufgeschreckt, denn der Soldat öffnete eine Luke in dem mit Eisenplatten beschlagenen Tor und fragte: »Euer Begehr, Herr?«
»Meldet dem Drosten, dass Advokat Walter von Linden, unterwegs im Auftrag des klevischen Rats, ihn sprechen möchte.«
Der Soldat verschwand und die Luke wurde geschlossen. Kurz darauf schob ein anderer Bediensteter einen der Torflügel auf und ließ den Besucher eintreten.
Der überließ sein Pferd einem wartenden Stallknecht und folgte dem Diener ins Innere des Hauses.
Jobst von Strünkede erwartete seinen Gast im Arbeitszimmer des Hauptflügels. Er war etwa einen Kopf kleiner als von Linden. Obwohl sein Haar schütter war, trug er es nach französischer Sitte links schulterlang und rechts kurz. Da sich auf der einen Seite gekräuselte Locken wanden, auf der anderen jedoch nicht, vermutete von Linden, dass von Strünkede eine Brennschere benutzte. Des Drosten Bart hingegen war sorgsam gestutzt. Da Jobst von Strünkede auch den Gänsebauch, ein fast den ganzen Oberkörper bedeckendes, ausgestopftes Koller, trug, wirkte er unförmig und behäbig. Von Linden hingegen bevorzugte, der aktuellen Mode zum Trotz, eine schlichte Schaube. Beiden Männern allerdings hing eine zwei Handbreit große Kröse um den Hals, die auf groteske Art den Kopf optisch vom Körper trennte. Einigkeit bestand auch in der Farbe der Kleidung: Die Herren trugen Schwarz.
Obwohl nicht von Adel wie der Droste, stand Walter von Linden in der gesellschaftlichen Hierarchie aufgrund seiner Tätigkeit etwa auf derselben Stufe wie sein Gastgeber. Entsprechend formlos fiel ihre Begrüßung aus. Außerdem kannten die Herren sich von vielen Begegnungen und hatten einander in den letzten Jahren schätzen gelernt.
»Ich sehe, Euer Anbau macht Fortschritte«, bemerkte der Advokat. »Das Dach ist ja fast fertig.«
Der Droste nickte zustimmend. »Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, wir schaffen es nicht mehr, bevor der Schnee fällt. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Hoffen wir, dass Gott mich die Fertigstellung der Wasserburg noch erleben lässt.«
»Na, na, nun übertreibt mal nicht, werter Droste. Ihr seid doch kaum älter als ich.«
»Ich werde zweiundvierzig.«
»Eben.«
»Mein Baumeister meint, wenn wir in dem bisherigen Tempo weiterbauen, wird es noch gut zwanzig Jahre dauern.«
»Auch das werdet Ihr schaffen.«
Ein Diener brachte heißen Würzwein.
»Ich soll Euch Grüße von Adam von Schwarzenberg ausrichten«, wechselte von Linden das Thema.
»Danke. Kümmert sich der Geheime Rat immer noch um jede Kleinigkeit selbst?«
»Nicht mehr so stark wie früher. Seit sich Kurfürst Georg Wilhelm vor zwei Jahren diese schreckliche Wunde am Unterschenkel zugezogen hat, kann er nicht mehr richtig laufen und muss meistens in einer Sänfte getragen werden. Deshalb hat er Kleve seitdem nicht mehr besucht. Von Schwarzenberg reist stattdessen regelmäßig ins Brandenburgische, um Bericht zu erstatten. Im Grunde vertritt er den Landesherrn in Kleve. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für Aufgaben, die leicht delegiert werden können.«
»Verstehe. Aber was genau führt Euch zu mir?«
»Ich habe Euch einen Brief geschrieben. Hat er Euch nicht erreicht?«
Von Strünkede schüttelte den Kopf.
»Dann will ich kurz dessen Inhalt zusammenfassen. Nach dem Tod des letzten Herzogs von Kleve beschlossen Erbprinz Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg und unser Kurfürst Georg Wilhelm in Xanten eine Aufteilung der früher vereinten Herzogtümer, wie Ihr wisst. Nun steht dieses Vorhaben auf tönernen Füßen. Nur das Durcheinander nach dem Prager Fenstersturz vor vier Jahren hat bisher einen Krieg zwischen den beiden Kontrahenten verhindert. Adam von Schwarzenberg ist sich jedoch sicher, dass dieser Konflikt weiterschwelt und irgendwann in einem offenen Flächenbrand münden wird. Die Spanier haben als Unterstützer von Pfalz-Neuburg den Vertrag von Xanten nie umgesetzt und halten immer noch große Teile unseres Landes besetzt. Brandenburg ist weit weg. Wir werden in diesem Konflikt nur bestehen, wenn wir uns einig sind. Eifersüchteleien und das Festhalten an alten Privilegien bringen uns nicht weiter.«
Der Droste wirkte bestürzt. »Spielt Ihr etwa auf mich an?«
Von Linden lachte auf. »Sollte ich das?«
»Ach was.«
»Nein, Euch gilt die Kritik nicht. Aber dem Herrn von Kemnade mit seinen ewigen Beschwerden und Eigenmächtigkeiten. Cordt von der Recke unterläuft unsere Anweisungen oder führt sie nur halbherzig aus. Er zahlt seine Abgaben unregelmäßig …«
»Er steckt bis zum Hals in der Schuldenfalle«, unterbrach ihn von Strünkede. »Was ich bis zu einem gewissen Grad sogar nachvollziehen kann. Mir geht es schließlich ähnlich.«
»Aber der Bau Eures Schlosses schreitet voran …«
»Langsam, viel zu langsam.«
»Meinetwegen. Aber immerhin.«
»Ich will von der Recke nicht entschuldigen. Er fällt mir ja selbst ständig in den Rücken. Fast jedes seiner Urteil wird angefochten und landet später auf meinem Tisch. Bochum ist schließlich die Berufungsinstanz für das Hochgericht Stiepel. Und meint Ihr, er hält sich an mein Verdikt, wenn ich anders entscheide als er? Einen Teufel tut er. Dann muss ich mich mit den Betroffenen herumschlagen, die sich bei mir beschweren. Das stärkt nicht gerade mein Ansehen.«
»Das ist genau das, was ich meine. Wir können es uns nicht leisten, dass der untitulierte Adel macht, was er will. Wenn es hart auf hart kommt, müssen wir uns auf jeden in unserem Herrschaftsgebiet verlassen können, egal ob Bauer, Bürger oder Adeliger. Bei Cordt von der Recke hat der Geheime Rat seine Zweifel. Der Herr von Burg Kemnade würde nicht zögern, die Seite zu wechseln, wenn es für ihn von Vorteil wäre.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Beschäftigt Ihr Euch gerade mit irgendwelchen Berufungsverfahren?«
»Nein. Warum fragt Ihr?«
»Adam von Schwarzenberg denkt darüber nach, den Herrn von Kemnade vor das Reichskammergericht zu zerren, um ihm seine Privilegien streitig zu machen und bestenfalls die Herrlichkeit Stiepel aufzulösen und Bochum zuzuschlagen. Euer Einfluss würde wachsen, werter Droste.«
Man sah, wie es im Kopf von Strünkedes arbeitete. »Dafür braucht Ihr hieb- und stichfeste Beweise.«
»So ist es. Am besten sogar eine offene Auflehnung gegen Euch oder den klevischen Rat. Das überzeugt das Kammergericht und den Kaiser möglicherweise.«
»Aber sicher ist das nicht, oder?«
»Leider nein. Das Verhältnis des Kurfürsten zum Kaiser ist, sagen wir, angespannt. Ohne Weiteres wird das Gericht unserem Anliegen daher nicht folgen. Aber wenn von der Recke offen rebellierte … Darüber könnte der Kaiser nicht hinwegsehen, selbst wenn er wollte.«
»Es geht also darum, den Herrn von Kemnade zu einer solchen Tat zu bewegen?«
»Ich sehe, Ihr tragt den Beinamen ›der Gelehrte‹ nicht ohne Grund.«
Jobst von Strünkede lächelte geschmeichelt.
5
–
Hattingen, 5. Dezember 1622
In diesem Moment hasste Jürgen von Linden seinen Schwager voller Inbrunst. Wilhelm, dem die Hattinger den Beinamen ›der Arzt‹ verliehen hatten, war ein stadtbekannter Trunkenbold und Taugenichts. Die Leute ließen sich von ihm nur dann die Zähne ziehen oder Furunkel aufstechen, wenn der Medikus nicht greifbar war oder die Kranken das Honorar des Doktors nicht aufbringen konnten. Und selbst dann überlegten sie lange, ob sie die Künste eines Mannes in Anspruch nehmen sollten, der aus dem Mund stank wie ein Schweinestall und dessen Hände nur dann nicht zitterten, wenn der Inhalt mehrerer Humpen Bier in seinem Bauch gluckerte. Entsprechend selten sprachen Kranke bei Wilhelm vor, sodass seine Frau Trine, Jürgens jüngste Schwester, sich mehrmals im Monat bei ihrem Bruder Geld borgte, um wenigstens das Nötigste zu kaufen.
Vielleicht hätten Wilhelms Einnahmen ausgereicht. Aber da er jeden Albus, den er in seinen Fingern hielt, sofort in die Schenken der Stadt schleppte, blieb der Gedanke, dass sein Schwager seine Familie eines Tags allein versorgen konnte, bloß eine vage Hoffnung Jürgens. Alles gute Zureden war erfolglos geblieben, Wilhelm hatte dem Kaufmann einmal sogar Prügel angedroht, als dieser ihn zur Ordnung rief.
Trine, ein Jahr jünger als Jürgen, war kurz nach der Geburt ihrer Tochter Alke Witwe geworden. Der Schwarze Tod hatte deren Vater geholt. Lange hatte seine Schwester einen neuen Ehemann gesucht. Aber da Jürgen keine weitere Mitgift aufbringen konnte und vor allem Frowe als der älteren der Schwestern Vorrang eingeräumt wurde, hatte Trine über Jahre hinweg im Haus ihres Bruders gelebt. Irgendwann war Wilhelm aufgetaucht und Trine hatte sich ihm aus Angst, niemand sonst würde um ihre Hand bitten, im wahrsten Sinne des Wortes an den Hals geworfen.
Seitdem hausten sie mit zwei weiteren armen Familien in einem halb verfallenen Kotten in der Nähe des Holschentores. Jürgens Angebot, zu den Knechten und Mägden in das Gebäude hinter dem Wohnhaus der Familie zu ziehen, hatte Trine rundweg abgelehnt. Sie nutzten einen Garten außerhalb der Stadtmauern, welcher der Kirche gehörte. Allerdings gelang es ihnen nur selten, die fällige Pacht pünktlich zu zahlen, sodass die drohende Kündigung durch den Pfarrer wie ein Damoklesschwert über ihnen schwebte.
Vorhaltungen ihrer Brüder wies Trine regelmäßig barsch zurück. Jürgen vermutete, dass sie ihnen nicht eingestehen wollte, mit Wilhelm die falsche Wahl getroffen zu haben. Aber jetzt schien sein Schwager zu weit gegangen zu sein.
»Trine hat mir erzählt, du hättest sie geschlagen.«
Wilhelm der Arzt stand mit gesenktem Kopf vor Jürgen in dessen Kontor und knetete seine Finger.
»Stimmt das?«
Langsam sah Wilhelm hoch. Jürgen erkannte die Tränen in den Augen seines Gegenübers. Fast hatte er Mitleid mit seinem Schwager. Aber ein Blick in das vom Branntwein gerötete Gesicht, in dem eine triefende Nase thronte, und auf das strähnige, fettige Haar, welches ungebändigt in die Stirn fiel, ließ Jürgen sein Mitgefühl schnell vergessen.
»Ich hatte getrunken. Nur wenig, das musst du mir glauben. Aber wohl genug. Ich hatte Hunger und es gab nichts zu essen. Trine hat mich beschimpft und da habe ich mich vergessen.«
»So wie du dich häufiger vergisst, oder?«
»Ich habe Trine oder Alke bisher nie geschlagen«, versicherte Wilhelm.
Das stimmte, soweit Jürgen wusste. Zumindest hätte Jürgen es erfahren, falls Wilhelm Alke gezüchtigt hätte, denn sein Sohn Dirk hing an seiner Cousine, als sei sie seine leibliche Schwester. Und Alke erwiderte diese Zuneigung. Sie hätte es Dirk erzählt, wenn ihr Stiefvater sie geschlagen hätte. Und Dirk hätte sich mit Sicherheit bei seinem Vater darüber beschwert.
»Es tut mir leid.« Wilhelms Zerknirschung schien echt zu sein.
Trotzdem wollte ihn Jürgen nicht mit einer einfachen Entschuldigung davonkommen lassen. »Solltest du dich noch einmal ›vergessen‹, werde ich dich zur Rechenschaft ziehen und in den Kerker werfen lassen. Egal, ob du mein Schwager bist. Und auch wenn Trine noch so bettelt, wirst du dafür büßen. Hast du das verstanden?«
»Ja, Herr.«
»Du brauchst mich nicht Herr zu nennen. Wir sind verwandt.« Leider, setzte Jürgen in Gedanken hinzu. »Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht?«
Er hatte Wilhelm angeboten, für ihn zu arbeiten. Er könne einen der Karren lenken und Waren transportieren. Dafür bekomme er genug Geld, um seiner Familie einen einfachen, dennoch angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen. Zusätzlich erhielten sie zwei Kammern im Hinterhaus, um darin zu wohnen.
Diese Offerte hatte Jürgen nicht ohne Eigennutz unterbreitet. Stünde Wilhelm in seinen Diensten, könnte er ihn besser kontrollieren. Geld bezahlte er seiner Schwester ohnehin. Außerdem wäre es ihm möglich, einen der Knechte zu entlassen. Unterm Strich würde er sogar sparen.
»Ja, ich habe Trine davon erzählt. Sie ist dagegen und ich will ihr nicht widersprechen. Trotzdem danke.«
Das hatte Jürgen befürchtet. Geld von ihm zu nehmen, war das eine. Quasi eine brüderliche Verpflichtung, weil er ihr keine zweite Mitgift gewährt hatte. Aber dass ihr Mann wie ein Knecht unter Jürgens Kommando arbeitete, ließ Trines Stolz nicht zu.
»Dann eben nicht. Hast du die Werkzeuge noch, die ich dir geschenkt habe?«
Wilhelm nickte.
Vor einigen Jahren hatte Jürgen seinem Schwager die wichtigsten medizinischen Instrumente gekauft, die ein Bader besitzen sollte, nachdem Wilhelm seine eigenen verhökert hatte, um Geld für Bier zu beschaffen.
»Du lügst mich auch nicht an?«
»Nein. Frag Trine.«
»Das werde ich. Sind sie in einem ordentlichen Zustand?«
»Ja.«
»Gut. Reinige dich und putze dir vor allem die Zähne. Ein Bader, der aus dem Mund stärker stinkt als seine Kunden, darf sich nicht wundern, wenn niemand Vertrauen in seine Fähigkeiten hat.«
Wieder nickte Wilhelm.
»Und sage Trine, sie soll deine Hosen waschen.«
»Das geht nicht«, erwiderte Wilhelm.
»Warum nicht?«
»Ich habe nur diese.«
Jürgen seufzte. Der Bader hatte ungefähr seine Statur. »Du bekommst welche von mir.«
Wieder bedankte sich sein Schwager.
»Jetzt gehst du nach Hause. Entschuldige dich bei Trine. Sie ist bei Gesche und Frowe in der Küche, die Frauen behandeln ihr blaues Auge. Und fasse meine Worte nicht als leere Drohung auf, das rate ich dir. Solltest du meine Schwester oder gar Alke jemals wieder schlagen, vergesse ich, dass du mein Schwager bist.«
6
–
Hattingen, 4. Januar 1623
Die spanischen Soldaten kamen kurz nach Sonnenaufgang. Zehn Musketiere mit Sturmhauben, Degen und Luntenschlossmusketen und ein Fähnrich, auf dessen Schärpe das Kreuz von Burgund prangte, betraten den Eickener Hof, der etwa fünfzehn Minuten Fußweg westlich der Hattinger Stadtmauer lag.
Sie überraschten den Pächter Arndt beim Melken der einzigen Kuh, die die Familie besaß. Unter Schlägen mit der flachen Seite ihrer Degen trieben zwei von ihnen Arndt aus dem Stall. Ein dritter stieß mit dem Fuß den halb vollen Milcheimer um und zog die verängstigt muhende Kuh ins Freie.
Durch den Lärm aufgeschreckt, den die Soldaten veranstalteten, stürmte Arndts Knecht Mattes herbei. Ohne zu zögern, stürzte er sich auf die beiden Musketiere, die die Arme des sich heftig wehrenden Bauern festhielten. Mattes war ein Mann wie ein Baum, seine Muskeln gestärkt von der Arbeit auf den Feldern. Den ersten Soldaten schlug er nieder, aber dem zweiten kamen seine Kameraden zu Hilfe. Einer von ihnen hieb Mattes den hölzernen Schaft seiner Muskete auf den Kopf. Mit einem Stöhnen sank der Knecht auf die Knie. Weitere Soldaten griffen in den ungleichen Kampf ein und nach kurzer Zeit lag Mattes auf dem Boden, übel zugerichtet und aus vielen Kopfwunden blutend. Er versuchte, sich stöhnend zu erheben, fiel aber wieder in sich zusammen.
»Das reicht«, befahl der Offizier auf Spanisch. Dann wandte er sich an Arndt. »Du siehst, Widerstand ist zwecklos«, meinte er in holprigem Deutsch. »Wo ist deine Familie?«
Arndt schlotterte vor Angst. »Im Haus.«
»Hol sie.« Der Fähnrich gab seinen Männern zu verstehen, dass sie den Bauern loslassen sollten. »Wenn du in zwei Minuten nicht zurück bist, suchen wir dich. Falls du Waffen in deinem Haus hast, lass sie unberührt, sonst wirst du es bereuen.«
Arndt nickte und lief los. Kurz darauf standen seine Frau und die beiden fünf und sieben Jahre alten Töchter neben ihm in der eisigen Kälte. Die Mädchen drängten sich weinend an ihre Mutter, die schützend einen Arm um jedes gelegt hatte.
Die spanischen Musketiere bauten sich vor der Familie auf und der Offizier fuhr Arndt mit herrischem Ton an: »Hast du Geld im Haus?«
Der Bauer warf seiner Frau einen schnellen Blick zu. Die schüttelte fast unmerklich den Kopf. »Nein«, antwortete er deshalb mit so fester Stimme, wie es ihm in dieser Situation möglich war.
»›Nein‹?« Der Spanier lächelte. »Ich denke, dass ihr sehr wohl Münzen im Haus versteckt. Alle Bauern haben Geld.«
»Wir nicht«, versicherte Arndt.
Der Fähnrich baute sich vor seinem Gefangenen auf. »Weißt du, was ich jetzt machen werde?«, fragte er gefährlich leise. »Ich werde meinen Männern freien Lauf lassen. Dein Weib ist jung und gut gebaut. Sie werden sicher ihren Spaß haben. Wo hast du das Geld versteckt?«
Als Arndt nicht sofort antwortete, setzte der Spanier fort: »Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Vielleicht gefällt es deiner Frau sogar, wenn meine Männer sie besteigen. Wenn dem so ist, warum solltest du die Wahrheit sagen? Ich denke, wir lassen deinen Knecht den Schwedentrunk schmecken. Und wenn du dann immer noch nicht redest, darfst du dieses edle Getränk ebenfalls probieren.«
»Bitte, Herr, lasst meine Frau in Frieden und tut auch Mattes nichts …«
Ungerührt befahl der Befehlshabende: »Fangt an.«
Mehrere Soldaten rollten den Knecht auf den Rücken, hielten dessen Arme und Beine. Mit Gewalt trieb ihm ein Dritter einen Trichter in den Mund, sodass einige Zähne brachen, und hielt diesen fest. Ein anderer lief in den Stall und kam mit einem Eimer übel riechender Jauche zurück.
Als alles für die Tortur vorbereitet war, nickte der Offizier und der Soldat kippte die stinkende Flüssigkeit langsam in den Trichter. Ein weiterer hielt dem Knecht die Nase zu. Zunächst passierte nichts. Dann aber schluckte Mattes reflexhaft, um den drohenden Erstickungstod zu verhindern. Er bäumte sich erfolglos auf, trank, gurgelte, schluckte wieder, bis sich der Inhalt des Eimers in seinem Magen befand. Damit aber nicht genug. Um seine Qualen zu verstärken, sprangen die Soldaten unter Gejohle immer wieder auf seinen prall gespannten Bauch. Mattes’ Schreie hatten nichts Menschliches mehr an sich. Minuten dauerte sein Todeskampf, Jauche und Blut liefen ihm aus Mund und Nase, bis endlich die Magenwand platzte und der Knecht in eine gnädige Ohnmacht sank.
Arndt weinte hemmungslos. Seine Frau hielt den Mädchen die Hände vor die Augen.
»Also?«
»Es liegt in der Truhe. Bitte, Herr, wir brauchen das Geld, um über den Winter zu kommen.«
»Und wir müssen nicht über den Winter kommen?«, spottete der Offizier. »Wir sind zu eurem Schutz hier, damit ihr nicht den Brandenburgern in die Hände fallt, und ihr wollt, dass wir hungern und frieren? Sieht so eure Dankbarkeit für unsere Hilfe aus? Wo steht diese Truhe?«
»Unter dem Bett in unserer Schlafkammer.« Arndt konnte den Blick nicht von Mattes wenden, der fast friedlich in der Mischung aus Blut und Jauche lag.
Die Bäuerin riss entsetzt die Augen auf, schwieg aber.
Der Fähnrich zeigte auf Mattes. »Du kannst ihn spätestens morgen begraben. Nur denk daran, dass du für seinen Tod verantwortlich bist. Hättest du eher geredet … Na ja, das war deine Entscheidung.«
Auf den Befehl ihres Anführers hin gingen zwei Soldaten in das Haus. Wenig später schleppten sie die Truhe hinaus und stellten sie vor dem Offizier auf den Boden. Der öffnete den Deckel, zog einen kleinen Beutel hervor und kippte den Inhalt in seine Handfläche. »Zehn Albus. Das ist alles?«
»Mehr haben wir nicht.«
»Das ist zu wenig. Dann werden wir uns wohl an deinem Vieh schadlos halten.« Der Fähnrich marschierte zum Stall und warf einen Blick hinein. »Die Kuh haben wir schon. Wir nehmen auch noch die zwei Schweine.«
Auf seine Kopfbewegung hin marschierten vier Soldaten in den Stall. Die Tiere quiekten laut und einer der Spanier fluchte. Dann wurde es still. Geduldig wartete der Offizier. Schon bald kehrte der erste Musketier wieder zurück und wischte sein blutiges Messer an Mattes Kleidung sauber.
»Wir brauchen Stangen«, forderte der Fähnrich.
Der Bauer hatte resigniert. »Hinter dem Haus liegen welche.«
Als die Soldaten die ausgebluteten Schweine auf den Stäben aus dem Stall trugen, liefen erneut Tränen über das Gesicht des Bauern.
»Was regst du dich auf?«, fragte der Offizier, als er Arndts Verzweiflung bemerkte. »Deine Familie lebt, du lebst und ihr habt ein Dach über dem Kopf. Außerdem lassen wir dir die Ziege und die Hühner. Andere Bauern sind schlechter dran. Du kannst dich glücklich schätzen, dass ich zu dir gekommen bin und keiner meiner Kameraden. Sie verspotten mich ständig wegen meines großen Herzens. Also hör auf zu flennen.«
»Aber wovon sollen wir leben?«
»Friss Brot, saufe Wasser. Und schlag Eier in die Pfanne. Was willst du mehr? Deine Familie wird schon nicht verhungern.« Der Offizier drehte sich um, wandte sich aber dann doch noch einmal Arndt zu. Er lächelte ihn an und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass die Lippe des Bauern platzte und Blut herausspritzte. »Du hättest wirklich ein wenig mehr Dankbarkeit zeigen können«, murmelte der Fähnrich und gab seinen Männern den Befehl zum Aufbruch.
7
–
Kloster Gräfrath, 9. Januar 1623
Sie lebte seit einigen Wochen in einem Kerker, der sich Frauenstift nannte und noch vor wenigen Jahren ein Kloster gewesen war. Ursula von der Recke hatte schon in den ersten Tagen nach ihrer erzwungenen Ankunft beschlossen zu fliehen, sobald sie die Gelegenheit dazu bekam. Aber das stellte sich als schwierig heraus. Denn nachts verschloss eine mürrische Nonne alle Türen, tagsüber blieben die Kanonissinnen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur selten allein. Alle Mahlzeiten nahmen die Damen gemeinsam im Refektorium ein, der Tag wurde vom frühen Morgen bis zum Abend durch fünf Stundengebete strukturiert, die genau drei Stunden auseinanderlagen und bis zu zwei Stunden dauerten. Die Stiftsdamen beteten und sangen immer gemeinsam. Viel Zeit blieb da nicht, die Ursula allein in ihrer Kammer verbringen konnte.
Versäumte eine Insassin den Anfang eines der Stundengebete, suchte die immer schlecht gelaunte Schwester Maria die Abwesende und geleitete sie in den Kapitelsaal.
Einige der Stiftsdamen wohnten nicht innerhalb der Klostermauern, sondern kehrten nachts in ihre Wohnungen in der Umgebung zurück. Andere durften dann und wann das Gebäude verlassen. Aber dieses Privileg genossen nur die wenigen, die auf eigenen Wunsch in das Stift gekommen waren.
Um kein Misstrauen zu erregen, fügte sich Ursula allen Regeln, sang und betete, als wollte sie jeden Augenblick in den Himmel auffahren, senkte züchtig den Kopf, wenn sie von der Äbtissin oder einer der Nonnen angesprochen wurde, behandelte ihre Mitbewohnerinnen höflich und zuvorkommend und erwarb sich so schnell den Ruf einer untadeligen jungen Dame, deren höchstes Glück darin zu bestehen schien, in den Gemäuern von Gräfrath begraben zu sein.
Vom Refektorium im Westflügel gelangte man an der Küche vorbei über den Kreuzgang zum Ostflügel. An dessen Anfang lag die Pforte, die in den Klosterhof führte, einige Meter gegenüber der Tür, die sich zum Schlaftrakt öffnete. Ursulas Kammer befand sich kurz dahinter. Nach dem letzten Stundengebet wurde auch dieser Einlass durch Schwester Maria verriegelt.
Ursula zog gerade ihre Schuhe aus, als ein gellender Schrei durch die Nacht hallte.
»Hilfe, schnell, ich brauche Hilfe!«
Sie wusste, wer da schrie. Ihre Zimmernachbarin, deren Zustiftung noch geringer als die ihre gewesen war, lebte mit einem anderen Fräulein gemeinsam in einer Kammer.
»Sie hat sich die Adern aufgeschnitten, schnell!«
Ursula öffnete ihre Tür einen Spalt und lauschte. Der Eingang zum Schlaftrakt wurde entriegelt.
»Was ist passiert?«, erkundigte sich Schwester Maria.
»Es ist alles voller Blut«, stammelte die andere Stiftsdame. »Ihre Kleider, das Bett, einfach alles.«
Ursula hörte, wie Schwester Maria die Kammer nebenan betrat und andere Stiftsdamen neugierig ihre Zimmer verließen. Wenig später kehrte die Nonne auf den Flur zurück und befahl: »Geht in Eure Kammern. Alle! Ich verständige die Äbtissin und den Medikus. Ich komme gleich wieder.«
Die Damen gehorchten. Als die Türen geschlossen wurden, war das Geräusch sich schnell entfernender Schritte neben dem Schluchzen ihrer Nachbarin das Einzige, was Ursula vernahm. Kein Vorschieben des eisernen Riegels, kein Drehen des Schlüssels im Schloss der Zwischentür. Sie stand offen! Ursula überlegte nicht lange, schlüpfte in ihre Schuhe, versicherte sich, dass ihr Geldbeutel in der Tasche steckte, und warf ihren Umhang über. Dann lief sie auf Zehenspitzen in den Flur und zur Pforte. Mit klopfendem Herzen zog sie an der schweren Eichentür, die leise in den Scharnieren quietschte. Erschrocken schaute Ursula sich um. Sie sah niemanden. Schnell zog sie die Pforte auf und schlüpfte hindurch.
Vor Aufregung und Angst schwer atmend, stand sie im Klosterhof. Es war stockdunkel. Nur eine einsame Fackel neben dem Tor, das in die Freiheit führte, warf einen schwachen Schein.
Ursula wusste, dass sie sich beeilen musste. Bis zum Wohnhaus der Äbtissin im Dorf war es nicht weit, der Weg dauerte nicht länger als einige Minuten. Und da das letzte Stundengebet erst kurze Zeit zurücklag, war sicher auch die Äbtissin noch nicht vollständig entkleidet. Umso schneller wäre sie im Stift. Aber alle Gedankenspiele blieben ohne Wert, wenn Schwester Maria die äußere Tür verriegelt und nicht wie die anderen zu schließen vergessen hatte.
Schnell lief Ursula zum Tor. Zu ihrer Erleichterung stand es offen. Hastig huschte sie hindurch. Keinen Moment zu früh, denn vom Dorf her erklangen aufgeregte Stimmen und Fackelschein erhellte die Nacht.
Ursula raffte ihren Rock und rannte los. Nur weg von hier! Fort von dem verfluchten Kloster. Und auch fort von ihren Eltern, die sie hier eingesperrt hatten.
Sie sah kaum die Hand vor Augen, da dichte Wolken den Mond verdeckten. Mehrmals rutschte sie aus, schlug hin, Zweige peitschten ihr ins Gesicht. Sie wusste nicht, wie lange sie gerannt war, als sie heftige Stiche in der Leiste verspürte. Nach Luft japsend, blieb sie stehen.
Höchstwahrscheinlich würde ihre Flucht erst morgen früh entdeckt werden. Bis dahin musste sie so viel Abstand wie möglich zwischen sich und das Kloster gebracht haben, denn die Äbtissin würde mit Sicherheit nach ihr suchen. Das war sie ihrer früheren Freundin Anna von Quadt schuldig. Und wenn Ursula gefunden würde … Daran mochte sie nicht denken.
Endlich riss die Wolkendecke auf und sie vermochte sich zu orientieren. Unter ihr schimmerte matt ein Fluss. Das musste die Wupper sein, von der Wennemar auf ihrer Reise gesprochen hatte. Jetzt im Winter dürften ihre Ufer vereist und begehbar sein. Wenn Ursula dem Fluss nach Norden folgte, würde sie irgendwann Elberfeld erreichen. Von dort war es nicht mehr weit bis Sprockhövel. Da kannte sie sich wenigstens etwas aus. Der Süden hingegen war ihr fremd. In dem kleinen Ort angekommen, würde sie ihr weiteres Vorgehen planen.
Ursula durchquerte eine Senke, hinter der das Gelände etwas abfiel, passierte einen kleinen Felsvorsprung und blieb wie angewurzelt stehen. Vielleicht zwanzig Schritte vor ihr erhellte ein flackerndes Licht das Dunkel. Vorsichtig schlich sie näher. Sie hörte die Klänge einer Laute und leisen Gesang. Ein junger Mann hockte an einem Feuer und spielte. Niemand sonst war zu sehen.
»Wer immer im Dunkeln herumschleicht: Kommt ins Licht und zeigt Euch.« Der Unbekannte legte sein Musikinstrument beiseite, ergriff einen Degen und erhob sich langsam. Dann klopfte er demonstrativ auf seine Waffe. »Glaubt mir, ich vermag damit umzugehen. Solltet Ihr Böses im Schilde führen, verschwindet besser. Wenn nicht, kommt näher, wärmt Euch an meinem Feuer, trinkt ein wenig Wein und leistet mir Gesellschaft. Also?« Der Mann schaute in Ursulas Richtung. Und obwohl sie wusste, dass er sie nicht sah, schien es, als blickte er direkt in ihre Augen.
Die junge Frau gab sich einen Ruck, holte tief Luft und trat in den Lichtschein des Feuers.
»Ah, eine hochwohlgeborene Dame, Eurer Kleidung nach zu urteilen.« Der Fremde legte den Degen beiseite, zog seinen Hut und verbeugte sich schwungvoll. Einzelne Strähnen seiner schwarzen Haare fielen ihm in die Stirn. »Clemens Nagel, wenn’s beliebt.«
Ursula wollte die Höflichkeit erwidern, biss sich dann aber auf die Lippen. War es klug, einem völlig Fremden ihren Namen zu nennen?
Clemens Nagel bemerkte ihr Zögern. »Ihr müsst mir nicht sagen, wie Ihr heißt. Sichert mir nur zu, dass Ihr Eure eigenen Kleider tragt und sie nicht irgendwo gestohlen habt. Ich möchte ungern als Mittäter in den Kerker wandern, sollten unverhofft irgendwelche Schergen auftauchen, die hinter Euch her sind.«
»Ich bin keine Diebin«, versicherte sie und kam langsam näher. »Ich habe auch nichts Unrechtes getan. Nennt mich Ursula.«
»Gut, dann setzt Euch zu mir.«
Der junge Mann schien Mitte Zwanzig und damit nur wenige Jahre älter als sie zu sein. Verstohlen musterte Ursula ihn, als er sich umdrehte und zum Feuer zurückging. Er war modisch gekleidet, sein Wams mit Goldbrokat bestickt. Seine Stiefel schienen aus feinstem Leder gefertigt, sein Umhang wie der ihre aus dicker Wolle gewebt. Ein Vollbart umrahmte sein spitzes Kinn.
Clemens Nagel schob einen Ast weiter ins Feuer. Die Glut loderte auf und Flammen schlugen hoch. Dann wandte er sich wieder Ursula zu und zeigte auf den Platz direkt unter einem Steinvorsprung. »Setzt Euch dorthin. Der Fels schützt vor dem Wind. Außerdem habe ich Reisig ausgebreitet und eine Decke darübergelegt. Das hält die Feuchtigkeit zurück.«
Ein Pferd schnaubte leise. Ursula schaute sich erschrocken um.
»Ihr müsst Euch nicht fürchten. Das ist nur mein Wallach. Ihr könnt ihn von hier aus nicht sehen. Ich habe ihn einige Meter entfernt angebunden. Dort wächst unter den Tannen etwas Moos. Ein karges Futter zwar, aber immerhin. Seine Unruhe hat mich vor Euch gewarnt.«
Ursula nickte und setzte sich. Tatsächlich war der Lagerplatz gut ausgesucht. Das Feuer wärmte, die kleine Ausbuchtung in der Felswand vermittelte eine gewisse Behaglichkeit und bot, wenn man sich eng an den Stein drückte, sogar Schutz vor Regen. Außerdem schirmte sie den Lichtschein ab, sodass man das Lager, zumindest aus der Richtung, aus der Ursula gekommen war, erst spät ausmachte.
Clemens Nagel reichte ihr einen Holzbecher und griff zu einem ledernen Schlauch. »Leider habe ich nur einen Becher. Wir müssen ihn uns also teilen. Dafür ist der Wein gut. Mehr kann ich Euch nicht anbieten. Es sei denn, Ihr mögt Moos wie mein Pferd. Was mich überraschen würde.« Er lachte.
»Habt Ihr etwas Wasser?«, bat Ursula. »Ich möchten meinen Durst nicht mit Wein löschen.«
Nagel stand auf, ergriff einen zweiten Schlauch und kippte Wasser in den Becher. Ursula trank hastig. Nachdem er ihr dreimal nachgeschenkt hatte, streckte Nagel ihr erneut fragend den Schlauch entgegen. »Danke. Aber jetzt nehme ich einen Schluck Wein, wenn es Euch recht ist.«
»Natürlich.«
Als Ursula am Roten nippte, hockte sich Nagel zwei Schritte von ihr entfernt auf den gefrorenen Boden. »Ist Euch nicht kalt?«, erkundigte sie sich mitfühlend.
»Mehr Reisig habe ich leider nicht. Auf Besuch war ich nicht eingestellt. Und in stockfinsterer Nacht geistere ich nur ungern durch den Wald und sammele Holz.«
Ursula rückte ein Stück zur Seite. »Dann setzt Euch zu mir. Hier ist Platz für uns beide.«
Der junge Mann ließ sich neben ihr nieder, griff zur Laute und spielte leise. Dazu sang er mit einer tiefen, melodischen Stimme.
Gebannt hörte Ursula zu. Dann fragte sie: »Ihr musiziert herrlich, wer hat Euch das beigebracht?«
»Meine Mutter.«
»Sie muss begabt sein.«
»Ja, das war sie.«
»Es tut mir leid.«
»Schon gut. Sie starb, als ich noch ein Kind war.«
»Woher stammt Ihr?«
»Der Sitz meiner Familie ist Haus Itlingen. Es liegt in Herbern bei Ascheberg. Habt Ihr schon einmal davon gehört?«
»Nein.«
»Ursprünglich diente unsere Familie dem Grafen von Ravensburg.«
»Und was macht ein Edelmann von Haus Itlingen in einem Wald bei Gräfrath?«
»Das ist eine lange Geschichte.«
»Erzählt sie mir«, bat Ursula. »Ich liebe Geschichten.«
»Gut, unter einer Bedingung.«
»Die wäre?«
»Im Gegenzug will ich wissen, was eine edle Dame wie Ihr ohne Begleitung in stockfinsterer Nacht in einem Wald bei Gräfrath macht.«
Ursula lachte auf. »Einverstanden«, antwortete sie, ohne nachzudenken, und schalt sich unmittelbar darauf eine Närrin.
8
–
Kleve, 10. Januar 1623
Durch die Butzenglasscheiben im Kanzleigebäude der Schwanenburg bot sich ein weiter Blick über die Stadt. Die frühere Stammburg der Herzöge von Kleve diente nach dem Tod des letzten Herzogs jetzt dem brandenburgischen Kurfürsten Georg Wilhelm als weitere Residenz und seinen niederrheinischen Räten als Dienstsitz.
Im Kontor des Geheimen Rats Adam von Schwarzenberg verbreitete ein Kaminfeuer behagliche Wärme. Der Raum war mit einigen Regalen, in denen Akten lagerten, und einem schweren Eichentisch, um den herum ein gutes Dutzend Stühle standen, nur spärlich möbliert.
Von Schwarzenberg saß an der Stirnseite des Tisches, zu seiner Rechten beugte sich Walter von Linden über ein Schriftstück. Vor den Herren stapelten sich Dokumente und Akten aller Art. Ein Diener stand neben der Tür bereit, um jederzeit warmen Würzwein nachzuschenken.
Der Geheime Rat hatte blondes, langes Haar, welches onduliert auf seine Schultern fiel. Sein Spitzbart reichte ihm bis zur Brust. Mit knapp vierzig war er fünf Jahre älter als sein Gesprächspartner.
»Der Vertrag von Xanten ist eindeutig und einfach. Unser Kurfürst erhält das Herzogtum Kleve und die Grafschaften Mark und Ravensberg, der Herzog von Pfalz-Neuburg die Herzogtümer Jülich und Berg.« Walter von Linden senkte das Schriftstück. »Damit sollten die Unklarheiten des Dortmunder Rezesses von 1609 beseitigt werden. Eine gemeinsame Regierung für alle Territorien konnte ja nicht gut gehen. Deshalb gab es die Übereinkunft von Xanten.« Er schmunzelte. »Nachdem unser Herr bei den Verhandlungen in Düsseldorf dem Erbprinzen von Pfalz-Neuburg eine Ohrfeige versetzt hat, war das Tischtuch zwischen den beiden endgültig zerschnitten und eine Regelung notwendig.«
»Trotzdem wüten die Spanier in Gebieten, die uns gehören. Unter anderem auch in Eurer Heimatstadt, wenn ich richtig informiert bin.«
»Das seid Ihr. Die Soldaten pressen Hattingen aus, wo sie nur können. Die Spanier haben dem Rat gegen die Zahlung einer beachtlichen Summe Schutz versprochen. Der besteht im Wesentlichen darin, dass sie den Bürgern nicht die Häuser über dem Kopf anzünden und ihre Rechnungen in den Schenken begleichen, solange sie ihren Sold regelmäßig erhalten. Ganz anders geht es im Umland Hattingens zu. Da plündern und rauben die Soldaten die Bauern aus, die sich glücklich schätzen können, wenn sie nicht ihr Leben verlieren.«
»Das ist schlimm. Nur geht es den Spaniern meines Erachtens nicht allein um das Herzogtum Kleve. Ich habe im Xantener Vertrag nachgelesen: Das Dokument sichert den Lutheranern, den Katholiken und den Calvinisten Religionsfreiheit zu. Das ist den spanischen Besatzern ein Dorn im Auge. Und natürlich wollen sie auch die Nachschub- und Handelsrouten der Niederländer treffen und deren Außenposten in Westfalen bekämpfen. Schließlich liegen sie mit denen schon seit Jahrzehnten im Streit. Auch deshalb sind die Spanier im Rheinland einmarschiert. Der Erbschaftsstreit ist nur ein Grund unter vielen.«
»War nicht unser verstorbener Herzog ein Freund Spaniens?«, wollte Walter von Linden wissen.
»Sicher. Und sowohl der Neuburger als auch der brandenburgische Kurfürst waren Lutheraner. Ein weiterer Grund für Spanien, in dem Erbschaftsstreit zu intervenieren.«
»›Waren‹?«
»Unser gnädiger Herr ist zum Calvinismus übergetreten, der Kurpfälzer hat die katholische Schwester des bayerischen Herzogs geheiratet und ist zu deren Glauben konvertiert. Jetzt hat er denselben wie die Spanier und fühlt sich ihnen plötzlich verbunden. Lutheraner ist keiner der beiden Herren mehr.«
»Was für ein Tohuwabohu.«
Adam von Schwarzenberg lachte. »Das könnt Ihr laut sagen. Als dann auch noch auf Bitten des protestantischen Adels die Franzosen, die Erbfeinde Spaniens, in Jülich einmarschierten, um die Stadt von den Katholiken zu befreien, gab es für die spanischen Truppen kein Halten mehr. Auch wenn die Franzosen wieder fort sind: Die Spanier sind geblieben und machen uns seit Jahren das Leben schwer.«
»Und der Kaiser schweigt.«
»Was soll er schon sagen? Er ist Katholik.«
»Wäre es nicht seine Pflicht, den Vertrag von Xanten durchzusetzen?«
Von Schwarzenberg nickte. »Eigentlich schon. Schließlich ist er auf seine Intervention hin überhaupt zustande gekommen. Aber der Kaiser tut es nicht. Ich habe bereits eine Klage beim Reichskammergericht gegen Pfalz-Neuburg erwogen. Ich kenne den Gerichtspräsidenten recht gut, er ist mir gewogen. Trotzdem habe ich mich dagegen entschieden, obwohl der Kurpfälzer den Vertrag von Xanten ständig verletzt.« Er lachte. »Denn dummerweise handelt unser gnädiger Herr ähnlich.«
»Ihr befürchtet also, unterliegen zu können? Schließlich steht der Kaiser Pfalz-Neuburg näher als dem brandenburgischen Kurfürsten.«
»Und die nicht an dem Erbfolgestreit beteiligten Reichsfürsten warten ab. Sie stellen allerdings die Mehrheit der Assessoren am Reichskammergericht, sind also bestenfalls neutral. Sicher auf unserer Seite sind nicht mehr als eine Handvoll der vierundzwanzig dort beschäftigten Juristen. Ja, wir würden verlieren. Und dann könnte der Kurpfälzer sich sogar auf diese Entscheidung berufen. Stimmt Ihr mir zu?«
»Ja.«
»Das freut mich. Ich habe auf Euren Rat immer große Stücke gehalten. Außerdem ist zu bedenken, dass die Spanier, selbst wenn wir gewinnen sollten, sich um ein solches Urteil einen Teufel scheren würden. Dann drohte Krieg. Wir müssen uns deshalb auf unseren Landadel verlassen können. Störenfriede wie dieser Herr von Kemnade mit seiner sogenannten Herrlichkeit Stiepel stehen uns nur im Weg.« Von Schwarzenberg rief einen Diener zu sich und orderte etwas zu essen. Dann setzte er das Gespräch mit von Linden fort. »Ihr habt mit dem Bochumer Drosten gesprochen?«