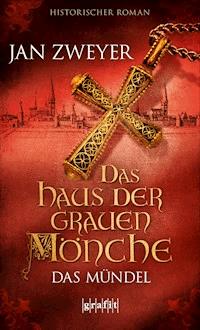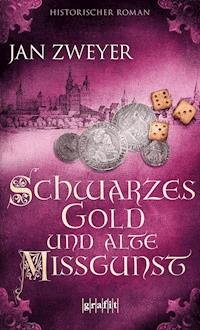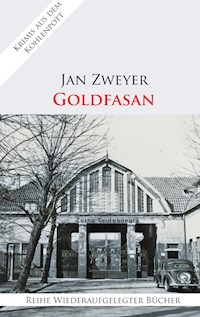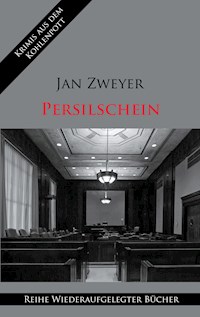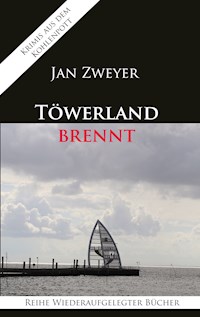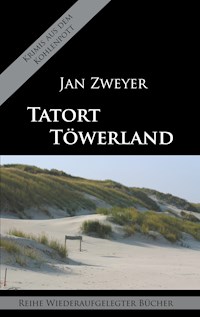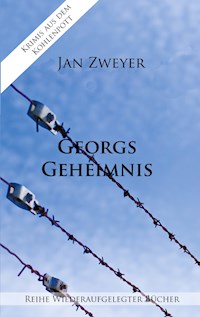
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eines Abends steht der Rentner Georg Pawlitsch in dem Büro von Rechtsanwalt Rainer Esch und hat ein merkwürdiges Anliegen: Ob sich Rainer im Presserecht auskenne und ob er ihn im Fall des Falles vertreten würde? Warum Pawlitsch presserechtliche Probleme befürchtet, sagt er nicht. Einen Tag später ist er tot - ermordet - und damit ein Fall für Hauptkommissar Brischinsky. Gleichzeitig hat Rainer ein ungutes Gefühl: Wäre der Mord zu verhindern gewesen, wenn er darauf bestanden hätte, dass Pawlitsch ihm seine Geschichte erzählt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne.
Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie Franzosenliebchen, Goldfasan und Persilschein das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte die von Linden-Saga, eine Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet (bisher fünf Bände, zuletzt: Schwarzes Gold und Alte Missgunst, Ein Königreich von kurzer Dauer, beide Grafit-Verlag).
In der Reihe Wiederaufgelegter Bücher werden verlagsseitig vergriffen Texte von Jan Zweyer als Buch und eBook neu veröffentlicht. Der Originaltext unterliegt jetzt den neue Rechtschreibregeln. Inhaltliche Veränderungen wurden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.
Menschen erscheinen nicht immer als das, was sie wirklich sind; sie dienen oft nur als Spiegelung, gleichsam als Bild, das sich andere von ihnen machen. Und wenn die Wahrheit zu spät herauskommt, ist sie nutzlos.
Roman Frister,
›Die Mütze oder der Preis des Lebens‹
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
1
»Nichts geht mehr!«
Der Spieler warf im letzten Augenblick seinen Jeton auf die Zwölf, trat einen Schritt vom Tisch zurück und wischte sich mit seinem Taschentuch einen Schweißtropfen von der Stirn. Dabei ließ er die kleine weiße Kugel, die gleichmäßig ihre Runden im Kessel drehte, nicht aus den Augen. Die Zwölf, dachte er, dieses Mal muss es doch die Zwölf sein.
Die Kugel wurde langsamer, taumelte nach unten, stieß mit einem klackenden Geräusch an einen der Stege zwischen den Abschnitten, wurde wieder hochgeschleudert und rollte weiter.
Fünfzehn Augenpaare verfolgten mit atemloser Spannung den Weg der Kugel. Erneut stieß sie an, machte einen Satz, dann noch einen, tanzte schließlich für einen Lidschlag zwischen zwei Zahlen und senkte sich endlich in eines der Fächer.
»Sechsundzwanzig. Schwarz«, gab der Croupier mit unbeteiligter Stimme bekannt.
Der größte Teil der Jetons wurde von ihmmit dem Rateau vom grünen Tableau geschaufelt, ein kleinerer Teil um den erzielten Gewinn aufgestockt und dann von ihren Besitzern wieder in Empfang genommen. Der Saladier sortierte die Chips der Verlierer am anderen Tischende.
Gierig sah der Spieler auf den immer größer werdenden Haufen vor dem Spielbankangestellten.
Die Gewinnzahl erschien als letzte einer langen Zahlenreihe auf der Permanenz, der elektronischen Anzeigetafel über dem Tisch, und wurde von einigen Gästen des Kasinos sorgfältig notiert. Manche benutzten dafür kleine Zettel oder Notizbücher, andere tippten die Zahlen in elektronische Geräte ein.
Der Spieler ging zur Bar des Spielkasinos im obersten Stock des Forum-Hotels am Berliner Alexanderplatz und bestellte ein Glas Champagner. Gedankenverloren sah er aus dem Fenster in Richtung Westen, nahm aber die fantastische Aussicht kaum wahr. Schon wieder hatte er verloren. Er dachte an die beiden letzten ihm verbliebenen Eintausend-Mark-Jetons in seiner Jackentasche. Gleich würde er gewinnen, musste er gewinnen, um den Verlust des Abends wieder auszugleichen. Dreiundzwanzigtausend!
Der Spieler nippte am Champagner. Er spielte jetzt seit fünfzehn Jahren. Erst nur sporadisch, später regelmäßig. Seit drei Jahren fuhr er nun zweimal im Monat nach Berlin. Nur zweimal monatlich. Nicht öfter. So weit hatte er seinen Spieltrieb noch im Griff. Berlin war eine brodelnde Metropole, die Chance kleiner, hier beim Spielen erkannt zu werden. Das hätte seinem Ruf als untadeligem Geschäftsmann geschadet. Deshalb besuchte er auch nicht das Dortmunder Kasino auf der Hohensyburg, obwohl es doch von Recklinghausen viel einfacher zu erreichen war. Jeden zweiten Samstag nahm er die Nachmittagsmaschine von Düsseldorf nach Tegel und bezog Quartier im SAS-Radison. Das Hotel war nicht weit vom Kasino entfernt. Das Forum genügte seinen Ansprüchen nicht.
Der Mann bestellte noch ein Glas des edlen Getränks. Unbewusst glitt seine Rechte in die Jackentasche, ertastete die Chips. Er musste gewinnen. Vielleicht sollte er nicht wieder auf die Zwölf, sondern die Nebennummern setzen? Oder ein Zero-Spiel wagen?
Mit dem Glas in der Hand stand er auf und ging an einen Tisch, dessen Minimum mit zwanzig Mark ausgewiesen war. Hier waren die professionellen Zocker unter sich. Für den Gelegenheitsspieler war der Einsatz zu hoch. Die Touristen bevorzugten Tische mit einem Mindesteinsatz von fünf Mark. Der Spieler blickte auf die Permanenz – die bisher gefallenen Zahlen waren nicht seine, das erhöhte hoffentlich seine Chancen. Aufmerksam beobachtete er den Croupier. Der war jung, höchstens Mitte zwanzig. Zu jung, fand er. Der Mann entschloss sich, sein letztes Geld auf diesem Tableau zu riskieren, aber erst, nachdem der Croupier ausgewechselt worden war.
Zwei Spiele später war es so weit.
»Die Hand wechselt«, verkündete der Tischchef. Ein älterer Angestellter trat an den Kessel. »Bitte das Spiel zu machen.«
Der Spieler atmete tief ein. Er stelle sein Glas ab, trat nach vorne, warf die zwei Tausenderstücke auf das Tableau und machte seine Annonce. Der Croupier hatte ihn nicht verstanden und fragte nach.
»Die Zwölf. Alles auf die Zwölf.« Jetzt war es geschehen. Er hat doch wieder auf diese Zahl gesetzt.
Leise kratzend schob das Rateau die Chips auf die Zwölf. Der Spieler spürte, wie seine Hände feucht wurden. Die magische Zwölf. Diesmal aber ... ganz sicher ... Zwölf. Er fixierte starr die Jetons auf dem Tableau.
Der Croupier drehte den Kessel, warf die Kugel. »Nichts geht mehr.«
Wieder der schreckliche, zermürbende, herrliche Tanz, der seinen Adrenalinspiegel nach oben trieb. Komm, komm schon. Gedanklich beschwor er die Kugel, trieb sie weiter: Zwölf. Komm schon, zwölf. Nur ein Mal. Zwölf. Das letzte Taumeln, ein erneutes Aufbäumen und dann ... Er konnte nicht mehr hinsehen, schloss die Augen.
»Zwölf. Rot«, verkündete der Croupier.
Das Herz des Spielers machte einen Sprung. Seine Zahl! Sie war gefallen! Zwölf, rot!
Der Croupier schob mit dem Rateau zweiundsiebzig Jetons herüber. Der Spieler hatte den Verlust mehr als nur ausgeglichen. Er hatte gewonnen. Er hatte ...
»Paroli!«, hörte er sich mit heiserer Stimme sagen.
Der Croupier unterbrach seine Bewegung und blickte fragend zum Tischchef, der erst den Spieler musterte und dann fast unmerklich nickte. Die zweiundsiebzigtausend Mark wanderten wieder zurück auf das Tableau, wurden auf der Zwölf platziert. Durch die Umstehenden ging ein Raunen, das weitere Spieler anlockte. Einige warfen hastig ihre Annoncen auf den Tisch, versuchten an der vermeintlichen Glückssträhne des Spielers zu partizipieren. Andere warfen ihm bewundernde, fast ehrfürchtige Blicke zu.
Er hörte die Ansagen des Croupiers nicht mehr. Er ignorierte die anderen Gäste, die ihn aufmerksam musterten. Sein Blick galt der Kugel, die wie in Zeitlupe in den Kessel geworfen wurde. Ihr Lauf hypnotisierte ihn. Die Zwölf! Sein Herz schlug bis zum Hals. Wenn die Zwölf jetzt noch einmal käme, dann wäre er seine Probleme los, dann könnte er ...
Die Kugel fand ihr Fach. Die Stimme des Croupiers drang nur langsam zu ihm durch. Seine Knie wurden weich.
»Siebenundzwanzig. Rot.«
Nichts ging mehr.
2
Hätte Rainer Esch geahnt, was sich in den nächsten Wochen ereignen würde – er wäre an diesem Montagmorgen im Bett geblieben.
So aber saß er in seiner Anwaltskanzlei in der Castroper Straße in Herne, starrte die Wand an und wartete auf Mandanten. Zwar lief sein Laden etwas besser als vor einem Jahr, Reichtümer warf er jedoch nach wie vor nicht ab. Auch zu einer Sekretärin hatte es immer noch nicht gereicht, so dass sich Rainer notgedrungen selbst mit dem Textverarbeitungsprogramm seines Computers abplagen musste.
Der 40-Jährige steckte sich eine Reval an, blätterte im Spiegel und überflog einen Artikel über den jüngsten Streit in der Regierungskoalition, da schellte es an seiner Praxistür. Rainer drückte hastig seine Kippe aus, verteilte, mit der Zeitschrift wedelnd, den Rauch im Zimmer und spurtete zum Eingang. Der Anwalt setzte sein Was-bin-ich-heute-wieder-beschäftigt-Gesicht auf und öffnete. Vor der Tür stand ein etwa 60-jähriger Mann in einem verbeulten Trench und mit einer Prinz-Heinrich-Mütze auf dem Kopf. Darunter waren graue Haare zu erkennen.
»Guten Tag«, begrüßte Rainer seinen Besucher.
»Ich möchte zu Rechtsanwalt Esch. Ich habe da ein kleines Problem ...«, antwortete dieser.
Der Anwalt ließ den Mann eintreten. »Wenn ich vorgehen darf ...?« Der potenzielle Mandant folgte ihm. Rainer bot ihm einen Stuhl vor seinem Schreibtisch an. »Möchten Sie einen Kaffee?«
»Nein, vielen Dank.«
»Eine Zigarette?« Esch hielt ihm die Schachtel hin.
»Nein, ich rauche nicht. Das hab ich mir vor Jahren abgewöhnt. Aber wenn Sie ...«
»Danke.« Der Anwalt griff zur Schachtel und zündete sich eine neue Zigarette an. »Was kann ich für Sie tun, Herr ...?«
»Pawlitsch. Georg Pawlitsch.«
Esch notierte den Namen. »Herr Pawlitsch. Also, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll ... Sagen Sie, was kostet eine Auskunft bei Ihnen?«
Solche Menschen liebte Rainer. Er hatte schon öfter erlebt, dass Mandanten mit ihm über die Höhe seines Honorars feilschen wollten, noch bevor er überhaupt wusste, worum es ging. Seiner Meinung nach verwechselten diese Leute eine Anwaltskanzlei mit einem orientalischen Basar, obwohl vermutlich auf Letzterem weniger als in seinem Büro gelogen wurde.
»Das hängt vom Sachverhalt ab, Herr Pawlitsch. Das Anwaltshonorar richtet sich nach dem Streitwert und ist in den meisten Fällen gesetzlich vorgeschrieben. Wenn Sie mir sagen, um was es geht, kann ich Ihnen zumindest grob sagen, welche Gebühren entstehen können.«
»Ich brauche eine Auskunft über das Presserecht.«
»Über das Presserecht?« Esch rekapitulierte seine Kenntnisse auf diesem Gebiet und musste selbstkritisch eingestehen, dass er nicht die geringste Ahnung hatte. An so eine Unwissenheit hatte er sich jedoch gewöhnt. Das war früher, während seiner Studentenzeit, der normale Zustand vor jeder Klausur gewesen. »Also das Presserecht. Selbstverständlich. Um was geht es?« Klappern gehört zum Handwerk. Rainer fand, dass er einen ungemein professionellen Eindruck machte.
Leider ließ der nächste Satz seines neuen Mandanten eine gewisse Skepsis erkennen. »Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber, kennen Sie sich wirklich auf diesem Gebiet aus?«
Esch zog leicht verstört an seiner Zigarette. »Ich bitte Sie. Darin bin ich sozusagen zu Hause. Was wollen Sie denn wissen?«
»Und Ihr Honorar? Wie hoch ist Ihr Honorar?«
»Wenn ich Ihre Frage sofort und ohne intensiver, äh ..., in die Materie einzusteigen beantworten kann, betrachte ich unser Gespräch als Beratung. Mein Honorar würde dann, äh, sagen wir mal, einhundertfünfzig betragen.« Rainer beobachtete sein Gegenüber aufmerksam, bereit, beim geringsten Ausdruck des Erschreckens oder Unwillens seine Forderung unverzüglich zu reduzieren.
»Einhundertfünfzig. In Ordnung.«
Esch atmete auf. Geld schien keine wesentliche Rolle zu spielen.
»Gut. Also, um was geht es denn nun?«
Pawlitsch zögerte. Esch schien es, als suche er nach den richtigen Worten. Dann begann Georg Pawlitsch bedächtig und langsam zu sprechen; so, als ob er jedes Wort sorgfältig abwägen müsste: »Wenn eine Zeitschrift oder ein Verlag irgendetwas veröffentlicht, dann muss es sich doch um die Wahrheit handeln, oder?«
»Das muss es.« Rainer dachte an die tatsächliche Praxis vieler Medien und hoffte, dass ihm nicht die Schamesröte im Gesicht stand.
»Und was ist, wenn es sich um lebende oder auch tote Personen handelt?«
»Da gilt das natürlich auch. Sie dürfen keine unwahren oder ehrverletzenden Aussagen über andere Menschen machen. Beispielsweise ist es nicht gestattet, Bilder anderer Leute ohne deren ausdrückliches Einverständnis zu veröffentlichen. Das nennt man: Recht am eigenen Bild. Das gilt allerdings nicht, wenn es sich bei dem Fotografierten um eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, zum Beispiel einen Politiker oder Schauspieler, handelt. Die müssen es sich in der Regel gefallen lassen, fotografiert zu werden. Zumindest dann, wenn sie sich in der Öffentlichkeit zeigen. Trotzdem versuchen immer wieder Sensationsfotografen ...«
»Nein«, unterbrach ihn Pawlitsch. »Darum geht es mir nicht. Es dreht sich nicht um Bilder. Ich meine Geschichten über andere Menschen ... wahre Geschichten.«
Esch hatte nicht die geringste Ahnung, worauf Pawlitsch hinauswollte. »Ich verstehe. Wenn eine Zeitung beispielsweise über mich schreibt, ich sei der beste Anwalt Hernes, ist das leider eine nicht überprüfbare Behauptung. Die Zeitschrift darf eine solche Aussage im Grunde nicht machen. Das gilt selbstverständlich in viel stärkerem Maß für das Gegenteil. Das stimmt natürlich erst recht nicht und darf deshalb auch nicht veröffentlicht werden.« Rainer grinste sein Gegenüber an, der reagierte jedoch überhaupt nicht auf seine Scherze. »Hm, gut. Also: Sie dürfen nur wahre Tatsachenbehauptungen aufstellen.«
»Was bedeutet das?«
»Wenn Sie behaupten, dass ein Politiker irgendwann einen Meineid geschworen hat, muss das stimmen. Sie sollten belegen können, dass dieser Politiker von einem Gericht deshalb rechtskräftig verurteilt worden ist. Mit dem Hinweis auf das urteilende Gericht oder des Aktenzeichens. Können Sie das nicht, müssen Sie damit rechnen, Ihrerseits verklagt zu werden.«
Rainer musterte seinen Mandanten genauer. Der Mann war schlank und salopp und gepflegt gekleidet. Allerdings schien er sich nicht ganz wohl in seiner Haut zu fühlen: Unaufhörlich knetete er seine Finger und rutschte, trotz seiner ruhigen Redeweise auf dem altersschwachen Freischwinger hin und her. Der Anwalt fürchtete angesichts der Zappelei um die Haltbarkeit seines Möbels.
Pawlitsch zögerte. »Wenn mir nun ein Dritter gesagt hat, dass dieser Politiker einen Meineid geschworen hat? Was mache ich dann?«
»Dann wird die Angelegenheit komplizierter. Sie sind dann gezwungen, diese Aussage zu überprüfen. Sie dürfen nicht allein auf die Glaubwürdigkeit Ihres Informanten setzen.«
»Und wenn ich das nicht überprüfen kann? Wenn der Politiker dem Dritten unter vier Augen den Meineid gestanden hat?«
»Dann, wie gesagt, müssen Sie damit rechnen, verklagt zu werden. Aber sagen Sie, Herr Pawlitsch, warum wollen Sie das wissen? Möchten Sie eine Zeitung herausgeben?«
»Nein, nein.« Georg Pawlitsch massierte seine Hände.
»Mich interessiert das einfach.«
Esch glaubte ihm kein Wort.
»Wenn mich dieser Politiker verklagt, kommt es zu einem Prozess, richtig?«
»Richtig.«
»Und da habe ich dann Gelegenheit, die mir bekannten Beweise vorzulegen?«
»So ist es.«
Unvermittelt stand Pawlitsch auf. »Danke, Herr Esch. Das reicht mir. Sie haben mir sehr geholfen.«
Rainer wusste zwar nicht, wobei, nickte aber freundlich. Anscheinend war er doch besser, als er dachte.
»Keine Ursache.«
»Ach, Herr Esch.« Georg Pawlitsch sah Rainer fragend an. »Wenn ich juristischen Beistand benötige, würden Sie mir dann helfen?«
Rainer war verblüfft. »Selbstverständlich. Was meinen Sie denn konkret?«
»Konkret? Nichts. Das war eine eher allgemeine Frage.«
»Wenn es sich um einen Prozess handelt, wie Sie eben angedeutet haben ...«
»Das könnte sein.« Pawlitsch dachte nach und sagte dann langsam: »Ja, das wäre möglich. So ginge es vielleicht.«
»Was ginge wie vielleicht?«
Pawlitsch ignorierte Rainers Bemerkung. »Benötigen Sie für einen Prozess eine Vollmacht?«
»Schon, aber Sie müssten mir schon mitteilen ...«
»Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Noch nicht. Kann ich nicht ...« Pawlitsch machte eine Pause. »Ich dachte, nur für alle Fälle ...«
»Sie meinen eine Blankovollmacht?«
»Geht das?«
»Das ist zwar ungewöhnlich, aber wenn Sie es wünschen ...« Esch kramte in seiner Schreibtischschublade und legte Pawlitsch eine Vollmacht vor, die dieser ohne zu zögern unterschrieb.
»Und wenn mir etwas passieren sollte, dann ... Ach was, Blödsinn.« Der Mann machte eine Handbewegung, als ob er eine lästige Fliege verscheuchen wollte.
»Was sollte Ihnen denn passieren?«, wunderte sich der Anwalt.
»Nichts. Gar nichts. Ich habe nur laut nachgedacht. Kommt nicht immer was Vernünftiges dabei raus, beim Nachdenken.« Pawlitsch lächelte verlegen. Dann zückte er seine Brieftasche und blätterte dem Anwalt das geforderte Honorar auf den Schreibtisch.
Esch kassierte die Scheine. »Benötigen Sie eine Quittung?«
Georg Pawlitsch schüttelte den Kopf. Rainer begleitete ihn zur Tür und sie verabschiedeten sich.
Zurück in seinem Arbeitszimmer wunderte er sich über diesen merkwürdigen Kunden.
3
Johannes Tülle befand sich im zeitweiligen Exil auf dem Balkon seiner Wohnung im Börster Weg in Recklinghausen. Er drückte sich an die Wand, um dem heftigen Schneetreiben zu entgehen, und versuchte sich trotz des starken Windes eine Zigarette anzuzünden. Er zog hastig an seiner Kippe. Seit der Hausarzt bei seiner Frau eine chronische Bronchitis diagnostiziert hatte, verzichtete er in ihrer Gegenwart auf die Qualmerei. Tülle blickte durch das Fenster in den Wohnraum. Ingrid schaltete gerade zu den Tagesthemen um. Durch den Spalt der nur angelehnten Balkontür nahm er die Stimme des Nachrichtensprechers wahr, nur sehen konnte er nicht viel. Sein Blickwinkel war zu ungünstig. Der Wind drehte und Schneeflocken hüllten ihn ein. Er nahm einen tiefen Zug, als auf der Straße ein Motor aufheulte. Neugierig beugte sich Tülle über die Brüstung und versuchte einen Blick um die Hausecke zu werfen. Er sah nichts. Dann hörte er einen kurzen Aufschrei, unmittelbar darauf einen dumpfen Schlag und schließlich das Geräusch eines anhaltenden Fahrzeuges.
Tülle stürmte mit der Zigarette in der Hand ins Wohnzimmer, ignorierte die Proteste seiner Frau, zog hastig die Rollos hoch und schaute aus dem Vorderfenster des zweiten Stocks. Schemenhaft konnte er im Schneetreiben ein dunkles Fahrzeug erkennen.
»Ich glaube, da ist ein Unfall passiert«, stieß er hervor.
»Ein Unfall? Wo?«
»Unten auf der Straße. Ich sehe nach.«
»Aber zieh was Warmes an.«
Tülle griff hastig nach seinen Winterschuhen. Als er auf den Gehweg trat, fuhr der Wagen, der eben noch gestanden hatte, gerade an und bog kurz darauf um die Ecke auf die Haltener Straße ein. Tülle sah dem Auto kopfschüttelnd nach.
Pötzlich nahm er auf der Straßenmitte einen leblosen Körper wahr. Nach einer Schrecksekunde rief er: »Kann ich Ihnen helfen? Ist Ihnen etwas passiert?« Tülle hastete über die Straße.
»O Gott!« Er drehte sich um und rief seiner Frau, die oben am Fenster stand, zu: »Hol einen Krankenwagen! Und die Polizei! Schnell!«
Notarzt und Polizei trafen fast gleichzeitig am Unfallort ein.
Der Mediziner eilte zu dem Mann auf der Straße, schüttelte aber schnell bedauernd den Kopf. »Nichts mehr zu machen«, sagte er zu den bereitstehenden Rettungssanitätern. »Der Mann ist tot.«
Der Arzt untersuchte die Leiche gründlicher. Nach einigen Minuten sagte er zu den Helfern: »Deckt den Toten ab. Er muss aber noch liegen bleiben.«
Der Doktor ging zu einem der Polizisten, der neben einem Streifenwagen wartete. »Sie sollten Ihre Kollegen von der Kriminalpolizei verständigen.«
»Schon passiert«, antwortete der Uniformierte. »Was denken Sie denn?«
»Ich meine nicht die Abteilung für Verkehrsdelikte«, antwortete der Arzt. »Ich meine die Mordkommission.«
4
Hauptkommissar Rüdiger Brischinsky, in der Ersten Kriminalhauptstelle des Polizeipräsidiums Recklinghausen zuständig für Mord und andere Kapitalverbrechen, räkelte sich auf seinem Sofa und schaute sich die Videoaufzeichnung eines alten Schimanski-Krimis an, als sein Telefon klingelte. Einen Moment lang erwog Brischinsky, nicht zu Hause zu sein, dann siegte aber doch sein Pflichtgefühl.
»Baumann! Weißt du eigentlich, wie spät es ist? – Wieso Verkehrsunfall? Dafür sind doch unsere Kollegen von der ... – Das ist natürlich was anderes. Selbstverständlich, ich komme. Wo, sagst du? – Börster Weg? – In Ordnung. Bin gleich da.« Seufzend stieg der Kriminalbeamte in seine neuen Lederschuhe, zog sein Sakko an und schaltete die Geräte aus. Dann schnappte er sich seinen Mantel und verließ die Wohnung.
Der Schneeregen war in Schneefall übergegangen. Es war kälter geworden. Brischinsky schlug den Mantelkragen höher und fluchte leise. Sein Dienstpassat stand auf dem unbefestigten Garagenhof hinter dem Haus. Hier, wo sich der Wind ungehindert austoben konnte, war der Schnee an einigen Stellen sogar liegen geblieben. Brischinsky hoffte, dass dieser Zustand nicht von Dauer war. Er hasste Schnee. Das heißt, vor allen Dingen hasste er Schneematsch. Und das, was er im funzeligen Licht der Hofbeleuchtung vor sich sah, war Schneematsch.
Der Hauptkommissar eilte über den Platz, wobei er sich bemühte die nassen Felder möglichst zu meiden. Er hatte seine Schuhe, ein exklusives Modell aus italienischer Fertigung, erst vor ein paar Tagen erstanden. Zum Spottpreis für 400 Mark – unter Freunden. Schuhe waren sein heimliches Laster. Was andere Männer in Kneipen ließen, gab Brischinsky für seine Fußbekleidung aus. Seine Leidenschaft hinderte ihn jedoch nicht daran, Schuhe als Gebrauchsgegenstände zu betrachten. So trug er seine Designerlatschen auch bei diesem Wetter.
Er hatte sein Fahrzeug fast erreicht, als er plötzlich ein knackendes Geräusch hörte. Unmittelbar darauf verspürte der Hauptkommissar etwas Kaltes an seinem rechten Fuß.
»Scheiße«, fluchte er. Und dann deutlich lauter: »Verdammte Scheiße! Warum immer ich?«
Er zog seinen Fuß aus der mit dünnem Eis und einer Schneeschicht überzogenen Pfütze und betrachtete frustriert seinen rechten Treter, aus dem schlammiges Schmutzwasser tropfte. Den Schuh konnte er vergessen.
Fünfzehn Minuten später erreichte der Hauptkommissar den Unfallort. Sein Assistent, Kommissar Heiner Baumann, kam ihm entgegen. Zehn Meter weiter waren Gestalten in weißen Overalls damit beschäftigt, Spuren zu sichern.
»’n Abend, Chef.«
»Ist schon fast Morgen«, knurrte Brischinsky ungehalten. »Also, was ist los?«
»Um kurz vor elf wurde hier ein älterer Mann überfahren. Er ist tot. Dem Notarzt ist einiges seltsam vorgekommen. Deshalb hat er uns verständigen lassen. So wie es aussieht, hat der Arzt Recht.«
»Das heißt was?«
»Der Tote hat schwere Verletzungen am Hinterkopf, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Folgen des Unfalls sind ...«
»Sondern ...?«
Die beiden Polizisten hatten die Unfallstelle erreicht.
»... dem Unfallopfer nachträglich zugefügt wurden.« Der Mediziner beendete den Satz und gab Brischinsky die Hand. »Sehen Sie, hier.« Der Arzt zog das schneebedeckte Tuch vom Kopf des Toten. Eine Blutlache rund um den Schädel der Leiche wurde sichtbar.
»Ich habe an drei nur wenige Zentimeter voneinander entfernten Stellen blutverklebte Haare auf dem Asphalt gefunden. Vermutlich von dem Toten. So wie es aussieht, ist der Mann mehrmals mit dem Kopf auf dem Straßenbelag aufgeschlagen. Das kann aber nicht Folge des Unfalles sein. Dafür befinden sich die Aufschlagstellen zu nahe beieinander. Wenn ein Fahrzeug einen Menschen trifft, wird dieser durch die kinetische Energie des Aufpralls weggeschleudert. Je nach Aufprallgeschwindigkeit kann das Unfallopfer durchaus mehrmals aufschlagen, die Aufschlagorte liegen dann aber weiter auseinander, als es hier der Fall ist. Dieser Mann wurde zwar auch durch die Luft geschleudert, aber nicht sehr weit. Nein, die Verletzungen am Hinterkopf des Toten sind keine Unfallfolgen. Der Mann wurde aller Wahrscheinlichkeit nach ermordet.«
»Und wie?« Brischinsky sah den Arzt aufmerksam an.
»Wie schlagen Sie Ihr Frühstücksei auf?«
»Mit dem Messer«, platzte Baumann heraus.
Der Arzt verzog keine Miene. »Und wenn Sie kein Messer zur Hand haben?«
Baumann antwortete nicht.
»Sind Sie sicher?«, erkundigte sich Brischinsky.
»Ziemlich. Allerdings, das ...«
»... genaue Ergebnis kann erst die Obduktion bringen«, sagten Brischinsky und Baumann im Chor.
Der Mediziner sah beide erstaunt an. »Ja, natürlich. Brauchen Sie mich noch?«
»Nein. Vielen Dank, Herr Doktor, dass Sie mitten in der Nacht ...«
»Keine Ursache. Ich hatte Bereitschaft.«
»Ich nicht«, erwiderte Brischinsky und wandte sich dann an seinen Mitarbeiter. »Was habt ihr noch?«
»Keine Bremsspuren. Entweder hatte der Unfallwagen ABS oder der Fahrer hat nicht reagiert. Und Splitter. Vermutlich vom Blinker. Schon auf dem Weg ins Labor. Und eine Zeugenaussage.«
»Jemand hat den Unfall beobachtet? Großartig!«
»Leider nicht den Unfall. Ein Anwohner hat gegen Viertel vor elf ein lautes Geräusch gehört, vermutlich den Aufprall. Er ist auf die Straße gelaufen, hat aber nur noch kurz einen Wagen gesehen, der mit hoher Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung in die Halterner Straße eingebogen ist. Der Zeuge meint ein Recklinghäuser Kennzeichen erkannt zu haben, ist sich aber nicht sicher«, berichtete Baumann.
»Scheiße. Weiß er was über den Fahrzeugtyp?«
»Nein. Er sagt, es war ein großer dunkler Wagen. Ein BMW, Mercedes oder Audi. Könnte aber auch ein anderes Fabrikat gewesen sein.«
»Toll. Fahndung?«
»Klar. Schon eingeleitet. Wir suchen nach einem dunklen Fahrzeug, das vorne beschädigt und wahrscheinlich in Recklinghausen zugelassen ist. Ich hab allerdings meine Zweifel, ob wir ...« Baumann zuckte mit den Schultern.
»Ich auch. Wer ist der Tote?«, fragte der Hauptkommissar.
»Georg Pawlitsch. Wohnt in Herne. Kohlenstraße 13. Pawlitsch war 64 Jahre alt.«
»Was macht ein Herner um diese nachtschlafende Zeit in Recklinghausen?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Das war keine Frage an dich, sondern anmich selbst. Na gut. Du bleibst hier und veranlasst alles Weitere. Und mach den Kollegen im Labor Dampf. Deren Bericht liegt bis morgen Mittag auf meinem Schreibtisch, klar? Ich fahre nach Herne, wenn der Tote Angehörige hat, muss die ja jemand verständigen.«
Baumann nickte und musterte verstohlen Brischinskys rechten Schuh. Dann grinste er breit. »Neu?«
Der Hauptkommissar hatte den Blick seines Assistenten bemerkt und blaffte: »Du sagst jetzt besser nichts mehr, Herr Kollege!«
Baumanns Grinsen verstärkte sich. »Verstanden! Jawohl, Herr Hauptkommissar«, feixte Baumann und machte sich hastig auf den Weg zu einem der Streifenwagen.
5
Am nächsten Morgen schlurfte gegen neun Uhr ein völlig übermüdeter Hauptkommissar in das Büro im ersten Stock des Präsidiums, ließ sich ermattet auf seinen Stuhl sacken und fragte: »Gibt es schon Kaffee?«
Baumann sprang auf. »Leider ist unsere Kaffeemaschine immer noch kaputt. Die letzte habe übrigens ich bezahlt. Ich hoffe, du erinnerst dich noch.« Der Vorwurf in seiner Stimme war auch für den schläfrigen Brischinsky nicht zu überhören. »Aber ich hol dir welchen. Wie immer?«
Brischinsky nickte.
Baumann ging zum Schrank und fischte ein Döschen wasserlöslichen Kaffee aus einer Schachtel. Das Gesöff, das der Automat auf dem Flur für fünfzig Pfennig ausspuckte, war fast untrinkbar. Mit Kaffeepulver aufgepeppt, schmeckte das Getränk zwar nur unwesentlich besser, sein Koffeingehalt war jedoch deutlich höher. Das verstärkte seine aufputschende Wirkung. Und genau darauf kam es an.
Als Baumann das Büro verlassen hatte, sichtete Brischinsky lustlos die eingegangene Post. Er gähnte herzhaft, lehnte sich zurück und schloss die Augen.
»Rüdiger, dein Kaffee.« Baumann berührte leicht seine Schulter.
Brischinsky schreckte hoch. »Scheiße, ich bin eingeschlafen.«
»Wann bist du ins Bett gekommen?«, erkundigte sich sein Mitarbeiter.
Der Hauptkommissar nahm einen Schluck von dem schwarzen Gebräu. Wie erwartet schmeckte der Kaffee nicht, war aber heiß und stark.
»Gegen sechs. Ich war zwar schon um drei wieder zu Hause, konnte aber nicht schlafen. Manchmal hasse ich unseren Job. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, Menschen die Nachricht zu überbringen, dass einer ihrer Angehörigen tot ist.« Brischinsky schüttelte den Kopf. »Und dann noch mitten in der Nacht! Gegen eins war ich in Herne. Ich habe bestimmt zehn Minuten vor der Haustür gestanden und geklingelt. Dann hat Frau Pawlitsch geöffnet. Die Ehefrau des Toten. Sie ist zweiundsechzig. Erst zweiundsechzig! Verdammte Scheiße!« Brischinsky steckte sich eine Zigarette an und inhalierte tief. »Erst hatte ich den Eindruck, die Frau versteht nicht, was ich ihr sage. Deshalb habe ich sie gefragt. Doch, hat sie gesagt, ich habe Sie sehr wohl verstanden. Ich habe Sie genau verstanden. Dann ist sie zusammengebrochen. Einfach so. Sie hat nicht geweint, nicht geschrien. Ist einfach so umgefallen. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Der Notarzt, den ich gerufen habe, hat ihr ein starkes Beruhigungsmittel gegeben. Dabei hat der Kerl mich angesehen, als ob ich Georg Pawlitsch auf dem Gewissen hätte.«
»Das ist doch Quatsch.«
»Natürlich. Ist mir aber so vorgekommen. Der Arzt hat dann von Frau Pawlitsch den Namen ihrer Tochter in Erfahrung bringen können. Ihre Rufnummer stand in einem Notizbuch, das neben dem Telefon lag. Die Tochter wohnt in Bochum. Sie heißt Ruth. Ich habe auf Ruth Pawlitsch gewartet und alles noch einmal erzählenmüssen. Natürlich konnte weder sie noch ihre Mutter mir irgendwelche Fragen beantworten. Deshalb müssen wir heute noch einmal bei den Pawlitschs vorbei. Das ist wirklich ein beschissener Job.« Brischinsky lehnte sich zurück und rauchte schweigend.
Baumann hielt es für ratsam, nichts zu sagen.
Es klopfte und ein Bote brachte eine Akte. Baumann griff nach den Unterlagen und sagte, als er den fragenden Blick Brischinskys registrierte: »Der Laborbericht.«
»Lass hören.«
»Einen Moment.«
Der Kommissar überflog den kurzen Bericht. Brischinsky wartete ungeduldig.
»Unser Zeuge hatte Recht. Das Unfallfahrzeug ist ein Mercedes-Benz 230, Baujahr 1993 oder 1994. Farbe: metallic schwarz. Ob Limousine oder Kombi ist nicht feststellbar. Die Splitter stammen vom Scheinwerfer und Blinker vorne rechts. Dieses Bauteil ist bei Limousine und Kombi identisch. Und die Lacksplitter, die wir auf der Straße gefunden haben, sind identisch mit denen an der Kleidung des Opfers. Pawlitsch ist zweifellos von einem schwarzen Mercedes angefahren worden. Und wenn sich der Zeuge auch beim Kennzeichen nicht geirrt hat, kommt der Wagen aus Recklinghausen.«
»Immerhin schon etwas. Heiner, lass dir vom Straßenverkehrsamt eine Liste der Halter aller in Recklinghausen zugelassenen PKW geben, auf die unsere Merkmale zutreffen. Und jage die Daten durch den Rechner. Vielleicht haben wir ja Glück und Kollege Computer hilft uns weiter.« Brischinsky schloss die Augen. »Ich muss jetzt etwas nachdenken.«
»Schon klar, Chef. Und wie lange willst du ... äh ... nachdenken?«
»Etwa eine Stunde.«
»Bis dahin habe ich die Unterlagen. Möchtest du noch einen ...«, er sah zu seinem Vorgesetzten, »... Kaffee?«
Baumann bekam keine Antwort mehr. Brischinsky war auf seinem Stuhl erneut fest eingenickt.
Der Hauptkommissar wähnte sich in einem Himmelbett aus weichen Daunen, als ihn Heiner Baumann aus seinen Träumen riss. »Es ist fast elf Uhr. Ich dachte, du wolltest noch arbeiten?«, feixte der.
Brischinsky reckte seine schmerzenden Glieder. »Und da heißt es, Büroschlaf sei der gesündeste ... Wahrscheinlich haben andere Beamte ergonomische Stühle und nicht solch ein Folterwerkzeug wie ich. Was habe ich verpennt?«
»Meine Anfrage beim Straßenverkehrsamt. Hier ist die Liste.« Baumann warf Brischinsky einen Computerausdruck auf den Schreibtisch. »Über hundert Halter fahren einen metallic schwarzen 230er. Ich habe bei den Mercedes-Vertragswerkstätten in Recklinghausen und Umgebung nachgefragt. Dort wurde heute kein Fahrzeug zur Reparatur abgegeben, das die bekannten Schäden aufweist.«
»Würde mich auch wundern. Sollte das Fahrzeug wirklich hier bei uns zugelassen sein, müsste der Täter doch geradezu mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn er die Karre auch noch in einer Werkstatt im Raum Recklinghausen in Stand setzen lässt. Nein, da müssen wir die Nachbarstädte in die Ermittlungen einbeziehen, mindestens die. Hat die Fahndung etwas ergeben?«
»Nein, leider Fehlanzeige.«
»Schade. War aber wohl zu erwarten. Was meint unser elektronischer Helfer?«
»Der meint nichts. Zumindest heute nicht mehr. Die Standleitung zum Zentralrechner des LKA ist unterbrochen, irgendein Knotenrechner hat seinen Geist aufgegeben, meinen die Kollegen von der Datenverarbeitung«, erwiderte Baumann. »Deshalb funktioniert auch unser Netzwerk nicht.«
»Was für ein Rechner?«, fragte Brischinsky entgeistert.
»Ein Knotenrechner.«
»Aha.«
Ehe Baumann erklären konnte, um was es sich dabei handelte, hob Brischinsky abwehrend die Hände. »Lass mich bitte mit dem Mist in Ruhe. Ich habe schon drei EDV-Fortbildungsveranstaltungen ergebnislos abgebrochen. Ich bin dafür zu alt.«
»Wieso? Du bist doch erst Anfang fünfzig.«
»Eben! Also lassen wir die bösen Jungs heute laufen?«
»Sieht so aus.«
»Auch gut. Dann fahren wir jetzt nach Herne, die Pawlitschs befragen. Oder nein, ich fahre allein nach Herne. Und du«, der Hauptkommissar nahm den Computerausdruck des Straßenverkehrsamtes und warf ihn Baumann wieder zu, »wirst dir die metallic schwarzen Mercedes-Benz der Baujahre 1993 und 1994 zeigen lassen.«
»O nein! Warum immer ich?«
»Weil sonst kein anderer da ist, deshalb. Klar, Herr Kommissar?«
Baumann knurrte.
»Ach, und Baumann ...«
»Hast du noch so einen tollen Auftrag für mich?«
»Ruf in der Gerichtsmedizin an. Ich will definitiv wissen, woran Pawlitsch gestorben ist. Bis nachher.«
Dreißig Minuten später erreichte der Hauptkommissar die Kohlenstraße am Rande der Teutoburgia-Siedlung in Herne. Ruth Pawlitsch öffnete ihm. Die junge Frau hatte ein verweintes, übernächtigtes Gesicht. Sie trug noch die Kleidung des vergangenen Abends.
»Frau Pawlitsch, es ist mir wirklich sehr unangenehm, aber ich muss Sie und Ihre Mutter noch einmal belästigen.«
Ruth Pawlitsch nickte stumm und ließ den Hauptkommissar eintreten. Sie führte ihn ins Wohnzimmer. Dort saß die Witwe mit dem Rücken zur Tür in einem Sessel und stierte auf den dunklen Fernsehschirm.
»Mama«, sagte Ruth Pawlitsch leise und strich ihrer Mutter zärtlich über das Haar. »Mama. Da ist der Polizist, der gestern schon hier war. Er möchte mit uns reden.«
Paula Pawlitsch schien zunächst nicht zu reagieren, erhob sich dann aber langsam, drehte sich um und kam schweren Schrittes auf Brischinsky zu. »Ja, sicher. Sie sind das. Natürlich. Bitte.« Sie zeigte auf den anderen Sessel und nahm selbst auf der Couch gegenüber Platz.
»Möchten Sie etwas trinken?«, fragte Ruth Pawlitsch.
»Nein, danke.«
Die Tochter setzte sich neben ihre Mutter und hielt deren Hand.
Brischinsky räusperte sich. »Frau Pawlitsch, es tut mir sehr Leid, aber ich muss Ihnen noch einige Fragen stellen.«
»Bitte.« Paula Pawlitsch war kaum zu verstehen.
»Es ist möglich, dass Ihr Mann nicht nur Opfer eines Verkehrsunfalls wurde, sondern ... Also, wir halten es für denkbar ... Frau Pawlitsch, Ihr Mann könnte ermordet worden sein.«
Die Tochter sah den Beamten an wie ein Gespenst. Paula Pawlitsch riss den Mund auf, als ob sie schreien wollte. Dann sog sie tief die Luft ein und stieß sie mit einem rasselnden, gequälten Stöhnen wieder aus. »Warum ...?«
Tränen liefen über ihr Gesicht. Ruth reichte ihr ein Taschentuch, mit dem sich die Witwe vergeblich bemühte, den Tränenfluss zu kontrollieren.
»Warum ...?«, schluchzte sie erneut.
Auch die junge Frau Pawlitsch konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Ein vorwurfsvoller Blick traf den Polizisten.
Brischinsky schwieg betreten. In diesen Momenten hasste er seinen Beruf immer wieder. Noch mehr aber hasste er die Täter, die solche Verzweiflung auslösten. Hilflos stammelte der Hauptkommissar: »Ich ... ich kann auch später ... oder morgen ...«
»Nein, bleiben Sie«, flüsterte Paula Pawlitsch. »Es geht schon.« Die Witwe straffte sich. »Fragen Sie.«
»Können Sie mir sagen, was Ihr Mann gestern Abend in Recklinghausen gewollt hat?«
»Ja, natürlich. Er war mit seinem alten Freund Kattlowsky verabredet.«
Brischinsky zückte sein Notizbuch. »Kattlowsky. Kennen Sie auch den Vornamen?«
»Selbstverständlich. Siegfried heißt er. Siegfried Kattlowsky.«
»Wissen Sie, wo Herr Kattlowsky wohnt?«
»Nicht genau. In einem Altersheim im Norden der Stadt. Wissen Sie, Siegfried und mein Georg kannten sich schon seit Jahrzehnten. Sie waren gemeinsam auf Erin.«
»Erin? Ist das nicht die Zeche in ...«
»Castrop. Ja, so ist es. Siegfried ist einer von Georgs besten Freunden. Wenn die beiden zusammen waren, schwelgten sie in gemeinsamen Erinnerungen. Ich habe da nur gestört.« Sie lächelte schmerzhaft. »Deshalb bin ich nie mit nach Recklinghausen gefahren. Und es war mir auch etwas zu beschwerlich. Ich habe Schwierigkeiten beim Laufen.«
»Wann war Ihr Mann denn mit seinem Freund verabredet?«
»Ich glaube, gegen fünf. Er ist mit dem Bus um kurz nach halb vier zum Bahnhof gefahren und von da weiter nach Recklinghausen. Das hat er immer so gemacht.« Sie schluchzte leise auf. »Und jetzt ist er tot.« Ein Weinkrampf schüttelte sie.
Ruth Pawlitsch nahm ihre Mutter in den Arm und blickte Brischinsky bittend an. Der nickte.
»Ich gehe dann besser. Bitte, bleiben Sie sitzen.« Der Hauptkommissar drückte den beiden Frauen fest die Hand und verließ leise die Wohnung.
In seinem Wagen funkte Brischinsky die Zentrale an und forderte eine Auskunft vom Einwohnermeldeamt.
Zehn Minuten später hatte er die genaue Anschrift von Siegfried Kattlowsky. Der Freund des toten Georg Pawlitsch lebte im Seniorenheim im Nordviertel Recklinghausens in der Straße Am Romberg. Das Heim lag nur wenige hundert Meter vom Unfallort entfernt. Brischinsky machte sich auf den Weg.
Der Hauptkommissar traf Siegfried Kattlowsky auf seinem Zimmer. Der Rentner war groß gewachsen, schlank und hatte langes, fast weißes Haar, das im Nacken von einem Gummiband zusammengehalten wurde.
»Kriminalpolizei?«, wunderte sich Kattlowsky, nachdem Brischinsky sich ausgewiesen hatte. »Was wollen Sie von mir?«
»Sie hatten doch gestern Besuch von Georg Pawlitsch?«
»Georg? Ja, der war gestern Abend bei mir. Warum wollen Sie das wissen?«
»Herr Pawlitsch ist tot«, antwortete der Hauptkommissar. »Er ist gestern nicht weit von hier von einem Wagen angefahren worden.«
»Tot? Georg? Oh, mein Gott.« Kattlowsky wurde bleich.
Brischinsky deutete die Reaktion falsch und wollte ihm hilfreich unter die Arme greifen, als dieser eine abwehrende Handbewegung machte: »Lassen Sie. So leicht wirft mich nichts um. Georg ist nicht der erste meiner Freunde, der sterben musste. Leider nicht der erste. Aber was hat die Kripo ... Ich meine, warum ...?«
»Der Fahrer des Unfallwagens hat Fahrerflucht began-gen.« Brischinsky hielt es für klüger, es fürs Erste bei dieser Erklärung bewenden zu lassen. »Wir fahnden nach ihm.«
»Unfallflucht ... tragisch.« Kattlowsky sah Brischinsky direkt an. »Weiß Paula, ich meine, seine Frau ...?«
»Ja, ich habe sie informiert.«
»Und? Wie hat sie es aufgenommen?«
»Sie ist verständlicherweise erschüttert. Ihre Tochter ist bei ihr.«
»Ruth? Gut, das ist gut. Ach, Georg.« Kattlowsky schüttelte betrübt den Kopf.
»Herr Kattlowsky, Frau Pawlitsch hat mir gesagt, dass ihr Mann mit Ihnen um fünf verabredet war.«
»Um fünf? Ja, ja, Georg war hier ... Sagten Sie fünf Uhr?«
»Ja.«
»Nein, das stimmt nicht. Da muss sich Paula irren. Georg und ich waren für halb acht verabredet. Halb acht. Nach meinem Abendessen.« Der Rentner lächelte verschmitzt. »Sonst vertrage ich den Bergmannsschnaps nicht, wenn ich keine Grundlage habe, verstehen Sie?«
»Sind Sie sich da ganz sicher?«
»Mit dem Schnaps oder der Uhrzeit?«
»Der Uhrzeit.«
»Hören Sie, ich bin noch nicht senil! Ich weiß, wann ich mich gestern mit Georg getroffen habe. Außerdem habe ich direkt nach dem Abendessen, so gegen sieben, noch einige Flaschen alkoholfreies Bier an der Bude besorgt. Für meinen Freund. Georg trank keinen Alkohol mehr seit seinem Herzinfarkt. Dabei hat mich mein Nachbar Heinz begleitet. Heinz von Rabenstein. Auf dem Rückweg haben wir Georg getroffen und er ist mit uns ins Heim gegangen. Ich kann Heinz holen, wenn Sie ...«
»Nein, das ist nicht nötig. Herr Kattlowsky, ist Ihnen an Georg Pawlitsch irgendetwas aufgefallen? War er vielleicht beunruhigt oder erregt?«
»Nein. Er war etwas stiller als sonst, das vielleicht. Etwas stiller. Aber nervös? Nein, sicher nicht. Stiller, ja. Obwohl ...« Der Rentner zögerte.
»Ja?«
»Ach, ihm war sein Notizbuch aus der Jackentasche gerutscht. Ich habe es aufgehoben und ihm gegeben. Dabei habe ich in dem Buch geblättert und er hat sich darüber aufgeregt. Das gehe mich nichts an, hat er gesagt. Ich solle meine Finger davonlassen. Richtig rumgemotzt hat er. Da war Georg ganz der Alte. Er hat ein fürchterliches Getue um das Buch gemacht. Wir haben ihn deswegen immer aufgezogen. Und jetzt ist er tot.« Kattlowsky schüttelte erneut den Kopf.
Brischinsky wartete noch einen Moment, ob dem Rentner noch etwas Wesentliches einfallen würde. Dann sagte der Polizist: »Danke, Herr Kattlowsky, das war es schon.«
»Herr Kommissar?«
»Ja?«
»Frau Pawlitsch, ich meine ... was denken Sie, kann ich sie besuchen?« Kattlowsky schien ehrlich betrübt und besorgt.
»Ich glaube, sie würde sich darüber freuen.«
Zurück im Präsidium führte Hauptkommissar Brischinsky ein kurzes Gespräch mit der Pressestelle, um die Veröffentlichungen der Lokalmedien in deren morgigen Erzeugnissen in seinem Sinne zu beeinflussen. Dann machte er sich auf den Weg nach Hause, um den ausgefallenen Schlaf der letzten Nacht nachzuholen.
6
Eschs erster Griff nach dem Aufstehen galt der Reval-Packung. Er steckte sich eine Kippe in den Mund und zündete sie an. Ohne seine Lungentorpedos war er geliefert. Rainer konnte auf das Frühstück verzichten, nicht aber auf seine morgendlichen Nikotinrationen. Im Grunde waren die Zigaretten sein Frühstück. Der Anwalt hustete sich fast die Seele aus dem Leib und schlurfte in die Küche, um Kaffee aufzusetzen. Dann begab er sich mit dem Sportteil der WAZ unterm Arm und der Reval im Mundwinkel auf die Toilette, um die Artikel in Ruhe zu studieren.
Später am Frühstückstisch las Rainer den Rest der Zeitung. Schwerpunkt der deutschlandpolitischen Berichterstattung waren die Auseinandersetzungen in der Regierungskoalition. Der Wirtschaftsteil berichtete ausführlich über die Reaktionen an den Weltbörsenplätzen auf die neuesten Beschlüsse der russischen Führung. Esch blätterte weiter zum Recklinghäuser Lokalteil. Die einzelne Mittelseite fiel auf den Boden. Der Anwalt legte den Rest der WAZ aus der Hand und hob die Seite auf.
Sein Blick fiel auf eine zweispaltige Überschrift: LoBauTech in Schwierigkeiten?
Darunter war über den Bergbauzulieferer zu lesen:
Der Hochlarmarker Betrieb LoBauTech mit rund einhundertsechzig Beschäftigten scheint in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten zu sein. Wie der Betriebsratsvorsitzende des Unternehmens, Peter Steinke (42), im Anschluss an eine Belegschaftsversammlung mitteilte, hat sich die Auftragslage der Firma in den letzten Monaten drastisch verschlechtert. Die Deutsche Steinkohle AG habe ihre Bestellungen bei LoBauTech