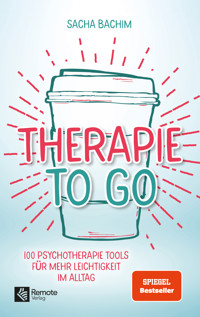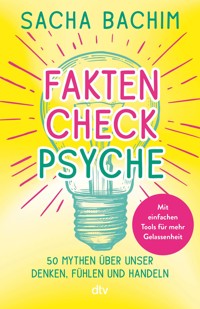
14,99 €
Mehr erfahren.
Lassen Sie sich nicht verrückt machen! Vom Autor des Bestsellers ›Therapie To Go‹ »Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg«, »Früher war alles besser« oder »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen«. Solche Sprüche kennen wir alle. Doch was davon trifft zu, was ist Quatsch? Selbst wenn Sie glauben, gegen solche Mythen immun zu sein, werden Sie ihnen schon einmal aufgesessen sein – denn sie durchdringen unsere Erziehung und prägen uns viel stärker, als wir glauben. In »Faktencheck Psyche« räumt Sacha Bachim mit den gängigsten Mythen der Psychologie auf. Mit Humor und Feingefühl beleuchtet er jenes psychologische Halbwissen und zeigt uns einfache Übungen für den Alltag, mit deren Hilfe wir uns entspannt durch den Mythen-Dschungel bewegen und endlich gelassen leben können. - Hinterfragen Sie verinnerlichte Glaubenssätze - Entdecken Sie neue Perspektiven - Lernen Sie Ihre Gefühle zu verstehen - Erkennen Sie eigene Denkmuster - Befreien Sie sich von den Erwartungen anderer Mit zahlreichen Tipps, Übungen und praktischen Lösungsansätzen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Endlich entspannt leben
In ›Faktencheck Psyche‹ räumt Sacha Bachim mit den gängigsten Mythen der Psychologie auf: Dass wir unter Stress effektiver arbeiten, dass Liebe keine Worte braucht, dass Eltern nur für ihre Kinder leben und positives Denken alle Probleme löst, sind nur ein paar der vielen Glaubenssätze, die unser tagtägliches Verhalten beeinflussen – und uns ständig unter Druck setzen.
Sacha Bachim zeigt uns, wie wir mit praktischen psychotherapeutischen Übungen diesen falschen Erwartungen trotzen und so Selbstzweifel überwinden, Verhaltensmuster durchbrechen, ein gesundes Wohlbefinden entwickeln und uns vom Urteil der anderen frei machen.
Sacha Bachim
Faktencheck Psyche
50 Mythen über unser Denken, Handeln und Fühlen
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
Zitate
MYTHEN ÜBER PSYCHISCHE GESUNDHEIT
Mythos #1: Psychisch gesund ist, wer keinen Dachschaden hat
Übung #1: Wie geht es mir gerade (wirklich)?
Mythos #2: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Übung #2: Die Wunsch-Checkliste
Mythos #3: Es liegt an der Jahreszeit
Übung #3: Der Polar-Rucksack
Mythos #4: Männer sind das stärkere Geschlecht
Übung #4: Weil ich (k)ein Mädchen bin
Mythos #5: In dem Alter ist das normal
Übung #5: Ressourcenaktivierung für Jung und Alt
Mythos #6 Erfolg macht glücklich
Übung #6: Zurück in die Zukunft
Mythos #7: Schicksalsschläge machen unglücklich
Übung #7: Einen Gang zurückschalten
Mythos #8: Früher war alles besser
Übung #8: Gegenwartsnostalgie
Mythos #9: Resilient wird man geboren
Übung #9: Der Weg zur Resilienz
Mythos #10: Wir wissen schon, was uns fehlt
Übung #10: Das Bedürfnisbarometer
Zitate
MYTHEN ÜBER GESELLSCHAFTLLICHE NORMEN
Mythos #11: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen
Übung #11: Die Pomodoro-Technik
Mythos #12 Eigenlob stinkt
Übung #12: Der Komplimente-Spiegel
Mythos #13: Ich darf nichts verpassen
Übung #13: Das Funkloch
Mythos #14: Kein Alkohol ist auch keine Lösung
Übung #14: Jetzt mal ehrlich
Mythos #15: Man muss immer einen Schritt vorausdenken
Übung #15: Der Body-Scan
Mythos #16: Träume sind Luftschlösser
Übung #16: Traumreise
Mythos #17: Im Zweifelsfall mehr desselben
Übung #17: Kopfkino
Mythos #18: Folge stets deinen Werten
Übung #18: Die Top Five
Mythos #19: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ebenso gut auf morgen
Übung #19: 72 Stunden, 3 Minuten und 5 Sekunden
Mythos #20: Vorwärts immer, rückwärts nimmer
Übung #20: Die Fortschritt-Skala
Zitate
MYTHEN ÜBER GEFÜHLE
Mythos #21: Gefühle lügen nicht
Übung #21: Der wissenschaftliche Blick
Mythos #22: Emotionen entstehen in der Gegenwart
Übung #22: Briefaustausch mit dem inneren Kind
Mythos #23: Es ist wichtig, sich zu sorgen
Übung #23: Aufmerksamkeitstraining
Mythos #24: Gefühle sind nutzlos
Übung #24: Das innere Gefühlsteam
Mythos #25: Stress ist leistungsförderlich
Übung #25: Feierabend
Mythos #26: Ansprechen macht’s schlimmer
Übung #26: Verbalisieren
Mythos #27: Akzeptieren heißt kapitulieren
Übung #27: Zwei Hände
Mythos #28: Trauer verläuft in fünf Phasen
Übung #28: Was ich noch sagen wollte
Mythos #29: Einmal traumatisiert, immer traumatisiert
Übung #29: Der sichere Ort
Mythos #30: Emotionen regulieren sich von selbst
Übung #30: Die PEP-Technik
Zitate
MYTHEN ÜBER SELBSTHILFE
Mythos #31 Man muss nur positiv denken
Übung #31: 50 Shades of Grey
Mythos #32: Bei Angst am besten ablenken
Übung #32: 5-4-3-2-1
Mythos #33: Erholung geht nur durch Schonung
Übung #33: Himmel und Erde verbinden
Mythos #34: Für Selbstfürsorge hat doch keiner Zeit
Übung #34: Palmieren
Mythos #35: Doppelt gemoppelt hält besser
Übung #35: Normklärung
Mythos #36 Schlaf lässt sich erzwingen
Übung #36: Das Schlaftagebuch
Mythos #37 Verdrängung ist immer schlecht
Übung #37: Die Tresorübung
Mythos #38: Selbstverbote sind zielführend
Übung #38: Die Pralinenübung
Mythos #39: Medikamente sind (k)eine Lösung
Übung #39: Die Medikamentenliste
Mythos #40: Therapie ist für Menschen, die keine Freund*innen haben
Übung #40: Wann brauche ich eine Psychotherapie?
Zitate
MYTHEN ÜBER BEZIEHUNGEN UND FAMILIE
Mythos #41: Liebe ist ein Allheilmittel
Übung #41: Das Selbstbildhaus
Mythos #42: In einer guten Beziehung will man immer das Gleiche
Übung #42: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Mythos #43: Partner*innen sind Blitzableiter
Übung #43: Zurück auf Los!
Mythos #44: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Übung #44: Freiräume und Qualitätszeit
Mythos #45: Liebe braucht keine Worte
Übung #45: Das Paargespräch
Mythos #46: Recht hat, wer am lautesten schreit
Übung #46: Perspektivenwechsel
Mythos #47: In einer glücklichen Familie wird nicht gestritten
Übung #47: Aufgabentausch
Mythos #48: Elternsein ist ein Fulltime-Job
Übung #48: Das Rollenprofil
Mythos #49: Strafe muss sein
Übung #49: Zwei Hochsitze
Mythos #50: Freundschaft hält ein Leben lang
Übung #50: Der BeziehungsManager
Zitate
Nachwort
Danksagung
Literatur
Nicht rechtefreie Zitate ...
Für Denise
Vorwort
Spinat ist reich an Eisen und macht stark.
Nach dem Essen schwimmen ist gefährlich.
Haare wachsen schneller, wenn man sie öfter schneidet.
Im Schlaf verschlucken wir regelmäßig Spinnen.
Schnaps ist gut für die Verdauung.
Knöchelknacken führt zu Arthritis.
Ein verschluckter Kaugummi bleibt sieben Jahre lang im Körper.
Nach dem Tod wachsen die Nägel weiter.
Lesen bei schlechtem Licht schadet den Augen.
In Büchern, in denen Mythen entlarvt werden, kann man dem Autor alles glauben.
– Annahmen, die allesamt als Mythen entlarvt worden sind (außer der letzten, die stimmt hundertprozentig!)
Nachdem ich mein Buch Therapie to go geschrieben hatte, war ich mir eigentlich sicher: Das war’s! Alles, was Leser*innen meiner Meinung nach über psychische Gesundheit und Psychotherapie wissen sollten, hatte ich in dieses Buch gepackt. Mehr habe ich nicht auf Lager, dachte ich. Meine kurze Karriere als Autor konnte ich somit guten Gewissens an den Nagel hängen und mich wieder auf meine Praxis konzentrieren. Auf gar keinen Fall würde ich noch einmal ein Buch schreiben! Und dann dachte ich plötzlich an Spinat … Und an Schwimmen nach dem Essen, verschluckte Spinnen und das ganze andere Halb- und Falschwissen, mit dem wir alle aufgewachsen sind.
Mythen sind tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Sie durchziehen unsere Kulturen, formen unsere Überzeugungen und beeinflussen unser Denken, Fühlen und Handeln, oft ohne dass wir dies bewusst merken. Dadurch können sie Unwahrheiten in unseren Alltag tragen, die sich nur allzu hartnäckig halten. Gerade über die Psyche gibt es sehr viele falsche Annahmen und Vorurteile. In Form von Glaubenssätzen können sie unsere Vorstellung von uns selbst und der Gesellschaft prägen. Sie können unbegründete Unsicherheiten, Ängste und Sorgen schüren, dazu beitragen, dass wir falsche Erwartungen an uns selbst, an unsere Mitmenschen oder an die Zukunft stellen, und dafür sorgen, dass wir immer wieder in schädliche Verhaltensmuster zurückfallen. Mythen können uns in diesem Sinne unserer Freiheit und Lebensqualität berauben – oder uns geradezu verrückt machen! Wenn wir es jedoch schaffen, verzerrte Glaubenssätze aufzudecken und kritisch zu hinterfragen, können wir uns von diesen Ketten befreien.
Also habe ich jetzt doch noch ein Buch geschrieben … Dieses Mal geht es nicht mehr vorrangig darum, was Sie als Leser*in alles wissen sollten, sondern vor allem um den Quatsch, den Sie nicht mehr glauben sollten. Und weil ich am Ende des Tages doch immer noch Therapeut bin, schlage ich zu jedem Kapitel eine konkrete Übung aus der Psychotherapie zum Ausprobieren vor. Lassen Sie uns also gemeinsam die Faktencheck-Lupe auf 50 geläufige Annahmen richten, die wir definitiv als überflüssige Mythen entlarven können!
Ich habe angefangen, ein bisschen vergnügt zu sein, da man mir sagte, das sei gut für die Gesundheit.
– Voltaire
Das Schicksal mischt die Karten, wir spielen.
– Arthur Schopenhauer
Wenn wir uns daran erinnern, dass wir alle verrückt sind, verschwinden die Geheimnisse und das Leben wird erklärt.
– Mark Twain
MYTHEN ÜBER PSYCHISCHE GESUNDHEIT
Mythos #1:Psychisch gesund ist, wer keinen Dachschaden hat
Es wurde aber auch mal Zeit! Es wird darüber gesprochen!
Dafür brauchte es lediglich eine weltweite Pandemie, Krieg in Europa, Inflation und eine Klimakrise, doch der Groschen scheint endlich gefallen zu sein. Was bislang nur Psycholog*innen, Psychiater*innen und Psychopath*innen vermuteten: Es gibt sie wirklich, die sogenannte psychische Gesundheit!
Erste Studien belegen den Einfluss, den die letzten Jahre auf unser seelisches Wohlergehen hatten. So zeigt sich bei Familien und jungen Erwachsenen, dass die psychische Gesundheit nach wie vor stark von den Nachwirkungen der Coronapandemie betroffen ist. Bei Menschen über 30 werden dagegen Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und der Krieg in der Ukraine als wichtigste Belastungen genannt (Pronova BKK, 2023). Das Päckchen, das wir alle mit uns rumtragen, scheint sich bei vielen allmählich mit Blei gefüllt zu haben. Die Nachfrage nach Therapieplätzen ist so hoch wie nie zuvor.
Einen Lichtstreif am Horizont stellt die Tatsache dar, dass psychische Gesundheit endlich Teil des öffentlichen Diskurses ist. Über psychische Gesundheit wird meistens allerdings erst dann gesprochen, wenn diese bereits angekratzt ist. Also dann, wenn eigentlich das Gegenteil gemeint ist, nämlich psychische Krankheit.
Psychische Gesundheit ist tatsächlich aber viel mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation definiert sie als einen »Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann« (WHO, 2004).
Der Frage nach der Entstehung von Gesundheit (Salutogenese) widmete sich bereits der Soziologe Aaron Antonovsky. Das sogenannte salutogenetische Modell (Antonovsky, 1979) änderte die medizinische Perspektive: Anstatt sich damit zu befassen, was uns krank macht, beschäftigt es sich damit, was uns gesund hält. Ein zentrales Konzept der Salutogenese ist das sogenannte Kohärenzgefühl, das sich aus drei Komponenten zusammensetzt:
Gefühl der Verstehbarkeit
Gefühl der Bewältigbarkeit
Gefühl der Sinnhaftigkeit
Die Salutogenese betont die Bedeutung der individuellen Ressourcen, des sozialen Umfelds und der persönlichen Einstellung. Es geht darum, positive Aspekte und Potenziale zu identifizieren und zu nutzen, um Widerstandsfähigkeit und Wohlbefinden zu stärken. Unser Wohlergehen, unsere Lebensqualität und unsere Resilienz werden in diesem Sinne maßgeblich von der mentalen Gesundheit bestimmt. Gerade heute stellt diese ein wertvolles Gut dar und sollte dementsprechend gehegt und gepflegt werden.
Es fängt mit der furchtbar simplen Frage »Wie geht’s?« an. Diese Frage ist hier nicht als lapidare Begrüßungsfloskel gemeint, sondern im Sinne einer ernsthaft interessierten Selbstreflexion: »Wie geht es mir gerade (wirklich), und könnte ich im Moment etwas tun, damit es mir vielleicht (noch) besser geht?« Es muss dabei nicht immer über weitreichende Lebensveränderungen entschieden werden. Oft sind es gerade die kleinen Dinge, die bereits eine große Wirkung haben können. Manchmal weist uns die Frage »Wie geht es mir gerade (wirklich)?« auch auf vernachlässigte Primärbedürfnisse hin. Wenn wir auf der Arbeit oder privat gedankenverloren vor dem Bildschirm kleben, kann die Selbstwahrnehmung schon mal auf der Strecke bleiben. So merken wir eventuell gar nicht, dass der Nacken sich verspannt, die Luft stickig ist, wir Durst haben oder die Blase drückt. Abhilfe können dann beispielsweise eine kurze Muskellockerungsübung, ein geöffnetes Fenster oder eine kurze Kaffee-/Toilettenpause schaffen, vorausgesetzt, es wurde zuvor die Frage gestellt: »Wie geht es mir gerade (wirklich)?«
Bei einer psychischen Verstimmung verhält es sich nicht anders. Wenn uns erst einmal bewusst wird, dass es uns gerade nicht so gut geht, weil wir uns einsam, träge oder lustlos fühlen, dann können eventuell ein kurzes Telefonat mit der besten Freundin oder dem besten Freund, der Spaziergang um den Block oder das Lieblingsalbum, zu dem im Auto laut mitgegrölt wird, die Stimmung wieder heben.
Lassen Sie uns also weiter über psychische Gesundheit sprechen, um dazu beizutragen, dass psychische Krankheit entstigmatisiert wird. Lassen Sie uns unseren wertvollsten Besitz zudem präventiv pflegen, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass wir nur noch auf Sparflamme brennen.
Übung #1:Wie geht es mir gerade (wirklich)?
Stellen Sie sich die Frage »Wie geht es mir gerade (wirklich), und könnte ich im Moment etwas tun, damit es mir (noch) besser geht?« doch einfach mal öfter, vielleicht sogar regelmäßig, zum Beispiel täglich vor dem Zubettgehen oder als Ritual auf dem Heimweg nach der Arbeit. Besorgen Sie sich ein Büchlein, in dem Sie Ihre Antworten auf diese Frage schriftlich dokumentieren. Mit der Zeit wächst Ihr Protokollbuch zu einem Archiv an guten Ideen an, von denen Sie sich in Zukunft inspirieren lassen können, wenn es Ihnen mal nicht so gut geht. Wenn Sie zu der Schlussfolgerung kommen, Sie könnten tatsächlich etwas dazu beitragen, dass es Ihnen heute ein klein wenig besser geht, dann schlage ich Ihnen folgenden radikalen Veränderungsansatz vor:
Tun Sie das doch einfach!
Mythos #2:Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Hobbits gegen Sauron, Rebellen gegen Imperium, Westdeutschland gegen Ungarn 1954 beim Wunder von Bern … Die Chancen sind aussichtslos, der Glaube an den Erfolg jedoch unbezwingbar. Durch pure Willenskraft gelingt den unwahrscheinlichsten aller Held*innen am Ende das Unmögliche. Ob wir uns für Fantasyliteratur, Science-Fiction-Filme oder Fußball begeistern, wir alle lieben eine gute Underdog-Geschichte. »From zero to hero«, heißt es im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn der amerikanische Tellerwäscher es zum Millionär schafft – einfach nur, weil er es unbedingt wollte. Diese Geschichten, die zum festen Bestandteil unserer westlichen Sozialisierung geworden sind, suggerieren, dass wir alle Astronaut*in, Fußballprofi oder TikTok-Superstar werden können, wenn wir es uns fest genug vornehmen.
Natürlich wird es Sie nicht überraschen, dass die Statistik eher ernüchternd ausfällt. Die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) erhielt zum Beispiel 2021 über 22500 Bewerbungen, von denen lediglich fünf Personen ausgewählt wurden (Siebert, 2022). Sogar wenn Sie die (sehr) hohen Anforderungen erfüllen sollten, die Sie berechtigten, Ihre Bewerbung bei der nächsten ESA-Ausschreibung einzureichen, läge die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gegenüber Ihren Mitbewerber*innen herausstechen könnten, also bei nur 0,02 Prozent.
Im Fußball sieht es nicht viel rosiger aus. Über 2,5 Millionen Kinder zwischen 7 und 14 Jahren spielen in Deutschland aktiv in einem Fußballverein (Inside Jugendfußball, 2019). Wenn man das den knapp 1000 Profifußballern der Bundesliga und der 2. Bundesliga gegenüberstellt, ergibt sich für die Kinder, die sich bereits leidenschaftlich in Vereinen engagieren, lediglich eine Chance von 0,04 Prozent, es zum erfolgreichen Profi zu schaffen. Der Traum, der nächste Basti Schweinsteiger zu werden, ist also nicht viel realistischer als der Traum, zu den Sternen zu fliegen.
In den sozialen Medien wird vor allem jungen Frauen abverlangt, sich künstlichen Schönheitsidealen zu unterwerfen. Obwohl klar sein sollte, dass die virtuelle Art der Selbstdarstellung sich dank Fotofilter und inszenierten Posen längst von jeglicher Alltagsrealität entfernt hat, wird sie doch größtenteils als die neue Normalität vorgelebt. Ob beim professionellen Fotoshooting oder kurz nach dem Erwachen im Bett, es gibt keine Entschuldigung, wieso man nicht jederzeit wie Heidis nächstes Topmodel aussehen sollte.
Ein aktueller TikTok-Trend, der als »Lucky Girl Syndrome« bekannt geworden ist, wird in zahllosen Videos junger Influencer*innen verbreitet, die eigene Erfolgsgeschichten als Beweise dafür vorlegen, dass sich das Glück ganz einfach durch positives Denken und Willenskraft herbeibeschwören lässt (El Ouassil, 2023).
Selbst in der Ratgeberliteratur und in zahlreichen Onlinetutorials wird versucht, den Tellerwäscher-Mythos zu Geld zu machen. Ob Sie mit Kryptoinvestitionen reich werden, mit einer neuen Diät abnehmen oder mit Anmachsprüchen zum Flirtexperten werden sollen, es wird meistens das gleiche simple Mindset verkauft: Der Glaube versetzt Berge.
Ohne Zweifel ist eine gesunde Portion Selbstvertrauen zielführend und gut für das eigene Selbstwertgefühl. Und Träume können tatsächlich – egal wie realistisch sie sein mögen – die Motivation stärken, den eigenen Werten entsprechend zu handeln und nicht bereits bei der ersten Hürde sofort aufzugeben. Bleibt das anvisierte Ziel jedoch trotz Ausdauer und Engagement langfristig aus, dann wird schnell die Kehrseite der Wir-müssen-nur-wollen-Medaille aufgedeckt. Wenn Erfolg, Glück und Gesundheit von der eigenen Willenskraft entschieden werden, dann kann das im Umkehrschluss ja nur bedeuten, dass Menschen, die erfolglos, unglücklich oder krank bleiben, ganz einfach nicht entschlossen genug etwas ändern wollen. Und wenn es mit der psychischen Gesundheit mal hapern sollte, ist man ja wohl selbst schuld. Zu der Enttäuschung über die nicht erreichten Ziele gesellt sich dann noch eine anständige Portion Schuld-, Scham- und Minderwertigkeitsgefühle.
Wenn Sie merken, dass das mit dem »Lucky girl/lucky boy«-Dasein trotz aller Bemühungen einfach nicht so richtig klappen will, überdenken Sie Ihre Ziele noch einmal. Niemand verlangt von Ihnen, Ihre Träume aufzugeben. Doch manchmal ist eine gesunde Portion Realismus hilfreicher als bedingungsloser Glauben.
Denn: Wo ein realistisches Ziel ist, ist oft auch ein Weg.
Übung #2:Die Wunsch-Checkliste
Wenn Sie aktuell ein bestimmtes Ziel verfolgen, kann die folgende Checkliste dabei helfen, eine realistische Einschätzung zu erlangen:
Was ist mein Wunsch/Ziel/Traum?
Wie trage ich im Moment aktiv dazu bei, dass ich mich dem Wunschzustand annähere?
Wie hoch schätze ich die Wahrscheinlichkeit (in Prozent) ein, dass ich meinen Wunschzustand erreichen kann, wenn ich so weitermache wie bisher?
Was könnte ich zusätzlich aktiv tun, um diese Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen?
Wie hoch schätze ich die Wahrscheinlichkeit (in Prozent) ein, dass ich meinen Wunschzustand erreichen kann, wenn ich alles tue, was in meinem Handlungsbereich liegt?
Was könnte das Erreichen meines Wunschzustandes erschweren oder verhindern, worauf ich keinen Einfluss habe?
Mythos #3:Es liegt an der Jahreszeit
Armeen von Schokonikoläusen werden in Supermärkten aufgefahren, Vorgärten werden mit lustigen Plastikrentieren und bunten LED-Knäueln geschmückt, und die geliebten Weihnachtsohrwürmer werden zum ununterbrochenen Hintergrundrauschen. Familien kommen Strickpulli tragend, Glühwein trinkend und vor Glückseligkeit seufzend unter einer prachtvoll geschmückten Nordmanntanne zusammen.
Die Tage werden kurz, das mitteleuropäische Winterwetter (Nieselregen-Matsch) zieht ein, die Kindernasen laufen pausenlos, und die verhassten Weihnachtsohrwürmer werden zum ununterbrochenen Hintergrundrauschen. Familien kommen (viel zu viel) Alkohol trinkend, Streitgespräche austragend und alte Wunden aufreißend unter einem staubigen Plastikbäumchen zusammen.
Man kann sie lieben oder hassen, diese Jahreszeit … Aber immer wieder ist in den Herbst- und Wintermonaten auch von Winterdepression und erhöhten Suizidraten, vor allem um die Feiertage, die Rede. Wenn man über die möglichen Gründe dafür nachdenkt, ist das nicht verwunderlich: Wenige Sonnenstunden und schlechtes Wetter können die Stimmung schon einmal trüben. Durch den Lichtmangel wird das Schlafhormon Melatonin nicht nur nachts, sondern auch tagsüber vermehrt ausgeschüttet, was uns schlapp und lustlos machen kann. Dazu kommt das von Industrie und Medien bediente harmonische Familienbild zur Weihnachtszeit, das als schmerzhafter Kontrast erlebt werden kann, wenn man die Feiertage womöglich allein verbringt.
Doch reicht das alles aus, um uns (im klinischen Sinne) depressiv zu machen? Internationale Studien zeigen, dass Suizide in den Herbst- und Wintermonaten eher ab- als zunehmen (Yu et al., 2020). Gerade um die Weihnachtszeit sind Akutpsychiatrien meistens weniger überlaufen. Selbst wenn es die Depression mit saisonalem Verlauf tatsächlich gibt, so ist sie doch selten. Bei den meisten Depressionen, die im Winter auftreten, scheint es sich eher um »normale« Depressionen zu handeln, unter denen Menschen auch ganzjährlich leiden können. Dass Herbst und Winter automatisch depressiv machen, kann also damit infrage gestellt werden.
Von einer Depression (mit saisonalem Verlauf oder ohne) abzugrenzen ist allerdings der sogenannte Winterblues, der uns melancholisch stimmt, ohne dass die Kriterien einer Depression erfüllt sein müssen. Der Winterblues ist normalerweise nicht schwerwiegend und erfordert in der Regel keine spezifische Behandlung. Dennoch können verschiedene Bewältigungsstrategien dabei helfen, die Symptome zu lindern oder ihnen vorzubeugen. Wenn Sie wissen, dass Sie im Winter anfällig für Stimmungstiefs sind, dann sorgen Sie vor!
Versuchen Sie, möglichst viel Sonnenlicht zu »tanken«. Der Lichteinfall auf die Augen ist das Signal an das Gehirn, weniger Melatonin auszuschütten. Dadurch werden wir weniger schläfrig.
Bleiben Sie aktiv und verbringen Sie tagsüber, vor allem während der Mittagsstunden, so viel Zeit wie möglich draußen.
Achten Sie etwas bewusster auf Ihre Ernährung und behalten Sie Ihren Alkoholkonsum im Auge (ja, auch in der Fondue- und Raclettesaison ist das nicht unmöglich!).
Pflegen Sie soziale Kontakte. Wenn Ihnen bestimmte Personen guttun, versuchen Sie diese während der Wintermonate (noch) regelmäßiger zu sehen.
Planen Sie im Voraus einige Highlights für die Winterzeit, vor allem in den Abendstunden. Besorgen Sie sich Karten für Konzerte, Theaterstücke oder Kunstausstellungen. Erkundigen Sie sich, welche Kinofilme demnächst anlaufen, oder planen Sie Restaurantbesuche. Stellen Sie sich ein Wellnessprogramm zusammen (Sauna, Massagen, Schaumbad, was auch immer Ihnen guttut). Legen Sie sich Bücher bereit oder wählen Sie Serien aus, für die Sie sich jetzt endlich Zeit nehmen wollen.
Sie können sich nach den Möglichkeiten einer Lichttherapie (einer wirksamen Behandlung mit Lampen, die Tageslicht simulieren) erkundigen. Besprechen Sie dazu zunächst mögliche Kontraindikationen (zum Beispiel bei Augenproblemen oder der Einnahme verschiedener Medikamente) mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.
Wenn Sie die Weihnachtszeit lieben: super! Wenn Sie nichts mit Weihnachten am Hut haben: auch super! Lassen Sie sich in jedem Fall nicht vom Feiertagsstress anstecken. Kochen Sie ein Festtagsmenü für 20 Leute oder bestellen Sie eine Pizza, beides kann schön sein.
Falls Sie denken, dass Sie unter Depressionen leiden könnten, sollten Sie nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Hüten Sie sich vor selbsterfüllenden Prophezeiungen, indem Sie nicht schon im Vorfeld eine Jahreszeit zur Depri-Zeit erklären. Entscheiden Sie einfach bewusst, die Herbst- und Wintertage (genauso wie eigentlich alle anderen Tage) so zu verbringen, dass es Ihnen möglichst gut geht.
Übung #3:Der Polar-Rucksack
Wenn sich Ihre Stimmung in bestimmten Jahreszeiten verschlechtert, analysieren Sie, woran das genau liegt:
Kann es sein, dass Ihnen in dieser Jahreszeit der Zugang zu bestimmten Ressourcen, also Aktivitäten und sozialen Kontakten, die Ihnen in der Regel guttun, wetterbedingt oder weil es weniger lang hell ist, verwehrt oder zumindest erschwert ist?
Falls ja, listen Sie alle Ressourcen auf, die Ihnen in dieser Jahreszeit fehlen.
Überlegen Sie für jede einzelne Ressource, was es bräuchte, um sie auch in anderen Jahreszeiten weiter nutzen zu können: wärmere Kleidung, Wärmepads, Kopflampen, Verlegung der gleichen Aktivität von drinnen nach draußen oder auf eine andere Tageszeit, virtuelle Umsetzungsmöglichkeiten?
Für jede Aktivität, bei der Sie wirklich keine jahreszeitunabhängige Umsetzungsmöglichkeit erkennen, denken Sie sich eine passende Alternative aus. Falls eine sportliche Aktivität draußen ausfällt, wählen Sie zum Beispiel eine andere Sportaktivität aus, die drinnen möglich ist und ähnliche Bewegungsabläufe erfordert.
Suchen Sie nach weiteren von der Jahreszeit unabhängigen Ideen, schreiben Sie zudem Aktivitäten auf, die Sie noch nie gemacht haben, aber von denen Sie sich vorstellen könnten, sie auszuprobieren.
Stellen Sie sich die so entstandene Liste als einen Rucksack voller Ressourcen vor, mit dem Sie für die kommende Eiszeit gewappnet sind.
Mythos #4:Männer sind das stärkere Geschlecht
Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Störung zu erkranken, bei Männern viel geringer als bei Frauen. Doppelt so viele Frauen wie Männer scheinen zum Beispiel unter Depressionen und Angststörungen zu leiden (ESEMeD/MHEDEA2000 Investigators, 2004). Damit steht doch wohl fest: Männer sind gesünder, resilienter und stärker als Frauen! Oder etwa doch nicht?
Dazu passt nämlich nicht, dass Substanzkonsumstörungen (wie beispielsweise Alkoholsucht) bei Männern viel häufiger auftreten als bei Frauen. Und auch die Tatsache, dass die Suizidrate bei Männern in Deutschland dreimal höher ausfällt, spricht doch wohl eine andere Sprache (Statistisches Bundesamt, 2023). Männer leiden also wahrscheinlich gar nicht weniger unter psychischen Problemen als Frauen, sondern greifen auf andere Bewältigungsstrategien zurück, die oft sogar noch viel selbstschädigender ausfallen.
Männer leben generell weniger gesundheitsbewusst als Frauen. Die männliche Bereitschaft zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge scheint in den letzten Jahren zwar leicht gestiegen zu sein, sie hinkt der weiblichen jedoch immer noch deutlich hinterher (Prütz et al., 2021).
Vor allem im Bereich der psychischen Gesundheit greifen nach wie vor jene toxischen Männlichkeitsideale, die eigentlich längst für beendet erklärt wurden. Negative Gefühle zu haben oder zumindest darüber zu sprechen, scheint auch heute noch in den Köpfen vieler Männer (und Frauen) mit Schwäche assoziiert zu werden. Kulturelle Geschlechterstereotype verändern sich nur sehr langsam, und so scheint auch heute noch der Griff nach der Flasche sozial akzeptierter zu sein, als über Gefühle zu sprechen. Den Whiskey kippenden einsamen Cowboy oder den traumatisierten Polizisten auf Revenge-Trip sieht man auch heute in Filmen eher selten auf der Therapiecouch sitzen. Eine weibliche Fernsehprotagonistin, die sich ihren Freundinnen anvertraut, wenn es ihr nicht gut geht, wird von diesen getröstet und in den Arm genommen. Einer männlichen Figur wird allenfalls mit einem »Das wird schon«-Schulterklopfer begegnet oder mit einer Einladung zum Frustsaufen. Den Männern von heute und den Männern von morgen wird also weiterhin vorgelebt, dass über Gefühle zu sprechen »unmännlich« und höchstens bei drei Promille erlaubt ist.
Ein Grund, wieso (zumindest auf dem Papier) weniger Männer von psychischer Krankheit betroffen zu sein scheinen, liegt also ganz einfach darin, dass sie auch heute noch Gefühle eher verdrängen als Frauen und aus Scham oder Angst vor negativer Bewertung weniger oft Hilfe suchen.
Männer scheinen Gefühle zudem weniger gut verbalisieren zu können und bringen im Gespräch mit Ärzt*innen öfter körperliche Symptome zum Ausdruck, auch wenn der Schuh eigentlich woanders drückt. Selbst Ärzt*innen sind nicht immun gegenüber gesellschaftlichen Geschlechterstereotypen und können in der Symptomerhebung bei männlichen Patienten einen blinden Fleck für psychische Probleme haben. Auch dadurch werden psychische Störungen bei Männern, wenn überhaupt, oft erst sehr spät diagnostiziert.
Selbstverständlich ändert dies alles nichts an der Tatsache, dass Männer Gefühle haben (und zwar nicht nur Hunger und Durst). Und ja, auch Männer dürfen und sollen über psychische Gesundheit und Krankheit sprechen! Das heißt jetzt nicht, dass Männer Kuschelgruppen gründen sollen, in denen man sich gegenseitig die Tränen abtupft (erlaubt ist natürlich auch das!). Es geht darum, auf die eigene psychische Gesundheit zu achten und im Gespräch mit Partner*innen, Freund*innen, Familienangehörigen oder Hausärzt*innen auch mal auszudrücken, wenn es einem nicht so gut geht – und ja, bei anhaltenden Symptomen das zu tun, was man tun würde, wenn das Auto streikt und selbst mit dem eigenen Werkzeug nichts mehr zu bewegen ist: auf professionelle Hilfe zurückzugreifen.
Psychische Störungen sind richtige Krankheiten, die sowohl Frauen als auch Männer betreffen können und die in der Regel sehr gut behandelbar sind. Frühzeitige Hilfe in Anspruch zu nehmen kann schlimmere Verläufe verhindern und hat nichts mit Schwäche zu tun. Ganz im Gegenteil: Gerade dadurch werden Männer (und Frauen) gesünder, resilienter und auf diese Weise tatsächlich stärker!
Übung #4:Weil ich (k)ein Mädchen bin
Viele Ansichten und Verhaltensmuster werden durch gesellschaftliche Stereotype beeinflusst und können zu verzerrten Denkweisen führen. Egal welchem Geschlecht Sie sich zugehörig fühlen oder mit welchem Geschlecht Sie sich identifizieren, kann es wertvoll sein, solche Verzerrungen aufzudecken.
In Situationen, in denen Sie unter unangenehmen Gefühlen leiden oder auf Verhaltensstrategien zurückgreifen, von denen Sie eigentlich wissen, dass sie Ihnen nicht guttun, stellen Sie sich bewusst die folgenden Fragen:
Kann es sein, dass mein Denken, mein Empfinden oder mein Verhalten in diesem Moment auf gesellschaftliche und/oder eigene Erwartungen an meine Geschlechterrolle zurückzuführen ist?
Kann ich diese Erwartungen hinterfragen? Kann ich sie vielleicht sogar als längst überholte Geschlechterstereotype identifizieren?
Wie würde ich denken, fühlen, handeln, wenn ich mich davon befreien könnte?
Inwiefern könnte es mir dadurch besser gehen?
Mythos #5:In dem Alter ist das normal
Jugendliche legen eine Null-Bock-Haltung an den Tag, sind launisch, ständig gereizt und ziehen sich wochenlang zum Zocken in ihr abgedunkeltes Zimmer zurück.
Menschen mittleren Alters wirken plötzlich wie ausgewechselt, handeln impulsiv und kaufen sich, um das Klischee vollends zu erfüllen, auch noch einen überteuerten Sportwagen.
Ältere Personen sind mürrisch, schlafen schlecht und klagen ständig über Gesundheitsprobleme und die undankbaren Enkel, die sich kaum mehr melden.
Pubertät. Midlife-Crisis. Seniorenalter. Da ist das doch alles normal!
Tatsächlich gehen bestimmte Lebensphasen mit bestimmten Herausforderungen einher. So ist die Pubertät eine Zeit der Entwicklung, in der körperliche, hormonelle und emotionale Veränderungen durchlaufen werden, die zu einer erhöhten Empfindlichkeit führen können. Jugendliche suchen nach Identität, entdecken ihre Unabhängigkeit und sind gleichzeitig mit Erwartungen seitens der Eltern und der Schule konfrontiert. Gelegentliche Stimmungsschwankungen, Unsicherheit oder Verwirrung erscheinen dabei schon fast selbstverständlich. Doch bereits im Jugendalter können übermäßige Reizbarkeit und Stimmungsverschlechterungen auf Depressionen, Angststörungen oder andere psychische Probleme hinweisen.
Das mittlere Erwachsenenalter kann eine Zeit der Selbstreflexion darstellen, in der über Lebensziele und Prioritäten nachgedacht wird. Oft ist es auch eine Zeit des Umbruchs, in der sich familiäre oder berufliche Verpflichtungen ändern. Diese Phase bringt Herausforderungen mit sich, in denen Unsicherheit, Selbstzweifel und Impulshandlungen bis zu einem bestimmten Grad als normal angesehen werden können. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass hierbei andere Faktoren wie beruflicher Stress, psychische Belastung oder tiefgreifendere Lebensprobleme eine Rolle spielen.
Das hohe Alter wiederum ist mit bestimmten Entwicklungen verbunden, die sich negativ auf das Gemüt auswirken können. Es ist nachvollziehbar, dass der Verlust von geliebten Menschen, körperliche Einschränkungen, altersbedingte Krankheiten oder der Verlust von Autonomie Gefühle wie Angst, Traurigkeit und Einsamkeit auslösen. So ist es nur logisch, dass auch Menschen im hohen Alter an psychischen Krankheiten leiden können, die eine angepasste Behandlung benötigen.
Aufgrund eingebürgerter Vorstellungen davon, welche Reaktionen in welchen Lebensabschnitten als normal anzusehen sind, können gesundheitliche oder psychische