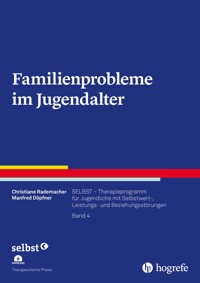
47,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
SELBST ist ein Therapieprogramm zur Behandlung von Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren mit Selbstwert-, Leistungs- und Beziehungsstörungen. Band 4 legt den Fokus auf die Behandlung von Jugendlichen mit Familienproblemen. Die Bewältigung von alterstypischen Konflikten zwischen Eltern und Jugendlichen z.B. zur Mediennutzung, Schulleistung oder zu häuslichen Pflichten kann im Kontext einer psychischen Störung schwerfallen und die Familienbeziehungen belasten. Der Band stellt systemisch-behaviorale Interventionen zur Behandlung von Familienkonflikten vor. Es wird geschildert, wie mit Eltern und Jugendlichen möglichst ressourcenorientiert ein Störungsmodell der Konflikte erarbeitet und gemeinsame Ziele bestimmt werden können. Dabei geht es zunächst, angelehnt an den Selbstmanagement-Ansatz von Kanfer, um den Aufbau von Änderungsmotivation und Selbstwirksamkeit bei Jugendlichen und Eltern. Ungünstige familiäre Muster und Prozesse sollen gemeinsam erkannt und verändert werden. Neben der Beratung der Eltern zu förderlichen Erziehungsstrategien geht es um die Veränderung von dysfunktionalen Annahmen im familiären Kontext. Weiterhin wird ein konkretes, graduiertes Training von Kommunikations- und Problemlösefertigkeiten unter Einbezug einer verbesserten Affektkontrolle aller Beteiligten vorgestellt. Möglichkeiten der Implementierung von gelernten Strategien in den Familienalltag sowie die Integration weiterer Hilfssysteme werden erörtert. Zahlreiche Arbeitsmaterialien können nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christiane Rademacher
Manfred Döpfner
Familienprobleme im Jugendalter
SELBST – Therapieprogramm für Jugendliche mit Selbstwert-, Leistungs- und Beziehungsstörungen
Band 4
Dr., Dipl.-Psych. Christiane Rademacher, geb. 1965. 1987 – 1993 Studium der Psychologie in Köln. Seit 1993 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Universität zu Köln. 1998 Approbation zur Psychologischen Psychotherapeutin. 2003 – 2021 Co-Leitung der Schwerpunktambulanz für Jugendliche. 2012 Promotion. Seit 2021 Leitung der Schwerpunktambulanz für Externale Störungen. Als Dozentin und Supervisorin an verschiedenen Ausbildungsinstituten tätig.
Univ.-Prof. (em.) Dr., Dipl.-Psych. Manfred Döpfner, geb. 1955. 1989 – 2021 Leitender Psychologe an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universität zu Köln und dort Professor für Psychotherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 1999 – 2024 Leiter des Ausbildungsinstituts für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (AKiP) an der Uniklinik Köln.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
SELBST-Logo: © Björn Mehnen, Berlin
Illustrationen: © Klaus Gehrmann, Freiburg; www.klausgehrmann.net
Satz: Sina-Franziska Mollenhauer, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2507-8; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2507-9)
ISBN 978-3-8017-2507-5
https://doi.org/10.1026/02507-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Übersicht
Cover
Titel
Über die Autor:innen
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhalt
Hinweise zu den Onlinematerialien
5Inhaltsverzeichnis
Familienprobleme im Jugendalter
Vorwort
Kapitel 1: Übersicht über SELBST-Familienprobleme
1.1
Das Therapieprogramm SELBST
1.2
Entwicklungspsychologische Relevanz von Familienproblemen in der Adoleszenz
1.2.1
Die Bedeutung von Familienkonflikten im Kontext psychischer Störungen
1.2.2
Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen
1.2.3
Entwicklungsaufgaben der Eltern
1.2.4
Konfliktthemen und Konfliktmanagement in der Familie
1.3
Systemisch-behaviorale Konzepte zur Behandlung von Familienproblemen
1.3.1
Problem-Solving-Communication-Training (PSCT) nach Robin und Foster
1.3.2
Das Behandlungsmanual „Defiant Teens“ von Barkley und Robin
1.3.3
Elternratgeber „Jugendliche kompetent erziehen“ von Schneewind und Böhmert
1.4
Zielgruppe und Indikation für die Behandlung mit SELBST-Familienprobleme
1.4.1
Zielgruppe von SELBST-Familienprobleme
1.4.2
Definition von Familienproblemen
1.4.3
Diagnostische Einordnung nach ICD-10/ICD-11 und DSM-5
1.4.4
Pathogenetisches Modell von Familienkonflikten
1.4.5
Voraussetzungen für eine ambulante Therapie
1.4.6
Kombination mit anderen Maßnahmen
1.4.6.1
Andere SELBST-Manuale
1.4.6.2
Andere psychotherapeutische Interventionen und Trainings
1.4.6.3
Medikamentöse Therapie
1.4.6.4
Ambulante und stationäre Maßnahmen der Jugendhilfe und stationäre Therapie
1.5
Aufbau des Therapiemanuals SELBST-Familienprobleme
1.5.1
Übersicht über die Therapiebausteine
1.5.2
Abfolge und Kombination von Therapiebausteinen
1.5.3
Setting und Strukturierung der Therapiesitzungen
1.5.3.1
Teilnehmende an den Sitzungen
1.5.3.2
Sitzungsfrequenz und -dauer
1.5.3.3
Aufbau der Sitzungen
1.5.3.4
Aktive Therapiegestaltung und Alltagstransfer mit der JAY-App
1.6
Wirksamkeit von SELBST-Familienprobleme
1.7
Diagnostik und Verlaufskontrolle
1.7.1
Klinisches Urteil
1.7.2
Fragebogen für Jugendliche, Eltern und Lehrer zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten von Jugendlichen
1.7.3
Verfahren zur Erfassung von Familienbeziehungen und Familienkonflikten
1.7.4
Qualitative Verfahren zur Erfassung von Familienbeziehungen
1.7.5
Verlaufskontrolle
1.8
Beziehungsaufbau und schwierige Therapiekonstellationen
1.8.1
Beziehungsaufbau
1.8.2
Schwierige Therapiekonstellationen
Kapitel 2: Therapiemanual SELBST-Familienprobleme
2.1
Phase 1: Screening der Eingangsbeschwerden, Beziehungsaufbau und Informationsvermittlung
2.2
Phase 2: Multimodale Diagnostik zur Erfassung individueller Probleme und Kompetenzen sowie Belastungen und Ressourcen im Umfeld
2.3
Phase 3: Problemanalyse und Erarbeitung eines Störungskonzeptes
2.4
Phase 4: Zielanalyse, Stärkung der Änderungsmotivation und Interventionsplanung
2.5
Phase 5: Durchführung von Interventionen
2.5.1
Baustein 1: Psychoedukation Jugendalter
2.5.2
Baustein 2: Training elterlicher Erziehungskompetenzen und Veränderungen im Familiensystem
2.5.3
Baustein 3: Stärkung positiver Beziehungselemente
2.5.4
Baustein 4: Korrektur dysfunktionaler Grundannahmen und Stärkung der Affektkontrolle
2.5.5
Baustein 5: Kommunikationstraining
2.5.6
Baustein 6: Problemlösetraining
2.6
Phase 6: Zwischenevaluation und Zielerreichung
2.7
Phase 7: Stabilisierung und Rückfallprävention
Kapitel 3: Fallbeispiel Luca
Literatur
Anhang
Hinweise zu den Onlinematerialien
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die 7 Phasen von SELBST
Abbildung 2: Verhaltenstherapeutische Interventionen in Phase 5
Abbildung 3: Bedingungsmodell für Eltern-Jugendliche-Konflikte nach Robin & Foster (1989)
Abbildung 4: Pathogenetisches Modell von Familienproblemen
Abbildung 5: Entscheidungsbaum zur Auswahl der Therapiebausteine in Phase 5
Abbildung 6: Willkommen (männlicher und weiblicher Avatar)
Abbildung 7: Auswahl eines Avatars
Abbildung 8: Auswahl eines Bildschirmdesigns
Abbildung 9: Psychoedukation – Übersicht aggressives Verhalten (links) und Depression (rechts)
Abbildung 10: Momentary Assessment, Beispiel für Filmplakate (links) und Spraydosen (rechts)
Abbildung 11: Videotagebuch Beispiel Depression, Level 1
Abbildung 12: Erinnerungsfunktion – Voraberinnerung und Erlebnisbericht
Abbildung 13: Problemlösefunktion
Abbildung 14: Bewältigungsskills – Beispiel: Entspannung – Traumreise
Abbildung 15: Spiele im Belohnungsbereich – Blocks, Snake und individuelle Wünsche
Abbildung 16: Verwaltung der Einträge
Abbildung 17: Problembelastung Jugendliche im Verlauf
Abbildung 18: Problembelastung Eltern im Verlauf
Abbildung 19: Breitband- und problemspezifische Verfahren
Abbildung 20a: F03 Checkliste Familienprobleme – SELBST-CL-Familie (Seite 1/3)
Abbildung 20b: F03 Checkliste Familienprobleme – SELBST-CL-Familie (Seite 2/3)
Abbildung 20c: F03 Checkliste Familienprobleme – SELBST-CL-Familie (Seite 3/3)
Abbildung 21: Prozessmodell zur Festlegung gemeinsamer Therapieziele (aus Walter et al., 2007)
Abbildung 22: Beispiel für ein ausgefülltes Arbeitsblatt „G14 Was ist das Problem?“
Abbildung 23: Beispiel für ein ausgefülltes Arbeitsblatt „G15 Was ist passiert?“
Abbildung 24: Beispiel für ein ausgefülltes Arbeitsblatt „G16 Mein Problem: Vorteile & Nachteile“ (Problem Nr. 1)
Abbildung 25: Beispiel für ein ausgefülltes Arbeitsblatt „G16 Mein Problem: Vorteile & Nachteile“ (Problem Nr. 2)
Abbildung 26: Beispiel zur Erarbeitung eines Perspektivwechsels mit dem Jugendlichen zu einer konkreten Problemsituation (G17 Was denken die anderen?)
Abbildung 27: Beispiel eines subjektiven Störungsmodells eines Jugendlichen (G18 Woher kommen die Probleme?)
Abbildung 28: Beispiel eines subjektiven Störungsmodells einer Mutter (G18 Woher kommen die Probleme?)
Abbildung 29: Beispiel eines Störungsmodells aus therapeutischer Sicht (G19 Therapeutisches Störungsmodell)
Abbildung 30: Beispiel für ein gemeinsames Störungsmodell bei Familienkonflikten (G20 Woher kommen die Probleme? Gemeinsames Modell)
Abbildung 31: Beispiel für einen Wunschzettel eines Jugendlichen
Abbildung 32: Beispiel für eine Zielkonkretisierung einer Jugendlichen (G21 Wo geht’s hin?)
Abbildung 33: Beispiel für ein ausgefülltes Arbeitsblatt „G24 Zusammenfassung von Problemen und Zielen“ aus Elternsicht
Abbildung 34: Beispiel für Vor- und Nachteile eines Ziels aus Jugendlichenperspektive (G22 Meine Ziele: Vorteile & Nachteile)
Abbildung 35: Beispiel für Lösungsansätze einer Mutter für familiäre Belastungen (G27 Familiäre Belastungen)
Abbildung 36: Beispiel zur Festlegung von Therapiezielen (G25 So wird’s gemacht)
Abbildung 37: Beispiel für eine Problemliste einer Jugendlichen (G10 Problemliste)
Abbildung 38: Beispiel für eine Zielliste einer Mutter und ihrer Tochter (G11 Zielliste)
Abbildung 39: Beispiel für die Auswahl von Therapiebausteinen in Phase 5 entsprechend der Therapieziele (G28 Therapieplanung – Therapeut)
Abbildung 40: Beispiel Auswertung des FRT-KJ
Abbildung 41: Beispiel für unterschiedliche elterliche Bewertungen (F19b Kognitives Modell Eltern – Beispiel Regelverstoß)
Abbildung 42: Beispiel für die Beurteilung der Zielerreichung (G11)
Abbildung 43: Beispiel für eine Verlaufsanalyse (G29)
Abbildung 44: Beispiel für die Festlegung hilfreicher und nicht hilfreicher Strategien (G31)
Abbildung 45: Beispiel zu Problemlösungsansätzen für ein missglücktes Familiengespräch (G32)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Ergebnisse der Zufriedenheitsbefragung der Mütter und der Jugendlichen bei Behandlungsende (Fragebogen zur Zufriedenheit mit der Behandlung, F-ZB; aus Rademacher et al., 2017)
Tabelle 2: Übersicht über Breitband- und problemspezifische Fragebogen bei Familienproblemen
Tabelle 3: Indikationen für verschiedene Therapiebausteine
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
177
179
180
7Vorwort
„Das Schöne an einer Familie: Man ist nie allein. Das Schlechte an einer Familie: Man ist nie allein.“ (Verfasser unbekannt)
Probleme in den Familienbeziehungen sind normal und Familienkonflikte sind vor allem im Rahmen der Autonomieentwicklung von Jugendlichen zu erwarten, wenn nicht gar unausweichlich. Eine zentrale Entwicklungsaufgabe des Jugendalters besteht schließlich darin, dass Jugendliche ihre eigene Identität entwickeln und sich zunehmend von ihren Eltern „abnabeln“. Umwälzende Veränderungen auf körperlicher, geistiger und psychischer Ebene stellen Jugendliche in der Pubertät vor große Herausforderungen, erfordern aber auch komplexe Anpassungsprozesse der Eltern im Umgang mit ihrem Kind. Dennoch gelingt es einem Großteil der Jugendlichen und ihren Familien diese Phase relativ schadlos zu überstehen. Vielmehr „nimmt seit 2002 der Anteil an Jugendlichen, die ein positives Verhältnis zu ihren Eltern haben, stetig zu. Vier von 10 Jugendlichen (42 %) kommen bestens mit ihren Eltern aus, die Hälfte (50 %) kommt trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten mit ihnen klar. Entsprechend viele Jugendliche sehen in ihren Eltern maßgebliche Erziehungsvorbilder“ (vgl. Shell-Jugendstudie, 2019).
In der kinder- und jugendlichenpsychotherapeutischen Praxis stellen sich nun häufig Jugendliche mit ihren Familien vor, denen die Bewältigung dieser Entwicklungsphase im Kontext einer psychischen Störung große Schwierigkeiten bereitet. Neben anderen Problemen, beispielsweise Leistungs-, Selbstwert- oder Gleichaltrigenproblemen, sind konfliktreiche, hoch belastete Beziehungen zwischen Eltern und ihren jugendlichen Kindern ein zentraler Vorstellungsgrund. Eltern wie Jugendliche beklagen oft vehement, dass es in der Familie meistens nicht gelingt, Probleme in angemessener Form anzusprechen und Konflikte zu lösen. Dabei machen sich die Streitigkeiten häufig an ganz alltäglichen, adoleszententypischen Themen fest, beispielsweise Mediennutzung, Schulleistungen, häusliche Pflichten, Freizeitgestaltung. Die Verhandlungen zwischen Eltern und Jugendlichen laufen nach recht kurzer Zeit „aus dem Ruder“: Es wird entweder mit hoher Frequenz und Intensität in aggressivem Ton gestritten oder aber schwierige Themen werden überwiegend vermieden und bis zum „großen Knall“ unter den Teppich gekehrt. Der Ausgang ist für die Beteiligten gleichermaßen frustrierend. Die Unfähigkeit, sich gegenseitig zu vermitteln, gemeinsam Lösungen zu finden, führt zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Beziehungen, im ungünstigsten Fall zu einer Entfremdung zwischen Eltern und Jugendlichen, vor deren Hintergrund wichtige Unterstützungsfunktionen in der Familie nicht mehr geleistet werden können. Diese Einschränkung des psychosozialen Funktionsniveaus in der Familie ist für Eltern, aber insbesondere für solche Jugendliche tragisch, die bedingt durch eine psychische Störung noch stark auf Unterstützung in der Familie angewiesen sind.
In diesem Buch soll praxisnah über Erfahrungswerte mit systemisch-behavioralen Interventionen bei der Behandlung von Familienproblemen im Jugendalter berichtet werden. Zentral sind Interventionen bei Familienkonflikten mit Jugendlichen im Alter zwischen 13 bis 18 Jahren. Konkrete Fallbeispiele und Analysen sollen die psychotherapeutische Arbeit mit Familien praxisnah veranschaulichen. Die Interventionsbausteine sind in das störungsübergreifende Behandlungsmanual SELBST eingebunden, welches sich um eine effektive Behandlung von Selbstwert-, Leistungs- und Beziehungsproblemen bei Jugendlichen bemüht. Angelehnt an den Selbstmanagement-Ansatz von Kanfer legt dieses Vorgehen initial einen Schwerpunkt auf den Aufbau von Änderungsmotivation und Selbstwirksamkeit bei Jugendlichen. Bei Familienproblemen stehen zudem auch Änderungsmotivation, Selbstwirksamkeit der Eltern sowie Ressourcen der ganzen Familie im Behandlungsfokus, die im Rahmen eines gemeinsamen Störungsmodells und gemeinsamer Zieldefinitionen erarbeitet werden. Die systemisch-behavioralen Interventionen beziehen sich schließlich auf Faktoren, die in den jeweiligen Familien als problembedingend und/oder aufrecht8erhaltend identifiziert wurden. Dies können dysfunktionale kognitive Annahmen sowohl bei Eltern als auch bei Jugendlichen sein, aber auch übergeordnete ungünstige familiäre Strukturen und -prozesse, wie beispielsweise schwache elterliche Koalitionen, eine mangelnde Abgrenzung zwischen Eltern und Jugendlichen, unangemessene Nähe oder Distanz in bestimmten Beziehungen. In vielen Fällen profitieren die Eltern von einer ausführlichen Beratung hinsichtlich ihrer komplexen Rolle als Erziehende gegenüber dem adoleszenten Kind und von der Anwendung förderlicher Erziehungsstrategien im Jugendalter. Weitere Therapiebausteine zielen auf eine verbesserte Affektregulation sowie die Stärkung von Kommunikations- und Problemlösefertigkeiten durch konkrete Trainings mit der ganzen Familie ab. Fast immer geht es um die Stärkung oder den Wiederaufbau von Beziehungsressourcen im Familiensystem. Auch wenn die Interventionen grundsätzlich auf die Teilnahme von Jugendlichen und ihrer Bezugspersonen ausgerichtet sind, können diese leicht abgewandelt auch in der Einzelarbeit mit Jugendlichen oder Eltern genutzt werden.
Es ist ein schwieriger und nicht immer von Erfolg gekrönter Weg, Familienkonflikte zu vermindern, die häufig bereits seit dem Kindesalter persistieren und zudem oft im Wechselspiel mit psychischen Störungen von Eltern und/oder Jugendlichen stehen. Einige Familien sind trotz hohem Leidensdruck nicht ausreichend in der Lage, Therapieinterventionen im Familienalltag umzusetzen. Ergänzend wird deshalb in diesem Manual beschrieben, wann Videotherapie und andere digitale Medien zur Generalisierung des Gelernten im Familienalltag eingesetzt werden können. Zudem wurden zur Unterstützung der Jugendlichen Funktionen der JAY-App integriert, um „den Job der Woche“ attraktiver zu machen. Schließlich geht es nicht darum, alle Familienprobleme in und während der Therapie zu lösen, sondern den Beteiligten Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie in der Lage sind, aktuelle und zukünftige Konfliktthemen gemeinsam konstruktiv aufzugreifen. In schwierigen Fällen wird der Einbezug weiterer Helfersysteme, wie z. B. der Jugendhilfe oder aber auch ergänzende einzeltherapeutische Unterstützung von Familienmitgliedern erforderlich sein und auch beschrieben. Gelingt es aber in der gemeinsamen Arbeit mit Eltern und Jugendlichen ein größeres Verständnis zwischen den Familienmitgliedern wiederherzustellen, Ressourcen zu aktivieren und Fertigkeiten zur Konfliktbewältigung zu steigern, so wird damit eine wichtige Weiche, insbesondere für eine weitere positive Entwicklung von Jugendlichen gestellt.
SELBST-Familienprobleme ist nach dem Grundlagenband (Walter et al., 2007) und den Bänden zu Leistungsproblemen (Walter & Döpfner, 2009) und zu Gleichaltrigenproblemen (Dresbach & Döpfner, 2020) der vierte Band des Therapieprogramms für Jugendliche mit Selbstwert-, Leistungs- und Beziehungsstörungen (SELBST). SELBST-Familienprobleme ist als Zusatzmodul zu SELBST-Grundlagen konzipiert, kann aber eigenständig eingesetzt werden. Ein herzlicher Dank der Autoren geht an die Mitherausgeber:innen des Therapieprogramms SELBST, Daniel Walter, Stephanie Schürmann und Eva Dresbach für ihre Geduld und langjährige kollegiale Unterstützung.
Wir hoffen, dass der Band SELBST-Familienprobleme Therapeut:innen in der Ausbildung, aber auch erfahrenen Kolleg:innen konkreten Input im Abgleich mit ihrem eigenen Tun gibt. Bleibt nur noch den Leser:innen sowie den Therapeut:innen viel Erfolg und Ausdauer bei der Umsetzung dieser Interventionen zu wünschen.
Köln, Juni 2024
Christiane Rademacher
und Manfred Döpfner
9Kapitel 1:Übersicht über SELBST-Familienprobleme
1.1 Das Therapieprogramm SELBST
SELBST ist ein Therapieprogramm für Jugendliche mit Selbstwert-, Leistungs- und Beziehungsstörungen, das in fünf Bände unterteilt ist:
Grundlagen der Selbstmanagementtherapie bei Jugendlichen (SELBST-Grundlagen; Walter, Rademacher, Schürmann & Döpfner, 2007): Im ersten Band werden wichtige Grundlagen des Therapieprogramms SELBST skizziert. Das therapeutische Vorgehen in den sieben Behandlungsphasen wird detailliert und anhand von zahlreichen Beispielen dargestellt. Eine Vielzahl von diagnostischen und therapeutischen Materialien ist auf einer CD-ROM enthalten. Therapeutische Besonderheiten und Voraussetzungen für die Therapie mit Jugendlichen werden beschrieben, der Umgang mit schwierigen Therapiesituationen wird ausgeführt. Spezielle kognitiv-behaviorale Interventionen in den vier Interventionsbereichen werden in den Folgebänden dargestellt.
Leistungsprobleme im Jugendalter (SELBST-Leistungsprobleme; Walter & Döpfner, 2009): Der Band fokussiert die Behandlung von Jugendlichen mit Leistungsproblemen – in der Schule oder am Ausbildungsplatz. Hierbei werden Leistungsstörungen in den Mittelpunkt gestellt, die nicht allein durch Begabungsdefizite, wie Intelligenzminderungen oder Teilleistungsstörungen erklärt werden können.
Gleichaltrigenprobleme im Jugendalter (SELBST-Gleichaltrigenprobleme, Dresbach & Döpfner, 2020): Dieser Band thematisiert häufig auftretende Beziehungsstörungen zu Gleichaltrigen, die sich im Sinne einer dimensionalen Sicht manifestieren. Diese können von ausgeprägtem sozialem Rückzug mit wenigen Kontakten zu Gleichaltrigen bis hin zu deutlich aggressiver Beziehungsgestaltung mit häufigen Streitigkeiten und Beziehungsabbrüchen reichen.
Familienprobleme im Jugendalter (SELBST-Familienprobleme): Im vorliegenden Band steht die Verminderung von ausgeprägten Beziehungsstörungen zwischen Jugendlichen und Eltern, die sich zumeist als chronifizierte Konflikte und Streitigkeiten äußern, im Mittelpunkt.
Selbstwert- Aktivitäts- und Affektprobleme im Jugendalter (SELBST-Selbstwertprobleme, in Vorbereitung) beschreibt die Behandlung von Jugendlichen mit Selbstwertstörungen. Störungen des Selbstwertes umfassen Fehleinschätzungen der eigenen Person, der Umwelt und der Zukunft und treten häufig in Kombination mit dysphorisch-depressivem Affekt sowie einem reduzierten Niveau an Aktivitäten auf; mitunter findet sich eine überhöhte Einschätzung der eigenen Person.
Während der Grundlagenband von SELBST (Walter et al., 2007) das problemübergreifende therapeutische Vorgehen mit dem Jugendlichen unter Einbezug der relevanten Bezugspersonen differenziert beschreibt, sind die übrigen vier Bände stark auf die jeweiligen Probleme ausgerichtet. Jeder Band ist jedoch für sich genommen eigenständig einsetzbar. Deshalb sind auch Überschneidungen zwischen den einzelnen Bänden notwendig. Die in Band 1 ausführlich dargestellten grundlegenden Vorgehensweisen werden in den Folgebänden, die sich auf die spezifischen kognitiv-behavioralen Interventionen in einzelnen Störungsbereichen beziehen, nur noch zusammenfassend beschrieben. Es ist daher durchaus sinnvoll, den Grundlagenband zusammen mit den jeweiligen Folgebänden zu verwenden. Eine Kombination von Bausteinen aus den verschiedenen Therapiemanualen ist häufig hilfreich und notwendig.
SELBST lässt sich durch folgende Merkmale charakterisieren (vgl. Walter et al., 2007):
10es ist störungsübergreifend, d. h. es orientiert sich nicht an den gängigen Störungskategorien der Klassifikationsschemata, und es ist
problemorientiert, indem es die konkreten Probleme im Bereich von Selbstwert-, Leistungs- und Beziehungsschwierigkeiten von Jugendlichen aufgreift. Es ist darüber hinaus
lösungsorientiert und versucht, konkrete Problembewältigungen mit dem Jugendlichen und seinen Bezugspersonen zu erarbeiten und sie bei der Umsetzung zu unterstützen. Schließlich ist es
ressourcenorientiert, weil es neben den Problemen auch die Stärken des Jugendlichen und seiner Umwelt aufgreift und in die Lösungen mit einbindet.
Damit werden mit dem SELBST-Programm wesentliche Kennzeichen der multimodalen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie realisiert (vgl. Döpfner et al., 2007).
Wie im Grundlagenband bereits dargestellt (Walter et al., 2007), umfasst das Therapieprogramm SELBST in Anlehnung an den von Kanfer et al. (2000, 2012) beschriebenen Selbstmanagementansatz sieben Behandlungsphasen (vertikale Ebene, vgl. Abbildung 1, Walter et al., 2007). In der Regel steht die Arbeit mit dem Jugendlichen im Vordergrund, relevante Bezugspersonen (z. B. Eltern, Geschwister, Lehrkräfte, Betreuer:in) können aber in Abhängigkeit von der Problematik intensiv mit einbezogen werden. Das Therapieprogramm ist in zwei unterschiedliche Behandlungssegmente aufgeteilt: Problem- und Zielanalyse (Phasen 1 bis 4) sowie Intervention und Verlaufskontrolle (Phasen 5 bis 7). In Phase 5 (Durchführung von Interventionen, horizontale Ebene, vgl. Abbildung 2) werden kognitiv-behaviorale Interventionen durchgeführt, welche die vier Problembereiche von SELBST ansprechen. Die Phasen 1 bis 4 dauern in Abhängigkeit von der Problematik etwa 5 bis 20, die Phasen 5 bis 7 bei hoher Varianz im Durchschnitt etwa 10 bis 35 Behandlungsstunden. Normalerweise werden die Phasen nacheinander durchlaufen, ein Rückgriff auf frühere Behandlungsphasen ist jedoch jederzeit möglich.
Abbildung 1: Die 7 Phasen von SELBST
Das Programm ist modular aufgebaut und besteht aus vielen unterschiedlichen Bausteinen, die auf die verschiedenen Problembereiche von SELBST zugeschnitten sind. Es wurden Bausteine für Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte entwickelt. Allerdings werden nicht alle Bausteine in einer Therapie eingesetzt, sondern es wird für jeden Fall individuell ein Behandlungspaket aus verschiedenen Bausteinen mit jugendlichen- und elternzentrierten Interventionen, ggf. unter Einbezug weiterer relevanter Bezugspersonen (z. B. Lehrkräfte, Geschwister) zugeschnitten.
Vertikale Ebene (Abbildung 1):
Phase 1 (Screening der Eingangsbeschwerden, Beziehungsaufbau, Informationsvermittlung): Die Eingangsphase hat den Aufbau initialer Behandlungsmotivation und Kooperationsbereitschaft, den Beziehungsaufbau zum Jugendlichen und wichtigen Bezugspersonen, das Sammeln und Bereitstellen von Informationen, sowie das Herstellen von Transparenz zum Ziel. Hierzu werden zunächst der Vorstellungsanlass sowie die Probleme und Erwartungen des Jugendlichen, der Eltern und eventuell weiterer Bezugspersonen erfragt. Anschließend wird über den Ablauf der Behandlung informiert 11und die nächsten Schritte werden mit allen Beteiligten abgestimmt. Hierbei berücksichtigt der Therapeut besonders die Wünsche der Jugendlichen. Wenn gar keine oder nur geringe Behandlungsmotivation vorhanden ist, wird angestrebt, die Jugendlichen zumindest dahingehend zu ermuntern, einen zweiten Termin als Probestunde in Anspruch zu nehmen, um eine Entscheidung für oder gegen eine weitere Mitarbeit auf einer breiteren Grundlage treffen zu können. Bereits in dieser Phase werden Jugendliche auch ohne die Anwesenheit der Bezugspersonen exploriert.
Phase 2 (Multimodale Diagnostik: Probleme & Kompetenzen, Belastungen & Ressourcen): Weitergehende Informationen über die Problematik werden erhoben. Gleichzeitig fokussiert der Therapeut Kompetenzen und Ressourcen bei Jugendlichen und ihren Bezugspersonen (z. B. Eltern, Lehrkräfte), damit diese in die Behandlungsplanung integriert werden können. Die Informationssammlung basiert hauptsächlich auf der Exploration der Jugendlichen, der Eltern, der Lehrkräfte und gegebenenfalls weiterer relevanter Bezugspersonen. Eltern und Jugendliche werden sowohl getrennt als auch gemeinsam exploriert. Um sich einen Überblick über die Probleme innerhalb der verschiedenen Interventionsbereiche zu verschaffen, werden selbst entwickelte symptomorientierte Screening-Fragebögen, Checklisten und Explorationsleitfäden eingesetzt. Auch standardisierte Leistungs-, psycho- und familiendiagnostische Verfahren einschließlich Selbst- und Fremdbeurteilungsskalen werden angewendet (vgl. Walter et al., 2007; Döpfner et al., 2000, 2017).
Phase 3 (Problemanalyse, Erarbeitung eines Störungskonzeptes): Ziel dieser Phase ist zum einen die Eingrenzung der jeweils subjektiv relevanten Probleme aus der Sicht aller Beteiligten, zum anderen wird ein umfassendes Störungsmodell erarbeitet. Die Arbeit mit den Jugendlichen steht wiederum im Zentrum. Eine differenzierte Problemanalyse mit Erfassung der auslösenden Bedingungen, des konkreten Verhaltens sowie der nachfolgenden kurz- und langfristigen Konsequenzen wird ausführlich erarbeitet. Gemeinsam mit den Jugendlichen werden die kurz- und langfristigen Vor- und Nachteile seines Verhaltens herausgearbeitet. Anschließend werden subjektive Störungskonzepte mit den Beteiligten getrennt erarbeitet. Im nächsten Schritt wird in gemeinsamen Gesprächen eine Übereinstimmung über das Störungskonzept angestrebt. Hierzu werden ursächliche und aufrechterhaltende Faktoren identifiziert, um anschließend daraus für alle nachvollziehbare Interventionen abzuleiten.
Phase 4 (Zielanalyse, Stärkung der Änderungsmotivation, Interventionsplanung): Diese Phase ist ein Eckpfeiler des Behandlungsprogramms und stellt die Basis der nachfolgenden Interventionen dar. Zu Beginn werden individuelle Therapieziele mit allen Beteiligten definiert. Die Änderungswünsche der Jugendlichen finden besondere Berücksichtigung, wobei die Ziele auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft werden. Hierdurch kann die Änderungsmotivation der Jugendlichen gestärkt werden. In einem weiteren Schritt versuchen Therapeut:innen, einen Konsens zwischen den Problemdefinitionen (vgl. Phase 3) und Zielen der Jugendlichen, jenen der Eltern und möglicherweise auch anderer Bezugspersonen zu erreichen. Abschließend werden Therapieziele gemeinsam festgelegt, die in einer ersten Interventionsphase realisiert werden sollen. Schließlich planen Therapeut:innen die nachfolgenden Interventionen von Phase 5.
Phase 5 (Durchführung von Interventionen): Die Durchführung von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Interventionen im engeren Sinne steht in Phase 5 im Zentrum. Ausgehend von den ausgewählten Therapiezielen und den im gemeinsam Störungskonzept erarbeiteten auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren erfolgt die Zuordnung zu den vier Problembereichen (horizontale Ebene, s. u.). Eine zentrale Funktion nehmen regelmäßige Therapieaufgaben (JOBs der Woche) ein, mit denen der Transfer verbessert werden soll.
Phase 6 (Zwischenevaluation, Zielerreichung): In regelmäßigen Abständen wird mit den Beteiligten eine Zwischenbilanz gezogen, in der eruiert wird, inwieweit Verhaltensänderungen realisiert und in welchem Umfang zuvor definierte Therapieziele bereits erreicht werden konnten. Wenn nötig, müssen Faktoren bearbeitet werden, die der Zielerreichung entgegenstehen (Misserfolgs- bzw. Widerstandsanalyse). Ist das entsprechende Teilziel erreicht worden, ist es möglich, neue Ziele zu definieren (Rückkehr zu Phase 4) und weitere Interventionen durchzuführen.
Phase 7 (Stabilisierung, Rückfallprävention): Die Stabilisierung der erreichten Verhaltensänderungen und die Rückfallprävention steht am Ende der Behandlung im Zentrum. Um die Stabilität der Behandlungseffekte zu gewährleisten, wird die therapeutische Unterstützung schrittweise zurückgenommen. Mögliche Problemsituationen oder auch Rückfälle in alte Verhaltensprobleme werden angesprochen, darüber hinaus werden geeignete Bewältigungsstrategien eingeübt. In Auffrischungssitzungen (Booster-Sitzungen), die in regelmäßigen niederfrequenten Abständen (z. B. alle drei Monate) oder bei Bedarf angesetzt werden, kann die 12Bewältigung der aktuellen Probleme mithilfe der erworbenen Verhaltenskompetenzen thematisiert werden.
Abbildung 2 gibt einen kurzen Überblick über die verhaltenstherapeutischen Interventionen von Phase 5 (Durchführung von Interventionen), gegliedert nach den vier Problembereichen.
Abbildung 2: Verhaltenstherapeutische Interventionen in Phase 5
Horizontale Ebene:
Selbstwertprobleme: Interventionen zur Stärkung des Selbstwertes, zur Erhöhung des Aktivitätsniveaus sowie zur Verbesserung der Affektregulation stehen im Zentrum dieses Interventionsbereichs (vgl. Selbstwertprobleme im Jugendalter; in Vorbereitung). Positive Aktivitäten werden aufgebaut und weiter stabilisiert und die Genussfähigkeit wird verbessert. Fehleinschätzungen der eigenen Person, der Umwelt und der Zukunft werden herausgearbeitet und korrigiert, ein selbstwertstützender Umgang mit Problemen eingeübt. Um die Emotionsregulation zu verbessern, kann ein Emotionsregulationstraining durchgeführt werden.
Leistungsprobleme: Der Band SELBST-Leistungsprobleme beinhaltet Interventionen zur Verminderung von Leistungsstörungen, die nicht hauptsächlich auf Begabungsdefizite zurückgeführt werden können. Hierzu wird zunächst eine adäquate schulische Platzierung sichergestellt und bei Teilleistungsschwächen werden Fördermaßnahmen eingeleitet. Dysfunktionale leistungsbezogene Kognitionen werden korrigiert, damit die Anstrengungsbereitschaft gesteigert und Leistungsängste vermindert werden können. Darüber hinaus kommen Maßnahmen zur Optimierung von Lernstrategien und Arbeitsorganisation, zur Verbesserung der Mitarbeit im Unterricht und zur Verminderung von Wissenslücken zum Einsatz.
Gleichaltrigenprobleme: Interventionen bei Gleichaltrigenproblemen zielen auf eine Veränderung der problematischen sozialen Informationsverarbeitung, dysfunktionaler Überzeugungen und interpersonaler Schemata ab. Zudem soll eine verbesserte Emotionsregulation und/oder eine Steigerung defizitärer sozialer Fertigkeiten erfolgen. Zusätz13lich werden problemaufrechterhaltende Verstärkungsprozesse verändert (vgl. Dresbach & Döpfner, 2020).
Familienprobleme: Interventionen in diesem Bereich fokussieren auf eine Verbesserung der Eltern-Jugendlichen-Beziehung sowie auf eine Erhöhung der Konfliktlösekompetenzen in der Familie. Ungünstige, problemerhaltende Familienstrukturen und -prozesse sollen verändert, dysfunktionale Einstellungen bearbeitet sowie Problemlöse- und Kommunikationsfertigkeiten eingeübt werden. Durch die Stärkung von positiven Beziehungselementen soll die Verbindung zwischen Eltern und Jugendlichen wieder enger werden.
1.2 Entwicklungspsychologische Relevanz von Familienproblemen in der Adoleszenz
Familienprobleme, die sich häufig auch als Familienkonflikte äußern sind im Rahmen der Autonomieentwicklung von Jugendlichen zu erwarten, wenn nicht gar unausweichlich. Eine zentrale Entwicklungsaufgabe des Jugendalters besteht darin, dass Jugendliche eine eigene Identität entwickeln und sich zunehmend von den Eltern abgrenzen. Die „zweite Geburt“, wie die Phase der Adoleszenz von der französischen Psychoanalytikerin Dolto auch genannt wird, kann ein zeitweise schmerzlicher und anstrengender Prozess für Eltern und Jugendliche gleichermaßen (Dolto, 1995) sein, in dem auch die Eltern komplexe Anpassungsleistungen erbringen müssen. Andererseits konnte eine Metaanalyse von Laursen et al. (1998) eine Zunahme von Konflikten im Alter von 10 bis 22 Jahren nicht durchgängig bestätigen, sondern verwies auf einen weitgehend kontinuierlichen Rückgang der Konflikthäufigkeit im Verlauf zwischen frühem und spätem Jugendalter (Walper et al., 2018). Im Übergang vom frühen zum mittleren Jugendalter wurden allerdings emotional intensivere Konflikte hervorgehoben. Sinnvollerweise werden Konflikte von vielen Familien als normal bewertet und stellen keine grundlegende Belastung der familiären Beziehungen dar. Cox et al. (1999) verweisen darauf, dass die Verhandlungen von Meinungsverschiedenheiten in engen Beziehungen notwendig sind und nicht pathologisiert werden sollten (vgl. Walper et al., 2018). Als zentrales Thema der Eltern-Kind-Konflikte kann der Widerspruch zwischen dem elterlichen Kontrollwunsch und dem Autonomiestreben der Jugendlichen benannt werden. Dabei erleben Jugendliche mit ihren Müttern bedingt durch die meist höhere Reibung in alltäglichen Situationen intensivere Konflikte als mit ihren Vätern. Der Kontrollwunsch der Mutter wird als negativ wahrgenommen (Pinquart & Scrugies, 1999), die Auseinandersetzungen mit der Mutter werden im Vergleich zu denen mit dem Vater aber als konstruktiver und die Beziehung als näher erlebt (vgl. Laursen & Collins, 2009, in Walper et al., 2018). Loeber et al. (2000) verweisen aber darauf, dass ernsthafte Beziehungsstörungen zwischen Eltern und Jugendlichen selten sind und in der Regel nicht erst im Jugendalter auftreten (Walper et al., 2018). Walper et al. (2018) belegen weiterhin durch eine Vielzahl von Studien, dass intensive, persistierende, feindselige Konflikte zwischen Eltern und Jugendlichen eine Belastung für die Jugendlichen darstellen, hier allerdings neben der Konfliktintensität ein autoritär-kontrollierender Erziehungsstil, anhaltende Feindseligkeit, elterliche Ablehnung und eine geringe familiäre Kohäsion zusätzlich eine Rolle spielen und die Beziehung zwischen Eltern und Jugendlichen durch zahlreiche Kontextfaktoren innerhalb und außerhalb der Familie beeinflusst wird. Die Autoren benennen Bindungssicherheit, die Verbundenheit zu den Eltern, aber auch die sozioökonomischen Ressourcen in einer Familie als relevante Einflussgrößen. Schließlich wird auch die psychische Belastung von Jugendlichen als Faktor für die Beziehungsprobleme in der Familie benannt. Diese können sich vor dem Hintergrund familiärer Belastungen entwickeln, aber auch ihrerseits negative Auswirkungen auf die Eltern-Jugendlichen-Beziehung haben (vgl. Walper et al., 2018, und Kapitel 1.2.1 im Folgenden).
Mit zunehmendem Alter gelingt es Jugendlichen laut Pinquart und Scrugies (1999) häufiger, einen Kommunikationsstil einzusetzen, der zu einer positiven Problemlösung führt, was die Anspannung in der Familie sukzessive vermindern dürfte. Das Jugendalter kann nach Pinquart und Scrugies (1999) als eine positive Zeit erlebt werden, wenn zwischen Eltern und Jugendlichen eine neue Balance zwischen Autonomie und Verwurzelung entstanden ist. Die Loslösung vom Elternhaus gilt als gelungen, wenn Jugendliche die Werte und Normen der Eltern hinterfragt haben, ein selbstständiges Leben führen und sich ihren Eltern dennoch verbunden fühlen können.
Um die Relevanz von Familienproblemen im Jugendalter einordnen zu können, ist es wichtig, die anstehenden Entwicklungsaufgaben des Jugendalters nachzuvollziehen und im therapeutischen Rahmen den individuellen Entwicklungsstand von Jugendlichen in diesem Kontext zu reflektieren. Zudem muss beim Vorliegen von Familienproblemen berücksichtigt werden, dass diese Lebensphase nicht nur an die Jugendlichen, sondern auch an die Eltern und letztendlich 14an die gesamte Familie spezielle Anforderungen stellt. Der Erfolg der elterlichen Unterstützung im Zusammenhang mit den elterlichen Erziehungskompetenzen im Jugendalter wirkt sich wiederum maßgeblich auf den Umgang mit den Jugendlichen aus und sollte in das Verständnis der Eltern-Jugendlichen-Interaktionen miteinbezogen werden.
Definition Jugendalter: Der Beginn des Jugendalters wird in der Regel durch biophysiologische Veränderungen, die sogenannte Pubertät eingeleitet, die den Anstoß für weitere psychische Prozesse gibt (Grob & Jaschinski, 2003). Die Pubertät kennzeichnet sich durch die Ausbildung und Entwicklung von primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen, einem erheblichen Wachstumsschub, Veränderungen im Herz-Kreislauf- sowie Atmungssystem, Veränderungen der Statur und das Erreichen der Geschlechtsreife. Diese stellt sich bei den Mädchen durch das Einsetzen der Menarche durchschnittlich bei etwa 12,8 Jahren (Kahl et al., 2007) ein. Bei Jungen lassen sich im Mittel nach Brämswig und Dommers (2009) mit 13,4 Jahren erste Spermien im Urin nachweisen (vgl. Konrad & König, 2018). Im Rückblick auf die letzten 120 Jahre zeigt sich, dass sich die pubertäre Entwicklung bei Jungen wie Mädchen vor allem durch verbesserte Ernährungsbedingungen zeitlich immer weiter nach vorn verschoben hat, wodurch sich die Phase der Kindheit sukzessive verkürzt. In den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts konnte der Trend der „sekulären Akzeleration“ in europäischen Ländern allerdings nicht gemessen werden, so dass sein Fortbestehen diskutiert wird (Ravens-Sieberer et al., 2007a, b).
Neben hormonell bedingten Veränderungen konnten neue Erkenntnisse in den Neurowissenschaften zeigen, dass es während der Adoleszenz zu einer grundlegenden Reorganisation des Gehirns kommt, welche auf eine größere Plastizität und Formbarkeit hinweist als bisher angenommen. Die zunehmende Myelisinisierung von Axonen (Aufbau weißer Substanz) und der Abbau verzichtbarer neuronaler Synapsen (Abbau grauer Substanz) führt zu einer besseren Vernetzung und einer stark beschleunigten Informationsweitergabe zwischen verschiedenen Hirnarealen des Jugendlichen. Vorrübergehende kognitive Leistungsverschlechterungen können auftreten, werden aber schnell von einem „enormen kognitiven Leistungsschub“ abgelöst (vgl. Konrad & König, 2018)
Allerdings verdeutlicht sich auch ein Ungleichgewicht zwischen dem früher reifenden lymbischen System und dem Belohnungssystem und einem noch nicht voll ausgereiften präfrontalen Kontrollsystem. Es wird vermutet, dass dieses Ungleichgewicht für den adoleszenztypischen, eher emotionalen Reaktionsstil sowie für die Häufung von risikoreichen Verhaltensweisen im Jugendalter (z. B. sensation seeking) verantwortlich gemacht werden kann (Konrad et al., 2013). Das Jugendalter umfasst allerdings weit mehr als nur biologische Veränderungsprozesse und ist bedingt durch seine unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben, die unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten des Jugendlichen erfordern, sehr vielschichtig. Man unterscheidet die Phase der frühen Adoleszenz (ca. 10 – 13 Jahre Jahre), der mittleren Adoleszenz (ca. 14 – 16/17 Jahre) und der späten Adoleszenz (ca. 17 – 20 Jahre). Das Ende des Jugendalters kennzeichnet sich soziologisch gesehen in der Regel durch die Verselbstständigung der jungen Erwachsenen, indem diese beruflich, partnerschaftlich, familiär und politisch selbstbestimmt und unabhängig agieren.
Wenngleich der Begriff der „Jugendkrise“ nach Pinquart (2003) vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ein Großteil der Jugendlichen problemlos durch diese Phase kommt (vgl. Oerter & Montada, 2002; Shell Jugendstudie, 2015), durchaus kritisch diskutiert werden muss, verweisen Reiß et al. (2024) durch Ergebnisse der HBSC-Studie 2009/10 – 2022 darauf, dass etwa die Hälfte der Mädchen und ein Drittel der Jungen von multiplen psychosomatischen Gesundheitsbeschwerden berichten mit einem deutlichen Anstieg im zeitlichen Verlauf. Insbesondere ältere Jugendliche, Mädchen und Genderdiverse würden ein erhöhtes Risiko für ein geringes Wohlbefinden aufweisen. Die subjektive Gesundheit und Lebenszufriedenheit habe sich über den untersuchten Verlauf hin zu letzten Erhebung deutlich verschlechtert.
Die Bewältigung von anstehenden Entwicklungsaufgaben wie die Ausbildung eines positiven Selbstbildes, inklusive eines positives Körperbildes, eines stabilen Selbstwertgefühls, die Verankerung von eigenen Wert- und Normvorstellungen verbunden mit einer angemessenen Verantwortungsübernahme und Selbstregulation, finden im Austausch mit Alltagsproblemen, kritischen Lebensereignissen, aber auch nachvollziehbar vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Belastungen, z.B. durch die COVID-19-Pandemie, durch die Klimakrise sowie durch den Krieg in der Ukraine statt. Reiß et al. (2024) sprechen sich für eine zielgruppenspezifische Prävention, Gesundheitsförderung und ein kontinuierliches Gesundheitsmonitoring aus.
Schließlich ist bei einer aktuellen Betrachtung des Jugendalters zu berücksichtigen, dass sich die Anforderungen an Jugendliche und somit auch indirekt an die Eltern in den westlichen Industrieländern durch verschiedene gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen verändert haben. So müssen sich Jugendliche heute auf eine deutlich verlängerte Ausbildungszeit und auf lebenslanges Lernen einstellen. Sie stehen vor einer Vielzahl möglicher Lebensentwürfe 15und Wertesysteme, können im Rahmen ihrer Identitätsentwicklung länger experimentieren, sowohl in Partnerschaften als auch im Beruf. Sie wachsen in unterschiedlichen, teils wechselnden Familienstrukturen auf und verbleiben insgesamt länger dort. Das Jugendalter beginnt durch ein früheres Einsetzen der Pubertät nicht nur früher, sondern findet auch später seinen Abschluss, wenn man diesen durch eine ökonomische und soziale Unabhängigkeit definiert. Arnett (2004) hat mit dem Begriff „Emerging Adulthood“ die oben angegebenen Besonderheiten der Lebensphase von 18- bis 25-Jährigen beschrieben.
1.2.1 Die Bedeutung von Familienkonflikten im Kontext psychischer Störungen
Familienkonflikte sind bereits im Kontext unterschiedlichster Störungsbilder wie z. B. Essstörungen, Sucht, Persönlichkeitsstörungen oder Psychosen als ein relevanter Faktor bei der Entwicklung und/oder Aufrechterhaltung der psychischen Störung bei Kindern und Jugendlichen untersucht worden. In der Regel werden Familienkonflikte allerdings in Studien nicht spezifisch, sondern im Kontext mit anderen familiären Risikofaktoren, wie einem unangemessenen elterlichen Erziehungsverhalten, der psychopathologischen Belastung der Eltern, Ehekonflikten sowie Scheidung der Eltern untersucht. Dabei kann ihnen die Rolle eines „Stressors“ zugewiesen werden, der in Kombination mit anderen Stressoren zu psychopathologischen Auffälligkeiten bei Kindern oder Jugendlichen führt (vgl. McMahon et al., 2003; Herrenkohl et al., 2008). Häufig werden Familienkonflikte aber auch als soziale Prozesse verstanden, welche die Weiterverarbeitung eines Stressors (z. B. belastende Lebensereignisse) wesentlich gestalten, somit mittelbar als Mediator einen Einfluss auf die psychopathologische Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen nehmen. Schlack et al. (2021, S. 14) weisen nach Datenanalyse einer Stichprobe von jungen Erwachsenen der KIGGS-Kohorte (KIGGS Welle 2, 2014 – 2017) darauf hin, dass sich, auch wenn in den Datenanalysen die Schutzfaktoren nicht hinsichtlich verschiedener Dimensionen bewertet wurden, „die Verfügbarkeit psychosozialer Schutzfaktoren in Kindheit oder Jugend am stärksten hinsichtlich der späteren psychischen Gesundheit, Lebenszufriedenheit und der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bemerkbar macht“. Familiären und sozialen Schutzfaktoren werden von den Autoren wichtige Funktionen dabei zugemessen, Risiken für spätere psychische Störungen zu verringern.
Studien sowohl zu Mediator- als auch Moderatoreffekten von Familienproblemen im Kontext psychischer Störungen bei Jugendlichen sowie weitere Studien zu der Frage, inwieweit die psychischen Störungen von Jugendlichen ihrerseits zu einer Verringerung von Familienfunktionen führen, sind noch wünschenswert (reziproke Effekte, vgl. Hughes & Gullone, 2008). Allen et al. (2004) konnten zeigen, dass eine erhöhte Depressivität bei Jugendlichen einen Verlust an Bindungssicherheit und eine Verminderung der Beziehungsqualität zu den Eltern mit sich bringt; Branje et al. (2010) konnten im Gegenzug umgekehrte Effekt demonstrieren (vgl. Walper et al., 2018).
Dennoch gibt es insbesondere bei externalisierenden Verhaltensstörungen eine belastbare Studienlage, die auf einen sich selbstverstärkenden „Teufelskreis“ der sozialen Interaktion verweist, der sich bereits im Kindesalter zwischen defizitärem elterlichen Erziehungsverhalten und provokativem, schwierigem Verhalten des Kindes in Form von Konflikten manifestiert und aggressives Verhalten stabilisiert (Cierpka, 1999; Patterson, 1982; Kendall et al., 2005; Döpfner, 2007). Barkley et al. (1991) konnten zeigen, dass hyperaktive Jugendliche und ihre Mütter stärker negativ-kontrollierendes Verhalten und weniger positiv-unterstützendes Verhalten in den Interaktionsdyaden zeigten, als dies in der Kontrollgruppe der Fall war. Zudem berichteten auch die Mütter hyperaktiver Adoleszenten von vergleichsweise verstärktem psychologischen Distress. Ein ähnliches Ergebnis wurde bereits bei der Eingangsmessung im Kindesalter gefunden, so dass die Autoren konstatieren, dass die Entwicklung und Aufrechterhaltung von oppositionellem Verhalten bei hyperaktiven Kindern wesentlich durch Aggressionen und negative Eltern-Kind-Interaktionen in der Kindheit bedingt werden. Auch Edwards et al. (2001) benennen das Ausmaß an „Feindseligkeit“, welches von den Eltern im Kontext mit gehäuften Konflikten berichtet wird, als wesentliche Bedingung für den Schweregrad der Ausprägung der oppositionellen Symptomatik bei Jugendlichen.
Gleichermaßen gibt die Studienlage im Kontext der internalen Verhaltensstörungen Hinweise für eine starke Vorhersagekraft von Familienkonflikten im Jugendalter. Das Aufwachsen in „feindlichen“ Beziehungen führt nach Annahmen mehrerer Autoren zu einem defizitären Stressmanagement gegenüber belastenden Lebensereignissen und Selbstbestrafungstendenzen bei jungen Erwachsenen, die anschließend sowohl in Partnerschaften wie Arbeitsverhältnissen Probleme entwickeln, die depressive Symptome nach sich ziehen (Herrenkohl et al., 2008; Lewandowski, 2009).
16Alaie et al. (2019) konnten anhand der Daten von 382 Jugendlichen im Rahmen der Uppsala Longitudinal Adolescent Depression Study zeigen, dass ausgeprägte Eltern-Jugendlichen-Konflikte bei depressiven Jugendlichen das Risiko für eine Depression im Erwachsenenalter deutlich erhöhen und somit überdauernde Gesundheitsprobleme hervorrufen.
Döpfner et al. (2018) konnten anhand einer Studie mit dem Family Relations Test zeigen, dass psychisch auffällige Jugendliche aus einer Klinikstichprobe insgesamt in ihren Familien stärkere negative Beziehungen als Jugendliche in einer repräsentativen Feldstichprobe erleben. Innerhalb der Klinikstichprobe konnten zum Teil deutliche Korrelationen zwischen dem Ausmaß der internalen und der externalen Auffälligkeiten der Jugendlichen und den berichteten Familienbeziehungen festgestellt werden.
Auch wenn die Untersuchungen nicht immer spezifische Aussagen zulassen und die Zusammenhänge häufig nur unidirektional untersucht wurden, verweisen die Ergebnisse doch klar darauf, dass es sinnvoll ist, Funktionen wie Kommunikation und Problemlösefähigkeit im Familiensystem zu verbessern, um die psychische Belastung von Jugendlichen auch vorausschauend für ihre weitere Entwicklung zu vermindern. Gleichsam erscheint es sinnvoll, Risiko-Familien präventiv hinsichtlich solcher Fertigkeiten zu trainieren.
1.2.2 Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen
Havighurst (1953, 1972) entwickelte bereits in den dreißiger und vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts das Konzept der Entwicklungsaufgaben im Jugendalter, um das pädagogische Handeln im Umgang mit Jugendlichen auf eine breitere Informationsbasis zu stellen. Dabei wird eine Entwicklungsaufgabe als ein Bindeglied im Spannungsverhältnis zwischen individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen verstanden. Dreher und Dreher (1985) untersuchten angelehnt an Havighurst die Gültigkeit dieser Entwicklungsaufgaben für Jugendliche in der Gesellschaft und definierten folgende relevanten Bereiche:
Gleichaltrigenbeziehungen: Jugendliche stehen vor der Aufgabe, einen Freundeskreis aufzubauen, d. h. zu Gleichaltrigen verschiedenen Geschlechts neue, reifere Beziehungen herzustellen.
Intimbeziehungen: Eine engere, intime (romantische) Beziehung zu einer anderen Person wird angestrebt.
Körperveränderungen: Jugendliche müssen die Veränderungen des Körpers und des eigenen Aussehens akzeptieren.
Geschlechtsidentität: Jugendliche stehen vor der Aufgabe im Austausch mit bestehenden Rollenbildern eine eigene Geschlechtsidentität zu entwickeln.
Selbstbild: Jugendliche versuchen zunehmende Klarheit über das Bild zu erlangen, dass sie von sich selbst haben (Selbsteinschätzung) sowie darüber, wie sie von anderen gesehen werden (Fremdeinschätzung).
Ablösung: Jugendliche zielen auf eine zunehmende Loslösung und emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen.
Berufsfindung/Qualifizierung: Jugendliche versuchen sich zunehmend in Richtung Berufswahl und Ausbildung zu orientieren.
Familie und Partnerschaft: Jugendliche entwickeln zunehmend Vorstellungen darüber, wie sie die eigene zukünftige Familie bzw. Partnerschaft gestalten wollen.
Werteklärung: Eine eigenes Wertesystem wird angestrebt, das bestimmt, an welchen Werten und ethischen Prinzipien man sein Handeln ausrichten will.
Zukunftsperspektive: Schließlich geht es darum, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, indem man Ziele anstrebt und sein Leben dahingehend plant.
In der Shell Jugendstudie (2015) wird ergänzend als aktuelle Entwicklungsaufgabe der Umgang mit Konsum-, Medien- und Freizeitangeboten hervorgehoben.
Aus der Fülle dieser Aufgaben lässt sich leicht schließen, dass das Jugendalter für Jugendliche eine Herausforderung darstellt, in der sie vielen Anforderungen nachkommen müssen, die auch verunsichern können. Andererseits erlangen Jugendliche durch die erfolgreiche Bewältigung dieser Aufgaben ein immer größeres Maß an Autonomie, welche ihnen ein selbstständiges Leben als Erwachsene ermöglicht. Schließlich gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe über mehrere Zeitabschnitte der Lebensspanne erstrecken kann, also keine in sich geschlossene Einheit darstellt. Havighurst (1972) spricht in diesem Kontext von „teachable moments“ und meint damit sensitive Perioden des Lernens, die für den Vollzug der Lernprozesse besonders günstig sind. Ein optimaler Zeitpunkt hierfür ist gegeben, wenn (1) die körperlichen Voraussetzungen zum Erlernen eines Inhalts gegeben sind; (2) der Inhalt seitens der Gesellschaft gefordert ist und (3) das Individuum auch gewillt ist, eine Aufgabe anzugehen.
171.2.3 Entwicklungsaufgaben der Eltern
Die Art und Weise, wie die Umwelt auf die Entwicklung von Jugendlichen reagiert, hat maßgeblichen Einfluss auf die erfolgreiche Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben. Betrachtet man die Familie als wichtigen Umweltfaktor der Jugendlichen, so stellt sich die Frage, wie förderlich die Eltern mit den Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen umgehen können. Mit der Stärkung von „life skills“ (Botvin, 1998, zitiert in Eschenbeck & Knauf, 2018) können Eltern durch Anleitung bei Stressbewältigung und Problemlösen sowie durch Unterstützung von Kommunikation, Eigenverantwortung und Selbstvertrauen die individuellen Bewältigungsressourcen der Jugendlichen im Umgang mit den anstehenden Entwicklungsaufgaben stärken.
Dreher und Dreher ermittelten bereits 1985 im Rahmen einer Befragung von 120 jungen Erwachsenen, drei relevante elterliche Haltungen, die in der Adoleszenz als unterstützend erlebt wurden:
Erweiterung der Handlungsspielräume und materielle Unterstützung durch die Eltern (z. B. durch Schaffung von Kontaktmöglichkeiten, Ermöglichung von Urlaub und Freizeitgestaltung).
Vertrauen und Akzeptanz gegenüber der Werteüberzeugung und den Freunden des Kindes.
Erziehung zur Selbstständigkeit, Leistung von Hilfestellungen ohne Autonomieeinschränkung des Jugendlichen.
Auch Drieschner (2007) bezeichnet „Selbstständigkeit“ von Heranwachsenden als Schlüsselqualifikation und somit wichtiges Erziehungsziel. Gleichsam betonen Ecarius et al. (2017) Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, Eigenverantwortung und Selbstkontrolle als notwendige zu vermittelnde Kompetenzen. Walper und Stemmler (2013) verweisen auf die zentrale Rolle von Eltern/Familie im Entwicklungs- und Bildungskontext, indem diese über die materielle Ausstattung des Haushalts und die Gestaltung von Beziehungen und Interaktionen Lern- und Entwicklungsgelegenheiten für das Kind eröffnen. Sie lenken kindliche Neugier und Lernmotivation und liefern Richtlinien für angemessenes Verhalten. Zudem vermitteln sie direkt und indirekt den Zugang zu außerfamilialen Erfahrungsräumen, die ihrerseits unterschiedliche Lern- und Bildungsprozesse ermöglichen. Ähnlich betonen Eschenbeck und Knauf (2018) die Notwendigkeit elterlicher Unterstützung in der Berufsorientierung und bei der Suche nach Ausbildungs- und Studienplätzen. Betont wird auch eine „entwicklungssensitive“ Gesundheitsförderung durch die Eltern. Minsel (2011) fasst die Bedeutung der Eltern als „einen der wichtigsten Einflussfaktoren für die psychische, soziale und physische Entfaltung des Kindes“ (Minsel, 2011, S. 865) zusammen.
Bereits die Aufzählung verdeutlicht den hohen Anspruch an die elterlichen Kompetenzen, die durch diese Entwicklungsphase eingefordert werden. Zudem sind die elterlichen Ressourcen im Rahmen von veränderten Familienstrukturen zu betrachten (z. B. wachsen Jugendliche mit beiden Elternteilen, mit nur einem Elternteil, in einer Patchwork-Familie auf? Welchen psychosozialen Belastungen sind die Eltern ausgesetzt?), wobei nicht die Art der Familienstruktur, sondern die wahrgenommene Beziehungsqualität und das Gelingen von familiären Prozessen für eine positive Entwicklung des Jugendlichen maßgeblich sind (vgl. Grob & Jaschinski, 2003). Umso relevanter scheint es zu beleuchten, welche Entwicklungsaufgaben die Eltern selbst zum Zeitpunkt der Adoleszenz ihres Kindes zu bewältigen haben und inwieweit sie vor diesem Hintergrund in der Lage sind, den Heranwachsenden angemessen beratend zur Seite zu stehen.
Um Kompetenzen, aber auch Probleme von Eltern in diesem Kontext zu erfassen, befand es Havighurst bereits (1972) als sinnvoll, auch die Entwicklungsaufgaben, die sich den Eltern selbst in dieser Phase stellen, zu reflektieren. Er definierte für das mittlere und spätere Erwachsenenalter folgende Entwicklungsaufgaben für Eltern: Den Eltern obliegt die Aufgabe, den häuslichen Lebensbereich zu gestalten und Kinder auf unterschiedlichem Entwicklungsstand angemessen zu erziehen. Bei jugendlichen Kindern kommt es zu einer Lockerung der Eltern-Kind-Bindung. Die Paarbeziehung der Eltern rückt stärker in den Vordergrund und erfordert zeitweise neue Definitionen. Gleichsam haben die Eltern wieder mehr Zeit für sich zur Verfügung, die es sinnvoll zu gestalten gilt. Die Eltern wenden sich häufig verstärkt den eigenen Eltern zu, die eventuell pflegebedürftig werden. Auch kann der Verlust der eigenen Eltern Trauerprozesse erforderlich machen.
1.2.4 Konfliktthemen und Konfliktmanagement in der Familie
Storch (1994) fand in einer Befragung von Familien heraus, dass Eltern andere Konfliktthemen benennen als die Jugendlichen selbst. Eltern erlebten solche Themen als stärker konfliktbehaftet, die um die Aufrechterhaltung familiärer Strukturen kreisen (z. B. Haushaltspflichten, Medienkonsum, gemein18same Mahlzeiten). Die Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren hingegen benannten häufiger solche Themen als konfliktreich, die ihre eigenen Autonomiebestrebungen betrafen, beispielsweise „Kleidung“, „politische Fragen“, „außerfamiliäre Kontakte“ und „Kaufentscheidungen“. Weiterhin wurden geschlechtsspezifische Unterschiede deutlich. Mädchen benannten stärker Themen wie „Kleidung“ und „gleichgeschlechtliche Freunde“ als Thema, während Jungen eher Themen wie „Kaufentscheidung“ und „Politik“ fokussierten. Hoppig (2001) ermittelte im Rahmen einer Untersuchung zu Eltern-Jugendlichen-Konflikten mittels der Issue-Conflict-Checklist Cologne (ICC) folgende Themen als relevant: Helfen im Haushalt, Zimmer aufräumen, Anziehsachen wegräumen, Streit mit Geschwistern, den Eltern frech antworten, Ausbildung/Zukunftsplanung. Es zeigte sich, dass Themen, über die heftig gestritten wird, auch häufiger diskutiert werden. Vergleichsweise „heftigere“ Diskussionen wurden in der Beziehung der Eltern zu ihren Söhnen gefunden. Jugendliche schätzten ihre Diskussionen mit dem Vater als weniger konflikthaft ein als solche mit der Mutter. Eine mögliche Erklärung zu diesem Sachverhalt könnte sein, dass Mütter sich im Alltag häufiger mit ihren jugendlichen Kindern auseinandersetzen müssen und es ihnen in diesem Kontext auch schlechter gelingt, eine sachliche Diskussion zu führen. Knox et al. (2001) ermittelten Themen über die Jugendliche ihre Eltern am häufigsten belügen. Hier wurden Punkte wie „Aufenthaltsort“, „Freunde“, „Alkoholkonsum“ und „Sexualverhalten“ genannt. Es ist naheliegend, dass Jugendliche bei diesen Themen häufiger lügen, um der elterlichen Kontrolle zu entgehen und Konflikte mit ihren Eltern präventiv zu vermeiden.
Deutsche Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren benannten 2023, erhoben durch das Statista Research Department, folgende Streitthemen als führend gegenüber den Eltern: „Wieviel Zeit ich am Computer verbringe“ (57 %); „Wie lange ich abends wegbleiben darf“ (56 %), „Wofür ich mein Geld ausgebe“ (55 %), „Meine Einstellung zur Schule bzw. Schulnoten“ (49 %), „Wohin ich weggehe“ (36 %) und „Was ich am Computer bzw. im Internet mache“ (33 %), gefolgt von „Wie ich mit meinen Eltern umgehen, mit ihnen rede“ (28 %), „Wie ich mich anziehe“ (28 %), „Ob und wieviel ich TV schaue“ (28 %), „Wieviel Alkohol ich trinke“ (26 %), „über Piercing und Tatoos“ (24 %), „Wie ich mich ernähre“ (22 %); „Gegenseitige Übernachtung bei festem Freund/Freundin“ (21 %); „Welche Freunde ich habe“ (20 %).
Konfliktbewältigung: Die Art und Weise, in der es einer Familie gelingt, Konflikte wahrzunehmen, anzusprechen und konstruktiv zu lösen, kann als ein Bestandteil der allgemeinen Funktionstüchtigkeit des familiären Systems betrachtet werden. Wesentliche Komponenten familiärer Funktionstüchtigkeit sind nach Kaiser (2002) real praktizierte und für die Familienmitglieder verbindliche Werte, Normen und Regeln. Ein Zusammenleben kann nur funktionieren, wenn die Angehörigen genügend übereinander wissen (z. B. über Befinden, Bedürfnisse, Erlebnisse der Familienmitglieder) und dieses Wissen regelmäßig über Kommunikation aktualisiert wird. Gleichsam fließen die elterlichen Modellvorstellungen über Bindung in ihrem Verhalten gegenüber dem Kind ein und bestimmen unter anderem Rituale, Vermächtnisse und Delegationen. Familienmodelle lassen sich danach unterscheiden, ob sie misserfolgs- oder erfolgsorientiert sind. Um konsistentes Handeln und Erleben zu ermöglichen, müssen die Modelle zwischen den Angehörigen möglichst gut abgestimmt und widerspruchsfrei sein. Konstruktive Kommunikations-, Entscheidungs- und Steuerungsfunktionen, unter denen Konfliktbewältigungsstrategien einer Familie einzuordnen sind, stellen unverzichtbare Bestandteile eines ungestörten Familienlebens dar. Insbesondere dem Verhältnis von positiven zu negativen Kommunikationserfahrungen (optimal 5:1) kommt eine wichtige Bedeutung für Beziehungen zu (Gottmann & Silver, 2015), wobei Art und Qualität der Kommunikation in den Herkunftsfamilien ein Modell für die Folgegeneration darstellen und die Generationen sich wechselseitig beeinflussen. Wesentlich für den Erhalt familiärer Funktionstüchtigkeit sind zudem eine sinnvolle Rollen- und Aufgabenverteilung zwischen Partnern, Eltern und Kindern sowie eine mittlere Ausprägung von Grenzen nach außen und zwischen den Subsystemen, die klar und reflektiert in der Familie gehandhabt werden. Schließlich wird die Beziehungsqualität, welche aus einer Vielzahl zeitlich begrenzter Interaktionen zwischen den Familienmitgliedern entsteht und sich durch die Ebenen von Wechselseitigkeit, Macht und Intimität beschreiben lässt, als ein wichtiger Faktor familiärer Funktionsfähigkeit betrachtet. Zudem kommt der Kompetenz der Subsysteme in der Familie (z. B. defizitäre Funktionen der Elterndyade, Geschwisterkonflikte) eine wichtige Bedeutung für das familiäre Funktionieren zu (vgl. Kaiser, 2002).
Ergänzend kann hier eine Studie von Van Dorn et al. (2007) angeführt werden, die im Rahmen einer longitudinalen Untersuchung von 282 Jugendlichen und ihren Eltern mittels Fragebögen einen Zusammenhang zwischen dem ehelichen Konfliktverhalten der Eltern und dem Verhalten der Jugendlichen bei Konflikten mit ihren Eltern herausstellen konnten. Es zeigte sich, dass eine angemessene Konfliktbereitschaft und positives Problemlöseverhalten der Eltern 19im Rahmen der ehelichen Beziehung signifikant verbunden waren mit Konfliktbereitschaft und günstigen Konfliktlösestrategien des Jugendlichen bei Konflikten mit seinen Eltern zwei Jahre später. Hier bestätigt sich die „Spill-over“-Hypothese, die annimmt, dass die Art und Weise wie Partnerschaftskonflikte ausgetragen werden, sich auf die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung auswirkt und somit gegebenenfalls Belastungen von der einen zur anderen Ebene über verschiedene Prozesse „überschwappen“ (vgl. Schneewind et al., 2002) können.
Die Bedeutung von Erziehungsstilen:Baumrind (1991), die sich bereits in den 60er Jahren mit dem Einfluss elterlicher Erziehungsstile auseinandergesetzt hat, erachtete vier elterliche Erziehungsstile als wichtig, die sich hinsichtlich der elterlichen Anforderung und Zuwendung gegenüber dem Kind unterscheiden. Diese Stile wurden in weiteren Studien in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung, insbesondere auf die psychosoziale Anpassung der Kinder und Jugendlichen weiter untersucht. Dieser Zusammenhang lässt sich unter näherer Betrachtung der Rolle von Familienkonflikten folgendermaßen darstellen:
Ein autoritärer Erziehungsstil der Eltern führt dazu, dass sich die Jugendlichen abhängiger, passiver, unsicherer, weniger wissbegierig und weniger sozial-kompetent entwickelten (McClun & Merrell, 1998). Mit strengen Regeln und einer hohen Gehorsamkeitserwartung schränken autoritäre Eltern die Autonomiebestrebungen ihrer Kinder eher ein. Es ist naheliegend, dass Konflikte in einer solchen Familie nicht angesprochen oder durch die Eltern dominant gelöst werden, so dass differenzierte Konfliktbewältigungsstrategien nicht ausreichend vorgelebt und somit auch nicht gelernt werden können.
Jugendliche, deren Eltern einen permissiven Erziehungsstil praktizierten, zeigten sich im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen weniger verantwortungsbewusst und eher daran orientiert, mit anderen konform zu sein. Sie waren nicht in der Lage, Führungspositionen zu übernehmen. Permissive Eltern wurden dadurch beschrieben, dass sie sich bezüglich der Disziplin ihrer Kinder eher passiv verhalten und den Kindern ein hohes Maß an Selbstbestimmung zugestehen. Daraus könnte man schließen, dass Eltern-Kind-Konflikte seltener entstehen, bzw. keine große Spannung entwickeln. Naheliegend ist dann aber auch, dass keine angemessenen Strategien zur Durchsetzung eigener Wünsche und Bedürfnisse erlernt werden, was einerseits zur erhöhten Konformität, aber auch zum verstärkten Einsatz von unangemessenen Strategien führen kann.
Eine noch problematischere Entwicklung haben Kinder von Eltern mit einem indifferenten Erziehungsstil genommen. Diese Jugendlichen zeigen sich impulsiver und häufiger delinquent und experimentieren früher auf den Ebenen von Alkohol, Drogen und Sexualverhalten (Kurdek & Fine, 1994; Steinberg et al., 1994). Da indifferente Eltern in erster Linie das eigene Wohl fokussieren, sich wenig für den Nachwuchs interessieren und darauf bedacht sind, die Erziehungszeit insgesamt zu minimieren, ist es sehr wahrscheinlich, dass Konflikte zwar entstehen, aber nicht hinreichend identifiziert und entfaltet werden. Zudem können die Kinder aus dem inkonsistenten Erziehungsverhalten der Eltern keine Lernerfahrungen hinsichtlich einer sozial-kompetenten Lösungsstrategie ableiten.
Nach Baumrind führt nur der autoritative elterliche Erziehungsstil zu einer gesunden psychosozialen Anpassung der Kinder. Dabei versuchen autoritative Eltern Grenzen gemeinsam mit den Kindern zu bestimmen und diese an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder anzupassen. Konflikte werden in einem solchen Erziehungsmodell angesprochen und in einer problemorientierten Auseinandersetzung mit dem Kind gelöst.
Auch wenn die Kategorisierung von Erzielungsstilen in der Forschung noch kontrovers diskutiert wird, können drei wesentliche Kernelemente im Zusammenhang mit einem autoritativen Erziehungsverhalten benannt werden: (1) Das Ausmaß, in dem der Jugendliche akzeptiert und geliebt wird (Wärme). (2) Das Ausmaß und die Vermittlung von festen Regeln gegenüber dem Jugendlichen (Struktur) (3) Das Ausmaß, indem Eltern die Autonomiebestrebungen ihrer Kinder aktiv unterstützen (Unterstützung von Autonomie). Jugendliche entwickeln in einem solchen Klima größere psychosoziale Fähigkeiten. Sie sind verantwortungsbewusster, selbstsicherer, sozial-kompetenter und wissbegieriger. Sie bewerten die Beziehung zu ihren Eltern langfristig als stabil und positiv (Beyer & Goossens, 1999; Steinberg, 2001; Sun et al., 2000).
Miller et al. (2002) untersuchten die Auswirkungen von elterlichen Erziehungsstilen auf die Reaktion von Jugendlichen gegenüber hypothetischen Konflikten. 439 afro-amerikanische Jugendliche im Alter von 11 bis 14 Jahren wurden hinsichtlich der Wahrnehmung des mütterlichen Erziehungsstils befragt (autoritär, permissiv oder autoritativ) und zudem mit hypothetischen Konfliktsituationen konfrontiert, die nach drei unterschiedlichen Graden der geäußerten Gewalt (keine, mittel, hoch) kategorisiert wurden. Es zeigte sich, dass Jugendliche, die eine permissivere mütter20liche Erziehung wahrnahmen, mehr intensive negative Reaktionen in Konfliktsituationen äußerten, wobei männliche Jugendliche dies deutlich stärker taten als weibliche Befragte.
Schneewind und Böhmert (2016) greifen in ihrem Konzept „Freiheit in Grenzen“ die oben genannten Kernelemente für eine „gute Erziehung“ auf und weisen elterliche Wertschätzung, Fordern und Grenzsetzung sowie Gewähren und Fördern von Eigenständigkeit als günstige Erziehungsprinzipien aus. Die autoritative Erziehung wird als das Erziehungskonzept bewertet, dass sich vor allem für den westlichen Kulturkreis am besten eignet. Während „Freiheit ohne Grenzen“ einen permissiven oder gar vernachlässigenden Erziehungsstil beschreibt, in „Grenzen ohne Freiheit“ ein autoritäres Erziehungsmodell zum Ausdruck kommt, beschreibt das Konzept „Freiheit in Grenzen“ ein demokratisches Erziehungsverständnis, welches sich nicht nur für das Jugendalter als geeignet erwiesen hat. Erziehung gelingt nach diesem Konzept, wenn sich Eltern ihre Erziehungswerte und -ziele vergegenwärtigen und ihr Erziehungsverhalten angemessen darauf abstimmen. Um eine werte- und wachstumsorientierte Erziehung zu gewährleisten, sollen sich Eltern nicht nur als Erziehende und Lehrkräfte, sondern auch als Interaktionspartner (bindungsförderndes Elternverhalten) und „Arrangeure von Entwicklungsangelegenheiten“ sehen, indem sie positive Entwicklungsumwelten für ihre Kinder auswählen und potenziell schädigende Umwelteinflüsse von ihnen abschirmen. Dies kann nur gelingen, wenn die Eltern ein „funktionierendes Erziehungsteam“ sind und sich in Erziehungsfragen um eine hohe Übereinstimmung bemühen. Als für das Jugendalter spezifisch weisen die Autoren in Anlehnung an Thomas Gordon (1982) die Frage aus, „wer (Eltern oder Jugendlicher) eigentlich in bestimmten Situationen ein Problem hat“, um daraus sinnvolles Elternverhalten ableiten zu können. Diese Klärung wird als wichtig erachtet, da es gerade im Jugendalter häufig darum geht, dass Jugendliche eigene Erfahrungen machen, den Konsequenzen ihres Handelns ausgesetzt werden und Eigenverantwortung erlernen. Somit sollten Eltern gut abwägen, ob sie sich in einer vermeintlich kritischen Situation einmischen oder nicht. Entscheiden sich die Eltern dafür, Grenzen zu setzen, werden im Rahmen dieses Konzepts Methoden auf der verbalen Ebene (z. B. klare Aussagen formulieren, begrenzte Wahlmöglichkeiten anbieten) und der Handlungsebene (natürliche, logische Konsequenzen, Auszeit) erörtert, die sich im Jugendalter umsetzen lassen.
1.3 Systemisch-behaviorale Konzepte zur Behandlung von Familienproblemen
Im Folgenden werden die Behandlungsansätze vorgestellt, die für die Entwicklung des vorliegenden Manuals maßgeblich waren. Die theoretische Darstellung der einzelnen Konzepte ist an dieser Stelle sehr knappgehalten, da viele Interventionen konkret im zweiten Kapitel unter Phase 5 (vgl. Kapitel 2.5) praxisnah vorgestellt werden.





























