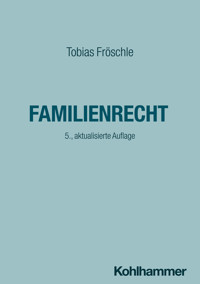
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk bietet einen kompakten, systematischen Einstieg in das deutsche Familienrecht. Es vermittelt die für das Erste Staatsexamen relevanten Grundzüge und ist zugleich eine wertvolle Hilfe für alle, die sich in Ausbildung oder Praxis mit familienrechtlichen Fragen befassen & etwa in der Sozialen Arbeit oder im Jugendamt. Der Text ist bewusst klar und übersichtlich gehalten; umfangreiche Streitfragen werden zugunsten einer schnellen Orientierung zurückgestellt. Die 5. Auflage bringt das Werk auf den neuesten Stand: Berücksichtigt sind die aktuelle Rechtsprechung bis Frühjahr 2025, das Gesetz zur Abschaffung des Güterrechtsregisters, das Selbstbestimmungsgesetz-Geschlecht (SBGG), die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sowie die Änderungen des Namensrechts ab 1. Mai 2025. Zur Vertiefung stehen auf der Verlagshomepage ergänzende Übersichten, weiterführende Hinweise sowie zahlreiche Fälle mit Lösungen zur Verfügung. Damit eignet sich das Buch gleichermaßen für die gezielte Prüfungsvorbereitung wie für den schnellen Zugriff in der Praxis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kompass Recht
herausgegeben von Dieter Krimphove
Familienrecht
von
Professor Dr. Tobias FröschleUniversität Siegen
5., aktualisierte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
5. Auflage 2026
Alle Rechte vorbehalten
© 2026 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN: 978-3-17-043795-1
E-Book-Formate:
pdf: 978-3-17-043796-8
epub: 978-3-17-043797-5
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit dieses Buches wurde auf die explizite Verwendung von männlichen und weiblichen Personenbezeichnungen verzichtet. Alle verwendeten Begriffe gelten gleichermaßen für beide Geschlechter und schließen auch diverse Geschlechtsidentitäten ein.
Dieses Werk bietet einen kompakten, systematischen Einstieg in das deutsche Familienrecht. Es vermittelt die für das Erste Staatsexamen relevanten Grundzüge und ist zugleich eine wertvolle Hilfe für alle, die sich in Ausbildung oder Praxis mit familienrechtlichen Fragen befassen & etwa in der Sozialen Arbeit oder im Jugendamt.
Der Text ist bewusst klar und übersichtlich gehalten; umfangreiche Streitfragen werden zugunsten einer schnellen Orientierung zurückgestellt.
Die 5. Auflage bringt das Werk auf den neuesten Stand: Berücksichtigt sind die aktuelle Rechtsprechung bis Frühjahr 2025, das Gesetz zur Abschaffung des Güterrechtsregisters, das Selbstbestimmungsgesetz-Geschlecht (SBGG), die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sowie die Änderungen des Namensrechts ab 1. Mai 2025.
Zur Vertiefung stehen auf der Verlagshomepage ergänzende Übersichten, weiterführende Hinweise sowie zahlreiche Fälle mit Lösungen zur Verfügung.
Damit eignet sich das Buch gleichermaßen für die gezielte Prüfungsvorbereitung wie für den schnellen Zugriff in der Praxis.
Dr. Tobias Fröschle ist Professor für Bürgerliches Recht mit dem Schwerpunkt Familienrecht an der Universität Siegen.
Inhaltsverzeichnis
VorwortAbkürzungsverzeichnisLiteraturverzeichnis1. Kapitel Einführung und ÜberblickI. FamilienrechtII. FamilienverfahrensrechtIII. Kinder- und Jugendhilferecht2. Kapitel EheschließungI. VerlöbnisII. Ehevoraussetzungen und EhehindernisseIII. Form der EheschließungIV. Aufhebung der fehlerhaften Ehe3. Kapitel Allgemeine EhewirkungenI. Eheliche LebensgemeinschaftII. EhenameIII. Haushaltsführung und FamilienunterhaltIV. Vertretung bei EinwilligungsunfähigkeitV. Weitere vermögensrechtliche EhewirkungenVI. Getrenntleben und seine Folgen4. Kapitel EhegüterrechtI. EhevertragII. ZugewinngemeinschaftIII. GütertrennungIV. GütergemeinschaftV. Gutglaubensschutz bei Eheverträgen5. Kapitel Scheidung und ScheidungsfolgenI. ScheidungII. Ehewohnung und HausratIII. Nachehelicher UnterhaltIV. Versorgungsausgleich6. Kapitel Verwandtschaft und AbstammungI. VerwandtschaftII. MutterschaftIII. VaterschaftIV. Recht auf Kenntnis der eigenen AbstammungV. Unterhalt unter Verwandten7. Kapitel Eltern-Kind-Verhältnis im AllgemeinenI. Name des KindesII. Weitere Wirkungen des Eltern-Kind-Verhältnisses8. Kapitel Elterliche SorgeI. AllgemeinesII. Inhaber der elterlichen SorgeIII. Gemeinsame Ausübung durch beide ElternIV. Ausübung durch DritteV. Ruhen der elterlichen SorgeVI. Beginn und Ende der elterlichen SorgeVII. Personensorge (§§ 1631 bis 1632 BGB)VIII. Vermögenssorge (§§ 1638 bis 1649 BGB)IX. Gesetzliche Vertretung9. Kapitel Schutzmaßnahmen des FamiliengerichtsI. Aufgabenverteilung zwischen Jugendamt und FamiliengerichtII. GefahrenlageIII. Abwehrprimat der ElternIV. VerhältnismäßigkeitV. Einzelne MaßnahmenVI. Überprüfung und Abänderung von Maßnahmen10. Kapitel Umgang und AuskunftI. UmgangsbestimmungsrechtII. Rechtsnatur und Bedeutung des UmgangsrechtsIII. Ausgestaltung und Grenzen des UmgangsIV. AuskunftV. Mitwirkung des Jugendamtes11. Kapitel AdoptionI. AllgemeinesII. Voraussetzungen einer AdoptionIII. Wirkungen der AdoptionIV. Aufhebung der Adoption12. Kapitel Vormundschaft, Betreuung, PflegschaftenStichwortverzeichnisVorwort
Dieses Buch richtet sich an alle, die sich einen ersten Überblick über das deutsche Familienrecht verschaffen wollen oder auch müssen. Es behandelt jedenfalls die in den Prüfungsordnungen für Juristen zum Stoff des Ersten Staatsexamens rechnenden Grundzüge des Familienrechts und reicht zur Prüfungsvorbereitung damit aus. Andererseits kann es jedem, der sich intensiver mit dem Familienrecht befassen muss, zum ersten Einstieg hilfreich sein. Hier sind vor allem auch Nichtjuristen angesprochen, für die das Familienrecht zum Thema ihrer Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit gehört, z. B. Studierende der Sozialen Arbeit.
Der Text ist mit Blick auf die Übersichtlichkeit bewusst knappgehalten. Auf die ausführliche Darstellung von Meinungsstreitigkeiten wird verzichtet. Ergänzende Hinweise sind in den Übersichten im Download-Material auf der Seite www.kohlhammer.de (unter diesem Titel) enthalten, außerdem zahlreiche Fälle mit Lösungen.
Da die Rolle des Jugendamtes in der Praxis des Familienrechts von erheblicher Bedeutung ist, kommt eine Darstellung des Familienrechts nicht ohne Bezüge zum Jugendhilferecht aus, die im Text bewusst knappgehalten sind und im Download-Material durch zwei Exkurse und in einigen Übersichten noch etwas mehr vertieft werden.
Die 5. Auflage berücksichtigt die Weiterentwicklung der Rechtsprechung seit Frühjahr 2019, z. B. zur Vertretung des Kindes durch nur einen Elternteil bei rechtlicher Verhinderung des anderen oder auch zur Reduzierung des Erwerbstätigenbonus im Unterhaltsrecht von 1/7 auf 10 %. Mit der großen Reform des Familienrechts ist es ja durch die vorzeitige Auflösung des Bundestages zur Jahreswende 2024/25 nicht mehr gekommen. Zu berücksichtigen waren aber das Gesetz zur Abschaffung des Güterrechtsregisters, das Selbstbestimmungsgesetz-Geschlecht (SBGG) und vor allem die große Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts. Ebenfalls schon berücksichtigt sind die am 1. Mai 2025 in Kraft tretenden Änderungen des Namensrechts.
Für die wertvolle Hilfe bei der Zusammenstellung des Buches, vor allem für die Graphiken im Download-Material, bin ich Frau Julia Bartkowski zu Dank verpflichtet. Für die Hilfe bei der Überarbeitung des Buches für die 5. Auflage danke ich Frau Meryem Bakici herzlich.
Siegen, August 2025Tobias Fröschle
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
BeckOK BGB/Bearbeiter, Beck’scher Online-Kommentar zum BGB, Band 3: Sachenrecht (§§ 854–1296 BGB): Stand 1.11.2024
MüKo.BGB/Bearbeiter, Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 8: Familienrecht I (§§ 1297–1588, Gewaltschutzgesetz, VersAusglG, LPartG), 8. Auflage 2019, Band 9: Familienrecht II (§§ 1589–1921, SGB VIII), 7. Auflage 2017
Staudinger/Bearbeiter, J. von Staudingers Kommentar zum BGB, §§ 1363 bis 1563: Neubearbeitung 2017, §§ 1626 bis 1633: Neubearbeitung 2015
Prütting/Helms, Prütting/Helms, FamFG, Kommentar mit FamGKG, 6. Aufl. 2023
Übersicht Piktogramme
Prüfungstipps für Studenten
Tipps für Praktiker
Weiterführender bzw. ergänzender Text als Download-Datei
Inhalt des Download-Materials:
– Gesetzestexte
– Gerichtsentscheidungen
– Exkurse zu
– Hilfen für Minderjährige (§§ 27–40 SGB VIII)
– Schutzmaßnahmen des Jugendamtes
– Multiple-Choice-Test
– Übersichten
– Statische und interaktive Fälle
Download des o. g. Materials unter https://dl.kohlhammer.de/978-3-17-043795-1
1. KapitelEinführung und Überblick
I.Familienrecht
1Das Familienrecht beruht auf dem Gedanken, dass man zwischen Menschen, die einander besonders nahestehen und füreinander in besonderer Weise Verantwortung tragen, nicht einfach die allgemeinen Regeln des Schuld- und Sachenrechtes anwenden kann, ohne der Besonderheit ihrer Beziehung Rechnung zu tragen. Das ist auch ein Verfassungsgebot, da „Ehe und Familie“ nach Art. 6 Abs. 1 GG unter dem „besonderen Schutz“ der Rechtsordnung stehen sollen. Natürlich suspendiert die familiäre Zusammengehörigkeit die ersten drei Bücher des BGB nicht, aber die Intensität der tatsächlichen Beziehungen von Familienangehörigen untereinander erfordert eine Modifikation dieser Regeln.
2Hierzu definiert das Gesetz eine Reihe von Rechtsinstituten des Familienrechtes und unterwirft sie besonderen Vorschriften. Das meiste davon findet sich im Vierten Buch des BGB (§§ 1297 bis 1888 BGB) wieder, das auch die Überschrift „Familienrecht“ trägt.
3Als Rechtsinstitute des Familienrechts sind anerkannt:
– die Ehe (§§ 1297 bis 1588 BGB)
– die Verwandtschaft (§§ 1589 bis 1772 BGB), innerhalb derer das Eltern-Kind-Verhältnis den Hauptteil der Regelungen einnimmt
– die familienrechtlichen Fürsorgeverhältnisse: die Vormundschaft, die Betreuung und die verschiedenen Formen der Pflegschaft (§§ 1773 bis 1888 BGB).
4Vor dem 01. Oktober 2017 konnten gleichgeschlechtliche Paare, denen die Ehe bis dahin verschlossen war, eine Lebenspartnerschaft eingehen. Neu begründet werden können solche Lebenspartnerschaften seither nicht mehr (§ 1 S. 1 LPartG), bestehende können in Ehen umgewandelt werden (§ 20a LPartG), müssen dies aber nicht. Da es sich also um ein auslaufendes Rechtsinstitut handelt und die Unterschiede zwischen der Ehe und der Lebenspartnerschaft ziemlich gering und zudem seither noch weiter verringert worden sind, werden sie in diesem Buch nicht mehr näher behandelt. Ein Plan der Bundesregierung, ein neues familienrechtliches Rechtsinstitut derVerantwortungsgemeinschaft einzuführen, ist nicht mehr verwirklicht worden.
5Das deutsche Familienrecht enthält also keine Vorschriften über das Zusammenleben Erwachsener als Paar ohne Trauschein. Wird von zwei Menschen eine umfassende Lebensgemeinschaft begründet, ohne dass sie einander heiraten, bleibt es für sie bei der Anwendung der ersten drei Bücher des BGB. Wird eine solcheeheähnliche Lebensgemeinschaft aufgelöst, richtet sich ihre Auseinandersetzung daher nach den Vorschriften des Schuld- und Sachenrechtes. Ein Vermögensausgleich wird hierbei, wenn überhaupt, auf § 313 BGB, §§ 705 ff. BGB oder § 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 BGB gestützt vorgenommen. Da dies nicht unmittelbar zum Familienrecht zählt, soll es hier nicht weiter vertieft werden.
Übersicht 1: Auseinandersetzung der eheähnlichen Lebensgemeinschaft
II.Familienverfahrensrecht
6Das Familienverfahrensrecht ist in einem eigenständigen Gesetz, dem FamFG, geregelt. Meist, aber keineswegs durchgehend, ist für Streitigkeiten innerhalb der Familie dasFamiliengericht zuständig. Mit geregelt ist in diesem Gesetz ferner die sog. Freiwillige Gerichtsbarkeit, deren Gegenstände vielfältig sind und zum Teil ebenfalls mit dem Familienrecht zu tun haben, zum Teil aber auch völlig andere Rechtsgebiete betreffen.
Neben einem Allgemeinen Teil (1. Buch, §§ 1 bis 110 FamFG), mit dem der Gesetzgeber versucht hat, das Verfahren der Familiengerichte und der Freiwilligen Gerichtsbarkeit auf einen groben gemeinsamen Nenner zu bringen, beschreibt ein 2. Buch (§§ 111 bis 270 FamFG) das Verfahren in einzelnen Familiensachen. Für einige davon (sog. Familienstreitsachen, § 112 FamFG) soll das Gericht aber doch überwiegend Zivilprozessrecht anwenden.
Auch das 3. Buch (Betreuungs-, Unterbringungs- und betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen, §§ 271 bis 341 FamFG) betrifft noch Gegenstände des Familienrechts.
7Besonders übersichtlich ist dies nicht. In diesem Buch wird Verfahrensrecht nicht weiter behandelt werden.
III.Kinder- und Jugendhilferecht
8Es existieren zahllose Berührungspunkte und Verzahnungen zwischen dem im Achten Buch des Sozialgesetzbuchs geregelten Jugendhilferecht und dem Familienrecht. Nur theoretisch kann man beides streng trennen. Am praktischen Fall muss sich beides nebeneinander bewähren, weswegen ich in diesem Buch an einigen Stellen nicht ohne Seitenverweise auf das Jugendhilferecht auskomme. Mehr davon findet sich im Download-Material.
Die Schnittstellen können an folgendem Fall verdeutlicht werden:
9Beispiel:
Ein zwölfjähriges Kind hält es im Haushalt seiner Alkoholiker-Eltern nicht mehr aus und bittet das Jugendamt um Einweisung in ein Heim. Das Jugendamt veranlasst dies als Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VIII. Es bietet den Eltern an, ihnen die Heimerziehung als Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 34 SGB VIII zu gewähren. Die Eltern sind damit überhaupt nicht einverstanden. Sie beantragen stattdessen, ihnen eine sozialpädagogische Familienhilfe (§§ 27, 31 SGB VIII) zu gewähren. Das Jugendamt hält das Kind aber im Fall einer Rückkehr ins Elternhaus für gefährdet. Es ist dann nach § 42 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 SGB VIII verpflichtet, das Familiengericht einzuschalten. Das Familiengericht wird prüfen, ob es auf der Grundlage von § 1666 Abs. 1 BGB Eingriffe in die elterliche Sorge oder sogar ihren Entzug (§ 1666 Abs. 3 Nr. 6 BGB) für notwendig hält. Es muss dabei nach § 1666a Abs. 1 S. 1 BGB wieder prüfen, ob öffentliche Hilfen – wie z. B. die von den Eltern beantragte sozialpädagogische Familienhilfe – zur Abwendung der Gefahr ausreichen. Ggf. wird es ihnen die elterliche Sorge entziehen und wegen § 1773 Abs. 1 BGB einen Vormund bestellen. Dann kann das Jugendamt diesem Vormund die Heimerziehung als Hilfe zur Erziehung gewähren. Vormund wiederum kann nach § 1774 Abs. 1 Nr. 4 BGB und § 55 Abs. 1 SGB VIII das Jugendamt selber sein. Umgekehrt können die Eltern sich gegen die Versagung der sozialpädagogischen Familienhilfe auch mit den Mitteln des Verwaltungsverfahrensrechts (hier: Widerspruch und Verpflichtungsklage, Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 VwGO) wehren, wenn sie der Meinung sind, dass dies zur Abwendung der Gefahr hinreichend und notwendig ist.
10Der mit einem solchen praktischen Fall befasste Rechtsanwalt oder Sozialarbeiter kommt also nicht umhin, die entsprechenden Rechtsgrundlagen im Familienrecht und im Jugendhilferecht aufzufinden und anzuwenden.
2. KapitelEheschließung
I.Verlöbnis
11Das Verlöbnis (§§ 1297 ff. BGB) ist ein Vertrag, durch den sich zwei Menschen wechselseitig versprechen, einander zu heiraten. Sein Zustandekommen ist nicht besonders geregelt, richtet sich also grundsätzlich nach §§ 145 ff. BGB.
Das Verlöbnis ist daher an keine bestimmte Form gebunden. Es ist aber ein höchstpersönliches Rechtsgeschäft. Ein Vertreter – auch der gesetzliche Vertreter – kann nicht für einen der Beteiligten handeln.
12Ob sichMinderjährige trotz § 1303 Satz 1 BGB die Ehe wirksam versprechen können, ist zweifelhaft. Auf keinen Fall können sie sich die Eheschließung für einen Zeitpunkt vor Erreichen der Volljährigkeit versprechen und aus der § 1303 Satz 2 BGB zugrundliegenden Wertung dürfte folgen, dass ein vor dem 16. Geburtstag abgegebenes Eheversprechen ganz unwirksam ist. Soweit man ein Verlöbnis unter Minderjährigen für möglich hält, ist dies wegen der Sekundäransprüche aus § 1298 f. BGB kein ausschließlich vorteilhaftes Geschäft und bedarf daher nach § 107 BGB der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.
13Das Versprechen einer Ehe kann wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig sein, so z. B., wenn zwei Personen einander in dem Bewusstsein die Ehe versprechen, dass einer von ihnen noch immer verheiratet ist.
14Das Verlöbnis begründet die Rechtspflicht zur Eheschließung in Form einer unvollkommenen Verbindlichkeit. Weder ist sie direkt durchsetzbar – eine Klage auf Eingehung der Ehe ist unzulässig (§ 1297 Abs. 1 BGB) – noch kann eine Vertragsstrafe wirksam vereinbart werden (§ 1297 Abs. 2 BGB).
Durch das Verlöbnis entsteht aber ein Dauerrechtsverhältnis, das wechselseitige Beistands- und Rücksichtnahmepflichten begründet, wenn auch in geringem Umfang. So sind Verlobte einander zwar nicht zum Unterhalt verpflichtet, wohl aber dazu, die persönlichen Rechtsgüter des anderen vor Gefahren zu schützen, so dass sie als Beschützergaranten i. S. v. § 13 StGB angesehen werden. Auch beinhaltet das Verlöbnis eine – wenn auch so wenig wie die Eheschließungspflicht durchsetzbare – Pflicht zur sexuellen Treue. Eine Pflicht zur umfassenden Lebensgemeinschaft ist mit dem Verlöbnis dagegen nicht verbunden. In einigen Zusammenhängen gelten Verlobte kraft gesetzlicher Regelung als Angehörige (z. B. im Strafrecht – siehe § 11 Abs. 1 Nr. 1a StGB).
15Das Verlöbnis wirdaufgelöst durch
– Eheschließung (= Erfüllung des Versprechens),
– Tod eines Verlobten,
– einvernehmliche Aufhebung durch Vertrag („Entlobung“), oder
– einseitigen Rücktritt.
16Zurücktreten und die Verlobung einvernehmlich aufheben kann der minderjährige Verlobte trotz § 107 BGB ohne Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Zwar ist mit ihm ein Rechtsnachteil verbunden, weil der Minderjährige den Anspruch auf Eheschließung gegen den anderen Verlobten verliert. Er muss das Verlöbnis aber schon deshalb ohne Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters auflösen können, weil er sonst ja gegen seinen Willen an der Eheschließungspflicht festgehalten würde.
17Die Möglichkeit zum jederzeitigen Rücktritt schließt die Anfechtung wegen Irrtums, Drohung oder Täuschung (§§ 119 ff. BGB) aus. Wer durch Drohung oder Täuschung zur Verlobung bestimmt wurde, hat jedenfalls einen wichtigen Grund zum Rücktritt. Bei einem Irrtum wird das davon abhängen, ob er vermeidbar war.
18Wer ohne wichtigen Grund vom Verlöbnis zurücktritt, schuldet dem anderen Verlobten Schadensersatz (§ 1298 Abs. 1 BGB), in Grenzen auch dessen Eltern oder Personen, die an Elternstelle gehandelt haben.
Nur der Vertrauensschaden (= negatives Interesse) ist zu ersetzen, also der Schaden, der durch das Vertrauen auf die Eheschließung entstanden ist, nicht der, der durch deren Unterbleiben entstanden sein mag. Kein Vertrauensschaden i. S. v. § 1298 BGB sind Aufwendungen, die durch eine außereheliche Lebensgemeinschaft der Verlobten entstanden sind, wenn diese – wie heute meistens – nicht von der späteren Eheschließung abhängig sein sollten. Durch ein solches voreheliches Zusammenleben wird dann nämlich die Ehe nicht vorbereitet, sondern vorweggenommen. Das tut jeder auf eigenes Risiko.
Der Verlobte kann auch einen eventuellen Erwerbsschaden ersetzt verlangen. Das ist heute sehr selten, weil kaum mehr jemand im Hinblick auf eine Eheschließung die Arbeitsstelle aufgibt und selbst wenn, wird es oft nicht angemessen i. S. v. § 1298 Abs. 2 BGB sein.
Entscheidung Nr. 1
19Nach § 1298 Abs. 3 BGB schuldet keinen Schadensersatz, wer einen wichtigen Grund für den Rücktritt hatte. Als wichtige Gründe sind z. B. anerkannt worden:
– eigene Krankheiten ebenso wie solche des anderen Verlobten, wenn sie für eine Ehe relevant sind (wie z. B. zur Unfruchtbarkeit führende oder Geschlechtskrankheiten),
– Untreue, Misshandlung oder andere Verfehlungen,
– die Täuschung über persönliche oder über Vermögensverhältnisse.
20Kein wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes ist dagegen erlahmte Zuneigung, die Erkenntnis, dass man nicht zusammenpasst oder Ähnliches. Das ist zwar eigentlich der beste Grund nicht zu heiraten, wenn dergleichen aber unter § 1298 Abs. 3 BGB fiele, gäbe es praktisch keinen grundlosen Rücktritt. Dies ist eben das Risiko, das man mit dem bindenden Eheversprechen eingeht.
Einen wichtigen Grund für den Rücktritt stellt es dagegen dar, wenn nachträglich ein Ehehindernis eingetreten ist.
21Schadensersatz schuldet nach § 1299 BGB ferner, wer den wichtigen Grund, aus dem der andere zurücktritt, schuldhaft herbeigeführt hat (§ 1299 BGB). So schuldet z. B. der untreue Partner Schadensersatz, wenn der andere die Untreue zum Grund nimmt, zurückzutreten. § 1299 BGB ist analog anwendbar, wenn ein Verlobter aus einem wichtigen Grund zurücktritt, den er selbst schuldhaft herbeigeführt hat. Wenn z. B. ein Verlobter sich anlässlich eines Seitensprungs mit HIV infiziert, gibt ihm das zwar einen wichtigen Grund für den Rücktritt. Er muss aber analog § 1299 BGB dennoch Schadensersatz leisten, weil er seinen eigenen Rücktrittsgrund schuldhaft herbeigeführt hat.
22§ 1298 Abs. 1 BGB gilt außerdem analog zum Nachteil eines Verlobten, der auf andere Weise als durch Rücktritt die Eheschließung schuldhaft vereitelt, z. B., indem er den Tod des anderen Verlobten fahrlässig herbeiführt oder – ohne vorher zurückzutreten – einen Dritten heiratet.
23Wird das Verlöbnis aufgelöst, sind außerdemGeschenke zurückzugewähren, die der eine Verlobte dem anderen gemacht hat (§ 1301 S. 1 BGB). Der Anspruch setzt nur voraus, dass das Geschenk während der Zeit gemacht wurde, in der das Verlöbnis bestand. Ein innerer Zusammenhang zur erwarteten Eheschließung ist nicht erforderlich. Der Anspruch wird dennoch als Sonderfall der condictio ob rem (§ 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 BGB) begriffen. §§ 815, 818 ff. BGB sind auf ihn anwendbar.
24Wird die Verlobung durch Tod aufgelöst, schwächt das die Rückgabepflicht für Geschenke ab. Es müssen dann nur die Geschenke zurückgegeben werden, von denen der Schenker eben dies nachweisbar wollte. Im Zweifel wird nach § 1301 S. 2 BGB das Gegenteil angenommen.
Bei der Prüfung von Ansprüchen aus Verlöbnis ist das Augenmerk nicht nur auf dessen Auflösung zu richten. Oft ist seine Begründung schwerer zu beurteilen. Sie setzt vor allem – wie jeder Vertrag – einen Rechtsbindungswillen voraus. Obwohl das Verlöbnis an keine Form gebunden ist, kann die Frage, in welcher Form die Einigung stattgefunden hat, genau hierfür eine Rolle spielen. Der Austausch von Verlobungsringen, das Abhalten einer Verlobungsfeier, ein förmlicher Antrag mit Kniefall usw. können als Zeichen für die Ernsthaftigkeit des Eheversprechens wichtig sein.
II.Ehevoraussetzungen und Ehehindernisse
25Ehevoraussetzungen sind
– Ehemündigkeit (§ 1303 BGB) und
– Geschäftsfähigkeit (§ 1304 BGB).
26Als Ehehindernisse kommen in Frage
– eine bestehende Ehe (§ 1306 BGB) oder
– eine Verwandtschaft der Partner (§§ 1307, 1308 BGB).
27Je nach den eintretendenRechtsfolgen unterscheidet man:
– Fehler, die zur Unwirksamkeit der Ehe führen (= Nichtehe, unwirksame Ehe)
– Fehler, die nach § 1314 Abs. 1 BGB einen Aufhebungsgrund bilden (= fehlerhafte Ehe)
– Fehler, bei denen der Verstoß ohne Folgen bleibt (= Ordnungsvorschriften)
28Ehemündig ist, wer volljährig ist (§ 1303 S. 1 BGB). Fehlende Ehemündigkeit führt an und für sich nur zur Fehlerhaftigkeit der Ehe (siehe § 1314 Abs. 1 Nr. 1 BGB). Aus § 1303 S. 2 BGB folgt jedoch, dass die Ehe mit einem noch nicht 16 Jahre alten Kind unwirksam (Nichtehe) ist.
29Geschäftsfähigkeit wird bei Personen ab sieben Jahren (siehe § 104 Nr. 1 BGB) vorausgesetzt. Geschäftsunfähig ist nach § 104 Nr. 2 BGB, wer sich in einem die freie Willensbestimmung nicht nur vorübergehend ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet. Ein freier Wille setzt Einsichts- und Steuerungsfähigkeit voraus. An die Einsichtsfähigkeit dürfen hier im Lichte der aus Art. 6 Abs. 1 GG folgenden Eheschließungsfreiheit keine hohen Anforderungen gestellt werden. Es genügt, wenn jemand im Wesentlichen verstanden hat, was eine Eheschließung bedeutet. Fehlende Geschäftsfähigkeit macht die Ehe fehlerhaft (s. § 1314 Abs. 1 Nr. 2 BGB).
Entscheidung Nr. 2
30Die Ehe schließt es ihrem Wesen nach aus, dass ein Mensch in mehreren Ehen gleichzeitig lebt. Daher verbietet § 1306 BGB die Eheschließung jedem, der bereits verheiratet ist. Das ist darüber hinaus als Doppelehe auch strafbar (§ 172 StGB).
Eine entgegen § 1306 BGB begründete Ehe ist fehlerhaft (§ 1314 Abs. 1 BGB).
Den Sonderfall der Wiederheirat, nachdem der frühere Ehegatte (zu Unrecht) amtlich für tot erklärt wurde, regeln die §§ 1319, 1320 BGB. Heiratet der Ehegatte wieder, obwohl weder er noch sein neuer Ehegatte wusste, dass sein früherer Ehegatte noch lebt, so löst dies die alte Ehe auf (§ 1319 Abs. 2 BGB). Auch die neue Ehe ist fehlerhaft, doch kann in diesem Falle nur der neu Verheiratete ihre Aufhebung beantragen (§ 1320 BGB). Wusste einer von beiden, dass der frühere Ehegatte noch lebt, bleibt es bei den gewöhnlichen Folgen einer Doppelehe.
31EngeVerwandte dürfen einander nicht heiraten (§ 1307 S. 1 BGB). Verboten ist das bei Verwandtschaft in gerader Linie (vgl. zu dieser Rn. 201) und zwischen voll- und halbbürtigen Geschwistern. Maßgeblich ist die Blutsverwandtschaft (§ 1307 S. 2 BGB). Nicht die Eheschließung, wohl aber der Geschlechtsverkehr unter Verwandten gerader Linie und unter Geschwistern ist auch strafbar (§ 173 StGB).
Auch eine entgegen § 1307 BGB geschlossene Ehe ist fehlerhaft (§ 1314 Abs. 1 Nr. 2 BGB).
32Adoptivverwandtschaft steht nach § 1308 Abs. 1 S. 1 BGB einer Eheschließung ebenfalls im Wege. Die Grenzen sind die gleichen wie unter Blutsverwandten.
Vom Verbot der Eheschließung unter Adoptivgeschwistern kann das Familiengericht auf Antrag eines der Geschwister Befreiung erteilen (§ 1308 Abs. 2 BGB). Adoptivverwandte in gerader Linie müssen dagegen die Aufhebung der Adoption erreichen, damit sie einander heiraten dürfen (vgl. § 1308 Abs. 1 S. 2 BGB).
§ 1308 BGB ist lediglich Ordnungsvorschrift.
Der Standesbeamte ist verpflichtet, seine Mitwirkung an der Eheschließung zu verweigern, wenn er ein Ehehindernis kennt oder weiß, dass die Ehe nach § 1314 Abs. 2 BGB aufhebbar wäre (vgl. § 1310 Abs. 1 S. 2 BGB). Oft kann ein Dritter gegen die einmal geschlossene Ehe nicht mehr viel unternehmen. Es kann daher wichtig sein, das Standesamt schon vor der Eheschließung über Bedenken z. B. an der Geschäftsfähigkeit eines Ehegatten zu informieren.
III.Form der Eheschließung
33Die Form der Eheschließung regeln die §§ 1310 bis 1312 BGB:
§ 1310 Abs. 1 S. 1 BGB schreibt die Eheschließung vor dem Standesbeamten vor (obligatorische Zivilehe). Wie aus § 1310 Abs. 1 S. 2 BGB folgt, muss der Standesbeamte hieran „mitwirken“, das heißt, er muss zur Entgegennahme der Eheschließungserklärung auch bereit sein, andernfalls die Ehe nicht „vor“ ihm geschlossen worden ist.
Durch eine Eheschließung, die dem nicht genügt, wird keine Ehe begründet. Die Erklärung ist dann ohne weiteres unwirksam (Nichtehe). Das gilt jedoch ausnahmsweise nicht, wenn
– die Ehe vor einer Person geschlossen wurde, die beide Eheschließenden für einen Standesbeamten gehalten haben, und diese Person die Eheschließung in das Eheregister eingetragen hat (§ 1310 Abs. 2 BGB) oder
– der Standesbeamte bestimmte Amtshandlungen vorgenommen hat, die eine Ehe voraussetzen und die Eheschließenden nach dieser Rechtshandlung zehn Jahre als Eheleute zusammengelebt haben. Haben sie bis zum Tod eines von ihnen zusammengelebt, genügen fünf Jahre (§ 1310 Abs. 3 BGB).
In diesen Fällen ist die Ehe von Anfang an als wirksam anzusehen. Der Formfehler wird dadurch also rückwirkend geheilt.
34Die Eintragung in das Eheregister wirkt nur in den in § 1310 Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 1 BGB geregelten Fällen konstitutiv. Wenn § 1310 Abs. 1 S. 1 BGB beachtet wurde, hat sie nur deklaratorischen Charakter.
35§ 1311 BGB schreibt die gleichzeitige, persönliche Anwesenheit beider Eheschließenden vor dem Standesbeamten vor.
Wird hiergegen verstoßen, ist die Ehe fehlerhaft (vgl. § 1314 Abs. 1 Nr. 2 BGB).
36Die Vorschrift des § 1312 S. 1 BGB über die zu verwendende Trauformel ist nur Ordnungsvorschrift. Eine Ehe kommt nur dann nicht zustande, wenn einer der Eheschließenden überhaupt keine Zustimmung erklärt hat.
Die Hinzuziehung von Trauzeugen stellt § 1312 S. 2 BGB den Eheschließenden überhaupt frei.
IV.Aufhebung der fehlerhaften Ehe
37Eine fehlerhafte Ehe kann aufgehoben werden. Fehlerhaft ist sie:
– wenn es an einer der Ehevoraussetzungen aus §§ 1303 Satz 1, 1304 BGB fehlt
– wenn eines der Ehehindernisse aus §§ 1306, 1307 BGB vorliegt,
– wenn ein für tot erklärter früherer Ehegatte doch noch lebt (siehe § 1320 BGB)
– wenn gegen die Formvorschrift des § 1311 BGB verstoßen wurde und
– im Übrigen, wenn einer der in § 1314 Abs. 2 BGB aufgezählten Willensmängel vorliegt.
38Die Aufzählung der Aufhebungsgründe ist abschließend. Die §§ 104 ff. BGB gelten für die Eheschließung nicht. Die nach § 1314 Abs. 2 BGB beachtlichen Willensmängel sind:
1.Unzurechnungsfähigkeit
39Eine Ehe, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit (z. B. im Vollrausch) geschlossen wurde, ist nach § 1314 Abs. 2 Nr. 1 BGB aufhebbar.
2.Irrtum
40Fehlerhaft ist die Ehe ferner, wenn einer der Ehegatten nicht gewusst hat, dass es sich um eine Eheschließung handelt, also bei seiner Erklärung einem Inhaltsirrtum unterlag (§ 1314 Abs. 2 Nr. 2 BGB). Andere – sonst beachtliche – Irrtümer bedingen hier keine Fehlerhaftigkeit.
3.Arglistige Täuschung
41Aufhebbar ist nach § 1314 Abs. 2 Nr. 3 BGB eine Ehe, die auf einer arglistigen Täuschung des einen durch den anderen Ehegatten beruht. Die Täuschung eines Dritten genügt nur, wenn der andere Ehegatte von ihr wusste.
Es muss feststehen, dass der Getäuschte die Ehe nicht geschlossen hätte, wenn er die Wahrheit gekannt hätte (subjektive Kausalität). Das muss wiederum einer verständigen Würdigung des Wesens der Ehe standhalten (objektive Kausalität). Die Täuschung über Vermögensverhältnisse (also der klassische „Heiratsschwindel“) ist ausdrücklich ausgenommen.
Auch durch Unterlassen kann man arglistig täuschen, soweit eine Pflicht zur Offenbarung bestimmter Umstände besteht (arglistiges Verschweigen). Offenbart werden müssen alle Umstände, die für die Entscheidung des anderen zur Eheschließung erkennbar von erheblicher Bedeutung sind. Das wird zum Beispiel für die Infektion mit einer durch sexuelle Handlungen übertragbaren Krankheit angenommen. Aber auch, ob – und ggf. von wem – die Frau schwanger ist, gehört wegen § 1592 Nr. 1 BGB zu den offenbarungspflichtigen Umständen, wenn sie heiratet.
Arglist (lat.: dolus) ist ein Synonym für Vorsatz. Bedingter Vorsatz genügt. Verbreiteter Fehler unter Studenten ist es, Arglist mit besonderer Verwerflichkeit des Verhaltens gleichzusetzen.
42Beispiel:
Max heiratet seine Freundin Lisa, weil sie schwanger ist. Später stellt sich heraus, dass sie während der Empfängniszeit des Kindes auch mit Stefan geschlafen hat.
Hier ist Max arglistig getäuscht worden und zwar unabhängig davon, von wem das Kind tatsächlich stammt. Denn da das Kind ihm allein wegen seiner Geburt während der Ehe zugeordnet wird (§ 1592 Nr. 1 BGB) kann er erwarten, dass Lisa ihn auch schon über die Möglichkeit aufklärt, dass das Kind von einem anderen Mann stammt (vgl. OLG Karlsruhe NJW-RR 2000, 737).
4.Drohung
43Die Ehe ist fehlerhaft, wenn ein Ehegatte – oder gar beide – durch widerrechtliche Drohung dazu gebracht wurde, sie zu schließen (§ 1314 Abs. 2 Nr. 4 BGB). Im Unterschied zur Täuschung genügt es hier auch, wenn ein Außenstehender den einen Verlobten ohne Wissen des anderen bedroht hat. Widerrechtlich ist die Drohung unter den gleichen Umständen, unter denen das auch zu § 123 Abs. 1 BGB angenommen wird (Verwerflichkeit entweder des verwendeten Druckmittels oder des Einsatzes des Druckmittels zu diesem Zweck). Die Androhung eines Nachteils ist nicht in jedem Falle verwerflich. Z.B. ist eine Ehe nicht aufhebbar, wenn sie einer der Ehegatten nur geschlossen hat, weil der andere ansonsten die Geltendmachung von Ansprüchen aus §§ 1298, 1301 BGB angekündigt hat.
Dass das Gesetz Zwangsehen als lediglich fehlerhaft behandelt, ist rechtspolitisch nicht ganz unproblematisch. Die Nötigung zur Eheschließung ist für den Nötigenden als Zwangsheirat strafbar (§ 237 StGB).
Für das Opfer einer Zwangsverheiratung ist die Scheidung wegen der Rechtsfolgen oft besser als die Aufhebung der Ehe. Da nur der Bedrohte den Aufhebungsantrag stellen kann, besteht hier ein echtes Wahlrecht, falls nicht beide Ehegatten zur Eheschließung genötigt wurden.
5.Scheinehe
44Aufhebbar ist nach § 1314 Abs. 2 Nr. 5 BGB schließlich eine Ehe, die nur zum Schein geschlossen worden ist. Eine Scheinehe schließen Ehegatten, wenn beide bei der Eheschließung sich darin einig waren, keine eheliche Lebensgemeinschaft aufnehmen zu wollen. Die Absicht, als Ehegatten zusammenzuleben, genügt, um eine Scheinehe auszuschließen, auch wenn die Verwirklichung dieser Absicht unrealistisch ist. Wer einen zu lebenslanger Haft verurteilten Massenmörder heiratet, schließt also keine Scheinehe, nur weil eine Haftentlassung nicht zu erwarten ist.
45Die fehlerhafte Ehe kann in bestimmten Fällen durch den Eintritt bestimmter Umstände geheilt werden. Die Einzelheiten sind in § 1315 BGB geregelt. Sie unterscheiden sich je nach Aufhebungsgrund.
Übersicht 2: Heilung von aufhebbaren Ehen, Antragsberechtigte, Antragsfrist
46Eine fehlerhafte Ehe ist in jeder Hinsicht wirksam, solange sie nicht durch rechtskräftigen Beschluss des Familiengerichts aufgehoben ist (vgl. § 1313 BGB). Bis dahin gelten die § 1353 ff. BGB einschließlich der das Getrenntleben regelnden §§ 1361 bis 1361b BGB.
Die Aufhebung entfaltet keine Rückwirkung. Ist die Ehe schon durch Tod oder Scheidung aufgelöst, ist daher auch keine Aufhebung mehr möglich (§ 1317 Abs. 3 BGB). Die Aufhebung der Ehe geht der Scheidung aber vor, wenn beides beantragt wird (§ 126 Abs. 3 FamFG).
War die Ehe beim Tod eines Ehegatten (noch) aufhebbar, entfällt nach § 1318 Abs. 5 FamFG das gesetzliche Erbrecht des überlebenden Ehegatten, falls einer der dort genannten Aufhebungsgründe bestand und der überlebende Ehegatte ihn kannte. War der Aufhebungsantrag schon gestellt, gilt außerdem § 1933 BGB.
47Wer zur Stellung des Aufhebungsantrags berechtigt ist, regeln §§ 1316, 1320 S. 1 BGB, auch hier in Abhängigkeit vom Aufhebungsgrund. In manchen – nicht allen – Fällen ist der Antrag an eine Ausschlussfrist gebunden (§§ 1317, 1320 S. 2 BGB).
Prüfungsreihenfolge bei der Eheaufhebung:
– Aufhebungsgrund (§ 1314 BGB)
– kein Wegfall des Aufhebungsgrundes durch Heilung (§ 1315 BGB)
– Aufhebungsrecht des Antragstellers (§ 1316 BGB)
– Einhaltung der Aufhebungsfrist (§ 1317 BGB)
48Die vermögensrechtlichen Folgen der Eheaufhebung regelt § 1318 Abs. 1 bis 4 BGB:
Nachehelicher Unterhalt wird nur nach Maßgabe von § 1318 Abs. 2 BGB gewährt. § 1318 Abs. 2 S. 1 BGB macht dies in komplexer und nicht völlig logischer Weise davon abhängig, welcher Aufhebungsgrund bestand und wer ihn kannte. Wäre danach einem Ehegatten, der ein gemeinsames Kind betreut, kein Unterhalt zu gewähren, so erhält er nach § 1318 Abs. 2 S. 2 BGB dennoch Unterhalt, soweit dies notwendig ist, um eine unbillige Härte für das Kind zu vermeiden. Er muss folglich so viel an Unterhalt bekommen, wie er braucht, damit er das Kind nicht vernachlässigen muss. Dies wird in der Regel darauf hinauslaufen, dass ihm der Mindestunterhalt zusteht.
Zugewinnausgleich und Versorgungsausgleich finden statt, soweit das nicht mit Rücksicht auf den Aufhebungsgrund ausnahmsweise unbillig ist (§ 1318 Abs. 3 BGB).
Die Verteilung von Ehewohnung und Hausratfolgt §§ 1568a, 1568b BGB. Soweit dort Billigkeitserwägungen vorgesehen sind, sind die Umstände der Eheschließung zu berücksichtigen.
Wird die Ehe wegen Doppelehe aufgehoben, dürfen die vermögensrechtlichen Folgen der Eheaufhebung außerdem die schutzwürden Interessen des früheren Ehegatten nicht beeinträchtigen.
3. KapitelAllgemeine Ehewirkungen
I.Eheliche Lebensgemeinschaft
49Nach § 1353 Abs. 1 S. 2 BGB sind die Ehegatten einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet und „tragen füreinander Verantwortung“. Das ist eine Generalklausel, die sich zu konkreten Pflichten verdichten kann.
50Soweit aus § 1353 Abs. 1 S. 2 BGB konkrete Ansprüche der Ehegatten untereinander folgen, können diese als sonstige Familiensache i. S. v. § 266 Abs. 1 Nr. 2 FamFG beim Familiengericht geltend gemacht werden.
51§ 120 Abs. 3 FamFG schließt die Vollstreckung aus einer auf einen solchen Antrag ergangenen Endentscheidung aus. Dieser Vollstreckungsausschluss wird eng ausgelegt: Er gilt nicht für alle aus § 1353 Abs. 1 S. 2 BGB folgenden Ansprüche, sondern nur für solche, die in erster Linie das personale Verhältnis der Eheleute betreffen (Helms in Prütting/Helms § 120 Rn. 14). Betreffen sie vermögensrechtliche Pflichten, ist die Endentscheidung vollstreckbar.
52Ähnlich verhält es sich mit Sekundäransprüchen auf





























