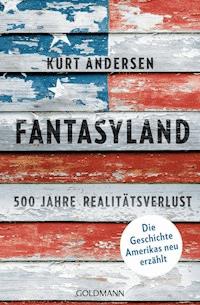
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Das postfaktische Zeitalter ist kein unerklärliches und verrücktes neues Phänomen. Im Gegenteil: Was wir jetzt sehen, ist nur die Spitze des Eisberges«, schreibt Kurt Andersen in seinem aufsehenerregenden Buch Fantasyland. Der Hang zum Magischen und Fantastischen, so der preisgekrönte Kulturjournalist, ist tief in die kollektive DNA der Amerikaner eingeschrieben. Er entstand, als europäische Siedler erstmals den Boden der »Neuen Welt« betraten, im Gepäck vor allem eins: ausgeprägten Individualismus und Lebensträume und Fantasien von epischem Ausmaß. Mitreißend und eloquent erzählt Andersen vom großen amerikanischen Experiment – und warum es so spektakulär scheiterte. Wer verstehen will, wie die Grenze zwischen Realität und Illusion derart verrutschen und ein Mann wie Donald Trump es ins Weiße Haus schaffen konnte, muss dieses Buch lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 978
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
»Die Tatsache, dass Amerika von Leuten gegründet wurde, die an das Unwahrscheinliche glaubten, spielt eine enorme Rolle – gleich, ob das die Puritaner waren oder andere Kult-Anhänger oder einfach nur Leute, die über Nacht reich werden wollten. In Amerika konnte man schon immer ein Vermögen machen und durfte gleichzeitig alles glauben, was man wollte. Das ist vielleicht der zentralste Aspekt der amerikanischen Identität: Leute, die nach Amerika kamen, waren von Anfang an Träumer und Fantasten.«
Kurt Andersen in der ZEIT
KURTANDERSEN
FANTASYLAND
500 JAHREREALITÄTSVERLUST
Aus dem Amerikanischen von Kristin Lohmann, Claudia Amor und Johanna Ott
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Fantasyland. How America Went Haywire – A 500-Year History« bei Random House, an imprint and division of Penguin Random House LLC, New York, USA.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2018
Copyright © 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Copyright der Originalausgabe © 2017 by Random House, NY
Some passages in Fantasyland were originally published in different forms in The New Yorker, New York, Time and The New York Times.
Lektorat: Doreen Fröhlich
DF · Herstellung: kw
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-23183-5V001www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für die Menschen, die mir das Denken beibrachten – Jean und Bob Andersenund die Lehrer des Schulbezirks 66 in Omaha
»Nichts ist leichter als Selbstbetrug, denn was ein Mensch wahrhaben möchte, hält er auch für wahr.«
DEMOSTHENES
»Wir werden unaufhörlich mit Pseudorealitäten bombardiert. Die Wirklichkeit ist das, was bleibt, wenn man nicht mehr daran glaubt.«
PHILIP K. DICK
»Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht das Recht auf seine eigenen Fakten.«
DANIELPATRICKMOYNIHAN
Inhalt
1 Auf nach Fantasyland!
TEIL I
Wie Amerika heraufbeschworen wurde: 1517–1789
2 Ich glaube, also bin ich im Recht: Die Protestanten
3 Alles, was glänzt: Die Goldsucher
4 Wir bauen uns den Himmel auf Erden: Die Puritaner
5 Das gottgegebene Recht, an Gott zu glauben
6 Imaginäre Freunde und Feinde: Die frühe satanische Angst
7 Das erste Ich-Jahrhundert: Religion auf Amerikanisch
8 Was unterdessen in der realitätsnahen Gesellschaft geschah
TEILII
Die Vereinigten Staaten des Staunens: Das 19. Jahrhundert
9 Das Erste Große Delirium
10 Die typisch amerikanische Fan-Fiction von Joseph Smith, dem Propheten
11 Moderne Magie: Die Nation der Quacksalber
12 Fantastische Geschäfte: Der Goldrausch als Wendepunkt
13 Auf der Suche nach gegnerischen Monstern: Der Einzug der Verschwörungstheorien
14 Zwei Weltanschauungen im Krieg
15 Zehn Millionen kleine Farmen
16 Die Industrialisierung der Fantasie
TEILIII
Der beschwerliche Weg zur Vernunft: 1900 –1960
17 Fortschritt und Rückschläge
18 Der größte Rückschlag: Alte Religion im neuen Glanz
19 Amerikas Geschäft mit dem Showbusiness
20 Amerikas Schlaraffenland: Die Utopie der Vorstadtidylle
21 Die Schein-Normalität der 1950er
TEILIV
Der Urknall: Die 1960er und 70er
22 Der Urknall: Die Hippies
23 Der Urknall: Die Intellektuellen
24 Der Urknall: Die Christen
25 Der Urknall: Die Politik, die Regierung und all die Verschwörungen
26 Der Urknall: Ein Leben im Land des Entertainments
TEIL V
Fantasyland in seiner ganzen Vielfalt: Von den 1980ern bis zur Jahrhundertwende
27 Wie man Scheinwelten realistischer gestaltet und die Realität unwirklich erscheinen lässt
28 Auf ewig jung: Das Kids-’R’-Us-Syndrom
29 Die Reagan-Regierung und der Beginn des digitalen Zeitalters
30 Die Religion im Amerika der Jahrtausendwende
31 Die ungestümen Formen unseres Christentums: Überzeugungen und Bräuche
32 Amerika gegen den gottlosen Rest der zivilisierten Welt: Warum sind wir nur so außergewöhnlich?
33 Übernatürlich, aber nicht notwendigerweise christlich; spirituell, aber nicht religiös
34 Hexendoktoren der Spitzenklasse: Die Wiederverzauberung der Medizin
35 Wie der Mainstream Fantasyland zum Aufstieg verhalf: Weicheier, Zyniker und echte Fans
36 Alles ist möglich – solange es mich nichts kostet und mir nicht wehtut
TEILVI
Fantasyland macht Probleme: Von den 1980ern bis in die Gegenwart und darüber hinaus
37 Die Irren haben die Zügel in der Hand – und sie sehen Monster überall
38 Real ist nur die Verschwörung: Amerikas Akte X
39 Wutbürger: Die neu erstarkte Stimme des Volkes
40 Als die Grand Old Party allmählich aus den Fugen geriet
41 Liberale Wissenschaftsverweigerer
42 Durchgeknallte Waffennarren
43 Der ultimative illusorisch-industrielle Komplex
44 Unsere inneren Kinder? Amüsieren sich in Disney World!
45 Traumhafte Zeiten für die Wirtschaft
46 Fantasyland gibt den Kurs der Nation vor
Danksagung
Personenregister
Sachregister
1 Auf nach Fantasyland!
DIEIDEEZUdiesem Buch ist über einen langen Zeitraum in mir gekeimt. Schon ein paar meiner Artikel aus den späten Neunzigern gingen in die Richtung – Artikel über die amerikanische Politik, die immer mehr zum Showbusiness geriet, über Babyboomer, die sich alle Mühe gaben, für immer jung zu bleiben, über haltlose Verschwörungstheorien, die sich immer stärker etablierten, und über die explosionsartige Verbreitung von Talkradio-Sendungen, in denen es mehr und mehr vor allem um die haarsträubenden Ansichten der Moderatoren ging. 1999 erschien ein Roman von mir über einen Fernsehproduzenten, der zwei zukunftsweisende Serien auf den Markt bringt: eine Krimiserie, bei der die fiktiven Charaktere mit der echten Polizei zusammenarbeiten und echte Verbrecher hinter Gitter bringen, und ein Nachrichtenformat, dessen Zuschauer auch Szenen aus dem Privatleben des Nachrichtensprechers zu sehen bekommen.
Wirklich greifbar wurden meine Ideen und Thesen zu Fantasyland aber erst in den Jahren 2004 und 2005. Damals prägte Karl Rove, politischer Mastermind der Regierung George W. Bush, den bemerkenswerten Ausdruck reality-based community. Die Menschen »in der auf Fakten basierenden Gesellschaft, in der reality-based community, wie wir sie nennen«, sagte er gegenüber einem Reporter, »denken, dass sie zu Lösungen kommen, indem sie die wahrnehmbare Realität penibel studieren. Aber so läuft das nicht mehr in der Welt.« Natürlich sagte er das nicht ganz ironiefrei – doch zugleich war es auch sein voller Ernst. Ein Jahr später ging The Colbert Report1 auf Sendung. In den ersten Minuten der ersten Folge führte Stephen Colbert in seiner Rolle als rechtsgerichteter, populistischer Kommentator ein wiederkehrendes Feature ein, das er »The Word« nannte und in dem er jeweils einen bestimmten Ausdruck auf die Schippe nahm. Der Begriff der ersten Sendung war truthiness (etwa: gefühlte Wahrheit), ein von Colbert neu geprägter Begriff in Anlehnung an das Wort truth:
»Jetzt melden sich bestimmt gleich wieder ein paar ›Wortpolizisten‹, ein paar Vertreter der Webster2-›Wort-Fetischisten‹ und rufen: ›Hey, das ist doch gar kein richtiges Wort!‹ Tja, wer mich kennt, weiß, dass ich kein besonders großer Fan von Wörterbüchern oder Nachschlagewerken bin. Ich finde das elitär, immer diese Vorgaben, was wahr sein soll und was nicht. Oder was wirklich geschehen sein soll und was nicht. Wer ist die Britannica3 schon, dass sie mir verklickern will, der Panamakanal sei 1914 fertiggestellt worden? Wenn ich behaupten will, dass er 1941 fertig wurde, dann ist das mein gutes Recht! Ich traue keinen Büchern … immer nur Fakten, null Gefühl … Sehen wir der Wahrheit doch ins Auge, Leute: Wir sind eine gespaltene Nation. Es gibt die, die mit dem Kopf denken, und es gibt die, die mit dem Herzen wissen … denn genau von da kommt sie doch, die Wahrheit, meine Damen und Herren – aus dem Bauch.«
Wow – genau das ist es, dachte ich. In dem Moment wurde mir klar, auf welch seltsame Art sich Amerika in dieser Hinsicht verändert hatte. Die Begriffe truthiness und reality-based community hätten vor den Zweitausendern nicht im Geringsten das Zeug zum Witz gehabt.
Wie es zu diesem Wandel gekommen war, wurde mir ein paar Jahre später noch einmal klarer, als ich anfing, an meinem neuen Roman zu arbeiten. Darin geht es um einen Freundeskreis von Kindern, die in den frühen 1960ern James-Bond-Geschichten nachspielen, und später dann, 1968, als Collegestudenten im echten Leben eine Bond-mäßige regierungsfeindliche Verschwörung vom Zaun brechen. In den Sechzigern verschwammen Realität und Fantasie auf problematische Weise miteinander – das ging den Figuren in meiner Geschichte so, aber auch vielen echten Amerikanern. Über meine Recherchen, und als ich gedanklich immer tiefer in die Geschichte eintauchte, entwickelte ich allmählich ein völlig neues Verständnis dieser Zeit und ihrer Auswirkungen. Mir wurde klar, dass dies, bei all der Unbeschwertheit und all den positiven Folgen der gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüche, auch der Zeitpunkt des Urknalls für truthiness gewesen war, für die gefühlte Wahrheit. Wenn die Sechzigerjahre nun aber tatsächlich einem nationalen Nervenzusammenbruch gleichkamen, dann können wir nicht davon ausgehen, heute darüber hinweg zu sein – denn es stimmt, was man über Genesung sagt: Wirklich geheilt ist man nie.
Mir wurde damals auch klar, dass sich dieses komplexe amerikanische Phänomen, das ich da zu entschlüsseln versuchte, nicht nur im Laufe von Jahrzehnten, sondern von Jahrhunderten entwickelt hatte. Wenn ich unserer Schwäche für Fantasien jeglicher Spielart wirklich auf den Grund gehen wollte, dann musste ich die Ranken und Zweige und Wurzeln viel weiter zurückverfolgen – ganz zurück, um genau zu sein, bis hin zu den Anfängen Amerikas.
Sie werden sicher nicht immer meiner Meinung sein, wenn ich viele Denkmuster, Glaubensvorstellungen und Verhaltensweisen als imaginär oder fantastisch einstufe. Vielleicht finden Sie auch, dass ich mit tiefen, persönlichen Überzeugungen zu urteilend umgehe. Wenn mir ein Moorhuhn vor die Flinte kommt, dann drücke ich auch ab, jedenfalls ziemlich häufig. Das heißt aber keinesfalls, dass ich grundsätzlich jede Art von Religion oder alternativem Glaubenssystem oder auch generell jede Verschwörungstheorie oder utopische Träumerei als töricht abtue. Wir alle befinden uns schließlich an irgendeinem bestimmten Punkt im Spektrum zwischen dem Pol des Rationalen und dem des Irrationalen. Jeder hat einmal eine Vorahnung, die er nicht erklären kann, oder hegt irgendeinen irrationalen Aberglauben.
Problematisch wird es erst, wenn die Sache aus dem Ruder läuft, wenn das subjektive Empfinden die Objektivität aushebelt, wenn Leute denken und handeln, als wären Meinungen und Gefühle ebenso wahr wie Tatsachen. Das amerikanische Experiment, die Fleischwerdung der großen aufklärerischen Idee von der intellektuellen Freiheit, die besagt, dass jeder Einzelne frei ist zu glauben, was auch immer er oder sie will, hat sich zu etwas ausgewachsen, das wir nicht mehr im Griff haben. Dieser Ultra-Individualismus war von Anfang an tief mit epischen Träumen verknüpft, manchmal auch mit epischen Fantasien – jeder einzelne Amerikaner, jedes Individuum aus Gottes erwähltem Volk, schuf sich sein eigenes, maßgeschneidertes Utopia, jeder von uns war frei, sich selbst anhand seiner Vorstellungskraft und seines Willens immer wieder neu zu erfinden. In Amerika haben diese zugegeben aufregenderen Elemente der Aufklärungsidee den nüchternen, rationalen, empirischen Teil längst fortgespült.
Im Laufe der Jahrhunderte haben wir Amerikaner uns immer intensiver allen möglichen Varianten des Magiedenkens und einem Alles-ist-möglich-Relativismus hingegeben. Immer stärker, und in den letzten fünfzig Jahren auch immer schneller, sind wir abstrusen Erklärungen nachgehangen und haben unseren Glauben an kleine und größere tröstliche, packende oder schauerliche Fantasien gepflegt. Und die meisten von uns haben dabei überhaupt nicht realisiert, wie einschneidend unsere seltsame neue Normalität inzwischen geworden ist. Das erinnert mich an den Frosch im Kochtopf, der in dem sich allmählich erhitzenden Wasserbad sein Schicksal erst erkennt, wenn es zu spät ist.4
Wir Amerikaner glauben – und ich meine wirklich glauben – in größerem Maße als alle anderen ein oder zwei Milliarden Menschen der reichen Welt an das Übernatürliche und Rätselhafte, an die Präsenz Satans auf Erden, an Berichte über erst kürzlich gemachte Ausflüge in den oder aus dem Himmel und an eine mehrere tausend Jahre alte Geschichte von der spontanen Entstehung des Lebens vor mehreren tausend Jahren.
Um die Jahrtausendwende fantasierte sich unsere Finanzindustrie zusammen, dass hochriskante Verschuldungen nun nicht mehr riskant seien, woraufhin Abermillionen Amerikaner sich zusammenfantasierten, dass sie fortan das Leben reicher Leute führen könnten; diese Vorstellung basierte auf der Fantasie, dass Immobilien immer nur in ihrem Wert steigen könnten, und das unaufhörlich.
Wir glauben, dass die Regierung und ihre Mitverschwörer alle möglichen entsetzlichen Wahrheiten vor uns geheim halten – etwa, was Mordanschläge betrifft oder Außerirdische, die Entstehung von Aids, die Anschläge des elften September, die Gefahren durch Impfstoffe und vieles mehr.
Wir häufen Waffen an, weil wir den Fantasien über unsere Vergangenheit als Pioniere nachhängen – oder in Erwartung eines imaginären Schusswechsels mit Verbrechern oder Terroristen. Wir legen uns Militärklamotten und die entsprechende Ausrüstung zu und tun so, als wären wir Soldaten – oder Elfen oder Zombies – , wir kämpfen in Schlachten, bei denen niemand stirbt, real oder in ungeheuer realistischen virtuellen Welten.
All das begann, noch bevor wir mit den Begriffen post-factual und post-truth (beide für postfaktisch) vertraut wurden. Und bevor wir einen Präsidenten wählten, der sich gegenüber Verschwörungstheorien, Wahrheit und Unwahrheit beziehungsweise dem, was die Wirklichkeit ausmacht, erstaunlich aufgeschlossen zeigt.
Wir sind mit Alice in den Kaninchenbau geschlüpft und befinden uns nun hinter den Spiegeln. Amerika ist zu Fantasyland geworden.
Wie weit verbreitet ist diese buntgewürfelte Hingebung an das Irreale eigentlich? Wie viele Amerikaner leben heute in parallelen Wirklichkeiten? Auch wenn Meinungsumfragen immer nur einen groben Abriss dessen liefern können, was die Leute wirklich denken, ergibt sich aus zahlreichen Forschungsergebnissen, aus detaillierten, gegengeprüften und zusammengefassten Angaben der letzten zwanzig Jahre, zumindest eine grobe, aber dennoch brauchbare Einschätzung des Phänomens, dass gewisse Vorstellungen, eine gewisse Leichtgläubigkeit, ein Sichtäuschenlassen in Amerika in diesem Zeitraum stetig zugenommen haben.
Meinen Berechnungen zufolge sind die wirklich solide realitätsbasierten Menschen in Amerika inzwischen in der Minderheit – vielleicht machen sie ein Drittel aus, ziemlich sicher aber sind es weniger als die Hälfte. Beispielsweise ist nur ein Drittel der Amerikaner mehr oder weniger davon überzeugt, dass vor allem die CO2-Emissionen der Autos und Fabriken für die globale Erderwärmung verantwortlich sind. Nur ein Drittel ist der Ansicht, dass die Schöpfungsgeschichte nicht wörtlich zu nehmen ist, dass wir es hier nicht mit einem auf Fakten basierenden Bericht zu tun haben. Und nur ein Drittel ist sich wirklich sicher, dass es keine Telepathie und keine Geister gibt.
Dagegen glauben zwei Drittel der Amerikaner, dass »Engel und Dämonen Einfluss auf unsere Welt« haben. Und mindestens die Hälfte hat nicht den geringsten Zweifel daran, dass der Himmel existiert und dass darin ein personifizierter Gott herrscht – keine unbestimmte Kraft, kein universeller Geist, sondern ein Typ. Mehr als ein Drittel aller Amerikaner ist nicht nur der Ansicht, der Klimawandel sei keine große Sache – diese Leute glauben außerdem, dass das Ganze ein von einer Verschwörung aus Wissenschaftlern, Regierungen und Journalisten in die Welt gesetztes Gerücht ist.
Ein Drittel glaubt, dass schon unsere allerersten Vorfahren Menschen waren – Menschen wie wir; dass der Staat zusammen mit der Pharmaindustrie Beweismaterial für »natürliche« Heilmethoden von Krebserkrankungen hat verschwinden lassen; dass Außerirdische erst kürzlich die Erde besucht haben (und immer noch unter uns weilen).
Ein Viertel glaubt, dass Impfungen autistische Entwicklungsstörungen verursachen können und dass Donald Trump bei den Wahlen 2016 die Mehrheit der direkten Stimmen bekam. Ein Viertel glaubt, dass unser vorhergehender Präsident der Antichrist war (oder ist?). Ein Viertel glaubt an Hexen. Und bemerkenswerterweise glaubt gerade mal jeder fünfte Amerikaner, dass die Bibel im Wesentlichen aus Legenden und Fabeln besteht. Dafür geht in etwa die gleiche Anzahl von Leuten davon aus, dass »die Fernsehzuschauer von den Medien oder dem Staat mittels einer geheimen Technologie über die Übertragungssignale einer Gehirnwäsche unterzogen werden« und dass amerikanische Funktionäre in die Anschläge vom elften September verwickelt waren.5
Wenn ich hier von einem Drittel spreche, das an X glaubt, oder von einem Viertel, das an Y glaubt, dann ist damit keineswegs jeweils dasselbe Drittel oder Viertel der amerikanischen Bevölkerung gemeint. Obgleich es natürlich Überschneidungen zwischen den verschiedenen Fantasy-Anhängerschaften gibt. Nicht selten nähren sie sich auch gegenseitig: So kann etwa der Glaube an den Besuch von Außerirdischen und deren Entführungen von Erdlingen zum Glauben an weitreichende staatliche Vertuschungsmanöver führen, was wiederum zu einem Glauben an noch umfassendere Verschwörungen und Intrigen führen kann, und das wiederum kann hervorragend mit dem Glauben an ein bevorstehendes Harmagedon einhergehen, in das auch Jesus involviert ist. Da funktioniert Fantasyland genau wie die Europäische Union: Auch hier haben wir es mit einer Ansammlung ganz andersartiger, verschieden großer Gebiete zu tun, alle miteinander verbunden durch den Schengenraum, dank dem sich die Bürger all dieser Länder im gesamten Gebiet frei bewegen dürfen: Ungarn und Malteser können jederzeit nach Belieben Frankreich oder Island einen Besuch abstatten.
Und genau wie bei den innereuropäisch gehegten Antipathien bringen sich auch manche Fantasyland-Regionen eine gegenseitige Verachtung entgegen, die der gemeinsamen Verachtung gegenüber den realitätsbasierten Fraktionen in nichts nachsteht. So betrachten etwa viele Evangelikale die Angehörigen der Pfingstkirche als Ketzer, und Evangelikale und Angehörige der Pfingstkirche wiederum betrachten die Mormonen als Ketzer; Pat Robertson6 hat die Scientologen als teuflisch bezeichnet; der Vatikan betrachtet Oprah Winfreys Jünger als törichte Narren, und verschiedene Truther7 sind der Ansicht, dass sich der jeweils andere nur etwas vormacht. Eine große Anzahl der Menschen, die gentechnisch veränderte Lebensmittel trotz der überwältigend einhelligen gegenteiligen Meinung der Wissenschaftler für nicht sicher halten, macht sich über die Leugner des Klimawandels lustig. Tatsächlich könnte man die Geschichte Fantasylands auch wunderbar als Schema der unterschiedlichen »Mannschaften« in einem Turnierplan darstellen – wie beim College-Basketball, mit kontinuierlichen, über die Jahrhunderte hinweg ausgefochtenen Entscheidungsspielen, bei denen bestimmte Teams verlieren (die Puritaner) beziehungsweise gewinnen (die Mormonen) und die bis heute fortgeführt werden.
Warum sind wir so?
Genau dieser Frage will ich in diesem Buch auf den Grund gehen. Die verkürzte Antwort lautet: Weil wir Amerikaner sind, weil man als Amerikaner einfach an jeden Mist glauben kann, an den man eben glauben will, weil der Glaube eines Amerikaners dem eines beliebigen anderen Menschen mindestens gleichauf ist, wenn er nicht sowieso über ihm steht – zum Teufel mit den Fachleuten! Wenn man sich auf eine solche Haltung erst einmal eingelassen hat, dann steht die Welt kopf, dann hat keine Ursache-Wirkung-Beziehung mehr Bestand. Dann wird das Glaubhafte unglaubwürdig und das Unglaubwürdige glaubhaft.
Der Begriff mainstream wurde in letzter Zeit zum abwertenden Kürzel für die Vorurteile der Eliten, für ihre Lügen und die Unterdrückung, die sie ausüben. Dabei hat gerade dieses so verhasste Establishment, das uns einst mittels seiner Institutionen und Kräfte davon abhielt, es mit dem offenkundig Falschen oder Absurden zu übertreiben, in den vergangenen Jahrzehnten all die Fantasien überhaupt erst möglich gemacht beziehungsweise angespornt – die Medien, die akademische Welt, die Politik, die Regierung, die amerikanischen Unternehmen, Berufsverbände, allgemein die Gesamtheit der angesehenen Meinungen.
In seiner täglich ausgestrahlten Fernsehshow wirbt ein Oberarzt, der an einer der angesehensten Universitätskliniken Amerikas tätig ist, für Wunderheilmittel. Auf den großen Kabelkanälen laufen Dokumentationen über Meerjungfrauen, Monster, Geister und Engel, in denen so getan wird, als seien sie alle echt. Ein CNN-Nachrichtensprecher stellte in einer Livesendung die Vermutung an, dass hinter dem Verschwinden einer malaysischen Passagiermaschine vermutlich etwas Übernatürliches steckte. Eine unserer beiden großen politischen Parteien erlässt landesweite Beschlüsse, durch die man sich der eingebildeten Einführung einer Neuen Weltordnung und dem Islamischen Recht widersetzen will – dasselbe geschieht in der Gesetzgebung mancher Bundesstaaten. Wenn ein Politikwissenschaftler die Idee von der Existenz »einer gewissen ›Öffentlichkeit‹ [angreift], die eine bestimmte Vorstellung von der Realität teilt, ein Konzept von Vernunft und eine Reihe von Kriterien, anhand derer dann beurteilt wird, was Vernunft und Rationalität ausmacht«, dann nicken die Kollegen nur und bestätigen ihn im Amt. Es gab eine weiße Frau, die sich als Schwarze fühlte, die so tat, als wäre sie schwarz, und die unter diesen Vorzeichen einen offiziellen Posten bei der NAACP8 bekam – und die, als sie aufgeflogen war, nur meinte: »Das ist keine Verkleidung … es ist nichts, das ich einfach so an- und ablegen kann. Ich würde zwar nicht behaupten, dass ich afroamerikanisch bin, aber ich würde schon sagen, dass ich schwarz bin.« Die Bill-Gates-Stiftung hat ein eigenes Institut nur für die pseudowissenschaftliche Arbeit an der kreationistischen Schöpfungslehre gegründet. Donald Trump wurde trotz seiner unaufhörlich verbreiteten Lügen und seiner offensichtlichen Hirngespinste – oder vielmehr deswegen – zum Präsidenten gewählt. Was früher die Randgebiete waren, wurde eingeklappt und bildet heute die neue Mitte. Das Irrationale ist zu Ansehen gekommen und kann in vielen Fällen nicht mehr aufgehalten werden. Während bestimmte Fantasien immer mehr Fahrt aufnehmen, bis sie sich wie eine ansteckende Krankheit verbreiten, werden andere Fantasten von einer Welle der nicht hinterfragenden Toleranz noch weiter beflügelt. Es scheint unbewusst eine Art verdrehte goldene Regel zu existieren: Wenn die Leute dieses glauben, dann können wir ja wohl auch jenes glauben.
Inzwischen begünstigt unser gesamtes soziales Umfeld mit all seinen sich überschneidenden Elementen – Kultur, Religion, Politik, Intellekt, Psychologie – die spektakulärsten Täuschungen und Vorspiegelungen. Auf unzähligen spiegelglatten Abhängen schlittern wir in unterschiedlichsten Richtungen geradewegs in den nächsten erstaunlichen Unsinn hinein. Diese natürlichen Eispisten wurden in den vergangenen Jahrzehnten zu einem gigantischen, beständigen Geflecht aus miteinander verbundenen, kreuz und quer verlaufenden Bobbahnen, aus denen es so leicht keinen Ausstieg mehr gibt. Voilà: Wir sind in Fantasyland angekommen.
Dieses Buch umfasst aber weit mehr als die epidemische Ausbreitung der klar umrissenen Unwahrheiten, deren fehlender Wahrheitsgehalt eindeutig überprüft werden kann. Wirklich Klick gemacht hat es bei mir erst, als ich einen Schritt zurückgetreten bin und mein Blickfeld erweitert habe; erst da erkannte ich, wie sehr sich unser Land verändert hat. Ich sah, wie eng die Verbreitung von Wahnvorstellungen und Illusionen innerhalb der großen Themen, die die Menschen immer schon beschäftigt haben – Politik, Religion, auch Wissenschaft – mit der Verbreitung und der Fülle an Fiktionen und Quasi-Fiktionen zusammenhängt, die den amerikanischen Alltag fluten.
Fantasyland ist für mich nicht nur der inbrünstige Glaube an Unwahrheiten – es sind auch die Menschen, die sich ihr ganzes Lebensmodell auf Scheinwelten aufgebaut haben. Beide Fantasiearten – Verschwörungstheorien und der Glaube an Magie auf der einen Seite und Fantasy Football9 und die virtuelle Realität auf der anderen – machen den Alltag einfach aufregender, dramatischer. An ihren jeweiligen Wendepunkt gelangten beide Varianten aufgrund derselben zwei folgenschweren Veränderungen.
Die erste, sich in den 1960er-Jahren Bahn brechende tiefgreifende Veränderung in der amerikanischen Denkweise, durch die die geistigen Betriebssysteme fortan nach anderen Regeln funktionierten, und zwar auch dann, wenn ein solches Betriebssystem sicher ist, selbst die echte Wahrheit zu kennen, war ein neues Motto, das da lautete: Mach dein eigenes Ding, finde deine eigene Realität, schließlich ist alles relativ. Ob dieses neue Denkmuster ganz offensichtlich zutage tritt oder stillschweigend zugrunde liegt, ob es bewusst oder unbewusst greift – Fakt ist: So funktionieren wir heute.
Die zweite tiefgreifende Veränderung war das neue Informations- und Kommunikationszeitalter. Digitale Technologien lassen die Fiktionen beider Fantasietypen erst wirklich realistisch erscheinen: Fiktive Lebensmodelle und Unterhaltungsformen genauso wie ideologische, religiöse und pseudowissenschaftliche Fiktionen, mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Bei einer Milliarde Websites ist es für Gläubige aller Art ein Leichtes, Tausende Gesinnungsgenossen zu finden, die ihren Glauben teilen und ganze Collagen von Fakten und »Fakten« zur Verfügung stellen. Bevor es das Internet gab, waren Spinner eher einsame Typen, und es fiel ihnen sicher nicht immer leicht, an ihrem Glauben an eine andere Wirklichkeit festzuhalten. Heute sind ihre so inbrünstig geglaubten Überzeugungen überall auf Sendung und im Internet – genau wie die echten Nachrichten. Heute wirken alle Fantasien real.
Dazu lassen die Computer all die Fantasien, die wir (meistens jedenfalls) als solche erkennen, noch viel authentischer wirken. Wir können uns als alles Mögliche und als jedes nur denkbare Wesen aus jeder beliebigen Zeit und Galaxie ausgeben. Nur hören die Online-Fantasien ja nicht auf, wenn wir die Sphären der Computeranimation von Dr. Ludvig Maxis und Lady Jaina Prachtmeer10 verlassen. Hinter den offensichtlichen Fiktionen solcher Computerspiele liegt eine riesige Grauzone. Und weil das Internet Anonymität bietet, können wir im echten Leben zur Fiktion gewordene Versionen unserer selbst sein – echte Menschen, die mit anderen echten Menschen auf eine Art und Weise interagieren, wie wir sie uns noch vor Kurzem niemals hätten ausmalen können oder uns auszumalen gewagt hätten.
Die einzelnen Minifantasien und Simulationen, die wir in unser Leben integrieren, sind für sich genommen ziemlich harmlos; ein kleines Stück des Authentisch-Banalen wird hier ersetzt, ein kleines dort. So wird die Welt ein bisschen mehr zur Filmkulisse, alles scheint ein wenig aufregender und glamouröser, Hitchcocks Definition von Drama entsprechend: ein Leben, aus dem man die langweiligen Momente herausgeschnitten hat. Jeder von uns kann sich wie ein sexy Held in einer cooleren Story fühlen, als das echte Leben sie zu bieten hat, man kann sich jünger fühlen, wenn man alt ist, und älter, wenn man jung ist. Mit der Zeit nehmen die irrealen Bereiche aber immer mehr Raum in unserem Leben ein. Bis schließlich die ganze Wiese nur noch aus Kunstrasen besteht. Und wir echt und vorgegaukelt, real und irreal nicht mehr voneinander unterscheiden können.
Wenn man früher die Chance bekommen wollte, auf einen Schlag reich zu werden, musste man nach Las Vegas fahren. Wenn man durch ein fiktives, wuseliges Königreich schlendern wollte, musste man, sofern man nicht psychotisch war, nach Disneyland. »Themen-« war damals noch kein Präfix, Pornografie nicht allgegenwärtig. Schönheitsoperationen gab es kaum; Brüste waren nicht ungewöhnlich groß und fest, Gesichter nicht künstlich glatt und straff. Niemand kam auf die Idee, tagelang Schlachten in der passenden militärischen superrealistischen Ausrüstung nachzuspielen. Und das Zwischending aus Melodram und Pseudo-Doku namens Reality-TV hatten wir auch noch nicht fabriziert.
Sicher: Nur weil jemand falsche Titten hat oder League of Legends spielt, muss er noch lange nicht der Überzeugung sein, dass er ein Dutzend halb automatische Waffen zur Selbstverteidigung horten sollte oder dass Impfungen Autismus verursachen oder dass die Erde sechstausend Jahre alt ist. Aber wir sind freier denn je zuvor, uns unsere eigene Welt zurechtzuschustern, zu glauben, was immer wir wollen, und uns als wer auch immer auszugeben. Und das lässt alle Grenzen zwischen dem Tatsächlichen und dem Fiktionalen leichter verschwimmen, teils bis zur kompletten Auflösung. So wird die Wahrheit insgesamt zu etwas Flexiblem, zu einer Frage der persönlichen Vorlieben. Zwischen unseren sich vervielfachenden Fantasien besteht eine gut funktionierende Synergie: den kleinen und den großen, den toxischen und denen, die nur der persönlichen Unterhaltung dienen, jenen, die wir ganz klar als Fantasien einstufen, solchen, an die wir doch irgendwie glauben, und schließlich den religiösen und politischen und wissenschaftlichen Fantasien, die wir in voller Überzeugung als wahr betrachten. Wenn es um Chemikalien in der Umwelt und Drogen im Gehirn geht, warnen Wissenschaftler vor dem sogenannten Cocktail-Effekt: Treffen mehrere Substanzen aufeinander, können sie sich potenzieren. Genauso ist es hier wohl auch. Unersättlich haben wir amerikanische Cocktails in uns hineingeschüttet, Cocktails aus all den unterschiedlichen Fantasy-Zutaten. Und diese vielen bewussten, halb bewussten und unbewussten Fantasien verstärken nun jeweils die Wirkung der anderen.
Dass wir uns einem solchen Saufgelage völlig frei hingeben dürfen, finden wir großartig, wir bestehen auf dieser Freiheit – auch wenn es uns Angst macht und wir es verabscheuen, in welcher Weise so viele unserer verbohrten Landsleute diese Freiheit missbrauchen. Als John Adams Anfang des 18. Jahrhunderts meinte, Fakten seien »störrisch«, war das vorrangige amerikanische Prinzip der persönlichen Freiheit noch nicht in der Unabhängigkeitserklärung oder der Verfassung verankert, ja die Vereinigten Staaten von Amerika waren selbst noch ein Traum. Zweieinhalb Jahrhunderte später hat die von Adams mitbegründete Nation seine Plattitüde »unsere Wünsche, unsere Neigungen« de facto mehrheitsprinziplich widerlegt; schließlich verändert heute das »Diktat unserer Leidenschaften« ganz offensichtlich »den Status des Faktischen und Beweisbaren«, denn es regieren extreme Gedankenfreiheit und das Streben nach Glück.
Dass Menschen das echte Leben als Fantasie betrachten und umgekehrt und dass sie absurde Ideen ernst nehmen, ist zwar keine rein amerikanische Angelegenheit. Einzigartig ist aber, wie tief wir in diesem Sumpf stecken. Im Vergleich zu anderen Industrieländern jedenfalls ist unsere Schwäche fürs Fantastische extrem. Wie bereitwillig wir auf alle möglichen Fantasien einsteigen, unterscheidet sich in Ausmaß und Intensität deutlich von anderen Ländern. Sicher: Der Arzt, dessen betrügerische Forschung die Anti-Impf-Bewegung losgetreten hat, war Brite, und Cosplay, das Sichverkleiden als Fantasyfigur, wurde von jungen japanischen Otaku erfunden. Und natürlich gibt es auch in anderen Industriestaaten Menschen, die an die Macht des Übernatürlichen, an Prophezeiungen und religiöse Pseudowissenschaften glauben – aber nirgends sonst in der reichen Welt spielen diese Überzeugungen eine derart essenzielle Rolle für das Selbstbild so vieler Menschen. Wir sind weltweit der Schmelztiegel von Fantasyland, wir sind das Epizentrum.
Im 21. Jahrhundert macht genau das Amerikas Außergewöhnlichkeit aus. Amerika war immer schon ein einzigartiger Ort – doch diese Eigentümlichkeit ist heute anderer Art. Reich und frei sind wir immer noch, auch einflussreicher und mächtiger als jedes andere Land; Amerika ist sozusagen der Inbegriff des Industriestaats. Gleichzeitig aber wiegt unser Hang zur Leichtgläubigkeit und dazu, unser eigenes Ding machen zu wollen und die Realität alles in allem eher nicht so richtig im Griff zu haben, inzwischen stärker als unsere anderen außergewöhnlichen Merkmale, sodass Amerika parallel auch zu einem Entwicklungsland geworden ist.
Der Trump-Moment – die Hochblüte des Postfaktischen, der alternativen Fakten – wird gerne als etwas völlig Unerklärliches angesehen, als ein verrücktes neues amerikanisches Phänomen. Dabei ist die aktuelle Entwicklung nur die logische Folge, der ultimative Ausdruck der Haltung und des Instinkts, die Amerika immer schon außergewöhnlich gemacht haben, seine ganze Geschichte über – tatsächlich sogar von seiner Vorgeschichte an. Mit dem vorliegenden Buch möchte ich versuchen, unseren aktuellen Zustand zu definieren, ihn möglichst genau zu bestimmen, ich möchte Maßstab und Umfang darstellen und ein paar frische Erklärungsansätze dafür liefern, wie es dazu kam, dass wir auf unserer nationalen Reise schließlich an diesem Punkt abgesetzt wurden.
Amerika wurde von wahren Gläubigen und leidenschaftlichen Träumern gegründet, von Scharlatanen und den Dummköpfen, die auf sie hereinfielen. Das hat uns im Laufe von vierhundert Jahren empfänglich gemacht für alle möglichen Fantasien: angefangen von der Hexenjagd in Salem über den Mormonengründer Joseph Smith, von P. T. Barnum über Henry David Thoreau zum Sprechen in Zungen, von Hollywood über Scientology zu Verschwörungstheorien, von Walt Disney über Billy Graham und Ronald Reagan und Oprah Winfrey bis hin zu Donald Trump. Mit anderen Worten: Man vermenge abenteuerlichen Individualismus mit extremer Religiosität, vermische Showbusiness mit allem anderen, lasse das Ganze ein paar Jahrhunderte lang gut durchziehen und vor sich hin köcheln, ziehe die Mischung dann durch die Nichts-ist-unmöglich-Sechziger und das Zeitalter des Internets und voilà: Heraus kommt das Amerika, in dem wir heute leben, in dem Realität und Fantasie auf völlig irre und gefährliche Art ineinander übergehen und miteinander verschmolzen sind.
Hoffentlich machen wir gerade nur einen langen, vorübergehenden Umweg, hoffentlich schaffen wir es irgendwie, wieder auf die richtige Spur zu kommen. Angenommen, wir befinden uns auf einer Sauftour und bekommen gerade die Auswirkungen von zu vielen Fantasy-Cocktails zu spüren, die wir über einen zu langen Zeitraum in uns hineingekippt haben, angenommen, das ist der Grund, der uns so manisch und hysterisch macht und uns straucheln lässt – müssten wir dann nicht irgendwann wieder nüchtern werden und uns regenerieren? Sollte man meinen. Dafür muss man aber zunächst verstehen, wie tiefgreifend sich der Hang zur Fantasie in unsere nationale DNA eingebrannt hat.
1The Colbert Report war eine US-amerikanische Satiresendung, die von 2005 bis 2014 viermal wöchentlich spätabends auf Comedy Central lief. Stephen Colbert mimte darin einen egomanischen, rechtsgerichteten Kommentator nach dem Vorbild eines Fox News-Moderatoren (Anm. d. Üb.).
2Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, auch Webster oder Merriam-Webster, ist ein im englischsprachigen Raum weit verbreitetes, bekanntes Wörterbuch (Anm. d. Üb.).
3 Die Encyclopædia Britannica ist eine englischsprachige Enzyklopädie, vergleichbar mit dem Brockhaus (Anm. d. Üb.).
4 In Wirklichkeit hüpfen Frösche aus dem Wasser, wenn es zu heiß wird. In dem Versuch aus dem 19. Jahrhundert, der diese Vorstellung scheinbar ins Leben gerufen hat, wurde der Frosch zwar tatsächlich zu Tode gekocht – nur war ihm zuvor das Gehirn entfernt worden. Was ja eine menschliche Geste war und die Metapher in unserem Kontext noch passender macht.
5 Ich beziehe mich in diesem Kapitel auf Umfragewerte, die zwischen 2000 und 2017 von folgenden Institutionen erhoben wurden: dem Pew Research Center, dem unabhängigen Umfrageinstitut NORC der University of Chicago (General Social Survey), dem International Social Survey Programme, Gallup, Ipsos, YouGov, der Cooperative Congressional Election Study, Qualtrics, Public Policy Polling, Opinion Research Corporation, Scripps, Harris und dem Climate Change Communication-Projekt.
6 Marion Gordon »Pat« Robertson ist ein amerikanischer Politiker, der als eine der einflussreichsten Figuren der konservativen Rechten in den USA gilt (Anm. d. Üb.).
7 Als Truther (von engl. truth, Wahrheit) werden Gruppen oder Einzelpersonen bezeichnet, die glauben, von Regierungen oder den Medien systematisch fehlinformiert oder belogen zu werden (Anm. d. Üb.).
8NAACP steht für National Association for the Advancement of Colored People (Nationale Organisation für die Förderung farbiger Menschen) und ist eine der ältesten und einflussreichsten schwarzen Bürgerrechtsorganisationen der USA (Anm. d. Üb.).
9 Fantasy Football (FF) ist ein meist internetbasiertes Spiel, das in Amerika äußerst beliebt ist. Jeder der acht bis zwölf Teilnehmer hat eine eigene Mannschaft (Fantasy Team), die sich aus echten Sportlern einer bestimmten Liga zusammensetzt. Basierend auf der Leistung der echten Sportler am jeweiligen Spieltag erhält man dann Punkte (Anm. d. Üb.).
10 Dr. Ludvig Maxis und Jaina Prachtmeer sind Protagonisten aus den Computerspielen Call of Duty bzw. World of Warcraft (Anm. d. Üb.).
TEIL I
Wie Amerika heraufbeschworen wurde: 1517–1789
»Der ganze Mensch liegt sozusagen schon in den Windeln seiner Wiege. Ähnliches spielt sich bei den Nationen ab. In den Völkern tritt immer schon das Gepräge ihres Ursprungs zutage … wären wir imstande, bis zu den Anfängen der Gesellschaft vorzudringen … ich zweifle nicht daran, dass wir die Hauptursachen der Vorurteile, der vorherrschenden Leidenschaften, kurz alles dessen erkennen könnten, was man als nationale Wesensart bezeichnet.«
ALEXISDETOCQUEVILLE, Über die Demokratie in Amerika (1835)
2Ich glaube, also bin ich im Recht: Die Protestanten
AMANFANGBESASSdas Land noch nicht einmal einen richtigen Namen: Die Neue Welt war ein Platzhalter, eine vorläufige, verallgemeinernde Bezeichnung, wie das Kürzel NewCo, das Gesellschaftsrechtler heutzutage gerne für die frisch gegründeten Firmen ihrer Mandanten nutzen. Für die zukünftigen weißen Bewohner der Neuen Welt war dieses Land ein imaginärer Ort. Amerika begann als Fieberwahn, als Mythos, als schöne Traumvorstellung, kurz: als Fantasie. Im Grunde handelte es sich um allerlei verschiedene Fantasien, die um das Jahr 1600 die Menschen dermaßen zu fesseln vermochten, dass die meisten von ihnen alles zurückließen – Freunde, Familie, Jobs, gesunden Menschenverstand, England, die altbekannte Welt – , um ihre Träume zu verwirklichen oder bei dem Versuch zu sterben. Und es waren viele, die ihr Leben ließen.
Unser Land war das allererste, das je aus dem Nichts erdacht und geschaffen wurde, das erste Land, das erschrieben wurde wie ein episches Gedicht, und wie es der Zufall will, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Shakespeare und Cervantes die moderne Prosa begründeten. Die ersten englischen Bewohner der Neuen Welt betrachteten sich als waghalsige Helden mit Anpackerqualitäten und einem Leben voll aufregender Abenteuer. Sie waren Extremisten, die sich am liebsten selbst inszenierten und für ihre flammenden Überzeugungen, weit hergeholten Hoffnungen, Träume und Fantasien, die sich doch bitte bewahrheiten sollten, alles ihnen bisher Bekannte zurückließen.
Aber spinnen wir Tocquevilles Metapher vom Kapitelanfang ein wenig fort: Wenn die ersten Unternehmungen der Engländer in der Neuen Welt das neugeborene Amerika darstellen, die Wiege der Nation, dann lassen Sie uns doch noch ein wenig weiter zurückgehen und zu ergründen versuchen, wie es dazu kam, dass dieses erstaunliche Kind überhaupt gezeugt wurde.
Ein frommer, junger Theologieprofessor an einer frisch gegründeten Provinzuniversität südlich von Berlin, ein Mann, der gern alles weiß, ist in manch wesentlicher Hinsicht mit der christlichen Doktrin und deren Umsetzung nicht einverstanden. Besonders ungehalten ist er über die Tatsache, dass der Erzbischof der Region, um die Kosten für die Feierlichkeiten zu seiner Beförderung zum Kardinal zu decken, die ortsansässigen Gläubigen dazu auffordert, für die Vergebung ihrer Sünden (und jener nahestehender Verstorbener) Geld zu zahlen und somit die postmortale Wartezeit im Fegefeuer zu verkürzen beziehungsweise gleich gänzlich zu umgehen. Zusätzlich zu diesem Obolus werden die Vergebung Suchenden dazu verpflichtet, am Allerheiligentag im Tross durch die Gemeindekirche zu ziehen und die Tausenden dort angesammelten heiligen Reliquien anzubeten, wovon die meisten, wenn nicht sogar alle, Fälschungen waren. Zu erwähnen wären hier etwa ein Strohhalm von der Krippe des Jesuskindleins, Fäden aus dem Stoff, in den das Kind gewickelt war, ein Rest von Marias Muttermilch, ein Barthaar des erwachsenen Jesus, ein Stück Brot vom Letzten Abendmahl und ein Stachel aus der Dornenkrone, die Er bei der Kreuzigung trug. Entsetzt über die Verkaufspraktiken der Kirche, schreibt der junge Theologe eine mehrere Seiten lange leidenschaftliche Kritik, eine Art Prototyp der PowerPoint-Präsentation, und nagelt sie am Vorabend des Allerheiligentages, an Halloween also, an die Kirchentür. Zur Sicherheit schickt er auch noch eine Abschrift seines Papiers an den Erzbischof höchstpersönlich.
Hätte das alles 1447 stattgefunden, wäre die Episode heute allenfalls eine kleine Fußnote der Geschichte. Doch weil der junge Prediger, der ehrwürdige Doktor Martin Luther, mit seinen Thesen im Jahr 1517 an die Öffentlichkeit ging, als die Ära des mechanischen Buchdrucks schon etwa seit einem halben Jahrhundert eingeläutet war, änderte sein Manifest alles. Die 95 Thesen wurden augenblicklich gedruckt, aus dem Lateinischen in die regionalen Sprachen übersetzt, in ganz Europa verbreitet und ohne Unterlass nachgedruckt. Der Protestantismus war geboren, als organisierte Alternative zum christlichen Religionsmonopol der römisch-katholischen Kirche.
Nachdem der neue christliche Glaube sich formiert hatte, ermöglichte ihm die Druckerpresse eine schnelle Verbreitung. Luthers Hauptvorwurf war, dass die Kirche faule VIP-Pässe für die Fahrt ins Himmelreich verhökert habe. »Lug und Trug predigen diejenigen«, so schreibt er in einer seiner Thesen, »die sagen, die Seele erhebe sich aus dem Fegfeuer, sobald die Münze klingelnd in den Kasten fällt.« Wenige Jahrzehnte später hatte sich die Sache ohnehin erledigt, denn der Vatikan verabschiedete sich vom Ablasshandel. Doch Luther hatte noch zwei wichtigere, wesentlich revolutionärere Ideen, die sowohl für seine Religion als auch für die Geburt Amerikas zur Grundlage werden sollten.
Luther war nämlich davon überzeugt, dass es für die Männer des Klerus keinen privilegierten Zugang zu Gott oder zu Jesus oder zur Wahrheit gab. Seiner Meinung nach stand alles, was ein Christ wissen musste, in der Bibel. So konnte und sollte jeder einzelne Gläubige die Heilige Schrift für sich selbst lesen und deuten. Jeder Gläubige, behaupteten die Protestanten, war nun ein Priester.
Zu jedem früheren Zeitpunkt wäre diese Haltung eine Donquichotterie gewesen, ein zum Scheitern verurteilter Traum. Gemäß einer vom Vatikan über lange Zeit praktizierten Regel war der Besitz von Bibeln nur Priestern erlaubt, was vor allem für Übersetzungen aus dem Lateinischen in lebende Sprachen galt. Es war ein Leichtes, diese Regel durchzusetzen, denn Bibeln waren äußerst rar und kostspielig. Um 1450, als Johannes Gutenberg das erste Buch – eine lateinische Bibel – druckte, existierten in ganz Europa nur insgesamt 30 000 Bücher, somit wäre etwa auf alle 2500 Menschen ein Buch gekommen. Als Luther 1517, also nur 60 Jahre später, die Reformation ins Rollen brachte, waren bereits 20 Millionen Bücher gedruckt worden, und die meisten davon waren Bibeln.
In den ersten hundert Jahren nach dem Druck der ersten englischsprachigen Bibeln verdreifachte sich in England die Alphabetisierungsrate. Millionen Christen konnten nun Luthers selbst gezimmertes Christentum in die Tat umsetzen. Die Kirche und ihre Priesterelite wurden dabei links liegen gelassen. Sollte diese Innovation wirklich alles bisher Dagewesene von Grund auf verändern? Allerdings, denn keine andere Technologie im Jahrtausend zwischen der Erfindung des Schießpulvers und der Dampfmaschine stellte einen solchen Bruch dar wie die Entwicklung der Druckerpresse. Und der Protestantismus war das erste daraus entstehende flächendeckende Kulturphänomen.
Neben der Übertragung religiöser Macht auf gewöhnliche Menschen – wodurch sich die Freiheit des Einzelnen maßgeblich erweiterte – bestand Luthers zweite große Idee darin, dass der Glaube an die in der Bibel erzählten übernatürlichen Begebenheiten, insbesondere die Geschichten über Jesus, die einzige Voraussetzung dafür sei, ein guter Christ zu sein. Den Aufstieg in den Himmel konnte man sich also nicht durch gute Taten verdienen. Es zählte allein das, woran man glaubte. (Und legt man den frühen Protestantismus streng aus, war selbst das keine garantierte Eintrittskarte.)
Diese ursprüngliche Forderung der Protestanten scheint ein Sieg der Vernunft, schließlich vermochten Geld oder das Bestaunen von (gefälschten) Reliquien keine einzige Seele in den Himmel zu befördern. Doch tatsächlich ist sie lediglich gerechter und logischer, nicht unbedingt vernünftiger. Es ist, als stritte man sich darüber, ob die Müllerstochter aus Rumpelstilzchen bei einer falschen Aussprache des Zwergennamens freizulassen gewesen wäre oder nicht. Die Uneinigkeiten, die Protestanten und Katholiken entzweiten, drehten sich im Kern um die Regeln des Übernatürlichen innerhalb ihres gemeinsamen Fantasiekonstruktes.
Wie dem auch sei, aus der neuen protestantischen Religion bildete sich im Laufe des 16. Jahrhunderts eine uramerikanische Gesinnung heraus: Millionen von gewöhnlichen Leuten beschlossen, dass jeder das Recht habe, für sich zu entscheiden, was wahr oder falsch war, egal was irgendwelche hochtrabenden Experten dazu sagten. Und obendrein waren sie davon überzeugt, dass ein leidenschaftlicher, für Wunder offener Glaube der Schlüssel zu allem sei. Der Grundstein für Fantasyland war gelegt.
3Alles, was glänzt: Die Goldsucher
IMSELBENJAHRHUNDERThatten in Europa auch die Fantasien von weltlicher Herrlichkeit eine neue, aufregende Quelle der Inspiration gefunden, die alle Aufmerksamkeit auf sich zog. 1492 war Christoph Kolumbus gen Westen gesegelt, um einen kürzeren Seeweg von Europa nach Asien zu finden, der die Landroute über die Seidenstraße ersetzen konnte – ein unrealisierbarer Traum, damals wie auch die nächsten 400 Jahre. Statt Japan bekam Kolumbus am Ende die Bahamas. Doch immerhin hatte er eine Neue Welt entdeckt. Es war ein leerer Landstrich, auf dem man sich aus einer Distanz von fast 5000 Kilometern unermesslichen Reichtum und Ruhm lebhaft vorstellen konnte.
Weitere Entdecker aus Europa ließen nicht lange auf sich warten. Immer mehr machten sich auf den Weg, und viele von ihnen jagten dem Traum einer Nordwestpassage nach. Dieser Traum war es auch, der einen gewissen Captain John Smith Anfang des 17. Jahrhunderts dazu veranlasste, mit dem Geld einiger englischer Investoren in die Neue Welt aufzubrechen. Smith glaubte, der Potomac River führe ans andere Ende Nordamerikas bis zum Pazifischen Ozean, letztlich kam er aber nur bis Bethesda in Maryland. Eine Schiffspassage nach Asien war auch der große Traum des Engländers Henry Hudson, der 1609 in Albany, New York State, endete. Ein Jahr später finanzierten englische Geldgeber, die weiterhin an den Traum der arktischen Handelsroute glauben wollten, Hudsons zweiten Versuch. Diesmal schaffte er es anstatt nach China immerhin bis nach Ontario. Doch als Hudson seinen Weg in Richtung Westen fortsetzen wollte, brach seine Crew, die für seinen Traum weniger Begeisterung aufbringen konnte, eine Meuterei vom Zaun, und Captain Hudson ward nie wieder gesehen.
Die Spanier, die Kolumbus nachfolgten, steuerten in südwestliche Richtung, anstatt ergebnislos nach einer Nordwestpassage nach Indien zu suchen. Dort stießen sie auf hoch entwickelte Kulturen und deren Stadtsiedlungen: die Azteken in Mexiko und die Inkas in Südamerika. Und was sie bei dieser Gelegenheit auch fanden, war das Gold der Inkas und Azteken – welches sie stahlen, über ein Jahrhundert lang schürften und dazu benutzten, ein transatlantisches Weltreich aufzubauen.
Die Engländer neideten den Spaniern ihre plötzliche Macht – und ganz besonders das viele Gold der Neuen Welt.
Wenn aber in den südlichen Gefilden solche Schätze zu holen waren, warum nicht auch Tausende Kilometer weiter nördlich, in den Ländern, die England am nächsten lagen? Und so wurde an der Wende zum 17. Jahrhundert die Goldsuche zu einem Fetisch für englische Möchtegernkolonisten. Gleichzeitig war dies der Anfang eines wiederkehrenden Phänomens, auf das wir hier noch häufig stoßen werden: dass nämlich die Amerikaner in der Lage sind, um ein plausibles Stückchen Realität herum mit Begeisterung wunsch- oder angstgetriebene Märchen zu spinnen, von deren Wahrheit sie felsenfest überzeugt sind.
Ein junger Absolvent der Universität Oxford und Faktotum des Königshauses namens Richard Hakluyt gehörte während der 1580er- und 1590er-Jahre zu den leidenschaftlichsten und einflussreichsten Amerika-Enthusiasten Englands. Er pickte die Rosinen aus den Berichten früherer Entdecker – einige davon aus zweiter und dritter Hand – und setzte daraus ein köstliches Bild vom perfekten Paradies zusammen. All die Forschungsreisen ins östliche Nordamerika, schrieb er in einem ausladenden Manuskript, »beweisen ohne jeden Zweifel, dass Gold und Silber … wertvolle Edelsteine, Türkise und Smaragde … entdeckt wurden«, den gesamten Küstenstrich hinauf und hinab. Im südlichen Teil »barg das Land Gold und Silber«, und auch ein kurzes Stück gen Norden war mit Sicherheit Gold zu finden, denn »die Farbe der Landschaft spricht ganz und gar dafür«. Und auch noch weiter nördlich »werden Gold und Silber erwähnt«. Zu dieser Zeit wuchs die englische Bevölkerung stärker als die Wirtschaft des Landes, also schlug Hakluyt vor, die »untätigen Männer« nach Amerika zu verschiffen und sie in Goldminen arbeiten zu lassen.
Die Tatsache, dass der nördliche Teil der Neuen Welt bereits von Menschen bewohnt war, war äußerst ungünstig. Dennoch berichtete Hakluyt, dass die Ureinwohner »gute Menschen von sanfter und freundlicher Natur« seien, die sich »bereitwillig unterordnen« würden. Und nachdem die Bevölkerungsdichte in Nordamerika weniger als fünf Prozent der englischen betrug, erachteten die Neuankömmlinge das Land als praktisch leer, als eine Tabula rasa, die sich in eine Art englisches Utopia verwandeln ließe.
Hakluyts fieberhafte Chronik Amerikas war von einem dreißigjährigen Aristokraten, Dichter, Schwerenöter, Abenteurer, eifrigen Protestanten und goldgierigen Amerika-Fan in Auftrag gegeben worden: Walter Raleigh. Er war ein charmanter, überbordender Senkrechtstarter – der klassische amerikanische Trendsetter, lange bevor es das englische Amerika überhaupt gab. Ab dem Augenblick, als er Hakluyts Bericht, der dem Zweck diente, Queen Elizabeth von der Kolonisierung zu überzeugen, in Händen hielt, vergingen gerade mal drei Jahre, bis er zu Sir Walter Raleigh avancierte. Er erhielt den königlichen Auftrag zur Ausbeutung und Unterwerfung der nordamerikanischen Ostküste und entsandte drei voneinander unabhängige englische Expeditionsteams, um das besagte Gold zu bergen. Sie fanden nichts.
Wenngleich Raleigh persönlich nie einen Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt hatte, glaubte er dennoch nicht nur an das Vorhandensein prächtiger Goldlager, sondern auch daran, den biblischen Garten Eden gefunden zu haben. Aus den Angaben der Bibel hatten englische Kleriker errechnet, dass das Paradies auf einer nördlichen Breite von fünfunddreißig Grad liegen müsse. Genau wie auf Roanoke Island!, stellten sie erfreut fest. Und damit noch nicht genug der neuen Beweise (die man immerhin vom Hörensagen kannte) für die wundersame Präsenz Gottes in Virginia: Das Buch eines Botanikers mit dem Titel Joyful News of the New World (Freudige Nachrichten aus der Neuen Welt) berichtete, dass es in Amerika manch einzigartige Pflanze gebe, die in der Lage sei, alle Krankheiten zu heilen. Ein berühmter englischer Dichter veröffentlichte seine »Ode to the Virginian Voyage«, worin er Virginia als das »einzige Paradies auf Erden« bezeichnete und als einen Ort, wo die Engländer »Perlen und Gold« finden würden. Nicht wenige Engländer glaubten daran, dass es sich buchstäblich um den neuen Garten Eden handelte.11 Nur leider war dem nicht so. Ein Großteil der ersten Siedler, die Raleigh losgeschickt hatte, wurde krank und starb. Daraufhin entsandte er eine zweite Expedition von Goldjägern. Auch diese scheiterte, und sämtliche Siedler kamen dabei ums Leben.
Doch Sir Walter hielt an seinem großen Traum vom Gold fest. Als es ihm 1595 bei seiner Reise nach Südamerika nicht gelang, die sagenumwobene goldene Stadt El Dorado aufzustöbern, hielt ihn das nicht davon ab, seine Fantasievorstellung in England weiter zu verbreiten. Er veröffentlichte ein Buch voll historischer Anekdoten fraglicher Herkunft, die dazu dienen sollten, seinem Traum einen Anstrich von Wahrheit zu geben. Somit wurde Raleigh zum Mitbegründer eines ausgeklügelten Pseudoempirismus, der in den folgenden Jahrhunderten zu einem permanenten Wesenszug der Berichterstattungen aus Fantasyland werden sollte, egal ob es sich dabei um Religion, Quacksalberei in der Wissenschaft, Verschwörungen oder irgendetwas anderes handelte, das gerade dringend verkauft werden musste.
1606 erteilte der neue König auf dem englischen Thron, Jakob I. (engl. James I.), trotz des desaströsen Ausgangs von Raleighs vorangegangenen Kolonisierungsversuchen, zwei weiteren privaten Unternehmungen den Auftrag zum Aufbau von Kolonien: der Virginia Company of London und der Virginia Company of Plymouth. Die südlichere Kolonie, die unter der Ägide Londons stand, wurde zu Ehren des Königs Jamestown genannt. Im königlichen Auftrag war das Hauptziel der Mission völlig unmissverständlich formuliert: »nach jeder Art Goldmine zu graben, zu schürfen und zu suchen … um das Gold in Besitz zu nehmen und sich daran zu erfreuen«. Zwei Jahrhunderte später schrieb Tocqueville: »Die Menschen, die man nach Virginia entsandte, waren Goldsucher. Kein einziger nobler Gedanke oder Plan stand hinter der Gründung der neuen Siedlungen.« Zwei Drittel der ersten Goldsucher kamen prompt ums Leben. Doch der Expeditionsleiter kehrte mit der Behauptung nach England zurück, Berge entdeckt zu haben, »die nach Gold aussahen«.
Hakluyt, einer der Leiter der London Company, schaffte es selbst nie bis nach Amerika, dennoch hörte er nicht auf, an das Gold zu glauben. Sicher, man habe noch nichts gefunden, bis jetzt, räumte er 1609 bei einem Vortrag vor seinen Kollegen ein, jedoch habe ihn ein Engländer, der indianische Sprachen beherrsche und Mitglied einer früheren Expedition gewesen sei, darüber informiert, dass die Indianer ihm mehrmals von einer Stelle südwestlich des alten Stützpunktes in Virginia erzählt hätten, wo jede Menge »rotes geschmolzenes Metall« zu finden sei. Darüber hinaus hätten auch die eigenen Indianer kürzlich von der ein oder anderen üppigen Mine berichtet, und zwar nur ein Stückchen westlich der verlassenen Siedlung.
Es wurde kein Gold gefunden. Selbst Captain John Smith, der nicht nach Gold, sondern einer schiffbaren Westpassage in den Pazifik suchte, war nicht gänzlich vor Leichtgläubigkeit gefeit. So nahm er die Behauptung eines Ureinwohners, die »Leute von Chesapeake Bay jagten in den Bergen nach Affen«, für bare Münze. Doch er war dafür bekannt, nicht an den Traum vom schnellen Reichtum durch Bodenschätze zu glauben. »Es gab kein Gespräch, keine Hoffnung, keine Arbeit, wo es nicht darum ging, Gold zu schürfen, zu verarbeiten, zu raffinieren, zu transportieren. Goldene Versprechen, die in der Hoffnung auf eine satte Belohnung alle Menschen zu Sklaven machten«, schrieb Smith über seine Kolonialgefährten in Jamestown. Tatsächlich entpuppte sich das Jamestown-Erz, das in der Kolonie geschürft, verarbeitet und nach England verschifft wurde, als Eisenpyrit – Narrengold.
Die nervösen Investoren in London forderten von den Kolonisten, wenigstens einen Klumpen echten Goldes zutage zu fördern. 1610 – drei Jahre dauerte die Operation nun bereits – entsandte man einen Mann, der die Sache endlich geradebiegen sollte. Seine Ankunft kam gerade recht, denn die Siedler, die noch am Leben geblieben waren, hatten ihren Traum endgültig aufgegeben und waren dabei, die Segel für die Heimfahrt nach England zu setzen. Lord De La Warr überzeugte sie, wieder aus ihren Booten auszusteigen und neuen Mut zu fassen. Er führte eine Delegation ins Landesinnere, wo die Männer einige Ureinwohner töteten und schließlich … wieder kein Gold fanden.
Das Goldfieber beschränkte sich aber nicht auf die südliche Kolonie. Die 120 Menschen, die zur gleichen Zeit von der Plymouth Company nach Amerika geschickt wurden, gingen an der Küste von Maine an Land, und auch sie hatten es auf Gold und einen schnelleren Weg nach Asien abgesehen. Doch sie fanden keine Spur, weder des einen noch des anderen. Die Verzweiflung, mit der sie an ihrem Glauben an das Unmögliche festhielten, ist so komisch wie traurig zugleich. »Immer noch kein Gold«, schrieb das Oberhaupt der Kolonie in einem Brief nach Hause, »doch die Ureinwohner beteuern unablässig, dass hier Muskat, Macis und Zimt vorkommen.« Tropische Gewürze in Neuengland? »Auch versichern sie mir, dass … nicht mehr als sieben Tagesreisen von unserem Stützpunkt … ein Meer liegt, das groß, breit und tief ist … und das nichts anderes sein kann als das Südliche Meer, das an die Regionen Chinas grenzt.« Anders als ihre Landsleute in Virginia fanden sich die englischen Siedler in Maine schnell mit der Realität ab und gestanden sich ihre Niederlage ein. Die erste Hälfte verließ das Land wenige Monate nach der Ankunft, der Rest folgte ein halbes Jahr später. Sie waren einfach nicht leichtgläubig und fantasievoll genug, um Amerikaner zu werden.
Aber halt! Vielleicht hatten sie einfach nicht mit den richtigen Ureinwohnern gesprochen! Oder an den richtigen Orten nachgesehen! Im Jahr 1614 brach eine weitere Expedition der Plymouth Company nach Neuengland auf, diesmal ausschließlich auf der Suche nach Gold. Sie hatten einen Insider an Bord, einen Ureinwohner, der von einem früheren Schiff der Plymouth Company vor Cape Cod gefangen genommen worden war. Der Indianer hatte die Zeit seiner Gefangenschaft in London dazu genutzt, Englisch zu lernen und zu durchschauen, wie versessen die Männer, die ihn gefangen hielten, auf das glänzende Metall waren, sodass er sich schließlich eine maßgeschneiderte Geschichte für sie zurechtlegte: Auf meiner Heimatinsel gibt es eine Goldmine, log er, ich führe euch hin, und sie gehört euch. Als die Engländer vor Martha’s Vineyard vor Anker gingen, sprang er von Bord, während seine Stammesbrüder ihm Rückendeckung gaben, indem sie von Kanus aus einen Pfeilregen abfeuerten. Die Engländer erkannten, dass sie hereingelegt worden waren, und segelten nach Hause.
Weiter südlich in Virginia waren unterdessen mehr als 6000 Menschen nach Jamestown ausgewandert, und so entsprach die Einwohnerzahl im Jahr 1620 jener einer mittelgroßen englischen Stadt. Mindestens ein Viertel der Ankömmlinge war umgekommen – nicht jedoch der unzerstörbare Traum. Immer wieder kamen neue Siedler an, die fest daran glaubten, bis die Hoffnung abermals in Enttäuschung umschlug. Es war ein Goldrausch ohne Gold. Fünfzehn Jahre nach der Gründung von Jamestown schrieb ein Siedler einem Freund, um von ihm eine Lieferung Nägel, Besteck, Essig und Käse zu erbitten. In dem Brief rechtfertigte er sich auch dafür, dass er es noch nicht bewerkstelligt hatte, reich zu werden. »Aufgrund meiner Krankheit und Schwäche war ich nicht in der Lage, die Berge und Täler dieser Länder zu durchstreifen, doch nun wird es jeden Tag so weit sein, und ich werde in die Berge aufbrechen, denn dort gibt es sowohl Gold als auch Silber.«
Krankheit, Schwäche und Tod wüteten weiter. Das Gold hingegen blieb ein Hirngespinst. Zwei Jahrzehnte des siebzehnten Jahrhunderts waren bereits vergangen, und das englische Amerikaprojekt war immer noch ein scheiterndes Start-up, ein leeres Versprechen mit tragischen Konsequenzen, eine Farce. Doch daheim in England hörten die Investoren und deren Berater nicht auf, Poster, schönfärberische Zeugenberichte und Dutzende von Büchern und Broschüren zu drucken, Lotterien zu veranstalten und raffgierig jede Menge blauen Rauch zu erzeugen. Die ersten englischsprachigen Amerikaner waren also tendenziell eher naiver Natur oder aus der Verzweiflung heraus besonders gutgläubig. »Die meisten der 120 000 Vertragsknechte und Abenteurer, die im siebzehnten Jahrhundert in den [Süden] segelten«, zeigte sich der Historiker der University of Pennsylvania Walter McDougall in seinem Buch über amerikanische Geschichte – Freedom Just Around the Corner (Freiheit gleich ums Eck) – überzeugt, »hatten keine Ahnung, was sie erwartete, sondern waren schlicht der Propaganda der Sponsoren auf den Leim gegangen.« Der Historiker Daniel Boorstin geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er sagt, dass »die amerikanische Gesellschaft dadurch geformt [wurde], dass eine Art natürliche Auslese derjenigen Menschen stattgefunden hat, die bereitwillig an Werbung glaubten«. Die erste groß angelegte Werbekampagne der westlichen Welt zielte somit darauf ab, für die Gründung Amerikas genug Trottel und Träumer anzulocken.
Was das schnelle Geld betraf, war das Projekt Virginia ein totaler Reinfall. Die Siedler, die blieben, kehrten zu den bereits bekannten Strapazen der traditionellen Landwirtschaft zurück. Was ihnen in dieser Situation die Haut rettete, war eine Kulturpflanze und gleichzeitig Vorbote eines gewissen Amerikas der Zukunft – raffiniert, neu und hip, nicht wirklich notwendig und doch berauschend mit Suchtfaktor: Tabak.
Ein weiterer führender Amerika-Fan war Francis Bacon, der englische Staatsmann und Philosoph, der zu jener Zeit den Boden für die Wissenschaft und für die Aufklärung ebnete. Er war erfrischend realistisch, was das Projekt »Neue Welt« betraf, und es machte den Anschein, als verstünde er besser als jeder andere seiner protoamerikanischen Zeitgenossen, wie verzerrend Wunschdenken manchmal sein konnte, wie die Fantasie über Fakten triumphieren konnte. 1620 schrieb er folgende Zeilen:
»Hat der menschliche Verstand einmal eine Meinung angenommen (sei es, weil es die vorherrschende ist, sei es, dass sie ihm sonst wie angenehm ist), dann interpretiert er alle anderen Dinge so, dass sie diese Meinung stützen und mit ihr übereinstimmen. Und wenn auch die Anzahl und die Bedeutung der Fälle, die gegen sie sprechen, größer sind, so werden diese doch von ihm entweder vernachlässigt und unterschätzt oder aber dadurch, dass er irgendeine Unterscheidung trifft, abgetan und zurückgewiesen; und dies alles deswegen, damit durch diese konsequente, aber schädliche Festlegung die Autorität seiner früheren Schlussfolgerungen unangetastet bleiben kann.
Und so verhält es sich mit allen Formen des Aberglaubens, ob sich dieser nun auf Astrologie, Träume, Omen, göttliche Strafen oder dergleichen bezieht; und die Menschen, die sich an solchen Nichtigkeiten erfreuen, notieren die Ereignisse, die sie bestätigen, wenn aber ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, was viel öfter geschieht, dann kümmern sie sich nicht darum und gehen darüber hinweg.«
In seinen Londoner Kreisen verkündete Bacon, »Gold, Silber und schneller Profit« seien alles, was das Kolonisierungsprojekt antreibe, nicht »die Verbreitung des christlichen Glaubens«. Doch für die unmittelbar bevorstehende nächste Welle zukünftiger Amerikaner war die Verkündung einer speziellen Mischung aus christlichem Aberglauben, aus Omen und göttlichen Weisungen mehr als nur ein Lippenbekenntnis, das den Traum vom schnellen Reichtum übertünchen sollte. Für diese Menschen ging es bei der Kolonisierung ausschließlich um den Export ihrer übernatürlichen Fantasievorstellungen in die Neue Welt.
11 Über ein Jahrhundert später nutzte ein englischer Grundstücksmakler bei dem Versuch, Georgia zu vermarkten, immer noch dieselben Verkaufsargumente: Es sei »das herrlichste Land des gesamten Universums« und zumindest ebenbürtig mit dem biblischen »Paradies, liege es doch auf demselben Breitengrad wie Palästina … bestimmt von Gottes eigener Hand … zum Segen … eines auserwählten Volkes.« Und außerdem, da war er ganz sicher, gebe es dort Silberminen.
4Wir bauen uns den Himmel auf Erden: Die Puritaner
DERTRAUMDERersten englischen Siedler vom großen Gold oder einer Nordwestpassage war nicht vollends verrückt. Zweihundert Jahre später wurde in Virginia tatsächlich Gold entdeckt und abgebaut. Und dreihundert Jahre später gelang es einem winzigen Schiff, auf einer Nordwestpassage durch das kanadische Eismeer den Pazifik zu erreichen. Doch vernünftige Menschen hätten in den 1620ern, nach vier Jahrzehnten gescheiterter Kolonisierungsversuche, wohl kaum weiterhin Leben wie auch Hab und Gut aufs Spiel gesetzt, um an ihren unrealistischen Träumen festzuhalten. Die ursprünglichen Hypothesen, die haufenweise Gold und einen Seeweg nach Asien versprachen, waren – wie Logiker sagen würden – falsifizierbar, und zu guter Letzt wurden sie auch falsifiziert. Es gab kein Gold. Und keine Abkürzung nach China und Indien. Unter bestimmten Umständen war es europäischen Auswanderern sogar möglich, in der Neuen Welt ihren Lebensunterhalt zu verdienen, in seltenen Fällen vielleicht sogar reich zu werden, aber letztendlich nur mit den Mitteln, die ihnen auch in der Alten Welt zur Verfügung standen, nämlich indem sie etwas züchteten, produzierten und verkauften. Als man im 17. Jahrhundert in Virginia die Suche nach Gold zugunsten des Tabakanbaus aufgab, drängten Empirie und Pragmatismus die Träumereien und das Wunschdenken zurück.
Übernatürliche religiöse Überzeugungen sind jedoch nicht falsifizierbar. Die Existenz eines Gottes, der die Welt schuf und nach einem feststehenden ewigen Plan lenkt, die Wunder und die Auferstehung Jesu, Himmel, Hölle, die Präsenz des Teufels auf Erden – die Unwahrheit all dessen wird niemals bewiesen werden können.
Königin Elisabeth I. war die erste protestantische Monarchin Englands. Auch ihr Nachfolger Jakob (King James) war Protestant. Als eine der ersten königlichen Amtshandlungen gab er eine neue, offizielle Übersetzung der Bibel in Auftrag – die nach ihm benannte King-James-Version: heute, vierhundert Jahre später, immer noch der beliebteste Bibeltext in Amerika. Die Arbeit dazu war gerade im Gange, als King James, das weltliche Oberhaupt der Church of England, die beiden zuvor erwähnten Unternehmen damit betraute, in Amerika ein englisches Imperium aufzubauen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich in den Zielsetzungen der Unternehmen auch die Evangelisation wiederfand, zur »Verbreitung des christlichen Glaubens unter Menschen, die immer noch in Dunkelheit und elendem Unwissen leben«, unter den »Ungläubigen und Wilden«, den Ureinwohnern. Anfang des 17. Jahrhunderts war bereits ein Großteil der Engländer (und ein Drittel der Europäer) protestantisch. In weniger als einem Jahrhundert war eine Sekte, die gegen das Establishment aufbegehrt hatte, die Protestanten nämlich, selbst zum Establishment geworden.
Doch im Vergleich zur römisch-katholischen Kirche, mit ihrem bewährten System einer globalen Hierarchie unter einem obersten Anführer, war das neue protestantische Christentum von Natur aus aufsässig und instabil, war es doch erst wenige Generationen zuvor von kompromisslosen Rebellen gegründet worden, die sich den Deutungen und Regeln des allwissenden, allmächtigen Klerus nicht unterwerfen wollten. In einer Zeit, als bahnbrechende Innovationen wie die Druckerpresse, der aufstrebende Welthandel, die Renaissance, der Aufstieg der modernen Wissenschaft und die Aufklärung im Rest von Europa Kultur und Wirtschaft reformierten, war der Protestantismus als innovative, neue Religion Teil dieser umfassenden Neuerungswelle. Sein einzigartiges Verkaufsargument war radikal: Wenn die offiziellen Hirten vom Weg abkommen, können und müssen fromme Normalbürger eigenständig über eine neue, verbesserte Wahrheit entscheiden. Das heißt, jedes Individuum kann durch das Studium der Heiligen Schrift die korrekte Bedeutung der christlichen Fantasien bestimmen. Das seit seiner Gründung dem Protestantismus zugrunde liegende Bekenntnis zu einer kompromisslosen, dezentralisierten, hausgemachten Wahrheitsfindung und spirituellen Reinheit führte zwangsläufig zur Herausbildung von selbstgefälligen Splittergruppen.





























