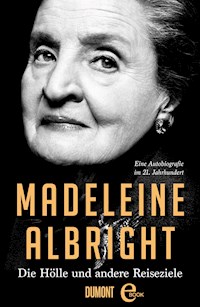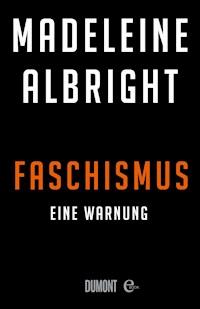
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Manche mögen dieses Buch und besonders seinen Titel alarmierend finden. Gut!« MADELEINE ALBRIGHT Weltweit kommt es zu einem Wiedererstarken anti-demokratischer, repressiver und zerstörerischer Kräfte. Die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright zeigt, welche großen Ähnlichkeiten diese mit dem Faschismus des 20. Jahrhunderts haben. Die faschistischen Tendenzen treten wieder in Erscheinung und greifen in Europa, Teilen Asiens und den Vereinigten Staaten um sich. Albrights Familie stammt aus Prag und floh zweimal: zuerst vor den Nationalsozialisten, später vor dem kommunistischen Regime. Auf Grundlage dieser Erlebnisse und der Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer diplomatischen Karriere sammelte, zeichnet sie die Gründe für die Rückkehr des Faschismus nach. Sie identifiziert die Faktoren, die zu seinem Aufstieg beitragen und warnt eindringlich vor den Folgen. Doch Madeleine Albright bietet auch klare Lösungsansätze an, etwa die Veränderung der Arbeitsbedingungen und das Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen nach Kontinuität und moralischer Beständigkeit. Sie zeigt, dass allein die Demokratie politische und gesellschaftliche Konflikte mit Rationalität und offenen Diskussionen lösen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
»MANCHE MÖGEN DIESES BUCH UND BESONDERS SEINEN TITEL ALARMIEREND FINDEN. GUT!«MADELEINE ALBRIGHT
Weltweit kommt es zu einem Wiedererstarken anti-demokratischer, repressiver und zerstörerischer Kräfte. Die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright zeigt, welche großen Ähnlichkeiten diese mit dem Faschismus des 20.Jahrhunderts haben. Die faschistischen Tendenzen treten wieder in Erscheinung und greifen in Europa, Teilen Asiens und den Vereinigten Staaten um sich.
Albrights Familie stammt aus Prag und floh zweimal: zuerst vor den Nationalsozialisten, später vor dem kommunistischen Regime. Auf Grundlage dieser Erlebnisse und der Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer diplomatischen Karriere sammelte, zeichnet sie die Gründe für die Rückkehr des Faschismus nach. Sie identifiziert die Faktoren, die zu seinem Aufstieg beitragen und warnt eindringlich vor den Folgen.
Doch Madeleine Albright bietet auch klare Lösungsansätze an, etwa die Veränderung der Arbeitsbedingungen und das Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen nach Kontinuität und moralischer Beständigkeit. Sie zeigt, dass allein die Demokratie politische und gesellschaftliche Konflikte mit Rationalität und offenen Diskussionen lösen kann.
Credit: © Timothy Greenfield-Sanders/Getty Images © Brosche: Peace Dove by Cécile et Jeanne
Madeleine Albright wurde 1937 als Marie Jana Korbelová in Prag geboren. Ihre Familie emigrierte 1948 in die USA. Seit den Siebzigerjahren prägte Albright die amerikanische Innen- und Außenpolitik als Mitglied der Demokratischen Partei. Von 1978 bis 1981 arbeitete sie im US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsrat und ab 1993 als US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Sie war von 1997 bis 2001 unter Präsident Bill Clinton Außenministerin der USA. Seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt ist sie als Universitätsdozentin tätig und leitet eine Consulting-Firma in Washington. Bis heute ist Madeleine Albright eine wichtige Stimme der internationalen Politik und gehört zu den beliebtesten Politikern der USA.
Bernhard Jendricke arbeitet seit mehr als dreißig Jahren beim Übersetzerkollektiv Druck-Reif. Er übersetzte u.a. Texte von Clare Clark, Frank Stella, Gore Vidal, Adam Grant und Hillary Clinton.
Thomas Wollermann
Madeleine Albright
mit Bill Woodward
FASCHISMUS
Eine Warnung
Aus dem Englischen von Bernhard Jendricke und Thomas Wollermann
eBook 2018 Die amerikanische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel ›Fascism. A Warning‹ bei HarperCollins Publishers, New York. Published by arrangement with Harper, an imprint of HarperCollins Publishers, LLC © Copyright 2018 by Madeleine Albright © 2018 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Übersetzung: Bernhard Jendricke, Thomas Wollermann, Kollektiv Druck-Reif Lektorat: Thomas Tilcher Umschlaggestaltung unter Verwendung der amerikanischen Ausgabe: Lübekke Naumann Thoben, Köln Umschlagabbildung: © Timothy Greenfield-Sanders/Getty Images © Brosche: Peace Dove by Cécile et Jeanne Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN eBook 978-3-8321-8410-0 www.dumont-buchverlag.de
Den Opfern des Faschismus damals und heute und allen, die den Faschismus der anderen und ihren eigenen bekämpfen
Jedes Zeitalter hat seinen eigenen Faschismus.Primo Levi
1
Eine Ideologie aus Angst und Schrecken
An dem Tag, als die Faschisten zum ersten Mal in mein Leben eingriffen, hatte ich gerade erst laufen gelernt. Es war der 15. März 1939. Verbände der deutschen Wehrmacht marschierten in das Land meiner Geburt, die Tschechoslowakei, ein, eskortierten Adolf Hitler auf den Hradschin und brachten Europa an die Schwelle eines zweiten Weltkriegs. Nachdem meine Eltern sich mit mir zehn Tage lang versteckt hatten, gelang uns die Flucht nach London. Dort trafen wir auf Exilanten aus ganz Europa, die wie meine Eltern die alliierten Kriegsanstrengungen unterstützten, während wir voller Sorge auf das Ende unserer Marter warteten.
Als die Nazis nach sechs zermürbenden Jahren kapitulierten, kehrten wir hoffnungsfroh in unsere Heimat zurück und machten uns voll Eifer daran, uns ein neues Leben in einem freien Land aufzubauen. Mein Vater nahm seine Tätigkeit im tschechoslowakischen Außenministerium wieder auf, und eine Zeit lang schien alles gut. Dann, im Jahr 1948, fiel unser Land in die Hände der Kommunisten. Mit der Demokratie war es auf einen Schlag vorbei, und meine Familie wurde erneut ins Exil getrieben. Auf den Tag genau drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs trafen wir in den Vereinigten Staaten ein, wo man uns unter dem wachsamen Blick der Freiheitsstatue als Flüchtlinge willkommen hieß. Um mich, meine Schwester Kathy und meinen Bruder John zu schonen und unser Leben möglichst normal erscheinen zu lassen, erzählten uns unsere Eltern nicht, was wir erst Jahrzehnte später erfahren sollten: dass drei unserer Großeltern und zahlreiche Tanten, Onkel sowie Cousinen und Cousins zu den Millionen Juden gehörten, die durch das Verbrechen, in dem der Faschismus gipfelte, den Holocaust, umgekommen waren.
Ich war elf Jahre alt, als ich in die Vereinigten Staaten kam, und hatte keinen größeren Ehrgeiz, als ein typischer amerikanischer Teenager zu werden. Ich legte meinen europäischen Akzent ab, las stapelweise Comichefte, hing ständig mit dem Ohr am Transistorradio und wurde süchtig nach Kaugummi. Ich tat alles, um mich anzupassen, aber irgendwo tief in mir war auch stets der Gedanke, dass wir in einer Zeit leben, in der in weiter Ferne getroffene Entscheidungen Tod oder Leben bedeuten konnten. Später, in der Schule, gründete ich einen Klub für Außenpolitik, ernannte mich selbst zu dessen Präsidentin und regte zu Diskussionen über alle möglichen Themen an, vom Titoismus bis hin zu Gandhis Grundhaltung der Satyagraha (»Die Kraft, geboren aus Wahrheit und Liebe«).1
Meine Eltern genossen die Freiheiten, die wir in unserer Wahlheimat vorfanden. Mein Vater, der schon bald eine Stellung als Professor an der Universität von Denver erhielt, schrieb Bücher über die Gefahr der Tyrannei und machte sich Sorgen, die Amerikaner könnten sich so sehr an die Freiheit gewöhnt haben – sich »allzu frei« fühlen, wie er schrieb –, dass sie die Demokratie womöglich als selbstverständlich betrachteten. Nachdem ich selbst eine Familie gegründet hatte, rief mich meine Mutter jedes Jahr am 4. Juli an, um nachzuprüfen, ob ihre Enkelkinder auch wirklich patriotische Lieder sangen und an der Parade teilgenommen hatten.
Viele Menschen in den Vereinigten Staaten neigen dazu, die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zu romantisieren – sich eine Periode himmelblauer Unschuld auszumalen, in der sich alle einig waren, dass Amerika ein großartiges Land sei, dass jede Familie einen verlässlichen Ernährer hatte und die neuesten Haushaltsgeräte besaß, dass die Kinder alle Erwartungen übertrafen und die Lebensperspektive einfach nur rosig war. In Wahrheit jedoch herrschte in der Zeit des Kalten Kriegs ständig Angst, nicht nur vor dem immer noch bedrohlichen Schatten des Faschismus. Als ich im Teenageralter war, entdeckte man in den Zähnen von Babys eine gegenüber dem natürlichen Normalwert fünfzigmal höhere Konzentration des radioaktiven Elements Strontium 90 – eine Folge der Atomtests. Praktisch jede Stadt verfügte über eine Zivilschutzleitung, die auf den Bau von privaten Atomschutzbunkern drängte, bevorratet mit Dosengemüse, einem Monopoly-Spiel und Zigaretten. Die Kinder in den Großstädten erhielten Metallmarken mit ihrem eingeprägten Namen, damit man sie identifizieren konnte, sollte das Schlimmste eintreten.
Als ich älter wurde, trat ich in die Fußstapfen meines Vaters und wurde Professorin. Zu meinen Spezialgebieten gehörte Osteuropa, deren Staaten als Satelliten einer totalitären Sonne abgetan wurden. Es galt als abgemacht, dass dort niemals etwas Interessantes geschehen und sich nie etwas Bedeutendes ändern würde. Marx’ Traum vom Arbeiterparadies war zu einem orwellschen Albtraum verkümmert; Konformität galt als höchstes Gut, Spitzel beobachteten mit Argusaugen jeden Wohnblock, ganze Länder lebten hinter Stacheldraht und Regierungen behaupteten, Unten sei Oben, Schwarz sei Weiß.
Als sich dann schließlich doch etwas veränderte, erfolgte dies in einem Tempo, das staunen ließ. Im Juni 1989 führten in Polen die jahrzehntelang erhobenen Forderungen von Werftarbeitern und das Wirken eines in Wadowice geborenen Papstes eine demokratische Regierung herbei. Im Oktober desselben Jahres wurde in Ungarn eine demokratische Republik proklamiert, und am 9. November fiel die Berliner Mauer. In diesen wundersamen Tagen meldeten unsere Fernsehsender jeden Morgen Dinge, die lange unmöglich erschienen waren. Unvergesslich sind mir die großen Momente der Samtenen Revolution in meinem Geburtsland, der Tschechoslowakei – einer Revolution, die diese Bezeichnung erhielt, weil sie weitgehend ohne Waffengewalt und Blutvergießen verlief. Es war an einem frostig kalten Nachmittag Ende November. Auf dem historischen Wenzelsplatz in Prag ließen 300000 Demonstranten ihre Schlüssel klingeln, gleichsam als Glocken, die das Ende der kommunistischen Herrschaft einläuteten. Auf einem Balkon über der Menge stand Václav Havel, der mutige Dramatiker, der sechs Monate zuvor als politischer Häftling eingekerkert gewesen war und fünf Wochen später den Amtseid als Präsident einer freien Tschechoslowakei ablegen sollte.
In jenem Moment gehörte ich zu den vielen Menschen, die spürten, dass die Demokratie ihre härteste Prüfung bestanden hatte. Die einst mächtige UdSSR, mürbe geworden durch wirtschaftliche Schwäche und ideologische Fadenscheinigkeit, zerbarst wie eine umgestürzte Vase auf dem harten Steinboden, wodurch die Ukraine, der Kaukasus, die baltischen Staaten und Zentralasien die Freiheit gewannen. Das nukleare Wettrüsten endete, ohne dass jemand pulverisiert wurde. Im fernen Osten schüttelten Südkorea, die Philippinen und Indonesien ihre langjährigen Diktatoren ab. Im Westen machten die lateinamerikanischen Militärherrscher den Weg für gewählte Präsidenten frei. In Afrika befeuerte die Freilassung Nelson Mandelas – auch ein politischer Häftling, der später Präsident seines Landes wurde – die Hoffnung auf eine Wiederauferstehung der ganzen Region. Weltweit gesehen wuchs die Zahl der Länder, die die Bezeichnung »Demokratie« verdienten; Ende der Achtzigerjahre waren es nur 35, doch nur zwei Jahre später waren es mehr als 100Staaten.
Im Januar 1991 verkündete George H. W. Bush vor dem US-Kongress, das Ende des Kalten Kriegs sei »ein Sieg für die gesamte Menschheit«; Amerikas Führerschaft habe »auf entscheidende Weise dazu beigetragen, dies möglich zu machen«.2 Auf der anderen Seite des Atlantiks ergänzte Havel: »Europa strebt danach, eine historisch gesehen neue Ordnung zu erschaffen durch den Prozess der Vereinigung … ein Europa, in dem der Mächtigere nicht länger in der Lage sein wird, den weniger Mächtigen zu unterdrücken, in dem es nicht mehr möglich sein wird, Konflikte gewaltsam zu lösen.«3
Heute, mehr als ein Vierteljahrhundert später, müssen wir uns fragen, was aus jener hehren Vision geworden ist; warum scheint sie immer mehr zu verblassen, anstatt klarer zu werden? Warum ist die Demokratie heute »Angriffen ausgesetzt und auf dem Rückzug«, wie die NGO Freedom House konstatiert?4 Warum versuchen viele Menschen in Machtpositionen, das öffentliche Vertrauen in Wahlen, in die Justiz, in die Medien und – was die grundlegenden Fragen zur Zukunft unseres Planeten angeht – in die Wissenschaft zu untergraben? Warum ließ man zu, dass sich gefährliche Spaltungen entwickelten wie die zwischen Reich und Arm, Stadt und Land, Gebildeten und Ungebildeten? Warum haben die Vereinigten Staaten – zumindest vorläufig – ihre globale Führungsrolle aufgegeben? Und warum müssen wir sogar jetzt noch, im 21. Jahrhundert, erneut über Faschismus sprechen?
Ein Grund dafür ist, offen gesagt, Donald Trump. Wenn wir uns den Faschismus als eine alte, fast verheilte Wunde vorstellen, bedeutete Trumps Amtsantritt im Weißen Haus, den Verband herunterzureißen und am Schorf zu kratzen.
Für die politische Klasse Washingtons – Republikaner, Demokraten und Unabhängige gleichermaßen – war die Wahl Trumps derart bestürzend, dass ein Komiker in einem alten Stummfilm in einem solchen Fall seinen Hut mit den Händen gepackt und ihn sich über beide Ohren gezogen hätte, wonach er abrupt hochgesprungen und geradewegs auf dem Hintern gelandet wäre. Die Vereinigten Staaten hatten auch früher schon Präsidenten mit Fehlern; genau genommen hatten wir nie andere, aber wir hatten in neuerer Zeit noch nie einen Regierungschef, dessen Äußerungen und Handlungen so sehr allen demokratischen Idealen spotteten.
Von Beginn seines Wahlkampfs an bis zum Einzug ins Oval Office hat sich Donald Trump verächtlich über die Institutionen und Prinzipien geäußert, die die Grundlage einer offenen, transparenten Regierung darstellen. Dabei würdigte er den politischen Diskurs in den Vereinigten Staaten systematisch herab, offenbarte eine erstaunliche Missachtung von Fakten, beleidigte seine Amtsvorgänger und drohte damit, seine Gegenkandidatin »einsperren« zu lassen. Er schikanierte Mitglieder seiner eigenen Regierung, verunglimpfte Journalisten angesehener Medien als »Feinde des amerikanischen Volkes«, verbreitete Unwahrheiten über die Zuverlässigkeit des Wahlverfahrens in den USA, propagierte gedankenlos eine nationalistische Wirtschafts- und Handelspolitik, diffamierte Einwanderer und deren Herkunftsländer und zeigte gegenüber den Anhängern einer der Weltreligionen eine paranoide Borniertheit.5
Für Regierungsvertreter anderer Länder mit autokratischen Tendenzen sind diese Exzesse ein gefundenes Fressen. Anstatt antidemokratische Kräfte in die Schranken zu weisen, macht Trump es ihnen leicht – sie können sich auf ihn berufen. Bei meinen Reisen höre ich immerzu dieselben Fragen: Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, die Presse würde stets lügen, wie kann man dann Wladimir Putin vorwerfen, dass er dasselbe behauptet? Wenn Trump behauptet, Richter seien voreingenommen, und die amerikanische Justiz als »Lachnummer«6 verhöhnt, wie ließe sich dann verhindern, dass ein autokratischer Staatschef wie Duterte von den Philippinen sein eigenes Rechtswesen diskreditiert? Wenn Trump Oppositionspolitiker des Hochverrats bezichtigt, bloß weil sie ihm nicht applaudieren, welche Möglichkeit haben dann noch die USA, gegen die Inhaftierung politischer Häftlinge in anderen Ländern zu protestieren? Wenn der Führer des mächtigsten Landes das Leben als einen Kampf aller gegen alle ansieht, in dem jeder Vorteil auf Kosten anderer errungen wird, wer wird dann das Banner der internationalen Zusammenarbeit hochhalten, wenn sie zur Lösung der drängendsten Probleme gebraucht wird?
Staatslenker haben die Pflicht, den Interessen ihres Landes auf beste Weise zu dienen – im Grunde eine Binsenweisheit. Wenn Donald Trump also »America first« als Parole ausgibt, konstatiert er nur eine Selbstverständlichkeit. Kein ernsthafter Politiker hat jemals vorgeschlagen, Amerika auf den zweiten Rang zu verweisen. Nicht dieses Ziel ist problematisch. Was Trump von allen Präsidenten seit dem kläglichen Trio Harding, Coolidge und Hoover unterscheidet, ist seine Auffassung davon, wie Amerikas Interessen am besten zu verwirklichen seien. Er betrachtet die Welt als ein Schlachtfeld, auf dem jedes Land die Absicht verfolgt, alle anderen zu dominieren, auf dem die Staaten gegeneinander konkurrieren wie Projektentwickler auf dem Immobiliensektor mit dem Ziel, die Rivalen zu ruinieren und aus jedem Deal noch den letzten Cent an Profit herauszuholen.
Trumps Werdegang mag solches Denken erklären, und sicherlich gibt es in der internationalen Diplomatie und den internationalen Handelsbeziehungen Fälle, in denen eine klare Unterscheidung zwischen Gewinnern und Verlierern möglich ist. Doch zumindest seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Vereinigten Staaten die Haltung vertreten, dass durch ein gemeinsames Vorgehen Siege leichter zu erringen und dauerhafter sind, als wenn jedes Land für sich allein handelt.
Die Generation von Franklin D. Roosevelt und Harry S. Truman war der Ansicht, dass Staaten am besten gediehen, wenn sie gemeinsame Sicherheit, gemeinsamen Wohlstand und gemeinsame Freiheit anstrebten. Beispielsweise gründete der Marshallplan von 1947 auf der Erkenntnis, dass die amerikanische Wirtschaft stagnieren würde, wenn die europäischen Märkte nicht in der Lage wären, das zu kaufen, was die Farmer und Industrieproduzenten in den USA anzubieten hatten. »America first« hieß in diesem Fall, unseren europäischen (und asiatischen) Partnern bei der Aufgabe zu helfen, ihre Volkswirtschaften zu entwickeln. Dasselbe Denken stand hinter Trumans Point-IV-Programm, mit dem die Vereinigten Staaten in Lateinamerika, Afrika und im Nahen Osten wirtschaftliche Aufbauhilfe leisteten. Eine vergleichbare Herangehensweise im Sicherheitsbereich war uns ebenso dienlich. Präsidenten von Roosevelt bis Obama versuchten, Verbündeten zu helfen, sich selbst zu schützen und eine kollektive Verteidigung gegen gemeinsame Gefahren zu schaffen. Wir taten das nicht aus Wohltätigkeit, sondern weil wir am eigenen Leib erfahren hatten, dass es über kurz oder lang uns selbst gefährlich werden konnte, die Probleme anderer Länder unbeachtet zu lassen.
Eine globale Führungsrolle ist keine Aufgabe, aus der man sich irgendwann zurückziehen kann. Alte Gefahren verschwinden kaum jemals vollständig, und neue ziehen mit jeder Morgendämmerung herauf. Sich mit ihnen effektiv auseinanderzusetzen war nie einfach nur eine Frage von Geld und Macht. Länder und Völker müssen dafür ihre Kräfte bündeln, und das geschieht nicht von allein. Auch wenn die Vereinigten Staaten im Lauf ihrer ereignisreichen Geschichte viele Fehler gemacht haben, so haben sie doch ihre Fähigkeit bewahrt, andere zu mobilisieren, weil sie sich für Ziele engagieren, die auch die meisten anderen anstreben – Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Die heutige Frage lautet, ob Amerika unter einem Präsidenten, der weder der internationalen Zusammenarbeit noch demokratischen Werten großes Gewicht beizumessen scheint, diese Art von Führungsrolle noch innehaben kann.
Als ich vor Kurzem einem Freund erzählte, dass ich an einem neuen Buch arbeite, fragte er nach dem Thema. »Fascism«, antwortete ich. Er sah mich erstaunt an. »Fashion?«, fragte er nach. Mein Freund lag gar nicht so falsch, denn der Faschismus ist tatsächlich in Mode gekommen und schleicht sich wie eine Schlingpflanze in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs ein. Bist du mit jemandem nicht einer Meinung? Schimpfe ihn einen Faschisten und entlaste dich damit von der Notwendigkeit, dein Argument mit Fakten zu belegen. 2016 war das Wort »Fascism« auf der Website des Wörterbuchs Merriam-Webster der am zweithäufigsten aufgerufene Begriff nach »surreal«, einem Wort, das nach der Präsidentenwahl im November plötzlich einen massiven Anstieg verzeichnete.
Wer den Begriff »Faschist« benutzt, offenbart sich selbst. Für Anhänger der extremen Linken passt diese Bezeichnung vermutlich auf jeden Wirtschaftsboss. Für die noch nicht Ultrarechten ist Barack Obama ein Faschist – außerdem ein Sozialist und heimlich auch ein Moslem. Ein widerspenstiger Teenager hält vielleicht jedes von den Eltern verhängte Handyverbot für Faschismus. Wenn Menschen ihren alltäglichen Frustrationen Luft verschaffen, wird das Wort millionenfach verwendet: Lehrer werden als Faschisten verunglimpft, ebenso Feministinnen, Machos, Yogalehrerinnen, Polizeibeamte, Vegetarier und Veganer, Bürokraten, Blogger, Radfahrer, Redakteure, Leute, die kürzlich das Rauchen aufgegeben haben, und sogar die Hersteller kindersicherer Verpackungen. Wenn wir uns weiterhin diesem Reflex hingeben, werden wir uns auch bald für berechtigt halten, alles Störende und jeden, der uns ärgert, als faschistisch oder als Faschisten zu bezeichnen – und dadurch diesen Begriff, der etwas Wichtiges aussagen sollte, verwässern und verharmlosen.
Was nun ist Faschismus wirklich, und woran erkennt man einen Faschisten? Diese Frage stellte ich Doktoranden an der Georgetown University – zwei Dutzend Studierende, die mit Papptellern, aus denen ihnen Lasagne auf die Kleidung suppte, auf dem Boden meines Wohnzimmers im Kreis saßen. Die Frage war schwerer zu beantworten als erwartet, weil es keine allgemeingültige oder rundum zufriedenstellende Definition gibt, auch wenn sich bereits zahllose Experten daran versucht haben. Es scheint so zu sein: Wann immer ein Fachmann »Heureka!« ruft und behauptet, eine stichhaltige Begriffsbestimmung gefunden zu haben, widersprechen ihm Kollegen entrüstet.
Trotz der Komplexität der Materie brannten meine Studenten darauf, es zu versuchen. Sie begannen von Grund auf, indem sie die Charakteristika benannten, die ihrer Ansicht nach am engsten mit diesem Begriff verbunden sind. »Eine Mentalität des ›wir gegen sie‹«, schlug jemand vor. Jemand anderer ergänzte »nationalistisch, autoritär, antidemokratisch«. Ein Dritter hob den Gewaltaspekt hervor. Ein Vierter überlegte laut, warum Faschismus fast immer als rechtsgerichtet betrachtet wird, und meinte: »Stalin war ebenso sehr Faschist wie Hitler.«
Eine Studentin meinte, Faschismus hänge oft mit Leuten zusammen, die einer bestimmten ethnischen Gruppe angehören, wirtschaftlich unter Druck stehen und das Gefühl haben, man würde ihnen etwas vorenthalten. »Es geht nicht so sehr darum, was die Leute haben«, sagte sie, »sondern darum, was sie ihrer Ansicht nach haben sollten – und wovor sie Angst haben.« Die Angst ist der Grund, warum der Faschismus emotional alle gesellschaftlichen Ebenen durchdringen kann. Eine politische Bewegung kann nicht ohne Unterstützung aus der Bevölkerung heranwachsen, aber der Faschismus ist von den Reichen und Mächtigen ebenso abhängig wie von dem Mann oder der Frau auf der Straße – von jenen, die viel zu verlieren haben, und jenen, die überhaupt nichts haben.
Diese Erkenntnis führte uns zu dem Gedanken, den Faschismus vielleicht weniger als politische Ideologie zu betrachten, sondern eher als Mittel zur Erringung von Macht und deren Erhalt. Zum Beispiel gab es in Italien in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts selbst ernannte Faschisten auf der Linken (die für eine Diktatur der Enteigneten eintraten), auf der Rechten (die einen autoritären korporatistischen Staat anstrebten) und in der politischen Mitte (die eine Rückkehr zur absoluten Monarchie forderten). Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) vertrat anfänglich Forderungen, die antisemitisch, xenophob und antikapitalistisch ausgerichtet waren, aber ebenso höhere Bezüge für Rentner, eine bessere Schulbildung für die arme Bevölkerung, ein Ende der Kinderarbeit und eine bessere Gesundheitsversorgung für Mütter mit einschloss. Die Nazis waren gleichzeitig Rassisten und, so sahen sie sich jedenfalls selbst, Sozialreformer.
Wenn der Faschismus weniger auf eine bestimmte Politik abzielt und es ihm mehr um die Erringung der Macht geht, wie steht es dann um die Taktiken der Führerschaft? Meine Studenten meinten, die faschistischen Führungsgestalten, die uns am stärksten im Gedächtnis geblieben sind, hätten sich durch ihr Charisma ausgezeichnet. Auf die eine oder andere Weise hätten alle eine emotionale Verbindung zu den Massen hergestellt und wie ein Sektenführer tiefe und oft hässliche Gefühle an die Oberfläche gebracht. Auf diese Weise dringen die Tentakel des Faschismus ins Innere einer Demokratie ein. Im Unterschied zu einer Monarchie oder einer Militärdiktatur, die der Gesellschaft von oben auferlegt wird, beziehe der Faschismus Energie aus dem Unmut von Männern und Frauen beispielsweise über die Niederlage im Krieg oder die hohe Arbeitslosigkeit, weil sie sich erniedrigt fühlen oder ihr Land in einem dramatischen Niedergang wähnen. Je schmerzhafter die Ursache des Unmuts, desto leichter gewinne ein faschistischer Führer Anhänger, indem er die Aussicht auf Erneuerung vorgaukelt oder zurückzuholen verspricht, was angeblich gestohlen wurde.
Wie die Initiatoren harmloserer Bewegungen beuteten diese säkularen Prediger den fast universellen menschlichen Wunsch nach Teilhabe an einer sinnvollen Aufgabe aus. Die geschickteren unter ihnen bewiesen ein Talent für Spektakel – für die Veranstaltung von Massenaufzügen mit martialischer Musik, aufpeitschender Rhetorik, lautem Jubel und zum Gruß erhobenen Armen. Treuen Anhängern boten sie als Lohn die Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft an, von der andere, die oft der Lächerlichkeit preisgegeben werden, ausgeschlossen sind. Um den Eifer der Massen anzustacheln, gebärdeten sich Faschisten gern aggressiv, militaristisch und – wenn die Umstände es erlauben – expansionistisch. Zur Sicherung der Zukunft wandelten sie Schulen zu Brutstätten für wahre Gläubige um, da sie danach strebten, »neue Männer« und »neue Frauen« zu erschaffen, die prompt gehorchen und keine Fragen stellen. Und, wie einer meiner Studenten bemerkte, »ein Faschist, der erst einmal ins Amt gewählt wurde, kann sich auf eine Legitimität berufen, die andere nicht haben«.
Was folgt nach der Erringung einer Machtposition? Wie festigt ein Faschist seine Herrschaft? Hierzu meldeten sich verschiedene Studenten zu Wort: »Indem er die Informationen kontrolliert«, sagte einer. »Und deshalb haben wir allen Grund, uns heute Sorgen zu machen«, ergänzte ein anderer. Die meisten Menschen versprachen sich von der IT-Revolution in erster Linie, dass sie die verschiedenen sozialen Schichten miteinander in Verbindung bringt, ihnen hilft, Gedanken auszutauschen und ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, warum Menschen so handeln, wie sie handeln – anders gesagt: unseren Sinn für Wahrheit zu schärfen. Diese Hoffnung ist noch nicht ganz gestorben, aber heute sind wir uns dessen nicht mehr so sicher. Es gibt die Besorgnis, dass wir aufgrund der riesigen Menge persönlicher Daten, die in die sozialen Medien hochgeladen werden, längst Big Brother ausgeliefert sind. Wenn ein Unternehmen diese Informationen nutzen kann, um seine Werbung gezielt auf die individuellen Interessen der Konsumenten auszurichten, was könnte dann eine faschistische Regierung daran hindern, dasselbe zu tun? »Angenommen, ich gehe auf eine Demonstration, etwa zum Women’s March«, sagte eine Studentin, »und poste davon ein Foto in den sozialen Medien. So gerät mein Name auf eine Liste, und diese Liste kann überallhin gelangen. Wie können wir uns vor so etwas schützen?«
Noch beunruhigender ist die Möglichkeit, auf gefälschten Websites und Facebook Lügen zu verbreiten, was manche Unrechtsregime und ihre Handlanger bereits praktiziert haben. Außerdem erlaubt die Technologie extremistischen Organisationen, Echoräume zur Verbreitung von Verschwörungstheorien, falschen Behauptungen und dummen Ansichten über Religion und ethnische Gruppen zu nutzen. Die erste Regel der Täuschung lautet: Oft genug wiederholt, klingt fast jede Behauptung, Geschichte oder Verleumdung glaubwürdig. Das Internet sollte ein Verbündeter der Freiheit und eine Pforte zum Wissen sein; oft genug ist es weder das eine noch das andere.
Der Historiker Robert Paxton beginnt eines seiner Bücher mit der Feststellung: »Faschismus war die bedeutendste politische Innovation des 20. Jahrhunderts und die Ursache vieler seiner Leiden.«7 Im Lauf der Jahre haben Paxton und andere Forscher viele zentrale Elemente des Faschismus aufgelistet. Am Ende unserer Diskussion versuchte mein Seminar, etwas Vergleichbares zu erarbeiten.
Die meisten meiner Studenten waren sich darin einig, dass der Faschismus eine extreme Form autoritärer Herrschaft sei. Er verlangt von den Bürgern, genau das zu tun, was er von ihnen fordert, nicht mehr und nicht weniger. Die Ideologie gründet auf einem fanatischen Nationalismus. Außerdem stellt sie den traditionellen Gesellschaftsvertrag auf den Kopf. Anstatt dass die Bürger dem Staat Macht übertragen, damit er ihre Rechte schützt, geht im Faschismus alle Macht vom Führer aus, und die Bürger sind rechtlos. Unter dem Faschismus haben die Bürger zu dienen, und die Regierung hat zu herrschen.
Spricht man über dieses Thema, entsteht oft Verwirrung über den Unterschied zwischen Faschismus und verwandten Begriffen wie Totalitarismus, Diktatur, Despotismus, Tyrannei, Autokratie usw. Als Wissenschaftlerin könnte es mich reizen, dieses Dickicht zu lichten, aber als ehemalige Diplomatin interessieren mich vor allem die konkreten Handlungen und nicht irgendwelche Bezeichnungen. Für mich ist ein Faschist jemand, der sich stark mit einer gesamten Nation oder Gruppe identifiziert und den Anspruch erhebt, in deren Namen zu sprechen, jemand, den die Rechte anderer nicht kümmern und der gewillt ist, zur Erreichung seiner Ziele jedes Mittel zu ergreifen, einschließlich Gewalt. Diesem Konzept zufolge wird ein Faschist wahrscheinlich ein Tyrann sein, aber ein Tyrann muss nicht zwangsläufig ein Faschist sein.
Oft kann man den Unterschied daran erkennen, wie mit Waffengewalt umgegangen wird. Als sich im Europa des 17. Jahrhunderts der katholische und der protestantische Adel 30Jahre lang über die Auslegung der Bibel bekriegten, herrschte die Übereinkunft, das Volk nicht zu bewaffnen; man hielt es für sicherer, mit Söldnerheeren Krieg zu führen. Heutige Diktatoren neigen ebenso dazu, ihren Bürgern zu misstrauen; deshalb stellen sie Leibgarden und andere Elitetruppen zum Schutz ihrer Person auf. Ein Faschist jedoch erwartet, dass das Volk hinter ihm steht. Während Könige versuchen, das Volk ruhig zu halten, wiegeln Faschisten es auf, damit beim Ausbruch der Kämpfe ihre Soldaten den Willen und die Feuerkraft besitzen, als Erste zuzuschlagen.
Der Faschismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in einer Zeit des geistigen Umbruchs und eines von Enttäuschung über den repräsentativen Parlamentarismus beflügelten, neu erwachten Nationalismus. Gelehrte wie Thomas Malthus, Herbert Spencer, Charles Darwin und Francis Galton hatten im 19. Jahrhundert die Ansicht populär gemacht, das Leben sei ein fortwährender Kampf um Anpassung, mit wenig Platz für Gefühle und ohne Garantie für Fortschritt. Einflussreiche Denker von Friedrich Nietzsche bis Sigmund Freud sannen über die Folgen für eine Welt nach, die anscheinend ihre traditionelle Verankerung verloren hatte. Suffragetten propagierten die revolutionäre Vorstellung, dass auch Frauen Rechte haben. Meinungsführer in Politik und Kunst räsonierten offen über die Möglichkeit, die menschliche Spezies durch gezielte Züchtung zu verbessern.
Erstaunliche Neuerungen wie die Elektrifizierung, das Telefon, die pferdelose Kutsche und das Dampfschiff brachten die Menschen in aller Welt einander näher, doch genau diese Innovationen kosteten Millionen Bauern und Handwerkern ihre Arbeit. Überall setzten sich Menschen in Bewegung – die Landbevölkerung drängte in die bereits dicht bevölkerten Städte, und Millionen Europäer ließen alles hinter sich und überquerten den Ozean.
Vielen, die blieben, waren die Verheißungen der Aufklärung und der Revolutionen in Frankreich und in den 13Neuengland-Kolonien bedeutungslos geworden. Große Teile der Bevölkerung fanden keine Arbeit; jene, die Arbeit hatten, wurden oft ausgebeutet oder später in dem blutigen Schachspiel des Ersten Weltkriegs auf den Schlachtfeldern geopfert. Winston Churchill schrieb über diese Tragödie: »Der Struktur der menschlichen Gesellschaft wurden Verletzungen zugefügt, die in einem Jahrhundert noch nicht verheilt sein werden.« Nachdem sich die Monarchien disqualifiziert hatten, die Religion kritisch beäugt wurde und alte politische Strukturen wie das Osmanische Reich und die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie zusammengebrochen waren, konnte die Suche nach Antworten nicht warten.
Der vom amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson propagierte demokratische Idealismus machte öffentlich Aufsehen. Noch bevor die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten, verkündete er das Prinzip, wonach »jedes Volk das Recht hat, sich die Staatsgewalt zu wählen, unter der es leben möchte«.8 Diese Doktrin der Selbstbestimmung half einer Handvoll mehrheitlich kleiner europäischer Länder, sich nach dem Krieg die Unabhängigkeit zu bewahren, und Wilsons Plan einer Weltorganisation mündete in die Gründung des Völkerbunds. Wilson war jedoch politisch naiv und in seinen letzten Jahren gesundheitlich stark angeschlagen; seine globale Vision hatte über seine Präsidentschaft hinaus keinen Bestand. Unter seinen Nachfolgern kehrten die Vereinigten Staaten dem Völkerbund den Rücken und wiesen jede Verantwortung für die Entwicklungen in Europa von sich, zu einer Zeit, als sich der Kontinent nur mühsam von den Folgen des Krieges erholte.
Viele Regierungen, die nach dem Krieg eine liberale Politik eingeleitet hatten, sahen sich mit explosiven sozialen Spannungen konfrontiert, die ihnen repressive Maßnahmen nötig zu machen schienen. Von Polen und Österreich bis Rumänien und Griechenland kam es zu demokratischen Gehversuchen, die alsbald scheiterten. Im Osten gaben grimmige sowjetische Ideologen vor, für die Arbeiter weltweit zu sprechen, und bereiteten dadurch britischen Bankiers, französischen Ministern und spanischen Priestern Albträume. In der Mitte Europas kämpfte ein verbittertes Deutschland darum, wieder eine Stellung in der Welt zu erlangen. Und in Italien erhob ein Schreckgespenst, dessen Stunde noch kommen sollte, zum ersten Mal sein Haupt.
2
Das größte Spektakel auf Erden
Thomas Edison bejubelte ihn als »das größte Genie der Neuzeit«,1 Gandhi als »Supermann«.2 Winston Churchill versprach, an seiner Seite zu stehen in seinem »Kampf gegen die unmenschlichen Ambitionen des Bolschewismus«.3 Zeitungen in Rom, Heimstatt des Vatikans, bezeichneten ihn als »Inkarnation Gottes«. Am Ende hängten Menschen, die ihn früher vergöttert hatten, seine Leiche an den Füßen neben der seiner Geliebten an einer Tankstelle in Mailand auf.
Benito Mussolini kam 1883 in Predappio zur Welt, einer bäuerlich geprägten Kleinstadt rund 100Kilometer nordöstlich von Florenz. Sein Vater war Schmied und Sozialist, seine Mutter Lehrerin und tiefgläubig. Mussolini wuchs in einem Häuschen mit zwei Zimmern auf, das an das Schulhaus grenzte, in dessen einzigem Klassenzimmer seine Mutter Unterricht gab. Seine Familie lebte in auskömmlichen Verhältnissen, war aber nicht in der Lage, das volle Schulgeld für das von Geistlichen geleitete Internat aufzubringen, das er ab dem Alter von neun Jahren besuchte. Dort nahmen die Schüler aus wohlhabenderem Elternhaus an dem einen Tisch Platz, Benito und seine Kameraden an einem anderen – eine Erniedrigung, die in Mussolini einen lebenslangen Zorn gegen Ungerechtigkeit (sofern sie ihn selbst betraf) weckte. Er hatte oft Unfug im Kopf, stibitzte Obst von den Bauern und prügelte sich gern. Mit elf Jahren wurde er des Internats verwiesen, nachdem er einem Mitschüler mit dem Messer die Hand verletzt hatte, und mit 15Jahren wurde er von einer anderen Schule zeitweilig ausgeschlossen, weil er einem anderen Mitschüler ins Gesäß gestochen hatte.
Benito las viel. Gern widmete er sich allein der Tageszeitung oder dem mehr als tausend Seiten dicken Wälzer Die Elenden von Victor Hugo. Von seinem Vater hatte er den Hang zum Draufgängertum geerbt; seine Mutter hingegen versuchte, ihm Geduld beizubringen – doch er geriet eher nach dem väterlichen Vorbild. Als im Internat die Schüler einmal über das harte alte Brot klagten, das ihnen ständig vorgesetzt wurde, ging Mussolini schnurstracks zum Rektor, um sich zu beschweren, was ihm die Anerkennung seiner Mitschüler eintrug. Der Rektor hatte ein Einsehen, und fortan gab es frisch gebackenes Brot.
Nach seiner Schulzeit erwarb Mussolini ein Lehrerdiplom, aber da es ihm im Unterricht an Disziplin mangelte, wurde ihm schon bald gekündigt. So ging er mit 19Jahren in die Schweiz, wo er als Tagelöhner arbeitete, auf Packkisten schlief und wegen Landstreicherei ins Gefängnis kam – die erste vieler Inhaftierungen. Nach seiner Freilassung erhielt er Arbeit als Maurer und wurde bald darauf in der örtlichen Gewerkschaft aktiv. Zu dieser Zeit war die Gewerkschaftspolitik in Europa scharf nach links ausgerichtet; sozialistische Aufwiegler predigten den Hass auf Regierung und Kirche und riefen zur Militanz im Namen der Arbeiterrechte auf. Mussolini war kein origineller Kopf, besaß aber schauspielerisches Talent und konnte überzeugend eine Rolle ausfüllen. Privat stets tadellos gekleidet, trat er öffentlich oft unrasiert und mit wildem Haar auf. Vor seinen Reden studierte er sorgfältig ein, wie man spontan wirkt. Er wusste um den Wert, als volkstümlich zu gelten, und meist gelang es ihm, seine Zuhörer zu Begeisterungsstürmen hinzureißen. Es dauerte nicht lange, und er sah sich selbst als vom Schicksal berufen – ein neuer Napoleon oder vielleicht auch ein neuer Kaiser Augustus.
Die Schweizer Behörden jedoch ließen sich von dem Möchtegern-Cäsar nicht beeindrucken, sondern verwiesen ihn als unerwünschte Person des Landes. Unverdrossen kehrte er nach Italien zurück, wo er einen bei den Lesern beliebten Groschenroman über einen lüsternen Kardinal verfasste,4 sozialistische Blätter herausgab und sich eine Anhängerschaft aufzubauen begann. In rauchgeschwängerten Sälen erklärte Mussolini den Arbeitern, die Eliten würden niemals kampflos ihre Privilegien aufgeben und kein Parlament würde sich jemals für ihre Sache gegen die Bourgeoisie auf ihre Seite stellen. Die alten Antworten, die die Religion lieferte oder die im Empfinden einer patriotischen Pflicht lägen, hätten sich als falsch erwiesen und sollten aufgegeben werden. Gerechtigkeit, sagte er, sei nur durch Kampf zu erreichen. Eine Revolution sei vonnöten.
Dann aber spielte dies alles plötzlich keine Rolle mehr. Im Sommer 1914 stand Europa vor dem Krieg. Da verwandelte sich Mussolini im Handumdrehen von einer sozialistischen Raupe in einen patriotischen Schmetterling. Anstatt sich seinen Genossen anzuschließen, die, wie sie meinten, nichts mit einer von Schwachköpfen aus der Oberschicht herbeigeführten Katastrophe zu tun haben wollten, gründete er eine Zeitung namens Il Popolo d’Italia und forderte den Kriegseintritt Italiens. Diese Kehrtwende mag Ausdruck eines ernsthaften Gesinnungswandels gewesen sein, da Mussolini nie sehr stark an ideologischen Überzeugungen festhielt und der Pazifismus ihm wesensfremd war; aber es gibt auch noch andere Erklärungen hierfür. Französische Wirtschaftsvertreter suchten seine Unterstützung beim Versuch, Italien zum Kriegseintritt gegen Deutschland und Österreich-Ungarn zu bewegen, und versprachen im Erfolgsfall eine Belohnung. Die Herausgabe einer Zeitung ist eine kostspielige Angelegenheit; Waffenfabrikanten finanzierten Il Popolo d’Italia großzügig.
Am 24. Mai 1915 erfolgte Italiens Kriegseintritt an der Seite Großbritanniens und Frankreichs. Mussolini wurde zur Armee einberufen und diente 17Monate lang an der Front; in dieser Zeit schrieb er nebenbei wöchentlich Artikel für seine Zeitung. Er wurde zum Korporal befördert und kam fast zu Tode, als während einer Übung ein Mörser explodierte, Dutzende Schrapnellkugeln seine Eingeweide durchlöcherten und ihn fast entzweirissen. Noch während er im Lazarett lag, erlitt die italienische Armee im Oktober 1917 ihre verheerendste Niederlage. In der Zwölften Isonzoschlacht wurden 10000 Italiener getötet, 30000 verwundet, und unter dem Trommelfeuer der feindlichen Artillerie ergaben sich mehr als eine Viertelmillion italienischer Soldaten.
Obwohl Italien schließlich zum siegreichen Bündnis gehörte, schmeckten dem Land und seinen Bewohnern die Früchte des Sieges bald bitter. Abgesehen von der immensen Zahl an Gefallenen und Verwundeten verweigerten die britischen und französischen Bündnispartner Italien die in Geheimabkommen zugesicherte territoriale Expansion. Sie versagten sogar Italiens Staatsoberhaupt, König Vittorio Emanuele III., die Teilnahme an der Friedenskonferenz. Diese Kränkungen stärkten Mussolinis frühere Genossen, die nun überzeugend behaupten konnten, dass sie mit ihrer Ablehnung des Krieges recht gehabt hatten. Die Sozialistische Partei erlebte einen starken Mitgliederzulauf, und bei den Parlamentswahlen 1919 errang sie mehr Stimmen als alle politischen Konkurrenten.
Beflügelt von diesem Erfolg, aber nach wie vor von der Regierungskoalition ausgeschlossen, wollten sich die Sozialisten nicht damit begnügen, ruhig im Parlament zu sitzen und an den Abstimmungen teilzunehmen. Die Demokratie hatte in den Reihen der Arbeiter das Selbstwertgefühl gestärkt und ein Bewusstsein für ihre Rechte geweckt. In den großen Fabriken, Ausdruck des technischen Fortschritts, schlossen sich die Industriearbeiter zusammen, wodurch die politischen Organisatoren leichter Unterstützung fanden und Agitatoren die Wut anstacheln konnten. Die Spannungen nahmen zu, als die Sozialisten, inspiriert durch die bolschewistische Revolution in Russland, den bewaffneten Kampf mit dem Ziel aufnahmen, für das Proletariat die Macht zu erobern und die Bourgeoisie kaltzustellen. Die Partei heuerte Bewaffnete an, um Streikbrecher einzuschüchtern, brachte zahlreiche Stadtregierungen in ihre Gewalt und hisste die rote Fahne über Fabriken in Mailand, Neapel, Turin und Genua. Auf dem Land forderten sozialistische Bauern das Land, das sie seit jeher bestellten, für sich. Zuweilen wurden mit Morden an Grundbesitzern persönliche Rechnungen beglichen.
Für die Industrie- und Agrarbarone waren die Proteste höchst beunruhigend. Es war eine Sache, wenn die Arbeiter einen etwas höheren Stundenlohn oder eine Absenkung der Arbeitszeit bei gleicher Bezahlung verlangten; eine andere Sache war es, wenn sie sich das Recht nahmen, die Bosse zu verjagen, eigenmächtig die Fabriken zu übernehmen und zu leiten, oder anfingen, das Ackerland zu besetzen und umzuverteilen. Die extremen Spannungen, der hohe Preis, um den es ging, und das vergossene Blut legten jenen Barrieren in den Weg, die nach einem Mittelweg suchten. Politiker, die vermitteln wollten, ernteten Misstrauen von beiden Seiten.
Die Streikwelle und die Konflikte wegen der Umverteilung des Landes zerrütteten die italienische Wirtschaft, sodass die Preise in schwindelerregende Höhen stiegen, während die Lebensmittel immer knapper wurden, die öffentlichen Einrichtungen kaum mehr funktionierten und die Eisenbahn aufgrund von Bummelstreiks praktisch lahmgelegt war. Währenddessen kehrten Zehntausende demobilisierte Veteranen nach Hause zurück, wo man sie eher anfeindete, als mit Ehren empfing, und wo sie keine Arbeit fanden, weil die Gewerkschaften die Stellen bereits vergeben hatten.
Italien stand kurz vor dem staatlichen Zerfall. Das Parlament galt selbst seinen Mitgliedern als korrupter Basar, auf dem Gefälligkeiten an jene verteilt wurden, die über politische und gesellschaftliche Beziehungen verfügten. König Vittorio Emanuele war schwach, ängstlich und unentschlossen. In den 22Jahren seiner Regentschaft hatte er nicht weniger als 20Premierminister kommen und gehen sehen. Die führenden Politiker lagen unablässig miteinander im Streit, hatten aber so gut wie jeden Kontakt zur Bevölkerung verloren. Vielen schien die Zeit reif für eine wirkliche Führungsperson, für einen Duce, der Italien wiedervereinigen und das Land erneut zum Mittelpunkt der Welt machen konnte.
Am 23. März 1919, einem regnerischen Sonntagmorgen, versammelten sich in Mailand einige Dutzend zornige Männer in einem von der Industriellenvereinigung Alleanza industriale e commerciale zur Verfügung gestellten, stickigen Versammlungsraum an der Piazza San Sepolcro. Nach stundenlangen Debatten erhoben sie sich, ergriffen einander an den Händen und schworen Bereitschaft, zur Verteidigung Italiens gegen alle Feinde »zu töten oder zu sterben«. Zur Verdeutlichung ihrer Einigkeit wählten sie als Emblem die fasces, ein Bündel aus Ulmenruten, in dem ein Beil steckt; im antiken Rom war es das Symbol für die Machtbefugnisse eines Konsuls gewesen. Ihr Manifest enthielt lediglich 54Unterschriften, und ihre Teilnahme am Wahlkampf in jenem Herbst fand öffentlich kaum Beachtung. Doch innerhalb von zwei Jahren konnte die faschistische Bewegung mehr als 2000 Ortsverbände vorweisen, und ihr oberster Chef war Benito Mussolini.
Die faschistische Bewegung wuchs, weil Millionen Italiener der Verhältnisse in ihrem Land überdrüssig waren und sich ängstigten vor dem, was im bolschewistischen Russland der Welt vor Augen geführt wurde. In zahllosen Reden bot Mussolini seine Alternative feil. Er beschwor seine Landsleute, nicht nur den ausbeuterischen Kapitalisten eine Absage zu erteilen, sondern auch den Sozialisten, die ihnen ihr Leben zerrütten wollten, und ebenso den korrupten und rückgratlosen Politikern, die immer nur redeten, während ihre geliebte Heimat immer tiefer in den Abgrund sank. Anstatt zum Klassenkampf rief Mussolini zur Vereinigung aller Italiener – Arbeiter, Studenten, Soldaten, Geschäftsleute – und zur Bildung einer gemeinsamen Front gegen alle Feinde auf. Seinen Anhängern malte er eine Zukunft aus, in der sie stets füreinander eintreten würden, während die Parasiten, die angeblich das Land klein hielten – die Ausländer, die Schwachen, die politisch Unzuverlässigen –, sich um sich selbst zu kümmern hatten. Mussolini beschwor seine Gefolgsleute, an ein Italien zu glauben, das durch Autarkie zu Wohlstand gelangen und das man respektieren würde, weil man es fürchtete. So begann der Faschismus des 20. Jahrhunderts: mit einem charismatischen Führer, der eine weitverbreitete Unzufriedenheit seinen Zwecken dienstbar machte, indem er das Blaue vom Himmel versprach.
Anfang der Zwanzigerjahre waren die Sozialisten nach wie vor die stärkste Kraft im Parlament und auch im ganzen Land deutlich präsent. Um ihnen Paroli zu bieten, griffen die Faschisten auf die große Zahl arbeitsloser Veteranen zurück und organisierten mit ihnen eigene Milizen, die Fasci di Combattimento (Kampfbünde). Sie sollten Arbeiterführer niederschießen, Zeitungsredaktionen verwüsten und linke Arbeiter und Bauern verprügeln. Diese Trupps gingen meist ungestört zu Werke, weil viele Vertreter der Polizei Sympathie für sie hegten und bei Verbrechen, die die Faschisten an ihren politischen Gegnern begingen, einfach wegsahen. In nur wenigen Monaten hatten die Faschisten die Sozialisten aus den Groß- und Kleinstädten vertrieben, vor allem in den nördlichen Provinzen Italiens. Als Erkennungszeichen trugen sie ihre eigene Uniform – schwarzes Hemd, grau-grüne Hose und eine dunkle, an einen Fes erinnernde Kappe mit Quaste. Zwar waren die Sozialisten zahlenmäßig stärker, aber die Faschisten holten schnell auf und setzten ohne Skrupel Gewalt ein.
Mussolini hatte kein Drehbuch für seinen aufkeimenden Aufstand. Er war der unangefochtene Führer einer Bewegung, deren Zielrichtung nicht eindeutig feststand. Die Faschisten hatten lange Listen teils widersprüchlicher Ziele aufgestellt, aber sie verfügten über kein offizielles Manifest oder Programm. Für manche der leidenschaftlichen Anhänger war die aufstrebende Partei ein Instrument zur Rettung des Kapitalismus und des römischen Katholizismus vor den leninistischen Horden; anderen galt sie als Verteidigerin der Tradition und der Monarchie. Viele sahen in ihr die Chance, Italien den Ruhm zurückzubringen, und für etliche bedeutete sie ein festes Einkommen und die Gelegenheit, anderen den Schädel einzuschlagen.
Mussolini folgte einem Zickzackkurs. Von Großunternehmen und Banken nahm er Geld entgegen, sprach aber die Sprache der Veteranen und Arbeiter. Mehrmals versuchte er, die Beziehungen zu den Sozialisten zu verbessern, musste aber feststellen, dass ihm seine früheren Genossen nicht über den Weg trauten; zudem kamen diese Annäherungsversuche beim fanatischeren Teil seiner Anhänger nicht gut an. Als sich die politischen Verhältnisse weiterhin verschlechterten, musste Mussolini immer militanter werden, einfach um mit den Truppen Schritt zu halten, die er vorgeblich kommandierte. Als ihn ein Journalist um eine Zusammenfassung seines Programms bat, antwortete Mussolini: »Es besteht darin, diesen Demokraten … die Knochen zu brechen. Und zwar je eher, desto besser.«5 Im Oktober 1922 beschloss er, die Regierung direkt herauszufordern, indem er Faschisten im ganzen Land mobilisierte. »Entweder man überlässt uns die Regierungsgewalt, oder wir marschieren nach Rom und holen sie uns selbst«, erklärte er in einer Ansprache vor den Schwarzhemden.6
Da die Politiker der Mitte gespalten und gelähmt waren, lastete die Verantwortung für die Abwehr von Mussolinis dreistem Schritt auf den schmalen Schultern König Vittorio Emanueles. Er musste die Wahl treffen zwischen den Sozialisten, die die Monarchie zerstören wollten, und den rauflustigen Faschisten, die – wie der König hoffte – sich vielleicht als beeinflussbar erweisen würden; einen Mittelweg gab es nicht. Die Armee und der Premierminister rieten ihm, den angekündigten Marsch der Faschisten zu verhindern, Mussolini zu inhaftieren und separat mit den Sozialisten zu verhandeln. Dies lehnte der König zunächst ab, besann sich jedoch anders, als die Faschisten begannen, Radiostationen und Regierungsgebäude zu besetzen. Am 28. Oktober um zwei Uhr morgens gab er den Befehl, die Faschisten aufzuhalten. Sieben Stunden später vollzog er erneut eine Kehrtwende, da er offenbar glaubte, die Faschisten seien der Armee im Kampf überlegen, was zu diesem Zeitpunkt so gut wie sicher nicht zutraf.
Nachdem das Militär abgezogen worden war und sich Zehntausende Schwarzhemden am Rand der Hauptstadt versammelt hatten, wählte Vittorio den, wie er meinte, sichersten Weg. Er telegrafierte an Mussolini, der aus Vorsicht in Mailand wartete, bat ihn, nach Rom zu kommen und das Amt des Premierministers zu übernehmen, nachdem der bisherige Premier seine Mehrheit verloren hatte und nur mehr als eine Art Verwalter fungierte. So hatte sich Mussolinis Hasardspiel ausgezahlt. Im Lauf nur eines Wochenendes kletterte Mussolini so bis an die Spitze der politischen Leiter, und er erreichte sein Ziel, ohne eine Wahl gewinnen zu müssen oder die Verfassung zu brechen.
Am 31. Oktober war dann die letzte Etappe des Marsches auf Rom, der Einzug in die Hauptstadt – mehr eine Siegesparade als der Putsch, der er sein sollte. Das Ereignis lockte sehr unterschiedliche Teilnehmer an, die sämtlichen Klischees spotteten, wie ein Faschist aussehen oder sein sollte.7 Unter den Marschierern waren Fischer aus Neapel, Seite an Seite mit Geistlichen, Geschäftsleuten in dunklen Westen und Pilotenkappen und Bauern aus der Toskana in Jagdjoppen. Einem 16-jährigen Gymnasiasten namens Giovanni Ruzzini hatte das Geld gefehlt, sich ein neues Hemd zu kaufen, deshalb hatte er ein altes schwarz gefärbt; auf dem Kopf trug er einen Militärhelm, den er auf der örtlichen Müllhalde gefunden hatte. Nicht wenige der Teilnehmer liefen barfuß, weil sie sich keine Schuhe leisten konnten. Ein Mann hatte 50Abzeichen mit Hammer und Sichel dabei, die er, wie er behauptete, den Leichen von Kommunisten abgenommen hatte. Das Aufgebot aus Grosseto wurde von einem 80-jährigen Blinden angeführt, der mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor unter Garibaldi, Italiens größtem General, gekämpft hatte. Manche in der lärmenden Menge hatten sich mit rostigen Flinten, Pistolen, alten Safarigewehren, Golfschlägern, Sensen, Tischbeinen und Dolchen ausgestattet; ein Mann hatte den Kieferknochen eines Ochsen mitgebracht, andere schleppten Riesenstücke getrockneten Stockfisch mit sich, um sie gegebenenfalls als Waffe zu verwenden. Die meisten gingen zu Fuß; ein wohlhabender junger Mann aus Ascoli Piceno jedoch begleitete die Menge in seinem Fiat, auf dem ein Maschinengewehr montiert war. Aus Foggia waren 50Kavalleristen auf Ackergäulen gekommen. Unter jenen, die an diesem Tag die Faschisten willkommen hießen und »Viva Mussolini!« riefen, waren 200Juden.
Trotz des eindrucksvollen Spektakels war die politische Stellung der Partei noch längst nicht gesichert. Mussolinis kometenhafter Aufstieg machte ihn anfällig für einen ebenso raschen Absturz. Das Parlament wurde nach wie vor von den Sozialisten und Liberalen dominiert, und die Konservativen trachteten nach nichts anderem, als den faschistischen Führer zu manipulieren, kaltzustellen und, wenn nötig, abzuservieren. Doch Mussolini, der schon bald als Il Duce bekannt wurde, hatte Talent für die große Bühne und wenig Respekt vor dem Mut seiner Gegner. Zwei Wochen nach seinem Amtsantritt hielt er seine erste Rede vor dem Parlament. Er betrat in gravitätischer Manier den Saal und erhob den Arm zum römischen Gruß.8 Schweigend ließ er seinen Blick über den Rand des Saals gleiten, wo sich muskulöse Schwarzhemden aufgereiht hatten und ihre Dolche tätschelten. Die Fäuste in die Hüften gestemmt, erklärte Mussolini sodann: »Ich hätte aus diesem unfreundlichen, düsteren Saal einen Lagerplatz für meine Schwarzhemden machen können, und ich hätte das Parlament abschaffen können. Es stand in meiner Macht, das zu tun, aber es war nicht meine Absicht. Wenigstens vorerst noch nicht.«9
Mit dieser Warnung verlangte und erhielt Mussolini die Befugnis, all das zu tun, was er wollte; aber überraschenderweise war sein oberstes Ziel vorerst, gut zu regieren. Er wusste, dass die Bürger genug hatten von einer Bürokratie, die Jahr für Jahr größer und ineffektiver zu werden schien. Deshalb verfügte er tägliche Anwesenheitsappelle in den Büros der Ministerien und maßregelte Bedienstete, wenn sie zu spät zur Arbeit kamen oder lange Essenspausen einlegten. Er setzte eine Kampagne in Gang, um drenare la palude (»den Sumpf trockenzulegen«), indem er mehr als 35000 Beamte entließ. Seinen faschistischen Banden übertrug er die neue Aufgabe, die Bahnfracht vor Dieben zu schützen. Er stellte Geld für den Bau von Brücken, Straßen, Fernsprechämtern und riesigen Aquädukten zur Verfügung, mit denen trockene Regionen mit Wasser versorgt werden sollten. Außerdem führte er in Italien den Achtstundentag ein, schuf einen Versicherungsschutz für Alte und Behinderte, finanzierte Kliniken zur Schwangerenfürsorge, gründete 1700 Sommerlager für Kinder und fügte der Mafia einen schweren Schlag zu, indem er das bisherige Geschworenensystem abschaffte und verkürzte Gerichtsverfahren einführte. Nachdem keine Geschworenen mehr eingeschüchtert werden konnten und die Richter direkt dem Staat gegenüber verantwortlich waren, wurden die Gerichte zwar praktisch unbestechlich, dafür aber der Regierung gegenüber gefügig. Entgegen der Legende schaffte es der Diktator aber nicht vollständig, dass die Züge pünktlich fuhren, doch allein für den Versuch erntete er große Anerkennung.
Von Anfang an genoss Mussolini es zu regieren. Zwar arbeitete er nie so hart, wie seine Propagandisten glauben machen wollten, aber er war auch kein Dilettant. Abgesehen von seiner unermüdlichen Schürzenjägerei und seiner Leidenschaft fürs Schwimmen und Fechten hatte er wenig andere Interessen. Er versuchte, gut zu regieren, glaubte dies aber ohne absolute Macht nicht tun zu können. Selbstzweifel waren ihm fremd, und sein Machthunger blieb unstillbar.
1924 peitschte Mussolini ein Wahlgesetz durch, das den Faschisten die Kontrolle des Parlaments ermöglichte. Als der Generalsekretär der Sozialistischen Partei Beweise für Wahlmanipulationen vorlegte, wurde er von Schergen entführt und ermordet. Bis Ende 1926 hatte der Duce alle konkurrierenden politischen Parteien ausgeschaltet, die Pressefreiheit abgeschafft, die Arbeiterbewegung entmachtet und sich das Recht gesichert, eigenhändig städtische Beamte zu ernennen. Zur Durchsetzung seiner Verordnungen übernahm er die Kontrolle über die nationale Polizei, stockte sie personell auf und erweiterte ihre Funktionen, sodass sie fortan auch für die Überwachung im Inneren zuständig war. Um den Einfluss der Monarchie zu beschneiden, verfügte er, dass die Ernennung eines Thronfolgers nur mit seiner Zustimmung erfolgen konnte. Um den Vatikan zu beschwichtigen, ließ er Bordelle schließen und die Priestergehälter deutlich erhöhen, wofür er von der Kirche das Vetorecht gegen die Ernennung von Bischöfen und Pfarrern erhielt. Mit Blick auf die Zukunft ließ er Schulen in Menschenfabriken umwandeln, in denen Jungen in schwarzen Hemden mit Gewehren exerzierten, die Aussicht auf den Heldentod feierten und das faschistische Credo skandierten: »Glaube! Gehorche! Kämpfe!«
Seiner Geliebten gestand Mussolini: »Ich möchte dieser Epoche meinen Stempel aufdrücken … wie ein Löwe mit seiner Pranke.«10 Um dieses zweifelhafte Ziel zu erreichen, hielt er die Italiener dazu an, romantische Vorstellungen über die Gleichheit der Menschen aufzugeben und stattdessen willkommen zu heißen, was er als »das Jahrhundert der Autorität, ein Jahrhundert, das nach ›rechts‹ tendiert, ein faschistisches Jahrhundert« bezeichnete. »Niemals zuvor«, sagte er, »haben die Völker mehr nach Autorität, Lenkung und Ordnung gedürstet als heute. Wenn jedes Zeitalter seinen eigenen Grundsatz hat, dann … ist der Grundsatz unseres Zeitalters der Faschismus.«11
Doch auch ein fanatisiertes Volk kann nicht immerfort im Zustand der Mobilisierung leben, wenn es nicht das Gefühl verspürt, es gehe voran. Mussolini bediente dieses Gefühl mit seiner großspurigen Rhetorik, mit der er ein dominantes Italien heraufbeschwor, wiedergeboren mit mehr spazio vitale (Lebensraum) – ein Italien, das über den Mittelmeerraum herrschen würde. Der Weg zu diesem Paradies hieß Krieg, für den er von den Italienern Verzichtbereitschaft forderte. »Vivere pericolosamente«, gefährlich leben, lautete eine seiner häufig wiederholten Parolen, die er von Nietzsche entlehnt hatte.12 Und er ließ seinen Worten Taten in Form einer aggressiven Außenpolitik folgen. Erst machte er aus Albanien faktisch ein italienisches Protektorat, danach fiel er in das nahezu wehrlose Äthiopien ein, das letzte unabhängige Königreich Afrikas. Zur Finanzierung der Kriegszüge spendeten die italienischen Frauen, animiert von Königin Elena, ihre Eheringe, die zu Goldbarren eingeschmolzen oder zu Geld gemacht wurden; auch die im Ausland lebenden Italienerinnen waren dazu aufgerufen, und Tausende folgten. Für Mussolini war der Feldzug in Äthiopien »der größte Kolonialkrieg der Geschichte«.13 Als die Maschinengewehre und das Giftgas der Italiener Äthiopien zur Kapitulation zwangen, rief Mussolini sein Volk auf: »Schwenkt eure Fahnen, erhebt eure Arme, öffnet eure Herzen und begrüßt das Imperium, das sich nach 15Jahrhunderten auf den schicksalsvollen Hügeln Roms wieder zeigt.«14