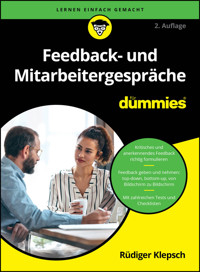
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
So motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und werden ein besserer Chef
Ohne Kommunikation geht nichts im Berufsalltag. Feedback soll motivieren und dem Empfänger Orientierung bieten, in Mitarbeitergesprächen stecken Sie die Ziele Ihres Teams ab. Doch zur richtigen Zeit den richtigen Ton zu finden ist gar nicht so leicht. Dr. Rüdiger Klepsch zeigt Ihnen, wie Sie verschiedene Mitarbeitergespräche optimal vorbereiten und durchführen, sodass Sie es schaffen, auch heikle Situationen angemessen zu gestalten. Auch zum Thema hybride Gespräche finden sich wertvolle Tipps. Zahlreiche Checklisten und Fragebogen unterstützen Sie bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung.
Sie erfahren
- Wie Sie Kritikgespräche und Leistungsbeurteilungen optimal vorbereiten
- Wie Sie Ihr Team durch gezieltes Feedback inspirieren und motivieren
- Welche Fallen Sie bei hybriden Gesprächen vermeiden sollten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Feedback- und Mitarbeitergespräche für Dummies
Schummelseite
DIE GRUNDREGEL: DER FEEDBACKDREIKLANG
Ein Feedback wird automatisch konstruktiv, wenn Sie den Dreiklang »Beobachtung – Wirkung – Wunsch« zum Klingen bringen:
Erster Schritt: »Ich habe beobachtet.«
Beschreiben Sie möglichst ohne Wertung, was Ihnen aufgefallen ist: »Am letzten Freitag in der Neun-Uhr-Sitzung habe ich gesehen, dass Sie mit dem Smartphone hantiert, mit den Nachbarn geredet und in der Zeitung geblättert haben.«
Zweiter Schritt: »Ich interpretiere.«
Beschreiben Sie, wie das Beobachtete auf Sie wirkt: »Das wirkt auf mich respektlos und unprofessionell.«
Dritter Schritt: »Ich wünsche/erwarte.«
Formulieren Sie Ihre Erwartung oder Ihren Wunsch an den anderen: »Ich wünsche mir einen respektvollen Umgang, ohne dass mit dem Smartphone E-Mails bearbeitet werden!«
REGELN FÜR DEN FEEDBACKGEBER
Gehen Sie von der Grundhaltung aus: »Ich bin okay, du bist okay.«
Stellen Sie sich vor, zwei Menschen schauen in die Landschaft. Der eine fertigt eine Landkarte, auf der die Wanderwege hervorgehoben werden. Der andere zeichnet eine Landkarte, auf der Landstraßen zu sehen sind. Zwei unterschiedliche Sichtweisen auf denselben Landstrich, und beide haben recht! Bezogen auf Feedback heißt das: Rückmeldungen sind ein Angebot, mehr darüber zu erfahren, wie der andere einen wahrnimmt. Es sind keine objektiven Wahrheiten und keine objektiven Werturteile.
Handeln Sie nach dem Prinzip: »Hart in der Sache, weich zur Person.«
Bleiben Sie in der Sache hart und konsequent, im Ton jedoch verbindlich und angemessen. Achten Sie deshalb darauf, die Rückmeldungen konkret und nachvollziehbar darzustellen – und konzentrieren Sie sich auf das Ziel, die Situation zu verbessern. Untermauern Sie das Feedback durch praktische Beispiele aus der gemeinsamen Arbeit, achten Sie aber darauf, ein einzelnes Beispiel nicht als Drama hochzuspielen.
Vermeiden Sie pauschale Kritik.
Pauschale Kritik anstelle konkreter Beispiele provoziert Gegenwehr und verbaut die Chance, sich konstruktiv über einzelne Verhaltensweisen oder Fehler auszutauschen. Folgen Sie stattdessen dem Feedbackdreiklang mit den Schritten Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch (siehe oben).
Beschreiben – nicht bewerten.
Wer Rückmeldung gibt, beschreibt seine Wahrnehmungen und Beobachtungen – also das, was ihm am anderen aufgefallen ist. Danach beschreibt er, was diese Beobachtungen in ihm selbst auslösen: Gefühle, Empfindungen, Fragen, Überlegungen. Er fällt jedoch keine allgemeingültigen Werturteile, macht keine unbegründeten Vorwürfe und moralisiert nicht.
Stellen Sie positive Aspekte an den Anfang.
Einseitigkeit führt zu Verzerrungen. Achten Sie deshalb darauf, bei einem Feedback neben der Kritik auch die positiven Aspekte herauszustellen (sofern es Positives zurückzumelden gibt). Beginnen Sie das Feedback mit diesen positiven Aspekten. Es ist wichtig, dass sowohl der Feedbackgeber als auch der Feedbackempfänger beide Dimensionen betrachten.
Positives Feedback ist ein Zaubermittel.
Viele Führungskräfte haben das Loben verlernt. Das Ausbleiben von Kritik erscheint ihnen als Anerkennung ausreichend und wird zur geübten Praxis. Dabei wird übersehen: Loben und Anerkennen ist der effektivste Weg, um Verhalten zu beeinflussen und zu formen. Nutzen Sie diese Möglichkeit! Das Verhältnis von anerkennenden zu kritisierenden Äußerungen sollte bei fünf zu eins liegen, um ein psychologisches Gleichgewicht zu sichern und Demotivation zu verhindern.
Sprechen Sie in Ich-Form.
Beim Feedback sprechen Feedbackgeber und Feedbacknehmer für sich selbst, jeder bezieht sich auf seine eigenen Erfahrungen und Empfindungen. Das bedeutet auch, dass Sie als Feedbackgeber den Empfänger direkt und persönlich ansprechen. Hieraus ergibt sich die Regel, stets in Ich-Form zu sprechen.
Feedback sollte zeitnah erfolgen.
Da sich Feedback auf konkrete Vorkommnisse bezieht, sollte es zeitnah erfolgen. Liegt es länger zurück und schieben sich neue Ereignisse dazwischen, verblasst der emotionale Bezug zum kritisierten Ereignis – und das Feedback verliert an Wirkung.
Kein Feedback im Zorn.
Vermeiden Sie Rückmeldungen, wenn Sie emotional aufgebracht sind. Hier gilt der Grundsatz: zeitnah, aber nicht unmittelbar. Ebenso wenig ist es sinnvoll, ein Feedback zu geben, wenn Ihr Gegenüber emotional aufgebracht ist.
REGELN FÜR DEN FEEDBACKNEHMER
AkzeptierenSie die disziplinarische Macht des Vorgesetzten.
Neben dem »Landkartenvergleich« kommt im beruflichen Alltag eine weitere Dimension ins Spiel, sofern es sich beim Feedbackgeber um den Vorgesetzten handelt: Sind im Feedbackgespräch die unterschiedlichen Sichtweisen geklärt, hat der Vorgesetzte das Recht, anzuordnen, welche Sichtweise für die weitere Zusammenarbeit gelten soll. Dieses Weisungsrecht ist im Arbeitsvertrag verankert.
Aktiv zuhören.
Signalisieren Sie dem Feedbackgeber, dass Sie ihm zuhören. Hierbei helfen Blickkontakt, eine zugewandte Körperhaltung, gelegentliches Nicken, immer wieder ein unterstützendes »Ja« oder »Ich verstehe«.
Zuhören heißt nicht zustimmen.
Wer kritisiert wird, reagiert schnell mit Rechtfertigungen, anstatt seinem Gegenüber so lange ruhig zuzuhören, bis er dessen Sichtweise vollständig verstanden hat. Hier hilft es, wenn Sie sich klarmachen: Zuhören heißt noch lange nicht, dass Sie zustimmen. Sie können ganz anderer Meinung sein und erhalten im zweiten Teil des Feedbackgesprächs auch die Möglichkeit, Ihre Position darzustellen. Zunächst geht es jedoch darum, die Sichtweise des anderen zu verstehen – denn dies ist die Grundbedingung für eine gelungene Kommunikation.
Tragen Sie zur Lösung bei.
Ihr Vorgesetzter ist weniger an Rechtfertigungen interessiert als daran, dass in Zukunft die Ergebnisse stimmen. Ihm geht es um die Lösung des Problems. Er wird Sie vermutlich fragen: »Wie wollen Sie das lösen? Haben Sie eine Lösungsidee?« Bereiten Sie sich auf diese Frage vor.
Bei Störungen ein »Signal« geben.
Wenn Sie sich verletzt oder durch die aktuelle Situation verunsichert fühlen, teilen Sie das dem anderen sofort mit, sodass darüber gesprochen werden kann.
Bedanken Sie sich für das Feedback.
Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie ein Feedback akzeptieren und Veränderungen vornehmen. In jedem Fall sollten Sie sich aber beim Feedbackgeber bedanken, weil Sie durch sein Feedback ein Stück Klarheit über Ihr eigenes Verhalten und Ihre Wirkung auf andere bekommen haben.
REGELN FÜR ERFOLGREICHES ONLINE-FEEDBACK
SeienSie klar und direkt.
Beim Online-Feedback verändert sich die Mimik und Gestik. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie deutlich machen, was Sie sagen wollen. Vermeiden Sie komplizierte Sätze oder Andeutungen.
Halten Sie es kurz und knackig.
Niemand will seitenlange Nachrichten lesen. Fassen Sie sich kurz, aber präzise. Wenn nötig, teilen Sie Ihr Feedback in kleinere Abschnitte auf.
Vermeiden Sie Missverständnisse.
Emojis können helfen, den Tonfall zu verdeutlichen. Wenn Sie zum Beispiel etwas freundlich meinen, fügen Sie ein Lächeln hinzu, J. Aber nicht übertreiben – es soll professionell bleiben!
Stellen Sie sicher, dass die Technik funktioniert.
Ob Videokonferenz oder Chat – überprüfen Sie vorher, dass Kamera, Mikrofon und Internetverbindung stabil sind. Technische Probleme lenken vom Feedback ab.
Wählen Sie den richtigen Kanal.
Nicht jedes Feedback passt in einen Chat. Besprechen Sie wichtige oder heikle Themen besser in einer Video- oder Telefonkonferenz, damit der Ton rüberkommt und Missverständnisse vermieden werden. Je emotionaler der Inhalt, umso bedeutsamer ist es, das Gespräch in Präsenz durchzuführen.
Feedback- und Mitarbeitergespräche für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © nenetus – stock.adobe.comKorrektur: Petra-Kristin Bonitz, Hemmingen
Print ISBN: 978-3-527-72280-8ePub ISBN: 978-3-527-85107-2
Über den Autor
Dr. Rüdiger Klepsch ist Diplom-Psychologe und seit 30 Jahren Experte für Veränderungsprozesse speziell im Medienbereich. Seine Managementberatung Dr. Klepsch & Partner bringt seit 1993 Stabilität und Sicherheit in Transformationsprozesse und sorgt für die Verknüpfung von psychologischen und betriebswirtschaftlichen Themen. Das 2009 gegründete Systemische Institut Hamburg (www.systemisches-institut-hamburg.de) bildet systemisch arbeitende Business Coaches und systemisch arbeitende Organisationsentwickler aus, um für die komplexen psychologischen Anforderungen des Wandels innerhalb einer Person, in Teams und in Organisationen gewappnet zu sein.
Dr. Klepsch publiziert regelmäßig Fachartikel in Fachmagazinen und Zeitschriften, unter anderem für SPIEGEL-Online als Kolumnist zur Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Bevor er seine Laufbahn als Unternehmensberater startete, arbeitete er als Psychotherapeut und Supervisor in der Verhaltenstherapie-Ambulanz des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Wie Sie dieses Buch benutzen
Konventionen in diesem Buch
Törichte Annahmen über die Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Grundlagen zum Feedback
Kapitel 1: Die wahre Bedeutung von Feedback
Die Kernfunktion: Feedback schafft Klarheit
Sechs mal zwei Perspektiven von Feedback
Feedback ganz privat
Kapitel 2: Das Grundprinzip von Feedback: Senden, Empfangen und Abgleichen
Senden und Empfangen – wie Feedback funktioniert
Trügerische Wahrheiten: Warum Feedback so wichtig ist
Die Grundhaltung: Was gutes Feedback ausmacht
Kapitel 3: Feedback geben und nehmen – die wichtigsten Regeln
Grundregeln für den Feedbackgeber
Grundregeln für den Feedbacknehmer
Wann Feedbackregeln sinnlos sind
Stimmigkeit nach innen und außen herstellen
Feedbackregeln im Online-Setting anwenden
Feedback trainieren: Übung macht den Meister
Teil II: Feedback »von oben nach unten«: Chef beurteilt Mitarbeiter
Kapitel 4: Situatives Feedbackmodell: Auf die Dosis kommt es an
Die Eskalationstreppe des Feedbacks
Feedback als Führungsinstrument
Feedback »von oben nach unten«: Chef beurteilt Mitarbeiter – online
Kapitel 5: Zwischen Tür und Angel: das Kurzfeedback
Worum es beim Kurzfeedback geht
Die gefährlichsten Fallstricke beim Kurzfeedback
Die Wirksamkeit erhöhen – häufig Feedback geben
Kurzfeedback trainieren: Zuhören und Mut zum Konflikt
Kapitel 6: Bei Fehlern und Auffälligkeiten: Konstruktives Feedback
Die Kunst des konstruktiven Feedbacks
Als Feedbacknehmer richtig reagieren
Konstruktives Feedback für Fortgeschrittene
Konstruktives Feedback von Bildschirm zu Bildschirm
Kapitel 7: Wenn sich nichts ändert: Metafeedback
Ein klassisches Metafeedback durchführen
Das Metafeedback für Fortgeschrittene
Kurzcheck Metafeedback: die Kernpunkte für den Feedbackgeber
Metafeedback aus der Perspektive des Empfängers
Warum ein Metafeedback besser offline bleibt
Kapitel 8: Die letzte Chance: Das Kritikgespräch
Ablauf eines Kritikgesprächs
Gesprächsführung im Kritikgespräch
Spezialfall: der unsympathische Mitarbeiter
Kurzcheck Kritikgespräch: die Kernpunkte für den Vorgesetzten
Kapitel 9: Nichts geht mehr: Wann Feedback sinnlos ist
Wenn Worte versagen: das No-Go-Gespräch
Flankierende Maßnahmen beim No-Go-Gespräch
Wann ein Feedback Zeitverschwendung wäre
Teil III: Feedback »von unten nach oben«: Mitarbeiter beurteilt Chef
Kapitel 10: Dem Chef Feedback geben
Aufwärtsfeedback – eine schwierige Angelegenheit
Perspektive Mitarbeiter: Den Chef loben und kritisieren
Mitarbeiterfeedback entgegennehmen
Online-Feedback von »unten nach oben«
Kapitel 11: Mitarbeiterfeedback systematisch einholen
Die offene Variante: Eine Feedbacksitzung einberufen
Die anonyme Variante: Mehrebenenfeedback per Fragebogen
Auf dem Weg zu einer (neuen) Feedbackkultur
Teil IV: Besondere Feedbacksituationen
Kapitel 12: Feedback unter Kollegen
Unter vier Augen: ein Wort von Kollege zu Kollege
In der Gruppe: gegenseitiges Feedback im Team
Kapitel 13: Mitarbeitergespräche und Feedback
Das Gemeinsame bei allen Mitarbeitergesprächen
Aufbau der einzelnen Gespräche
Kapitel 14: Verspätetes Feedback: Jahresgespräch und Leistungsbeurteilung
Das Jahresgespräch: Feedback in der Rückschau
Leistungsbeurteilung: Dem System ausgeliefert
Der Wahrnehmungsfalle entgehen
Kapitel 15: Feedback in besonders heiklen Situationen
Ratgeber für schwierige Fälle: das innere Team
Gut beraten vom inneren Team: Heikle Situationen meistern
Das Feedback in schwierigen Situationen verbessern
Teil V: Selbstfeedback
Kapitel 16: Beurteilung in eigener Sache: Sich selbst Feedback geben
Das Eigenbild korrigieren: Warum Selbstfeedback so wichtig ist
Selbstbeurteilung anhand allgemeingültiger Lebensanforderungen
Selbstbeurteilung nach dem Riemann-Thomann-Modell
Selbstfeedback durch Persönlichkeitstests
Kapitel 17: Der Außentest: Aktiv Feedback einholen
Feedback für die persönliche Weiterentwicklung
Das Selbstbild im Realitäts-Check
Den Entwicklungsprozess anstoßen
Online Feedback einholen – so geht's mit Herz und Verstand
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 18: (Etwas mehr als) zehn häufige Feedbackfehler
Kapitel 19: Zehn Tipps zum Umgang mit negativem Feedback
In der Höhle des Löwen
Zehn Tipps zum Umgang mit negativem Feedback
Kapitel 20: Zweimal zehn Fragen: Der Feedbacktest
Quiz: das Feedbackwissen im Test
Quiz zum Online-Feedback
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Checkliste Feedbackannahme
Tabelle 3.2: Stimmig Feedback geben: das Vier-Felder-Schema nach Professor Fried...
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Die sieben Phasen des konstruktiven Feedbackgesprächs
Tabelle 6.2: Resümee eines Feedbackgesprächs
Kapitel 7
Tabelle 7.1: Beispiel für ein Anforderungsprofil
Kapitel 14
Tabelle 14.1: Eine Liste der Highlights und Lowlights für jeden Mitarbeiter
Tabelle 14.2: Beispiel für einen Aktionsplan
Tabelle 14.3: Auszug aus einem Beurteilungsbogen
Kapitel 16
Tabelle 16.1: Das Johari-Fenster: Je kleiner der blinde Fleck ist, desto besser...
Kapitel 17
Tabelle 17.1: Einteilung möglicher Rückmeldungen in vier Quadranten
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Vom Sender zum Empfänger zum Sender
Abbildung 2.2: Vier Seiten einer Nachricht nach Friedemann Schulz von Thun
Abbildung 2.3: Sechs oder Neun? Je nach Sichtweise wird dieselbe Form anders wah...
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Die Rückmeldung richtig dosieren: fünf Eskalations...
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Das Eisbergmodell
Kapitel 16
Abbildung 16.1: Menschliche Grundausrichtungen nach dem Riemann-...
Abbildung 16.2: Beispiel einer Abteilungsleiterin: Darstellung d...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
4
7
8
9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
279
280
281
282
283
284
285
286
287
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
307
309
310
311
312
313
314
315
Einführung
Feedback heißt Rückmeldung – und Rückmeldungen bestehen keineswegs nur aus dem, was andere Menschen ungefragt oder auf unsere Bitte »zurückmelden«. Feedback heißt für einen Rundfunksender, dass seine Programme gehört oder nicht gehört werden. Feedback bedeutet für ein produzierendes Unternehmen, zu erfahren, ob seine Produkte verkauft werden oder in den Regalen verstauben. Wenn Sie morgens aus dem Haus gehen, meldet Ihnen ein Kältegefühl, dass Sie doch lieber Schal und Handschuhe mitgenommen hätten. Auf dem Weg zur U-Bahn gibt Ihnen der Duft von Kaffee den Impuls, doch noch einen Kaffee to go zu kaufen. Und so geht es weiter: Noch bevor Sie das Büro erreichen, bekommen Sie zahlreiche Rückmeldungen, die Ihnen bei der Orientierung im Alltag helfen. Über zu wenig Feedback müssen Sie sich also wahrlich nicht beklagen!
Rückmeldungen, also Feedback, entweder bewusst eingesetzt oder unbewusst, durchdringen unseren Alltag. Dieses Buch behandelt einen Ausschnitt: Es konzentriert sich auf das bewusste Feedback, das auf Kommunikation beruht – das also durch Worte oder über Gesten, Mimik, Stimme und Stimmlagen gegeben wird. Dabei gilt eine wichtige Annahme: Es gibt nicht die Wahrheit! Jeder schafft sich seine Wirklichkeit. Somit gibt es so viele Wirklichkeiten, wie es Menschen gibt.
Durch Feedback ist es möglich, unterschiedliche Wirklichkeiten zu erkennen und abzugleichen. Wer eine dauerhaft produktive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen Menschen anstrebt, muss an einem solchen Vergleich der Wirklichkeiten brennend interessiert sein. Nur wenn die Selbst- und Fremdbilder der beteiligten Personen zusammenpassen, können sie reibungsarm zusammenarbeiten – und nur wenn eine gemeinsame Sicht auf die Wirklichkeit geklärt ist, steigt die Wahrscheinlichkeit einer guten Zusammenarbeit.
Feedback dient also zur Klärung des Unterschieds, sei es in der Wahrnehmung einer Sache, einer Person, eines Verhaltens zwischen zwei Personen oder zwischen einer Person und einer Gruppe. Dank technischer Möglichkeiten lässt sich Feedback zudem auch in Form von Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen, Zuschauer- oder Zuhörerbefragungen oder Befragungen von Parteimitgliedern bekommen.
Feedback ist oft unangenehm. Zwar mögen wir es, wenn uns andere loben und so bestätigen, wie wir uns selbst gern sehen wollen. Sobald Feedback jedoch kritische Hinweise enthält, frustriert es schnell. Selbst wenn es respektvoll geäußert wird, schwingt doch immer die Botschaft mit: »Ich bin beim anderen nicht so gut ankommen, wie ich dachte.« Das ist natürlich unerfreulich.
Aber wer hat gesagt, dass Feedback angenehm sein muss? Viel wichtiger ist, dass Rückmeldung etwas Wertvolles ist. Sicher, es ist eine Zumutung, aber eben doch eine nützliche Zumutung. Richtig eingesetzt, ist Feedback ein mächtiges Allzweckführungsinstrument, das es ermöglicht, Verhalten zu steuern und zielgerichtet zusammenzuarbeiten.
Konstruktives Feedback hat viele Vorteile. Es ermutigt Menschen, selbst wenn der Inhalt nicht lobend, sondern kritisch ist. Es ermöglicht Lernen, weil es bei der Fehlersuche hilft; ebenso löst es persönliche Lernprozesse aus. Die Identifikation mit der Aufgabe, zu der man Rückmeldung erfährt, verdichtet sich. So führt häufiges Feedback im Berufsalltag zu einer erhöhten Identifikation mit der Arbeitsumgebung und der eigenen beruflichen Entwicklung. Mehr noch: Bei gelungenem Feedback verbessert sich die Beziehung zwischen Feedbackgeber und Feedbacknehmer. Wenn Ihnen jemand durch Feedback signalisiert: »Ich setze mich mit Ihnen auseinander«, hebt das Ihre Motivation – vorausgesetzt natürlich, das Feedback ist erwünscht und wird in einer Form vermittelt, dass Sie zuhören mögen.
Es ist keine gute Alternative, Feedback zu vermeiden. Wer vor der Realität die Augen verschließt, erspart sich zwar unangenehme Erkenntnisse, aber der Preis ist hoch: Wer sich der Frustration des Feedbacks entzieht, lebt nur kurzfristig komfortabler. Mit der Weigerung, über Feedback die Realität zur Kenntnis zu nehmen, steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, früher oder später umso heftiger mit eben dieser Realität zusammenzuprallen. Es lohnt sich also, sich mit den Regeln für ein konstruktives Feedback vertraut zu machen. Genau das ist das Ziel dieses Buches.
Über dieses Buch
Ohne Feedback befinden Sie sich im Blindflug. Bezogen auf den Arbeitsalltag könnte man sagen: Sie betreiben »Management By Surprise«. Sie wissen nicht, ob das, was Sie tun, den Erwartungen des Vorgesetzten oder der Kollegen entspricht. Umgekehrt weiß Ihr Vorgesetzter oder Kollege nicht, welche Prioritäten Sie gerade gesetzt haben und welches Ziel Sie genau ansteuern. Erst Feedback gibt die Orientierung, die Sie im Alltag, insbesondere im beruflichen Alltag, benötigen.
Hybrides Arbeiten – die Kombination aus Büroarbeit und Homeoffice – bringt besondere Herausforderungen mit sich, nicht nur, aber insbesondere auch beim Feedbackgeben. Ihnen ist bestimmt schon aufgefallen, dass es durch das Fehlen persönlicher Kommunikation und durch verzögerte oder verzerrte Signale leicht zu Missverständnissen kommen kann. Technische Barrieren machen den Austausch nicht einfacher.
Dieses Buch hilft Ihnen, die notwendigen kommunikativen Feedbackprozesse bewusst wahrzunehmen – und leitet Sie dazu an, Feedback konstruktiv und zielgerichtet einzusetzen.
Beleuchtet wird das Thema aus beiden Perspektiven – der des Feedbackgebers und der des Feedbacknehmers. Außerdem wird die Online-Perspektive für Feedbacknehmer und Feedbackgeber – wo sinnvoll – beleuchtet. Das Buch vermittelt einerseits Regeln und Verfahren, wenn Sie Rückmeldung geben und so das Verhalten Ihrer Mitarbeiter effektiver und effizienter gestalten wollen. Andererseits erfahren Sie, wie Sie Feedback entgegennehmen oder sogar aktiv einholen, um so Ihr eigenes Verhalten zu korrigieren. Dies sowohl bei Präsenz als auch bei hybriden Arbeitsbedingungen.
Die Feedbackregeln sind durchweg zukunftsorientiert. Ermutigung des anderen und Respekt vor dem anderen sind die beiden Grundpfeiler, auf denen die Hinweise dieses Buches aufbauen. Dahinter steht die Annahme, dass ein respektvoller und wertschätzender Umgang, unabhängig von der hierarchischen Zuordnung, die mächtigste, weil einflussreichste Haltung ist.
Wie Sie dieses Buch benutzen
Je nach Situation können Sie dieses Buch unterschiedlich nutzen. Wenn Sie Feedback geben wollen, stellt sich die Lage anders dar, als wenn Sie ein Feedback empfangen. Als Führungskraft haben Sie andere Probleme mit dem Feedback als in der Rolle als Mitarbeiter. Als Coach und Coachee, Trainer und Trainee sind Ihre Motive, dieses Buch zu nutzen, wieder anders.
Um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, ist das Buch so aufgebaut, dass es auch als Nachschlagewerk dienen kann. Die einzelnen Kapitel stehen für sich und können Ihnen in einzelnen Feedbacksituationen ein wertvoller Ratgeber sein. Allerdings empfehle ich Ihnen, zunächst Teil I zu lesen: Die dort dargestellten Grundlagen sind für das Verständnis von Feedback wichtig.
Sie können das Buch aber auch als abgeschlossenes Ganzes betrachten. Dann beginnen Sie mit den Grundlagen und erarbeiten sich nach und nach die unterschiedlichen Anwendungsgebiete und Techniken. So erwerben Sie ein praktisch-methodisches Rüstzeug, mit dem Sie nicht nur die wichtigsten Feedbacksituationen professionell meistern können, sondern auch in der Lage sind, in Ihrem Verantwortungsbereich eine moderne, auf gegenseitiger Wertschätzung beruhende Feedbackkultur aufzubauen.
Das Buch möchte darüber hinaus Anstoß geben, die eigene Person weiterzuentwickeln. Es wendet sich daher auch an alle, die besser werden wollen, die mit den Gegebenheiten nicht zufrieden und neugierig auf mehr sind. Das in diesem Buch vorgestellte Feedbackinstrumentarium ermöglicht es, auch sich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen.
Konventionen in diesem Buch
Damit Sie sich besser in diesem Buch zurechtfinden, möchte ich Folgendes mit Ihnen vereinbaren:
Kursivdruck
verwende ich, um bestimmte Dinge hervorzuheben und auf neue Begriffe aufmerksam zu machen, die anschließend erläutert werden.
Fettdruck
verwende ich bei wichtigen Begriffen in gegliederten Aufzählungen.
Schreibmaschinenschrift
verwende ich für Webadressen.
In grau unterlegten Kästen finden Sie interessante Informationen, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
Törichte Annahmen über die Leser
Es gibt zahlreiche Bücher über Managementtechniken. Ich gehe davon aus, dass Sie kein weiteres Buch über irgendeine kompliziert klingende Managementtechnik lesen wollen. Stattdessen sind Sie daran interessiert, sich endlich einmal eingehend mit der »Mutter aller Führungstechniken« zu befassen: dem Feedback.
Ich habe ein paar Punkte aufgelistet, warum ich glaube, dass dieses Buch Sie interessiert:
Sie möchten mehr über das Geben und Nehmen von Feedback im beruflichen Alltag erfahren.
Sie fühlen sich beim Feedbackgeben manchmal unsicher und möchten lernen, wie Sie mit Ihren Vorgesetzten, Mitarbeitern oder Kollegen in schwierigen Feedbacksituationen besser umgehen.
Es fällt Ihnen manchmal schwer, Feedback entgegenzunehmen – und Sie möchten wissen, wie Sie mit solchen Situationen professionell umgehen.
Sie arbeiten ganz oder teilweise remote, was Ihnen das Feedback-Geben oder -Nehmen noch zusätzlich erschwert.
Sie möchten sich persönlich weiterentwickeln, indem Sie Feedbacktechniken anwenden oder auf sich wirken lassen.
Es geht Ihnen um die praktische Umsetzung im Berufsalltag. Sie sind zwar an einer theoretischen Einordnung und an einem Überblick interessiert – aber nur soweit es sinnvoll ist, um die Feedbackregeln zu verstehen und in der Praxis erfolgreich anwenden zu können.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Das Buch ist in sechs Teile untergliedert. Nach einem grundlegenden Teil, verbunden mit etwas Theorie, liegt der Schwerpunkt in der praktischen Umsetzung.
Teil I: Grundlagen zum Feedback
Der erste Teil führt Sie in die Grundlagen des Feedbacks ein. Sie erfahren, warum Feedback so wichtig ist und wie es funktioniert. Deutlich wird, dass es unterschiedliche Varianten gibt: anerkennendes Feedback, kritisierendes Feedback, ja sogar Situationen, in denen Feedback nicht mehr sinnvoll ist. Nach einem kurzen Ausflug in die Theorie lernen Sie die wesentlichen Regeln kennen, um einerseits konstruktiv Feedback zu geben und andererseits Feedback richtig zu empfangen. Dabei werden immer auch die Besonderheiten des remote gegebenen Feedbacks berücksichtigt.
Teil II: Feedback »von oben nach unten«: Chef beurteilt Mitarbeiter
Der zweite Teil beleuchtet die Situation, in der Sie als Vorgesetzter Ihren Mitarbeitern Rückmeldung geben möchten. Für den Führungsalltag hat ein systematisches Feedback eine enorme Bedeutung: Es gibt Ihren Mitarbeitern Orientierung, motiviert sie – und trägt so entscheidend dazu bei, die Abteilungs- oder Teamziele zu erreichen.
Der Grundgedanke dieses Feedbacks vom Vorgesetzten zum Mitarbeiter liegt darin, die für die jeweilige Situation richtige Feedbackform zu wählen. Ich stelle eine »Eskalationstreppe des Feedbacks« vor. Sie reicht vom Kurzfeedback zwischen Tür und Angel über das konstruktive Feedback, das Metafeedback und das Kritikgespräch bis hin zu Situationen, in denen kein Feedbackgespräch mehr geführt werden kann.
Teil III: Feedback »von unten nach oben«: Mitarbeiter beurteilt Chef
Auch Vorgesetzte sind nur Menschen – und Rückmeldungen können für sie nützlich und heilsam sein. Doch wie geben Sie Ihrem Chef ein Feedback, ohne dass er gleich sauer ist? Wenn Sie Ihren Chef kritisieren, bewegen Sie sich auf gefährlichem Terrain. Teil III befasst sich mit den Risiken und Gefahren des Aufwärtsfeedbacks, beleuchtet das Thema aber auch aus umgekehrter Perspektive: Wie nehmen Sie als Chef das Feedback Ihrer Mitarbeiter richtig entgegen? Und was können Sie tun, um in Ihrer Abteilung oder Ihrem Unternehmen eine konstruktive Feedbackkultur zu entwickeln?
Teil IV: Besondere Feedbacksituationen
Entwicklungsgespräche, Rückkehr -und Fehlzeitengespräche, Vertragsauflösungs- oder Kündigungsgespräche, Exit-Interviews, Leistungsbeurteilungsgespräche, Jahresmitarbeitergespräche, auch das Feedback unter Kollegen – das alles sind besondere Feedbacksituationen, die in diesem Teil herausgegriffen werden. Auch auf einige heikle Situationen, die Ihnen im Alltag immer wieder begegnen, gehe ich hier gesondert ein: Wie reagieren Sie zum Beispiel, wenn sich Mitarbeiter A bei Ihnen über Mitarbeiter B beschwert? Oder wie gehen Sie mit einem aggressiven, wie mit einem aufdringlichen Menschen um? Oder wie vermitteln Sie einem Kollegen, dass er Mundgeruch hat? Und die Besonderheiten im Homeoffice? Natürlich gibt es Herausforderungen, aber diese sind da, um gemeistert zu werden. Seien Sie direkt, klar und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft ankommt. Gute Führung und damit letztendlich gute Kommunikation endet nicht an der Bürotür – sie wird in diesen Zeiten sogar noch wichtiger.
Teil V: Selbstfeedback
Im fünften Teil lernen Sie, wie Sie sich selbst Feedback geben und wie Sie aktiv Feedback einholen, um zu erfahren, wie andere Menschen Sie wahrnehmen. Gerade in einer immer komplexeren Welt ist es enorm wichtig, sich selbst, seine Bedürfnisse und seine eigene innere Haltung genau zu kennen – denn das ist die Grundlage, um die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Selbstfeedback ist ein Weg, die eigenen Schwachstellen oder »blinden Flecken« auszuleuchten und so sich selbst besser kennenzulernen.
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Im Top-Ten-Teil erhalten Sie praktische Tipps in komprimierter Form. Sie erfahren die häufigsten Fehler beim Feedback und bei Mitarbeitergesprächen. Außerdem finden Sie hier kurz zusammengefasst die besten Tipps zum Umgang mit negativem Feedback – und schließlich einen Test, der Ihnen hilft, die wichtigsten Aspekte dieses Buches zu rekapitulieren. Selbstverständlich gibt es auch praktische Tipps für das Arbeiten am Monitor.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Im Verlauf des Buches begegnen Ihnen immer wieder Symbole, die Ihnen helfen, bestimmte Arten von Informationen leicht zu finden.
Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und Ratschläge, wie Sie die Effektivität Ihres Feedbacks optimieren können.
Elefanten vergessen nie, Menschen schon. Dieses Symbol weist auf Informationen hin, die Sie nicht vergessen sollten.
Dieses Symbol weist auf mögliche Probleme und Fallstricke hin.
Oft kann nur ein Beispiel einen Gedankengang richtig lebendig werden lassen. Die Beispiele im Text sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.
Und manchmal sollen Sie auch selbst aktiv werden! Wenn Sie dieses Symbol sehen, habe ich eine kleine Übung für Sie eingebaut.
Wie es weitergeht
Nutzen Sie dieses Buch nach Lust und Laune: Vielleicht haben Sie ein wichtiges Mitarbeitergespräch oder Feedbackgespräch vor sich. Dann erfahren Sie in der Einführung, mit welchem Kapitel Sie sich darauf vorbereiten können, um aus diesem Gespräch den größten Nutzen ziehen zu können. Viele wollen sich persönlich weiterentwickeln und benötigen ein Repertoire an Begriffen und Techniken, um diese Weiterentwicklung zu steuern. Diese Leser sollten sich auf den Selbstfeedback-Teil konzentrieren. Vielleicht wollen Sie sich aber auch über die vielfältigen Möglichkeiten des Feedbacks informieren; dann kommen Sie nicht umhin, das gesamte Buch von vorn bis hinten zu lesen. Für ganz schnelle Leser sei die Schummelseite, das Stichwortverzeichnis und der Top-Ten-Teil empfohlen.
Ab diesem Punkt liegt es an Ihnen, sich über das Erkenntnisziel klar zu werden und das Leseverhalten darauf abzustimmen. Viel Spaß!
Teil I
Grundlagen zum Feedback
IN DIESEM TEIL …
Der erste Teil dieses Buches führt Sie in die Grundlagen des Feedbacks ein. Sie erfahren, warum Feedback so wichtig ist und wie es funktioniert. Zudem lernen Sie die wesentlichen Regeln kennen, um einerseits konstruktiv Feedback zu geben und andererseits Feedback richtig zu empfangen.
Kapitel 1
Die wahre Bedeutung von Feedback
IN DIESEM KAPITEL
Feedback als KlärungsprozessSechs FeedbacksituationenPersönlicher Nutzen von FeedbackAuf den ersten Blick ist Feedback etwas Alltägliches. Sie erhalten Feedback, Sie geben Feedback. Ständig, bei jeder Gelegenheit. Sie finden etwas gut oder schlecht und teilen es dem anderen mit. Und umgekehrt.
Was auf den ersten Blick so banal erscheint, erweist sich bei näherem Hinsehen als höchst komplexes Thema. Mehr noch: als ein Thema mit enormer praktischer Bedeutung – für den beruflichen Erfolg ebenso wie für die eigene persönliche Entwicklung. Feedback entpuppt sich als ein Thema, das besondere Aufmerksamkeit verdient. Dieses Kapitel möchte die Augen für die Dimensionen öffnen: Es gibt einen Überblick und zeigt auf, worin die besondere Bedeutung von Feedback liegt.
Die Kernfunktion: Feedback schafft Klarheit
Feedback ist nicht nur eine Schönwetterangelegenheit, die sich im gelegentlichen Lob oder in ein paar kritischen Hinweisen zwischen Tür und Angel erschöpft. Eine Form von Feedback ist zum Beispiel auch das ernsthafte Gespräch, das Sie mit einem Mitarbeiter führen, der mit seinem Verhalten die Abteilungsziele gefährdet – etwa weil er wiederholt Termine nicht eingehalten oder wichtige Informationen nicht weitergegeben hat.
Nun steht viel auf dem Spiel, und Sie benötigen eine gute Strategie, damit das Gespräch gelingt. Zum Beispiel kann es passieren, dass dieser Mitarbeiter mit Ihrem Feedback überhaupt nicht einverstanden ist. Sie haben den Eindruck, dass er Ihre Kritik nicht einsieht. Was tun? Nun, Sie könnten jetzt Ihre Argumente wiederholen, etwas lauter und massiver, in der Hoffnung, dass er endlich kapiert, was Sie meinen. Es kann doch nicht so schwer sein?!
Eine Alternative läge darin, die Perspektive zu wechseln und ernsthaft zu versuchen, die Sichtweise des Mitarbeiters zu verstehen. In diesem Fall stellen Sie einige gezielte Fragen, um herauszufinden, wie er die Situation wahrnimmt.
Fassen Sie dann in eigenen Worten zusammen, was der andere gesagt hat, etwa in dem Tenor: »Ich möchte gern sichergehen, dass ich Sie richtig verstanden habe. Ihr Gefühl ist, dass Sie Ihre Kollegen immer korrekt informiert haben, was bei mir aber nicht angekommen ist …«
So entsteht ein Feedbackprozess: Sie geben Rückmeldung zu dem, was Ihr Mitarbeiter gesagt hat, der hierauf reagieren kann. Dieses Hin und Her schafft zunehmend Klarheit. Das muss keineswegs heißen, dass Sie sich am Ende mit Ihrem Gegenüber einig sind. Aber die unterschiedlichen Sichtweisen liegen auf dem Tisch. Immerhin!
Wenn Sie jetzt eine Entscheidung treffen, kann der Mitarbeiter sie nachvollziehen. Er hat Ihre Position kennengelernt und weiß, dass Sie seine Sichtweise zur Kenntnis genommen haben. Damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er Ihre Entscheidung akzeptiert, etwa wenn Sie sagen: »Wir haben die Situation jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert und ich habe den Eindruck, dass jeder von uns weiterhin auf seiner Sichtweise besteht. Ich kann nicht sehen, dass wir jetzt aufeinander zukommen. Deshalb schlage ich vor, dass wir beide das Thema einen Monat lang beobachten und dann noch einmal ein Feedbackgespräch führen.«
Das Beispiel zeigt: Feedback schafft Klarheit, indem es die unterschiedlichen Sichtweisen ausleuchtet. Die eine Person gibt ein Feedback, die andere empfängt es – und meldet ihr Feedback zum Feedback zurück. So entsteht ein Feedbackprozess, der Schritt für Schritt die unterschiedlichen Sichtweisen offenlegt. Man fängt an, einander zu verstehen. Genau da liegt die besondere Bedeutung von Feedback: Es bietet die Möglichkeit, Unterschiede in der Wahrnehmung aufzudecken und gegenseitig sichtbar zu machen.
Diese Klarheit ist gerade im betrieblichen Zusammenhang bedeutsam. Nur wenn ein Mitarbeiter verstanden hat, was der Vorgesetzte von ihm erwartet, kann er effektiv arbeiten. Erst das regelmäßige Feedback gibt die notwendige Orientierung. Oder umgekehrt formuliert: Je weniger der Vorgesetzte seinen Mitarbeitern Rückmeldung gibt, desto größer ist die Gefahr, dass sie vom Kurs abkommen und die Abteilungs- oder Unternehmensziele verfehlt werden.
Sechs mal zwei Perspektiven von Feedback
Bei jedem Feedback gibt es zwei Beteiligte, den Feedbackgeber und den Feedbacknehmer. Oder um ein Begriffspaar aus der Kommunikationswissenschaft zu verwenden: Es gibt einen Sender und einen Empfänger. Daran anknüpfend lässt sich das »Phänomen Feedback« aus unterschiedlichen Perspektiven beschreiben:
Als
Feedbackgeber
senden Sie eine Botschaft. Dabei gilt es, zu unterscheiden, wer der Empfänger ist. Je nachdem, ob Sie sich an Ihren Chef, einen Ihrer Mitarbeiter oder einen Kollegen richten, wählen Sie eine andere Vorgehensweise.
Als
Feedbacknehmer
empfangen Sie eine Botschaft und müssen darauf reagieren. Wie Sie das am besten tun, hängt davon ab, wer der Sender ist – Chef, Mitarbeiter oder Kollege.
Dementsprechend lassen sich sechs typische Situationen unterscheiden: Sie geben Feedback …
»nach unten«,
»nach oben«,
an eine Person auf gleicher Ebene
… oder Sie empfangen Feedback …
»von oben«,
»von unten« oder
von jemandem auf Ihrer Ebene.
Alle diese Situationen können in einem hybriden(= mindestens ein Teilnehmer ist online dazugeschaltet) Setting stattfinden. Als Vorgesetzter oder Mitarbeiter werden Sie mit all diesen Varianten konfrontiert sein und benötigen jeweils ein anderes Rüstzeug, um mit der Situation richtig umzugehen – und jede davon funktioniert in Präsenz etwas anders als in einem hybriden Setting. Aber keine Angst, all diese Situationen gehe ich nun Schritt für Schritt mit Ihnen durch.
Einem Mitarbeiter Feedback geben
Wer eine konstruktive Rückmeldung geben will, muss sich die Mühe machen, sein Feedback nachvollziehbar aufzubereiten und einfühlsam zu kommunizieren – und läuft dennoch Gefahr, einen Konflikt austragen zu müssen. So ist es kein Wunder, dass viele Führungskräfte die Situation gern meiden oder hinausschieben. Dabei übersehen sie, dass das Geben von Feedback zu ihren ureigenen Führungsaufgaben zählt.
Einem Mitarbeiter Feedback geben – das ist ein erlernbares Handwerk und zugleich eine Kunstfertigkeit, an der sich ein Vorgesetztenleben lang feilen lässt. Entscheidend ist die Feedbackdosis: Wo ein kurzes Feedback zwischen Tür und Angel genügt, bedarf es keines großen Kritikgesprächs. Das hieße, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
In Kapitel 4 lernen Sie eine »Eskalationstreppe des Feedbacks« kennen. Oft genügt die unterste Stufe, ein kritischer Hinweis, damit ein Mitarbeiter sein Verhalten ändert. Sollte ein solches Kurzfeedback nicht fruchten, stehen weitere Eskalationsstufen zur Verfügung. Sie reichen vom konstruktiven Feedback über das Metafeedback bis zum Kritikgespräch.
Deutlich wird: Feedback ist ein Führungsinstrument, auf dem sich virtuos spielen lässt – mal in leisen Tönen, mal mit Pauken und Trompeten.
Dem Vorgesetzten Feedback geben
Als Mitarbeiter sind Sie mit Ihrem Vorgesetzten unzufrieden und wollen ihm das auch sagen. In diesem Fall sind Sie der Sender – und möchten Ihr Anliegen »nach oben senden«. Ein solches Aufwärtsfeedback hat seine Tücken. Man weiß ja nie, wie der Chef reagiert. Und wer seine Karriere nicht gefährden will, verdirbt es sich nicht mit ihm.
Gerade Topmanager tun sich manchmal schwer, Feedback entgegenzunehmen. Anstatt ein Fehlverhalten einzuräumen, reagieren sie gekränkt. Der Dumme ist dann der Mitarbeiter, der sich getraut hat, seinem Chef ein ehrliches Feedback zu geben. Anstatt Anerkennung für seinen Mut zu bekommen, fühlt er sich bestraft. Wer will schon dieses Risiko eingehen?
Ob Sie Ihrem Chef ein negatives Feedback geben, hängt von der konkreten Situation ab und sollte in jedem Fall gut überlegt sein; Kapitel 10 gibt Ihnen hierzu die erforderliche Hilfestellung. Falsch wäre es jedoch, auf Kritik am Chef grundsätzlich zu verzichten. Wenn Sie sich zum Beispiel von Ihrem Chef nicht wertgeschätzt, nicht unterstützt oder gefördert fühlen, wirkt das auf Dauer enorm belastend. Es kann die Zusammenarbeit gefährden und Ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Spätestens dann besteht Handlungsbedarf – und da sollten Sie die Initiative ergreifen und trotz aller Bedenken auf Ihren Vorgesetzten zugehen.
Gelingt das Feedback, können Sie damit rechnen, künftig entspannter und damit auch effektiver arbeiten zu können. Das liegt auch im Interesse des Vorgesetzten, der von einem guten Arbeitsklima ebenfalls profitiert.
Letztlich weiß auch der Vorgesetzte, dass er auf konstruktives Feedback angewiesen ist. Entscheidend ist deshalb, dass Sie das Aufwärtsfeedback richtig anpacken – auf eine Weise, die der Vorgesetzte tatsächlich als konstruktiv ansieht.
Nebenbei bemerkt: Es muss ja nicht immer Kritik sein. Sie können Ihren Chef auch mal loben – sofern Sie etwas wirklich gut finden. Alle Menschen möchten gern gelobt werden. Auch Vorgesetzte. Ein ehrlich gemeintes Lob trägt zu einer belastbaren Beziehung bei, die auch negatives Feedback verträgt.
Einem Kollegen Feedback geben
Ein Wort von Kollege zu Kollege: Diese Situation unterscheidet sich vom Feedback zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter vor allem in einem Punkt: Es gibt kein hierarchisches Verhältnis.
Das macht die Sache keineswegs einfacher. Wenn etwa Ihr Kollege in einem ausgefallenen, Ihnen völlig unpassend erscheinenden Outfit zur Arbeit kommt, ist das bis zu einem gewissen Grad sein Privatvergnügen. Selbst wenn Sie das Verhalten Ihres Kollegen als sehr störend empfinden, kann es besser sein, sich eine Bemerkung zu verkneifen. In vielen Fällen treffen schlicht unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinander. Und da ist es meistens besser, diese Tatsache anzuerkennen und den anderen so zu akzeptieren, wie er ist.
Überlegen Sie genau, ob Sie ein störendes Verhalten wirklich ansprechen wollen. Je mehr Sie eine bestimmte Verhaltensweise stört, desto eher ist es angebracht, den Kollegen offen und ehrlich darauf anzusprechen. Dabei hilft es, die eigene Motivation zu hinterfragen und zu überlegen, warum Sie sein Verhalten nicht tolerieren.
Es gibt aber auch Fälle, da müssen Sie einem Kollegen Feedback geben – nämlich dann, wenn sein Verhalten Ihre Arbeitsleistung beeinträchtigt. Wenn Ihnen ein Kollege wichtige Informationen nicht weitergibt oder Termine nicht einhält, ist der Fall eindeutig: Um ein Feedbackgespräch mit diesem Kollegen kommen Sie nicht herum. Dann liegen die Dinge aber auch klar auf der Hand. Die Kritik lässt sich an einem konkreten Verhalten im Zusammenhang mit der Arbeit festmachen. Damit mischen Sie sich ganz sicher nicht in eine Privatangelegenheit ein.
Feedback vom Vorgesetzten empfangen
Nicht Sie laden zum Feedbackgespräch, sondern Ihr Vorgesetzter möchte mit Ihnen sprechen. Verständlich, wenn Ihnen die Situation erst einmal missfällt. Offenbar ist Ihr Vorgesetzter mit Ihren Leistungen unzufrieden, womöglich steht Ihre weitere Karriere auf dem Spiel. Nehmen Sie den Feedbacktermin deshalb ernst – und bereiten Sie sich darauf vor. Und bedenken Sie vor allem eines: Ihr Vorgesetzter ist weniger an Rechtfertigungen interessiert als daran, dass in Zukunft die Ergebnisse stimmen. Für das Gespräch gilt eine Grundregel: Lassen Sie den Vorgesetzten ausreden, hören Sie ihm bis zum Ende zu. Zuhören ist die Grundvoraussetzung, um die unterschiedlichen Wahrnehmungen zu erkennen und ein gemeinsames Verständnis aufzubauen.
Führt der Austausch der Fakten zu keiner einheitlichen Sichtweise, ist es nicht sinnvoll, wenn Sie dem Vorgesetzten seine Wahrnehmung ausreden wollen. Am Ende entscheidet er – und Sie müssen wohl oder übel akzeptieren, dass seine Einschätzung gilt.
Sie empfangen Feedback von einem Mitarbeiter
Machen wir uns noch einmal klar: Feedback dient der gegenseitigen Abstimmung und gibt beiden Seiten die notwendige Orientierung, um etwa ein gemeinsames Ziel auf effektive Weise zu erreichen. Schon deshalb liegt es in Ihrem Interesse, wenn Sie als Vorgesetzter ehrliches Feedback von Ihren Mitarbeitern erhalten. Das gilt umso mehr, als das Feedback eines Mitarbeiters mit einiger Wahrscheinlichkeit auf ein ernstes Problem hinweist, denn wer sich dazu durchringt, seinem Chef ein Feedback zu geben, hat in der Regel wirklich etwas zu sagen.
Wie reagieren Sie auf das Feedback eines Mitarbeiters? Wie können Sie dazu beitragen, dass es konstruktiv verläuft? Kurz zusammengefasst kommt es auf zwei Regeln an:
Nehmen Sie das Feedback eines Mitarbeiters grundsätzlich wohlwollend entgegen, selbst wenn Ihnen die Kritik unberechtigt erscheint.
Hören Sie aktiv zu. Zuhören heißt ja nicht, dass Sie zustimmen. Sie können vollkommen anderer Meinung sein, aber Ihren Mitarbeiter dennoch in Ruhe anhören – so lange, bis Sie seinen Standpunkt wirklich verstanden haben.
Mit dieser Haltung erreichen Sie auch, dass der Mitarbeiter sich ernst genommen fühlt. Und genau das darf er bei einem konstruktiven Feedbackprozess auch erwarten: dass Sie bereit sind, seine Sicht der Dinge zu verstehen. Wie gesagt: Das heißt noch lange nicht, dass Sie diese Sichtweise teilen. Nun ist es alles andere als selbstverständlich, dass Mitarbeiter ihren Chefs freiwillig Feedback geben.
Es kann durchaus sein, dass Sie als Vorgesetzter von Ihren Mitarbeitern keine Rückmeldungen bekommen oder das Gefühl haben, dass Sie kein ehrliches Feedback erhalten.
Wenn Sie von Ihren Mitarbeitern kein Feedback erhalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Feedbackprozess »von unten nach oben« in Gang zu bringen. Zum Beispiel können Sie Ihre Mitarbeiter zu einem Meeting zusammenrufen und das Feedback in Form eines speziellen Workshops einfordern. Ein anderer Weg ist das sogenannte Mehrebenenfeedback, das anhand eines Fragebogens systematisch Rückmeldungen einholt. Beide Varianten beschreibe ich in Kapitel 11 ausführlich.
Feedback von einem Kollegen empfangen
Bleibt noch der Fall, dass ein Kollege Ihnen Feedback gibt. Grundsätzlich gilt auch hier: Versuchen Sie, der Kritik mit Wohlwollen zu begegnen – und hören Sie zu, anstatt im Abwehrmodus zu reagieren oder sich sofort zu rechtfertigen.
Zuallererst ist es »natürlich«, sich zu rechtfertigen, da Sie vielleicht einen Fehler begangen haben und sich konfrontiert sehen. Fehler aufgezeigt bekommen wird als Bedrohung wahrgenommen und löst automatisch und reflexartig – physiologisch nachweisbar – Schutzreaktionen wach, die ein vernunftbegabtes Sich-mit-dem-Thema-Auseinandersetzen schwer machen. Es ist jedoch nicht unmöglich: Aber vielleicht es hilft Ihnen auch, sich noch einmal vor Augen zu führen, dass Ihr Erfolg im Wesentlichen vom Lernen und Ihrer Lernfähigkeit abhängt. Die Kunst, negatives Feedback anzunehmen, beginnt mit der Einstellung, aus Fehlern lernen zu wollen und zu können. So erfahren Sie in diesem Buch auch, wie Sie eine konstruktive Gelassenheit entwickeln können.
Feedback in all diesen Perspektiven, aber online
Willkommen in der wunderbaren neuen Welt der hybriden Arbeit! Falls Sie sich schon gefragt haben, warum Ihr letztes Feedbackgespräch im Homeoffice so anders verlief als im Büro, dann ist dies Ihr Moment der Erleuchtung. Hybrides Arbeiten, also die Kombination von Büropräsenz und Homeoffice, bringt eine Reihe von ganz besonderen Herausforderungen mit sich – und die machen auch vor dem Feedbackprozess nicht halt.
Missverständnisse vorprogrammiert
Eine der größten Hürden in hybriden Settings ist das Fehlen von nonverbalen Signalen. Im Büro sehen Sie, ob Ihr Gesprächspartner nervös mit dem Stift spielt, sich zurücklehnt oder Ihnen interessiert in die Augen schaut. Diese kleinen, aber feinen Hinweise auf die Stimmung und den Zustand Ihres Gegenübers fehlen oft, wenn das Feedback »von Bildschirm zu Bildschirm« erfolgt. Da kann ein neutral gemeinter Kommentar schnell als scharfe Kritik rüberkommen – und schon haben Sie einen kleinen Konflikt, den es eigentlich nicht geben müsste.
Zeitversetzte Kommunikation
Eine weitere Herausforderung ist die zeitversetzte Kommunikation. Unterschiedliche Arbeitszeiten zwischen Teammitgliedern können dazu führen, dass Feedback nicht sofort und im Kontext der Situation gegeben wird. Das kann bedeuten, dass die Rückmeldung entweder zu spät ankommt oder in einem anderen Kontext interpretiert wird. Was im Büro direkt angesprochen wird, liegt im Homeoffice womöglich schon Stunden oder sogar Tage zurück – und hat seine Wirkung längst entfaltet.
Technische Hürden
Die Technik, unser Segen und Fluch zugleich, spielt ebenfalls eine Rolle. Schlechte Verbindungen, verpixelte Bilder oder verzögerte Audioübertragungen können die Qualität eines Feedbackgesprächs erheblich beeinträchtigen. Ein Stocken im Video-Call wird schnell als Unentschlossenheit interpretiert, und schon ist der Weg frei für Missverständnisse.
Das Gefühl der Isolation
Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird: die Isolation im Homeoffice. Mitarbeiter, die nicht regelmäßig im Büro sind, können sich leicht von der restlichen Gruppe abgeschnitten fühlen. Feedback, das im Büro unter vier Augen gut funktioniert, kann im virtuellen Raum schnell als »alleingelassen werden« empfunden werden. Hier ist es besonders wichtig, empathisch vorzugehen und sicherzustellen, dass sich niemand im virtuellen Raum verloren fühlt.
Wie meistern Sie nun diese Herausforderungen? Wie geben Sie in einem hybriden Setting dennoch effektives und konstruktives Feedback? Die folgenden Tipps werden Ihnen die Sache erleichtern:
Klare, direkte Kommunikation:
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Botschaften klar und deutlich formuliert sind. Was im Büro durch den Tonfall und die Körpersprache unterstützt wird, muss im virtuellen Raum explizit gesagt werden.
Regelmäßige Check-ins:
Häufige, kurze Feedback-Gespräche helfen, Missverständnisse zu vermeiden, und geben dem Mitarbeiter die Möglichkeit, sich regelmäßig auszutauschen.
Technische Vorbereitung:
Stellen Sie sicher, dass die Technik einwandfrei funktioniert, bevor Sie in ein wichtiges Feedbackgespräch gehen. Testen Sie Kamera und Mikrofon – denn nichts ist störender als technische Pannen während eines sensiblen Gesprächs.
Empathie und Verständnis:
Zeigen Sie Verständnis für die besondere Situation des Gegenübers. Manchmal ist ein schlechtes Internet nicht das größte Problem – vielleicht braucht Ihr Mitarbeiter einfach nur das Gefühl, gehört zu werden.
Follow-up im Büro:
Nutzen Sie die Tage im Büro, um Feedbackgespräche noch einmal persönlich aufzugreifen und etwaige Missverständnisse auszuräumen.
Feedback ganz privat
Ohne Feedback agieren wir weitgehend orientierungslos. Für eine effektive Zusammenarbeit im Team, für das Erreichen der Abteilungs- oder Unternehmensziele ist das Geben und Nehmen von Feedback deshalb unabdingbar. Feedback zählt zu den wichtigsten Führungsaufgaben. Daneben hat Feedback aber auch eine private Seite: Es kann als Instrument zur persönlichen Weiterentwicklung genutzt werden.
Es gibt Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die einem selbst nicht bewusst sind, Außenstehende aber sehr wohl sehen. Die Folge davon ist, dass Selbstbild und Fremdbild nicht übereinstimmen. Je weiter jedoch Selbstbild und Fremdbild auseinanderliegen, desto schwieriger fällt die Kommunikation mit anderen Menschen und desto weniger gelingt es, sich im Einklang mit seinem Umfeld zu bewegen und die eigenen Ziele zu erreichen.
Ziel sollte es sein, Selbst- und Fremdbild möglichst weitgehend in Einklang zu bringen. Hierzu bietet eine Feedbackstrategie die Lösung: Indem Sie auf die Rückmeldungen der anderen achten, erhalten Sie Informationen über alle jene Gewohnheiten, Vorlieben, Abneigungen oder Vorurteile, derer Sie sich bislang nicht bewusst waren.
Es kommt also darauf an, einen Feedbackprozess in eigener Sache in Gang zu bringen. Wie Sie das anstellen, erfahren Sie in den Kapiteln 15 und 16. Ein zentraler Punkt: Wenn Sie aktiv das Feedback anderer Menschen einholen, sind Sie zwar in einer Privatangelegenheit unterwegs, dennoch können Sie hierfür alle Feedbackgelegenheiten nutzen, die sich im Arbeitszusammenhang ohnehin ergeben.
Feedback ist eine Fertigkeit, die erlernt und trainiert werden kann. Nicht nur mit Blick auf die betrieblichen Ziele lohnt sich die Anstrengung: Feedback bietet auch die Chance, sich selbst besser kennenzulernen. Wer hingegen Konflikten lieber aus dem Weg geht und den Abgleich unterschiedlicher Wahrnehmungen scheut, bleibt Gefangener seiner eigenen Sichtweise. Er vergibt sich die Chance, seinen Horizont zu erweitern und sich selbst weiterzuentwickeln.
Kapitel 2
Das Grundprinzip von Feedback: Senden, Empfangen und Abgleichen
IN DIESEM KAPITEL
Sender und Empfänger von FeedbackAbgleich unterschiedlicher WahrheitenGrundhaltung für gutes FeedbackWas genau ist Feedback? Welche Funktion hat es in der zwischenmenschlichen Kommunikation? Welche Grundhaltung erfordert ein gutes Feedback? Dieses Kapitel legt wichtige Grundlagen. Sie lernen Zusammenhänge kennen, die Ihnen dabei helfen, die später vorgestellten Feedbackregeln zu verstehen und richtig anzuwenden.
Senden und Empfangen – wie Feedback funktioniert
Feedback bedeutet zunächst »Rückmeldung«. Das klingt einfach und banal, doch werden Sie in den folgenden Abschnitten erkennen: Feedback ist eingebettet in ein komplexes sozialpsychologisches Phänomen. Eine Person gibt Feedback, eine andere empfängt dieses Feedback – und meldet ihr Feedback zum Feedback zurück. So entstehen Feedbackschleifen, die unterschiedliche Sichtweisen offenlegen und im Idealfall ein gemeinsam getragenes Verständnis schaffen. Und genau hier zeigt sich die besondere Bedeutung von Feedback: Es ermöglicht, Unterschiede in der Wahrnehmung aufzudecken.
Woher der Begriff Feedback kommt
Der Begriff »Feedback« hat seinen Ursprung in der Kybernetik, der Lehre von den Regelungsprozessen. Zum Beispiel verfügt eine Heizungsanlage über einen Heizofen und einen Temperaturmesser. Das Thermometer meldet die Temperatur, worauf die Heizung die Leistung steigert oder drosselt. Beide Komponenten geben sich laufend Feedback – Teil A teilt Teil B die Situation mit, worauf Teil B kontinuierlich reagiert.
Auch wenn es ziemlich unpassend erscheint: In der Psychologie kam man anfänglich auf die Idee, das technische Feedback zweier Geräte auf zwischenmenschliche Prozesse zu übertragen. Dabei ist eigentlich klar, dass sich das System der sich regulierenden Maschinen davon deutlich unterscheidet, denn zwischen Menschen erfolgen Rückmeldungen nicht linear, sondern auf unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig. Welche Wirkung das Feedback einer Person B auf die Person A hat, lässt sich nicht vorhersagen. Klar ist nur: A hat eine Wirkung auf B und B auf A – und das kontinuierlich. Doch der aus der Technik entlehnte Begriff Feedback hat sich gehalten, ja sogar etabliert. Er wird verwandt, um ein Phänomen zu beschreiben, das die zentralen Merkmale »kontinuierliche Wahrnehmung«, »Rückmeldung« und »wechselseitige Beeinflussung« umfasst.
Auf das Feedbackprinzip stieß der Psychologe Kurt Lewin 1946 im Rahmen gruppendynamischer Untersuchungen. Mit seiner Arbeitsgruppe erforschte er, was das zwischenmenschliche Zusammenleben ausmacht und normalerweise unbewusst abläuft: das Geben und Wahrnehmen von Rückmeldungen. In einem Seminar für Lehrer, Sozialarbeiter und Geschäftsleute holte er den Trainerstab und eigens eingesetzte Beobachter zusammen, um das Trainerverhalten oder auch das Gruppenverhalten aus der Beobachterperspektive zu verfolgen.
Wenn im gemeinsamen Gespräch Wahrnehmungen rückgemeldet werden, entstehen neue Wahrnehmungsebenen, die vorher nicht bewusst waren. Hieraus ergeben sich neue Gesprächsthemen, die wiederum den Arbeitsprozess auf neue Ebenen bringen können. Lewin hatte mit seiner Gruppe diesen sich selbst fortschreibenden Gruppenprozess entdeckt, der unter dem Begriff Gruppendynamik – dem Verhalten in, von und zwischen Gruppen – von nun an erforscht und analysiert wurde.
Welche Schlussfolgerung lässt sich ziehen? Feedback ist vor allem ein Instrument, um Unterschiede in der Wahrnehmung auszumachen. Das hat handfeste Vorteile:
Im beruflichen Alltag führt permanentes Feedback dazu, Abweichungen zu erkennen und sich durch einen Prozess des Ist-Soll-Abgleichs einem gesetzten Ziel anzunähern.
In der persönlichen Entwicklung hat das Erkennen der Wahrnehmungsunterschiede einen Wert an sich. Aus der Wahrnehmung »So kann man es auch sehen!« entwickeln sich neue Anknüpfungspunkte für das eigene Denken.
Feedback begreifen – ein wenig Theorie
Um zu begreifen, braucht man Begriffe. Wer einen Zusammenhang präzise beschreiben und verstehen möchte, benötigt eindeutige Bezeichnungen. Daher ist es sinnvoll, einen kurzen Ausflug in die Theorie zu machen. Das in Abbildung 2.1 gezeigte Kommunikationsmodell hilft, die Mechanismen des Feedbacks und die daraus abgeleiteten Feedbackregeln zu verstehen. Wenn zum Beispiel in den folgenden Kapiteln immer wieder von »Sender« und »Empfänger« die Rede ist, dann ist es gut zu wissen, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Sonst haben Sie womöglich einen Sendemast und ein Radiogerät vor Augen.
Gut geeignet für die Erklärung von Feedback ist das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Im Kern besagt das Modell, dass es einen Sender, einen Empfänger und eine Rückmeldeschleife gibt (siehe Abbildung 2.1).
Abbildung 2.1: Vom Sender zum Empfänger zum Sender
So weit, so gut. Schulz von Thun hat Erkenntnisse der Kommunikationspsychologie aufbereitet und sein Vier-Seiten-Modell einer Nachricht (siehe Abbildung 2.2) entwickelt. Das Modell zeigt vier Aspekte der zwischenmenschlichen Kommunikation, die in jeder Botschaft, ob man will oder nicht, enthalten sind.
Abbildung 2.2: Vier Seiten einer Nachricht nach Friedemann Schulz von Thun
Sie kommen abends nach Hause, schauen in den Kühlschrank und sagen zu Ihrem Lebenspartner: »Du, der Wein ist alle!« Unabhängig von Ihrer tatsächlichen Absicht kann der Zuhörer nun vier unterschiedliche Aspekte heraushören oder auch nicht heraushören. Er kann auch eine Mischung aus zwei, drei oder vier Aspekten heraushören.
SachinhaltSender: Worüber informiere ich?
Empfänger könnte hören: Wir haben keinen Wein mehr.
Selbstkundgabe/SelbstoffenbarungSender: Was sage ich über mich aus?
Empfänger könnte hören: Ich brauche Wein. (Jeden Abend? Alkoholiker?)
BeziehungSender: Wie stehen wir zueinander?
Empfänger könnte hören: Er stellt sich über mich und tut so, als hätte ich die Verantwortung für den Wein!
AppellSender: Wozu möchte ich veranlassen?
Empfänger könnte hören: Ich muss loslaufen und einkaufen!
Alle vier Aspekte beschäftigen einerseits in bewussten oder unbewussten Anteilen den Sender, werden andererseits auch bewusst oder unbewusst vom Empfänger wahrgenommen. Das macht die Sache ausgesprochen komplex. Schulz von Thun spricht von vier Schnäbeln und vier Ohren, die unterschiedlich ausgerichtet sind.
Ausgesprochen komplex – was heißt das? Jeder Sender kann sich bewusst vornehmen, über eine Sache zu informieren, eine Selbstkundgabebotschaft zu senden, seine Beziehung zum anderen auszudrücken oder an den anderen einen Appell zu richten. Das Problem ist jedoch: Der Empfänger kann unabhängig vom Sender die Empfangskanäle aktivieren und zum Beispiel nur auf einem der vier Kanäle empfangen. Es gibt daher keine Garantie, dass der Empfänger wirklich versteht, was der Sender meint.
Wenn man sich zudem vor Augen hält, dass eine Botschaft zu etwa 75 Prozent nonverbal – also mimisch, gestisch oder durch die Stimmlage und Stimmmodulation – ausgedrückt wird und nur zu ungefähr 25 Prozent über das Wort, wird deutlich: Selbst in der Alltagskommunikation herrscht ein hoher Grad an Unsicherheit. Im Alltag scheinen wir damit mehr recht als schlecht auszukommen. Tauchen aber Konflikte auf, geht es ohne Feedback und ohne Extra-Klärungsaufwand nicht mehr.
Der Sender kann nie wissen, ob der andere ihn verstanden hat. Die Bedeutung entsteht beim Empfänger. Sie müssen also erst die Antwort abwarten, um verstanden zu haben, was Sie in den Ohren des Gegenübers gesagt haben. Die Lösung des Problems liegt im Feedback, in den gegenseitigen Rückmeldungen zwischen Sender und Empfänger: Was will ich sagen? Was habe ich verstanden? Erst diese Rückmeldeschleifen schaffen ein gemeinsam getragenes Verständnis.
Feedback aus zwei Perspektiven
Wie das Kommunikationsmodell nahelegt, lässt sich Feedback aus zwei Perspektiven beschreiben: aus der Sicht des Senders, der eine Rückmeldung gibt, und aus der Sicht des Empfängers, der diese Rückmeldung erhält. Je nach Situation befindet sich jeder von uns mal in der Rolle des Senders, mal in der des Empfängers.
Als Mitarbeiter sind Sie mit Ihrem Vorgesetzten unzufrieden und wollen ihm das auch sagen. In diesem Fall sind Sie der Sender – Sie geben Feedback. Wie Sie dabei am besten vorgehen, ohne Ihren Chef zu verärgern, erfahren Sie in Teil III. Wenn dagegen Ihr Vorgesetzter Sie für etwas lobt oder kritisiert, sind Sie der Empfänger – Sie erhalten Feedback.
Es empfiehlt sich, die beiden Perspektiven auseinanderzuhalten; denn je nachdem, ob Sie Sender oder Empfänger von Feedback sind, haben Sie es mit unterschiedlichen Problemen zu tun.
Als
Feedbackgeber
senden Sie eine Botschaft. Doch just in dem Moment, in dem Sie etwas gesagt haben, sind Sie schon nicht mehr Herr der Situation. Jetzt liegt die Angelegenheit beim Empfänger. Stellt sich die Frage: Was können Sie tun, damit Ihre Botschaft so vollständig wie möglich ankommt?
Als
Feedbacknehmer
stehen Sie vor der Herausforderung, die Botschaft so zu verstehen, wie sie gemeint ist. Außerdem sollten Sie dem Sender ein Feedback zum Feedback geben, sprich: ihm vermitteln, dass bei Ihnen angekommen ist, was er sagen wollte. Stellt sich die Frage: Wie machen Sie es, Feedback richtig anzunehmen?
Deutlich wird, dass je nach Perspektive unterschiedliche Regeln gelten. Auf beide Situationen gehe ich in den folgenden Kapiteln ausführlich ein. Ziel ist es, dass Sie sowohl in der Rolle des Feedbackgebers als auch in der des Feedbacknehmers das Richtige tun.
Trügerische Wahrheiten: Warum Feedback so wichtig ist
Jeder Mensch nimmt seine eigene Wirklichkeit wahr – eine Wirklichkeit, die er für wahr hält, die sich aber von der Realität ebenso wie von den Wahrnehmungen anderer Menschen unterscheidet. Wie die folgenden Abschnitte zeigen, ist Feedback ein Instrument, um die Sichtweise des Gegenübers zu begreifen und sich gemeinsam den tatsächlichen Verhältnissen anzunähern.
Feedback heißt, sich der Wirklichkeit anzunähern
Wenn es heißt, jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung – was ist damit gemeint? Ein kleines Experiment verdeutlicht das sehr schön. Schauen Sie sich Abbildung 2.3 an: Was sehen Sie auf dem linken Feld? Klar, eine Sechs. Eigentlich eine unbestreitbare Wahrheit – sollte man meinen. Doch richten Sie Ihr Augenmerk nun auf das rechte Feld: Hier blickt eine Person von oben, also von der gegenüberliegenden Seite auf das Gebilde, das Sie soeben als eine Sechs identifiziert haben. Was sieht diese Person?
Eine Sechs oder eine Neun? Das ist hier die Frage. Zwei Wahrheiten, die aufeinanderprallen. Das Sechs-Neun-Experiment belegt eindrucksvoll eine Tatsache, die wenig geläufig ist: Jeder Mensch konstruiert seine Wirklichkeit. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass das, was sie denken, auch die anderen so sehen – dass es die Wahrheit ist. Ein Trugschluss!
Abbildung 2.3: Sechs oder Neun? Je nach Sichtweise wird dieselbe Form anders wahrgenommen.
Was ist nun die Funktion von Feedback? Angenommen, der eine spricht von einer Sechs, der andere, der die Sache aus der gegenüberliegenden Perspektive sieht, beharrt auf der Neun. Streiten sich die beiden, kommt heraus, was häufig passiert: viel Ärger, aber keine Klärung.
Beherrschen die beiden jedoch die Feedbackregeln





























