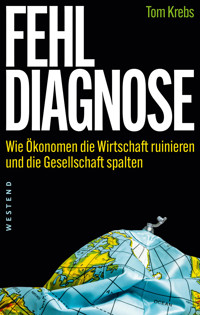
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Deutschland steckt in einer Dauerkrise. Die Wirtschaft stagniert, der Lebensstandard vieler Menschen ist dramatisch gesunken und die AfD gewinnt an Zustimmung. In diesem Buch zeigt der renommierte Ökonom Tom Krebs, dass eine Fehldiagnose marktliberaler Ökonomen und die entsprechenden Fehlentscheidungen der Bundesregierung für die schlechte Lage in Deutschland verantwortlich sind. Um den Wohlstand zu retten und den Zusammenhalt zu stärken, muss sich die deutsche Politik von der marktliberalen Märchenwelt der Ökonomen befreien. Denn nur ein Ansatz, der die Sorgen der Menschen ernst nimmt und gleichzeitig eine positive Vision der Zukunft bietet, kann uns aus der Misere führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ebook Edition
Tom Krebs
Fehldiagnose
Wie Ökonomen die Wirtschaft ruinieren und die Gesellschaft spalten
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2024
ISBN 978-3-98791-073-9
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut Berlin
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Cover
Einleitung: Ende der Märchenstunde
Teil I: Der Weg aus der Dauerkrise
1 Die größte aller Krisen: Die Energiekrise stellt alles in den Schatten, aber die Ökonomen sehen nichts
1.1 Der Ukrainekrieg und der Energiepreisschock
1.2 Inflation und die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte
1.3 Krise, welche Krise?
2 Energiepolitik: Die Bundesregierung hat mit staatlichen Markteingriffen Erfolg
2.1 Das erfolgreiche Energiemanagement der Regierung
2.2 Die gelungene Stabilisierung der Wirtschaft
2.3 Die innige Liebe der Ökonomen zum Markt
3 Schocktherapie für Deutschland: Die Bundesregierung ignoriert die Empfehlung der Ökonomen und verhindert so eine Katastrophe
3.1 Die abgewendete Katastrophe
3.2 Die irrsinnige Liebe zur Schocktherapie
3.3 Marktliberale Taschenspielertricks
4 Die Energiepreisbremse:Die Bundesregierung folgt dem Ratschlag der Ökonomen, und die AfD freut sich
4.1 Steigende Energiepreise, zögernde Bundesregierung und die AfD als Gewinner
4.2 Wie die Ökonomen eine effektive Energiepreisbremse für die Industrie verhinderten
4.3 Gesamtwirtschaftlich sinnvoll, ideologisch schwierig
5 Marktliberalismus: Eine ökonomische Märchenwelt ohne Keynes, Marx und Polanyi
5.1 Eine Märchenwelt uneingeschränkter Freiheit und effizienter Märkte
5.2 Ohne die Einsichten von Keynes, Marx und Polanyi geht es nicht
5.3 Warum der Marktliberalismus die öffentliche Debatte dominiert
Teil II: Die Fehlentscheidungen der Bundesregierung
6 Das Dogma vom effizienten Markt:Wird Deutschland zum Disneyland für ausländische Touristen?
6.1 Deutschland droht der Disneyland-Effekt
6.2 Ist Deutschland ein alter Mann?
7 Klima- und Wirtschaftspolitik:Die USA sind auf Kurs, aber Deutschland steckt in der Märchenwelt der Ökonomen fest
7.1 Die USA machen es vor
7.2 Eine Chance für Deutschland
7.3 Die Ampelregierung ergreift die Chance nicht
8 Krisenverschärfer: Geldpolitik, Finanzpolitik und das Desaster mit dem Heizungsgesetz
8.1 Die Europäische Zentralbank verschärft die Krise
8.2 Wirtschaft ohne finanzpolitischen Schub
8.3 Klimafreundliches Verhalten fördern, nicht die vermeintlichen Klimasünder bestrafen
9 Mindestlohn und Kindergrundsicherung: Der Mythos der marktliberalen Leistungsgesellschaft
9.1 Die Mindestlohnkommission ignoriert das Mindestlohngesetz und die Bundesregierung schaut zu
9.2 Karl Marx und die moderne Arbeitsmarktforschung
9.3 Die Kindergrundsicherung und der Mythos der marktliberalen Leistungsgesellschaft
10 Das Karlsruher Haushaltsurteil: Noch mehr Macht für den Finanzminister
10.1 Die Finanzpolitik der Bundesregierung ist verfassungswidrig
10.2 Finanzminister Lindner nutzt die Gunst der Stunde
Teil III: Der Weg aus der Dauerkrise
11 Was bringt die Zukunft:Wirtschaftsboom oder Stagnation?
11.1 Die Politik der Ampelregierung kostet Wohlstand
11.2 Grünes Wachstum ist möglich
12 Moderne Klima- und Wirtschaftspolitik: Investitionen, Investitionen, Investitionen
12.1 Ein Investitionsbooster für den Mittelstand
12.2 Einstürzende Schuldächer und fehlende Stromleitungen
12.3 Brüssel redet immer mit
13 Solide Finanzierung: Wer soll das bezahlen?
13.1 Die schwäbische Hausfrau als Unternehmerin
13.2 Die Kreditfinanzierung zusätzlicher Investitionsausgaben ist auch mit Schuldenbremse möglich
13.3 Große Vermögen besteuern, um das Bildungssystem zu retten
14 Soziale Gerechtigkeit: Ohne faire Löhne geht es nicht
14.1 Warum es faire Löhne braucht
14.2 Wie die Bundesregierung einen Fair New Deal schaffen kann
14.3 Neoliberale Nebelkerzen
Schluss: Abwarten ist keine Option
Dank
Literatur
Anmerkungen
Orientierungspunkte
Cover
Inhaltsverzeichnis
Einleitung:Ende der Märchenstunde
Deutschland steckt in einer Dauerkrise. Nach fast zwei Jahren Coronapandemie hatten die Menschen auf ein halbwegs normales Leben und eine kräftige wirtschaftliche Erholung gehofft – stattdessen hat die Energiekrise ihnen hohe Inflationsraten und eine Rezession gebracht. Ein Gasmangel im Winter 2022/2023 konnte zwar verhindert werden, doch der Energieschock hat die Wirtschaft schwer getroffen und zu den höchsten Reallohnverlusten der Nachkriegsgeschichte geführt. Die Deutschen machen sich Sorgen um ihre Zukunft, und rechtspopulistische Ideen gewinnen an Zustimmung. In der Europawahl belegte die AfD Platz zwei, und in einigen ostdeutschen Bundesländern ist sie mittlerweile stärkste politische Kraft.
Warum ist die wirtschaftliche und politische Lage so schlecht? Dieses Buch ist der Versuch, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Der Erklärungsansatz beruht auf zwei Thesen. Zum Ersten zeige ich, dass die meisten Ökonomen die Energiekrise falsch diagnostiziert haben, weil sie in einer Märchenwelt leben und an einem realitätsfremden Marktliberalismus glauben. Zum Zweiten erhebe ich den Befund, dass die Fehldiagnose dieser Ökonomen irgendwann von der Ampelregierung übernommen wurde und dies zu politischen Fehlentscheidungen führte – mit dramatischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen. In diesem Sinne haben Ökonomen der Wirtschaft geschadet und die Gesellschaft gespalten.
Die Fehldiagnose lässt sich am besten mit einer in Ökonomenkreisen beliebten Erzählung illustrieren. Diese beginnt mit der Feststellung, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland kaum gesunken sei und es deshalb den Menschen doch gar nicht so schlecht gehen könne – die Deutschen meckerten nur gern. Zudem hätten magische Marktkräfte dafür gesorgt, dass die deutsche Wirtschaft die Energiekrise gut überstehen konnte. Angeblich habe es nach Auffassung dieser Ökonomen überhaupt keine Wirtschaftskrise gegeben.1 Prominente Energieökonomen wiederholen gebetsmühlenartig das marktliberale Dogma, dass die anstehende Klimatransformation im Wesentlichen mit einem hohen CO2-Preis bewältigt werden könne.2 Schließlich lehnen die meisten Wirtschaftsexperten wirksame Energiepreisbremsen,3 existenzsichernde Mindestlöhne4 oder eine moderne Industriepolitik nach amerikanischem Vorbild ab,5 weil solche staatlichen Eingriffe in das heilige Preissystem angeblich ineffizient seien. Um die Dauerkrise hinter sich zu lassen, bräuchte Deutschland mutmaßlich nur »strukturelle Reformen«: niedrigere Rentenzahlungen, längere Arbeitszeiten und »mehr Bock auf Arbeit«.6
Der naive Wirtschaftsliberalismus, der in der Ökonomenerzählung zum Ausdruck kommt, ist mehr als nur eine ökonomische Theorie. Er ist eine politische Agenda basierend auf dem methodischen Individualismus, wie er in den Werken von Friedrich A. von Hayek zu finden ist und einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die wirtschaftspolitischen Debatten der letzten vierzig Jahre gehabt hat. In der Märchenwelt marktliberaler Ökonomen werden moderne Gesellschaften als eine Ansammlung von individuellen Präferenzen und Produktionsmöglichkeiten beschrieben, die unabhängig von den gesellschaftlichen Strukturen gleichberechtigt auf gottgegebenen Märkten agieren. Komplexe gesellschaftliche Transformationsprobleme werden in dieser fiktiven Welt von einer guten Marktfee gelöst, die mit ihren magischen Kräften alle Hindernisse einfach wegzaubern kann. Diese Trivialisierung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit ist ein wesentlicher Grund für die zahlreichen Fehldiagnosen der Ökonomen.
Der hier beschriebene Marktliberalismus mag vielen absurd erscheinen, aber sein Einfluss auf die öffentliche Debatte und die Politik ist nicht zu unterschätzen. Denn die meisten Ökonomen sind marktliberal – und sie haben politischen Einfluss. Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein Wirtschaftswissenschaftler ein aktuelles Thema in den Fernsehnachrichten oder in einer Talkshow als Experte kommentiert. Zudem sitzen Ökonomen in vielen Kommissionen und besetzen wichtige Positionen in den Ministerien. Die fünf Mitglieder des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung werden regelmäßig als »Wirtschaftsweise« bezeichnet, und es gibt allein sieben staatlich geförderte Wirtschaftsinstitute der wissenschaftlichen Leibniz-Gesellschaft, deren Präsidenten im Großen und Ganzen dem wirtschaftsliberalen Camp zuzuordnen sind. Hinzu kommen noch einflussreiche Einrichtungen wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), die in wirtschaftspolitischen Fragen eindeutig eine marktliberale Linie vertreten – und eine einheitliche CO2-Bepreisung in Kombination mit dem Klimageld als das Allheilmittel der Klimapolitik propagieren. Ökonomen haben Einfluss und Macht!
Diesen Einfluss der Ökonomen und ihrer marktliberalen Theorie auf die öffentliche Debatte und die Politik analysiere ich in diesem Buch. Dabei zeige ich, wie ihre ökonomischen Fehldiagnosen zu politischen Fehlentscheidungen mit desaströsen Konsequenzen für die deutsche Bevölkerung führten. Konkret verhinderten Wirtschaftswissenschaftler als Mitglieder der Kommission zur Gas- und Strompreisbremse eine ökonomisch vernünftige Preisbremse. Mit fragwürdigen Argumenten bekämpften sie erfolgreich eine angemessene Erhöhung des Mindestlohns. Das politische Desaster mit dem Heizungsgesetz, das die Republik im Frühsommer 2023 in Atem hielt, lässt sich ebenfalls auf das marktliberale Credo vieler Ökonomen zurückführen. Ganz allgemein hat die Illusion eines CO2-Preises als Leitinstrument der Klimapolitik großen Anteil daran, dass effektiver Klimaschutz in Deutschland zu scheitern droht. Und schließlich durfte Bundesfinanzminister Christian Lindner im Schulterschluss mit marktliberalen Ökonomen bereits im Frühjahr 2023 eine »Normalisierung« der Finanzpolitik verkünden, weil die Energiekrise angeblich beendet und die Zeit für einen finanzpolitischen Sparkurs gekommen sei. Doch diese sogenannte »Normalisierung« ist letztlich nur ein anderes Wort für eine Kürzungspolitik, die dann mit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 voll einschlug – die Bauernproteste im Januar 2024 mit den Traktorkolonnen in Berlin sind vielen noch gut in Erinnerung.
Mit meiner Kritik an der Ökonomenzunft setze ich mich bewusst von der These ab, dass sich die wirtschaftspolitische Beratung seit der Finanzkrise 2008/2009 und der damaligen Blamage der Ökonomen verbessert habe. Natürlich stimmt es, dass nur noch wenige Ökonomen einen banalen Neoliberalismus öffentlich propagieren, wie es vielleicht in den 1990er-Jahren üblich war. Und in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur gab es sicherlich Fortschritte und neue Erkenntnisse, von denen ich in diesem Buch ebenfalls berichten werde. Doch was hilft dieser Fortschritt, wenn im entscheidenden Moment – und die Energiekrise war ein solcher Moment – die wirtschaftspolitische Beratung mehrheitlich versagt und damit immensen Schaden verursacht? Zudem sind die aktuellen Vorschläge vieler prominenter Wirtschaftsexperten, wie Deutschland der Dauerkrise entkommen kann, realitätsfremd und kontraproduktiv. Letztlich müssen sich auch Wirtschaftswissenschaftler an der Qualität ihrer Empfehlungen messen lassen.
Angesichts der Klagen vieler Ökonomen, dass die Politik nicht genug auf sie höre, erscheint meine These von dem großen Einfluss der Ökonomen vielleicht gewagt, doch ich werde sie ausführlich belegen. Dabei behaupte ich nicht, dass die Politik immer den marktliberalen Empfehlungen folgen würde. Beispielsweise hat die Bundesregierung im März 2022 den Ratschlag einer meinungsstarken Gruppe von Wirtschaftsprofessoren ignoriert, eine Schocktherapie anzuwenden und die Gasimporte aus Russland sofort zu stoppen – auch diese Episode werde ich betrachten. Ökonomen und ihr Marktliberalismus gewinnen also nicht jede wirtschaftspolitische Debatte, doch sie definieren das Koordinatensystem, in dem diese Debatten stattfinden. Damit haben sie in der Regel die Deutungshoheit und einen nicht zu unterschätzenden Einfluss, sodass politische Entscheidungen tendenziell in eine gewisse Richtung gehen. Das schließt natürlich nicht aus, dass die Politik besonders absurde Vorschläge marktliberaler Ökonomen einfach ignoriert.
Einige Wirtschaftsexperten und Politikberater werden mir vorwerfen, dass ich es mit meiner Fundamentalkritik an der Ampelregierung übertreibe. Die Bundesregierung habe in der Energiekrise mit ihren Sofortmaßnahmen einen Gasmangel verhindert, die klimapolitische Wende eingeläutet und mit verschiedenen Wachstumsinitiativen einige vernünftige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Das mag alles stimmen, aber dieses Argument folgt einer internen Verwaltungslogik, die niemanden außerhalb des Dunstkreises der Berliner Denkfabriken und Beraterfirmen interessiert. Und es beantwortet die entscheidende Frage nicht: Wie konnte es dazu kommen, dass eine hoffnungsfroh gestartete Fortschrittskoalition in einem großen politischen Fiasko endete? Der in diesem Buch entwickelte Ansatz bietet eine strukturelle Erklärung: Zwar hatte die Ampelkoalition einen guten Auftakt, weil sie zu Beginn der Energiekrise die realitätsfremden Ratschläge der marktliberalen Ökonomen ignorierte, aber allmählich konnten diese Ökonomen und die neoliberale FDP das Kommando übernehmen – mit den entsprechend schlechten Ergebnissen für Wirtschaft und Gesellschaft. Anders gesagt: Mit einem FDP-Finanzminister, der an seiner marktliberalen Fantasiewelt festhält und gleichzeitig die Politik der Regierung bestimmt, kann es keine vernünftige Wirtschaftspolitik geben.
Bei aller Kritik an der Ampelregierung und ihrer marktliberalen Agenda mit grün-roten Tupfern will ich in diesem Buch auch einen konstruktiven Beitrag zur Problemlösung leisten. Die kritische Analyse der aktuellen Ampelpolitik ist nicht Selbstzweck, sondern Voraussetzung für eine erfolgreiche Politikwende. In einem letzten Schritt nutze ich die gewonnenen Einsichten, um einen Weg aus der Dauerkrise zu skizzieren.
Mein Vorschlag enthält zwei wesentliche Elemente: Um einen Wirtschaftsboom anzustoßen und das Klima zu retten, braucht es einen neuen Investitionspakt (»Green New Deal«). Um die soziale Gerechtigkeit zu stärken und die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden, muss es faire Löhne und angemessene Renten für alle Menschen in Deutschland geben (»Fair New Deal«). Es braucht also einen neuen Deutschlandpakt, der alle mitnimmt und nicht einzelne Gruppen gegeneinander ausspielt.
Die Vorschläge sind bekannt – und trotzdem passiert viel zu wenig. An dieser Stelle setzt dieses Buch an. Zum einen kann ein Wirtschaftsplan nur erfolgreich sein, wenn er sich auf einige wenige Maßnahmen konzentriert, die in der aktuellen Lage besonders wirksam sind. Diese Eigenschaft unterscheidet meinen Ansatz von der Politik der Ampelregierung, die mit vielen – teilweise fragwürdigen – Minimaßnahmen vergeblich versucht, eine Wirtschaftswende einzuleiten. Überdies entwickle ich ein realistisches und ökonomisch vernünftiges Finanzierungskonzept für die erforderlichen Maßnahmen. Die Erfahrung der letzten zwei Jahre hat gezeigt, dass eine moderne Wirtschaftspolitik nicht mit einer ideologisch verbohrten Finanzpolitik möglich ist.
Zudem erörtere ich Wege zur Überwindung von Hindernissen in der politischen Umsetzung. Dabei konzentriere ich mich auf die vielleicht größte Hürde: die naive Marktgläubigkeit der Politik und der wirtschaftspolitischen Beratung, die bereits zu zahlreichen Fehlentscheidungen geführt hat und derzeit eine effektive Wirtschaftspolitik verhindert. Beispielsweise diskutiere ich, wie das EU-Beihilferecht auf einer neoliberalen Märchenwelt basiert, die eine moderne Industriepolitik, wie sie die USA mit dem Inflation Reduction Act betreibt, fast unmöglich macht. Zudem biete ich eine Analyse, wie der Unwille oder die Unfähigkeit vieler Ökonomen und Politiker, sich ernsthaft mit der Funktionsweise von Mindestlöhnen und Gewerkschaften auseinanderzusetzen, nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwächt, sondern auch eine der größten Wachstumsbremsen darstellt. Schließlich beschäftige ich mich mit der populären und einflussreichen These, dass grünes Wachstum unmöglich sei – Klimaschutz und Wohlstand seien angeblich unvereinbar. Wie ich zeigen werde, greift diese Wachstumskritik zu kurz, weil sie letztlich auf einer fehlgeleiteten neoliberalen Logik basiert, die einen aktiven und unterstützenden Staat nicht einmal als gedankliche Möglichkeit zulässt.
Der Weg aus der Misere erfordert einen neuen Ansatz, der die Sorgen der Menschen ernst nimmt und gleichzeitig eine positive Zukunftsvision bietet. Davon handelt dieses Buch. Dazu muss die Politik die Märchenwelt der selbstregulierenden Märkte hinter sich lassen und das alte Marktdogma durch eine realistische Theorie von Wirtschaft und Gesellschaft ersetzen. In dieser neuen Theorie spielen Unsicherheit (John Maynard Keynes), Anpassungskosten (Karl Polanyi) und Marktmacht (Karl Marx) eine zentrale Rolle. Sie bietet eine Methode zur Analyse einer Gesellschaft im Transformationsprozess, die sich am besten mit dem Begriff »ökonomischer Realismus« umschreiben lässt. Das Ergebnis eines solchen Paradigmenwechsels ist eine Politik, die ökonomische Vernunft und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt rückt. Dieser Ansatz steht im krassen Widerspruch zum marktliberalen Fundamentalismus mit seinen realitätsfremden Annahmen und gefährlichen Schlussfolgerungen, wie er immer noch die öffentlichen Debatten und die Darstellung in den Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre dominiert. Insofern lässt sich dieses Buch auch als Versuch lesen, die Grundzüge einer kritischen und gleichzeitig relevanten Wirtschaftswissenschaft zu skizzieren.
Teil I
Die Fehldiagnosen der Ökonomen
1Die größte aller Krisen: Die Energiekrise stellt alles in den Schatten, aber die Ökonomen sehen nichts
1.1 Der Ukrainekrieg und der Energiepreisschock
Am 24. Februar 2022 marschierten russische Streitkräfte in die Ukraine ein und versuchten die Regierung in Kiew zu stürzen. Mit diesem Überfall auf ein souveränes Land begann der Ukrainekrieg, der die Welt nachhaltig verändern sollte. Er löste eine Energiekrise aus, die mit hohen wirtschaftlichen und sozialen Kosten verbunden war. Anders gesagt: Große Energieschocks haben große Auswirkungen.
Die Energiekrise war in erster Linie eine Erdgaskrise. In Deutschland heizen etwa die Hälfte aller Haushalte mit Gas, Energieunternehmen nutzen es zur Stromerzeugung, und ein großer Teil der Industrieproduktion verwendet es zur Erzeugung von Prozesswärme oder als Grundstoff. Darüber hinaus wirken sich die Erdgaspreise über das Design der Strommärkte auf die Strompreise aus. Diese starke Gasabhängigkeit des deutschen Energiesystems hatte zur Folge, dass der abrupte Anstieg der Gaspreise erheblichen Einfluss auf die Gesundheit der deutschen Wirtschaft und die Stabilität der Gesellschaft nehmen konnte. Und sie führte dazu, dass der russische Präsident Wladimir Putin Erdgas als Waffe einsetzen konnte. Denn vor der Energiekrise kam knapp die Hälfte des deutschen Gases aus Russland. Als der russische Gaskonzern Gazprom im Jahr 2021 die Erdgaslieferungen nach Deutschland drosselte, stiegen die Preise an den europäischen Gasmärkten, und die Gasspeicher konnten nicht wie üblich im Sommer gefüllt werden.1 Und als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfiel, spielten die Gasmärkte verrückt, sodass die Energiekrise ihren Lauf nahm.
Abbildung 1 zeigt die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Erdgaspreise – eine anschauliche Darstellung des Energiepreisschocks, dessen Auswirkungen wir in den folgenden Kapiteln ausführlich analysieren werden. Die Grafik zeigt die Entwicklung von drei verschiedenen Preisen für Erdgas: der Börsen- oder Großhandelspreis, der durch den Handel auf den europäischen Gasmärkten bestimmt wird, der Importpreis, der von Gas importierenden Unternehmen gezahlt wird, und der Gaspreis, den die deutschen Endverbraucher (Haushalte und kleine Unternehmen) als Neukunden zahlen.
Abbildung 1: Erdgaspreise2
Die Abbildung 1 verdeutlicht, dass die Verbraucherpreise den Einfuhrpreisen mit einer gewissen Verzögerung folgen, und die Einfuhrpreise wiederum zeitverzögert den Börsenpreisen. Die Grafik stellt die Verbraucherpreise für Neukunden dar, sodass die Verzögerung sehr kurz ist und fast jede Bewegung der Marktpreise sich direkt in den Verbraucherpreisen widerspiegelt. Anders ausgedrückt: Was an den europäischen Gasbörsen passiert, hat direkte Konsequenzen für das Leben der Menschen in Deutschland.3
Die Entwicklung der Erdgaspreise lässt sich in drei Phasen einteilen. Die erste Phase begann im Frühjahr 2021, als die russischen Erdgaslieferungen zum ersten Mal ins Stocken gerieten und die deutschen Erdgasspeicher sich nicht wie üblich im Sommer füllten. Diese Entwicklung zusammen mit dem Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine sorgten für große Verunsicherung an den Gasmärkten, und die Gaspreise zogen an. Die zweite Phase begann mit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Hier stiegen die Börsenpreise für Erdgas bis August 2022 auf das mehr als Zehnfache im Vergleich zum Frühjahr 2021. In der letzten Phase beruhigten sich die Märkte etwas, und die Gaspreise fielen wieder, bleiben aber bis zum Frühjahr 2023 auf einem sehr hohen Niveau. Insofern war der Energiepreisschock zwar sehr ausgeprägt, aber zum Glück nicht zu langlebig.
Die Strompreise stiegen während der Energiekrise 2022 ebenfalls sehr stark. In Abbildung 2 sind die Entwicklungen von zwei Strompreisen dargestellt: der Marktpreis (Nettostrompreis), wie er auf den Strombörsen bestimmt wird, und der von Endverbrauchern für Neuverträge gezahlte durchschnittliche Strompreis (Bruttostrompreis).
Abbildung 2: Strompreise4
Ein Vergleich der Abbildungen 1 und 2 zeigt, dass die Strompreise dem Anstieg der Gaspreise gefolgt sind. Der Gaspreisschock führte also zu einem Strompreisschock. Der Grund für die Abhängigkeit der Strompreise von den Gaspreisen ist das Design des deutschen und europäischen Strommarkts, auf dem die Börsenpreise bestimmt werden. Gemäß dem sogenannten Merit-Order-Prinzip wird der Preis auf den Strommärkten durch das Kraftwerk mit den höchsten Grenzkosten bestimmt, was im Jahr 2022 häufig Gaskraftwerke waren. Der Einfluss der Gaspreise auf die Strompreise ist ein weiterer Wirkmechanismus, über den sich die Energiekrise 2022 direkt auf Haushalte, Unternehmen und die Wirtschaft auswirkte.5
1.2 Inflation und die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte
Der in Abbildung 1 dargestellte Energiepreisschock erhöhte die Produktionskosten für viele Unternehmen, die als Antwort auf den Kostenschock die Preise ihrer Erzeugnisse anhoben. Zudem gab es Unternehmen, die zwar kaum von den steigenden Energiekosten betroffen waren, aber trotzdem die Gelegenheit zu üppigen Preiserhöhungen nutzten. Als Folge der Energiekrise stiegen also die Preise vieler Güter und Dienstleistungen, und Deutschland erlebte eine Inflationsphase vergleichbar mit der Ölkrise in den 1970er-Jahren. Wenn die Preise für Butter, Gemüse, Öl und Erdgas anziehen, dann steigen die Lebenshaltungskosten – das Leben wird teuer. Der Energiepreisshock führte zu einem Inflationsschock, der dramatische Konsequenzen für das Leben der Menschen in Deutschland und Europa haben sollte.6
Im Lauf der Energiekrise erhöhte sich die Verbraucherpreisinflation von 3 Prozent im Jahr 2021 auf 6,9 Prozent 2022 und auf 5,9 Prozent 2023. Abbildung 3 zeigt diese Entwicklung der Preise für Energie (Öl, Erdgas, Strom, Benzin), Nahrungsmittel (Butter, Brot, Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch) und dem Warenkorb aller Verbrauchsgüter (Energie, Nahrungsmittel, Restaurants, Zugticket, Kleidung). Die Grafik unterstreicht den starken Anstieg der Lebenshaltungskosten, den die Energiekrise verursacht hat: Innerhalb von zwei Jahren haben die Preise für Energie um 50 Prozent, für Lebensmittel um 30 Prozent und für alle Verbrauchsgüter um 13 Prozent zugenommen. Dieser Anstieg betraf also primär Energie und Lebensmittel – was die sozialen Kosten der Inflation hervorhebt, da beide einen großen Teil des Konsumkorbs der unteren und mittleren Einkommen ausmachen.7
Abbildung 3: Verbraucherpreise8
Ein einfaches Rechenbeispiel belegt die Dramatik solcher Preisentwicklungen. Betrachten wir eine vierköpfige Familie mit monatlichen Ausgaben für Energie von 400 Euro und für Nahrungsmittel von 800 Euro. Insgesamt belaufen sich die monatlichen Kosten für Öl oder Gas zum Heizen, Strom für Licht und Kochen, Benzin zum Autofahren und dem Einkauf der Nahrungsmittel also auf 1 200 Euro. Die in Abbildung 3 dargestellte Inflation bedeutet, dass für diese Familie die monatlichen Kosten für Energie und Nahrungsmittel um 440 Euro auf 1 640 Euro zugenommen haben. Es fehlen also krisenbedingt jeden Monat 440 Euro in der Haushaltskasse – für viele Familien ist das kaum zu schaffen.
Löhne und Gehälter stiegen im Jahr 2022 nicht in demselben Maß wie die Güterpreise, sodass die Reallöhne und somit die realen (inflationsbereinigten) Einkommen der Beschäftigten sanken. Für die meisten Personen ist das Arbeitseinkommen die wesentliche Einkommensquelle, sodass sie einen Verlust an realem Einkommen vor Steuern und Transfers erlebten. Abbildung 4 zeigt, dass dieser Einkommensverlust erheblich war.
Abbildung 4: Reallöhne seit 19509
Die Reallöhne sanken 2022 durchschnittlich um 4 Prozent. Dieser Einkommensverlust markiert den größten Rückgang des Lebensstandards für Beschäftigte in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es gibt nur wenige Episoden in der jüngeren Geschichte, in denen der jährliche Rückgang der Reallöhne signifikant war: 1981 sanken die Reallöhne um fast 2 Prozent, 1993 sowie während der Coronakrise 2020 gingen sie um etwas mehr als 1 Prozent zurück. Und natürlich mussten viele Arbeitnehmer in Ostdeutschland gleich nach der Wiedervereinigung riesige Reallohnverluste hinnehmen. Während der Finanzmarktkrise 2008 blieben die Reallöhne hingegen stabil – weswegen sie für die wenigsten Beschäftigten eine echte Krise war.
Der in Abbildung 4 dargestellte Reallohnverlust von 4 Prozent im Jahr 2022 ist ein Durchschnittswert, der die soziale Dimension des Verlustes nicht vollständig widerspiegelt. Denn die unteren und mittleren Einkommen waren aus zwei Gründen stärker von den Reallohnverlusten betroffen als die obere Gruppe. Erstens verwenden Haushalte mit geringem Einkommen einen großen Teil ihres Einkommens für Energie und Lebensmittel, deren Preise besonders stark gestiegen sind (Abbildung 3). Zweitens haben Familien mit geringem und mittlerem Einkommen in der Regel kaum Ersparnisse, sodass jeder Einkommensverlust direkt zu Einschränkungen bei den Ausgaben für teilweise essenziellen Sachen führt. Diese Umstände müssen bei der Interpretation solcher Durchschnittswerte berücksichtigt werden.10
Abbildung 4 zeigt außerdem, dass die Reallöhne im Jahr 2023 trotz einer Inflationsrate von 5,9 Prozent leicht um 0,1 Prozent gestiegen sind. Die Arbeitseinkommen haben also im Durchschnitt um rund 6 Prozent im Jahr 2023 zugenommen. Dies ist teilweise auf staatlich subventionierte Einmalzahlungen zurückzuführen, die Arbeitgeber als Inflationsausgleich an ihre Beschäftigten geleistet haben. Die hohen Tarifabschlüsse sind ein weiterer Grund dafür, dass die Reallöhne 2023 nicht weiter gefallen sind. Zudem werden die Reallöhne aufgrund der Tariferhöhungen und der sinkenden Inflation 2024 wieder steigen.11 Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis die während der Corona- und Energiekrise erlittenen Verluste von insgesamt 5 Prozent ausgeglichen sind und die Beschäftigten in Deutschland nennenswerte Reallohngewinne im Vergleich zum Vorkrisenniveau erleben werden.
Die außerordentlich hohen Reallohnverluste sind ein Indikator dafür, dass der Energiepreisschock 2022 eine ausgewachsene Wirtschaftskrise verursacht hat.12 Der damit verbundene Verlust des Lebensstandards erklärt zudem die Unzufriedenheit und Verunsicherung in großen Teilen der Bevölkerung. Die wirtschaftliche Lage ist in gewisser Weise vergleichbar mit der Situation in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung, denn Reallohnverluste gehen Hand in Hand mit einer hohen Unsicherheit über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Viele Menschen in Deutschland, denen es aktuell vielleicht noch gutgeht, fragen sich: Wird mein Lebensstandard in ein paar Jahren noch zu halten sein, und wie wird es meinen Kindern und Enkelkindern ergehen?
1.3 Krise, welche Krise?
Im Frühjahr 2023 begann eine Erzählung in Ökonomenkreisen zu kursieren, die sich bis heute hartnäckig in den Medien hält und der obigen Darstellung der Energiekrise zu widersprechen scheint. Demnach waren die Folgen der Energiekrise eher moderat – alles halb so schlimm. Diese Story wurde scheinbar gestützt von einer Studie der drei Ökonomen Benjamin Moll (London School of Economics), Moritz Schularick (Kiel Institut für Weltwirtschaft) und Georg Zachmann (Bruegel), die auch in der internationalen Ökonomenszene beachtet wurde und die Meinung ausländischer Beobachter beeinflusste.13 Ihnen zufolge habe die deutsche Wirtschaft aufgrund einer erfolgreichen Anpassung an die veränderten Marktbedingungen den Energiepreisschock gut überstanden. In den Worten der Autoren der Studie: »Noch nicht einmal eine Rezession.« Auch wenn es Stimmen gab, die davor warnten, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Energiekrise zu unterschätzen,14 wurde diese Erzählung dankbar von der Bundesregierung aufgenommen. Denn sie zeigte scheinbar, dass die ergriffenen Krisenmaßnahmen gewirkt hatten und die Krisenpolitik der Ampelregierung erfolgreich war.
Im zweiten Teil dieses Buchs werde ich ausführlicher diskutieren, wie die Bundesregierung ab dem Frühjahr 2023 unkritisch die Fehldiagnose der Ökonomen übernahm und daraus ihre falschen Schlüsse für die Wirtschaftspolitik ableitete. An dieser Stelle sei nur auf ein Beispiel verwiesen, das stellvertretend für die Art der Realitätsverweigerung steht, wie sie in Regierungskreise und unter Ökonomen üblich war und immer noch ist.
Am 19. Juni 2023 lud der Chef des Bundeskanzleramts Wolfgang Schmidt zur Konferenz »Ökonomische Zeitenwende« ein. In dieser ganztägigen Veranstaltung sollten Vertreter der Wissenschaft im Austausch mit der Bundesregierung gemeinsame Herausforderungen diskutieren. Ein Blick auf die Vorträge verdeutlicht, in welcher marktliberalen Märchenwelt sich die große Mehrheit der geladenen Wirtschaftswissenschaftler bewegt.15 Beispielsweise behauptete der Ökonom Moritz Schularick in einem Vortrag, dass aufgrund von magischen Marktanpassungen die deutsche Wirtschaft den Energieschock ohne nennenswerten Schaden überstanden habe – noch nicht einmal eine Rezession.16 In einem anderen Vortrag versuchte der Bonner Wirtschaftsprofessor Christian Bayer – ein Mitglied der Energiepreisbremsen-Kommission der Bundesregierung – zu demonstrieren, dass die Gaspreisbremse der Ampelregierung ein effizientes Kriseninstrument ist, weil sie eigentlich gar keine Preisbremse sei.17 Und die Vorsitzende ebendieser Kommission Veronika Grimm pries in höchsten Tönen die Vorzüge freier Märkte im Strom- und Wasserstoffbereich und kritisierte Pläne, die eine staatliche Strompreisbremse für industrielle Kunden mit Transformationsbedarf vorsahen, den sogenannten Brücken- oder Industriestrompreis.18
Während die versammelten Ökonomen im Bundeskanzleramt ihr Loblied auf den Markt sangen, blieb ein Punkt gänzlich unerwähnt: die hohen Reallohnverluste der Beschäftigten im Jahr 2022. In keinem der zehn Vorträge der Wirtschaftsprofessoren wurde sich mit dem Problem auseinandergesetzt, dass die Arbeitnehmer in Deutschland 2022 die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte hinnehmen mussten. Die Tatsache, dass der Lebensstandard vieler Menschen während der Energiekrise dramatisch gesunken war und eine große Verunsicherung in der Bevölkerung um sich griff, wurde totgeschwiegen. Stattdessen wurde ausgiebig über eine ökonomische Traumwelt diskutiert, die sehr wenig mit der ökonomischen Realität der Menschen in Deutschland zu tun hatte. Und auch wenn einige Vorträge die künftigen Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft betonten, wurde nirgendwo der Zusammenhang zwischen diesen Herausforderungen und der Energiekrise hergestellt. Mit wenigen Ausnahmen galt das Motto: Krise, welche Krise?19
Die in Ökonomen- und Regierungskreisen beliebte These der »milden Rezession« geht an der Lebensrealität vieler Menschen offensichtlich vorbei und ist auch nicht von den Einkommensdaten gestützt. Damit handelt es sich um eine klare Fehldiagnose. Dennoch ist die These nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist weder 2022 noch 2023 stark gefallen. Können wir daher nicht zumindest folgern, dass die Auswirkungen der Energiekrise 2022 auf die deutsche Wirtschaft – wie es die Autoren der Studie behaupten – moderat ausgefallen ist? Anders gefragt: Hat der Markt es geregelt, weil Preissignale zu einer effizienten Anpassung der Menschen und Unternehmen geführt haben? Die Antwort auf die Frage lautet Nein, wie die folgenden Überlegungen zeigen.
Ein einfacher Blick auf den zeitlichen Verlauf des Bruttoinlandsprodukts während der Energiekrise reicht nicht aus, um deren Auswirkungen zu beurteilen. Denn er vernachlässigt, dass die deutsche Wirtschaft ohne die Energiekrise 2022 stark gewachsen wäre. Eine solche kräftige Erholung gab es zum Beispiel gleich nach der Finanzkrise 2008/2009 und wurde auch nach der Coronakrise 2020/2021 erwartet. Doch sie ist ausgeblieben, weil die deutsche Wirtschaft 2022 nach dem Coronaschock von dem Energiepreisschock getroffen wurde. Dieses Ausbleiben einer wirtschaftlichen Erholung ist ein Verlust, der der Energiekrise zuzuschreiben ist.
Um die Produktionsverluste der Energiekrise zu berechnen, muss also die Differenz gebildet werden zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung ohne Energiekrise (kräftige Erholung) und der tatsächlichen Entwicklung (keine Erholung). Abbildung 5 zeigt das Ergebnis eines solchen Vergleichs zwischen Krisenszenario und dem Szenario ohne Krise.20 Dabei wird die Frühjahrsprognose 2022 der fünf Wirtschaftsforschungsinstitute DIW, Ifo, IfW, IWH und RWI, die zusammen eine Gemeinschaftsdiagnose erstellen, als Schätzung für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im hypothetischen Fall ohne Energiekrise herangezogen.21 Diese Wirtschaftsinstitute führen die Konjunkturanalyse für die Bundesregierung durch, und ihre Prognosen sind gewissermaßen die besten Schätzungen in einem hypothetischen Szenario ohne Energiekrise.
Abbildung 5: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) mit und ohne Energiekrise22
Abbildung 5 macht deutlich, dass der Verlust des Bruttoinlandsprodukts in den zwölf Monaten nach Beginn des Ukrainekriegs rund 4 Prozent betrug – die Differenz zwischen gestrichelter Linie und durchgezogener Linie im ersten Quartal 2023.23 Der größte Teil dieses Verlusts von 4,1 Prozent ist darauf zurückzuführen, dass das deutsche Wachstum nach dem Ende der Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im Frühjahr 2022 stark zugenommen hätte, wenn es keine Energiekrise gegeben hätte.24 Für den Industriesektor ergibt sich auf Basis dieser Methode sogar ein Produktionsverlust von 6 Prozent im gleichen Zeitraum.
Der rund vierprozentige Produktionsverlust der deutschen Wirtschaft war das Gesamtergebnis verschiedener Wirkungskanäle. Die gestiegenen Energiepreise führten zu einem Produktionsrückgang, weil die Unternehmen ihre Erzeugnisse nur mit höheren Kosten herstellen konnten. Dieser direkte Effekt war besonders ausgeprägt bei den Betrieben in den energieintensiven Industriebranchen (zum Beispiel Chemie und Metallerzeugung). Doch auch Unternehmen, die wenig Energie verbrauchen und daher kaum direkt betroffen waren, fuhren teilweise aufgrund der gestiegenen Materialkosten ihre Produktion herunter. Zudem wirkte sich die Verunsicherung in der Wirtschaft negativ auf die Unternehmensinvestitionen aus, was zusätzlich die wirtschaftliche Lage verschlechterte. Darüber hinaus führten allgemeine Preissteigerungen (Abbildung 3) und die damit verbundenen Reallohnverluste (Abbildung 4) zu einem Rückgang der Konsumnachfrage, sodass die Produktion der Güter und Dienstleistungen für den privaten Verbrauch sank. Schließlich wäre es bei einer Gasmangellage, die glücklicherweise verhindert werden konnte (Kapitel 2), zu Unterbrechungen der Lieferketten und Kaskadeneffekte gekommen, die zusätzlichen Schaden verursacht hätten (Kapitel 3).
Diese Analyse unterstreicht, dass der Energieschock 2022 die deutsche Wirtschaft schwer traf und zu erheblichen Verlusten führte. Um deren Ausmaß richtig einzuordnen, lassen sie sich mit den entsprechenden Verlusten während der Corona- und der Finanzkrise vergleichen (siehe Abbildung 6).25
Bruttoinlandsprodukt
Reallöhne
Energiekrise 2022
–4,1 %
–3,4 %
Coronakrise 2020
–2,5 %
–0,8 %
Finanzkrise 2008
–5,8 %
–0,4 %
Abbildung 6: Verluste während der letzten drei Wirtschaftskrisen ein Jahr nach Krisenbeginn26
Die Tabelle in Abbildung 6 zeigt, dass die Energiekrise 2022 zu kurzfristigen Produktionsverlusten führte, die vergleichbar mit den entsprechenden Produktionsverlusten während der Finanzkrise 2008 und der Coronakrise 2020 sind. Darüber hinaus war der Reallohnverlust in der Energiekrise wesentlich stärker ausgeprägt als während der beiden vorherigen Krisen, weil 2022 Löhne und Gehälter nicht im selben Maß wie die Preise gestiegen sind. Die Energiekrise 2022 war in diesem Sinn die schwerste Wirtschaftskrise der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Auf den ersten Blick scheint es verwunderlich, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 nicht gesunken ist, obwohl die realen Arbeitseinkommen um 4 Prozent gefallen sind. Denn die Grundsätze der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung besagen, dass die gesamtwirtschaftliche Produktion (Bruttoinlandsprodukt) dem Einkommen der zur Produktion verwendeten Produktionsfaktoren entsprechen sollte. Was in einem Land erwirtschaftet wird, ist gleichzeitig das Einkommen der Wirtschaftsakteure – hauptsächlich das Arbeitseinkommen der Erwerbstätigen (Löhne und Gehälter) oder das Kapitaleinkommen (Gewinn und Zins) der Kapitaleigentümer.
Die Divergenz zwischen der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts und der Reallöhne ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Erstens haben die Nettozahlungen für Energieinputs an das Ausland, zum Beispiel Norwegen, zugenommen, sodass das inländische Einkommen stärker gesunken ist als das Bruttoinlandsprodukt (die inländische Produktion). Mit anderen Worten: Steigende Energiepreise haben dazu geführt, dass Deutschland 2022 rund 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mehr für seine Energieimporte bezahlt hat als 2021. Zweitens sind die Kapitaleinkommen im Gegensatz zu den Arbeitseinkommen 2022 nicht gesunken. In Zeiten hoher Inflation verlieren die Arbeitseinkommen im Verhältnis zum Kapitaleinkommen, wenn die Nominallöhne starr sind und viele Unternehmen steigende Kosten an die Kunden weitergeben können. Diese Überlegung unterstreichen, dass Krisen immer auch Verteilungsprobleme verschärfen.
Fassen wir zusammen. Die Energiekrise hat die deutsche Wirtschaft schwer getroffen, aber die Mehrheit der Ökonomen konnte keine Krise erkennen, weil sie entgegen der Evidenz unbeirrt an die heilenden Kräfte selbstregulierender Märkte glaubte. Im Kanzleramt wurde diese Fehldiagnose der Ökonomen spätestens ab dem Frühjahr 2023 gern gehört, weil sie in der öffentlichen Debatte eine Möglichkeit bat, die Stärken der eigenen Politik anzupreisen. Marktliberale Ökonomen und Bundesregierung marschierten im Gleichschritt voran. Doch das war nicht immer der Fall. In den nächsten zwei Kapiteln möchte ich zeigen, wie zu Beginn der Energiekrise die Bundesregierung die fragwürdigen Analysen marktliberaler Ökonomen ignorierte und damit die deutsche Wirtschaft vor noch größeren Schaden bewahrte.





























