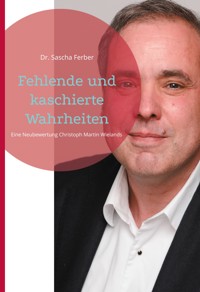
72,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die aktuelle literaturwissenschaftliche Diskussion zeigt sukzessive auf, dass Christoph Martin Wieland nicht nur ein "Wiederentdeckter" ist, sondern Literaturwissenschaftler mit spezieller Expertise des 18. Jahrhunderts stellen nun immer mehr dar, dass Wieland zu erheblichsten Teilen "die Grundlagen der westlichen Moderne" formuliert hat und diese in Theorie und literarischer Anschauung vermitteln konnte. Ferbers erster Titel zu Wieland (>Die Geschichte der Vorurteile - Wieland-Rezeption im 19. Jahrhundert<), der ein Standardwerk der Literaturwissenschaft geworden ist, hat 2013 schon bahnbrechend die Diskussion in diese Richtung intensiver angestoßen und in eine starke Dynamik befördert. Dieser, sein zweiter Titel zu Wieland, geht in dieser Hinsicht nicht nur erheblich weiter, sondern zeigt die Sachverhalte in aller Deutlichkeit: Wieland ist "DER deutsche Klassiker", ein Titel, der ihm gestohlen wurde, und im Sinne einer "späten Gerechtigkeit" zurückzuerstatten ist. Darüber hinaus berührt der aktuelle Titel geschichtliche, politische und literaturgeschichtliche Themen erster Größenordnung: Die Abkehr von Wieland markierte bereits die Abwendung von der Aufklärung. Der sich fortsetzende Verlust von Vernunft und Rationalität, führte immer weiter über die Postmoderne bis in die heutige grundsätzliche Infragestellung und Aufweichung von Prämissen, was in vielem einen Verlust der intellektuellen Leistungen der Neuzeit darstellt, die mit Wieland in maximale Beschleunigung kommend, die Moderne einst in vielen Bereichen stark gemacht und auf wirtschaftliche wie auch gesellschaftlich-kulturelle Höhen gebracht hatten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Neue Forschungsergebnisse zu Wielands Rezeptionsgeschichte und zur Bedeutung der Wielandschen Klassik – sowie die Auswirkungen ihres Niedergangs in der Moderne bis hin zur späten Postmoderne – Ein Beitrag zum heutigen Paradigmenwechsel in der Rezeptionsgeschichte der Deutschen Klassik und – in inhaltlichem Zusammenhang damit – Reflexionen über letzte Entwicklungen der Postmoderne, die Entwicklungen ihrer Nachfolgeepoche und eine jetzt erfolgende, und auch nötige, Reetablierung der Aufklärung.
Vorwort
2013 konnte ich in meiner heute zum Standardwerk gewordenen Untersuchung zur Rezeptionsgeschichte Wielands im 19. Jahrhundert1 zeigen, wie gegen Mitte des 18. Jahrhunderts bis in das 19. Jahrhundert hinein die Literarhistoriker der Zeit Wielands umfassende Bedeutung vollkommen gesehen haben, weil es gleichsam ‚zwischen den Zeilen‘ als selbstverständliches Allgemeingut kontinuierlich unübersehbar aufleuchtete, wie wichtig, zentral und prägend dieser erste Weimaraner für die Epoche war, während es die Absicht vieler maßgeblicher Verfasser der Zeit war, eine deutliche Abwertung Wielands zu betreiben, um ihm seine Bedeutung abzusprechen.
Viele andere Literarhistoriker schrieben quasi immer und immer wieder ab, was erstere als ihre ‚Forschungsergebnisse‘ veröffentlichten und so wurde ein Wieland-Bild konstruiert, welches den Urheber der Deutschen Klassik geradezu als nicht bedeutend einstufte – auf jeden Fall im Verhältnis zu den ‚Größen‘ der Weimarer Klassik Goethe und Schiller. Dies führte dazu, dass dieser Dichter ein zunehmend Vergessener wurde, den immer weniger Menschen kannten und lasen.
Friedrich Sengle hob ihn schließlich gleichsam aus dem ‚Grabe der Vergessenen‘ wieder heraus, aber ohne dass die wahre Relevanz dieses Großen der deutschen Geistesgeschichte jemals wieder in das allgemeine Bewusstsein gekommen wäre – und es war zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht die dafür erforderliche Wieland-Forschung umfassend genug ausgeführt worden, um die Fakten dafür vor Augen zu haben – und mit entsprechender Trennschärfe Urteile vornehmen zu können, welche nicht durch den riesigen Apparat von Vorurteilen und Abwertungsversuchen, dessen Aufbau bereits in Wielands Leben begonnen und dann beständigen Weiteraufbau erfahren hatte, beeinträchtigt oder massiv in eine unwahre Richtung geführt zu werden.
Bereits Arno Schmidt hatte Wieland in manchen Aspekten klar sehen können wie er war und kam zu Urteilen außerordentlicher Größe. Wohl als erster „setzt er [ihn an] den Platz, den die Literaturgeschichte des Neunzehnten Jahrhunderts Goethe zugewiesen hat“2 und nimmt darüber hinaus noch kaum weiter steigerbare Wertaussagen vor, nämlich, dass Wieland der Mann sei „durch dessen Schreibtisch wir Schriftsteller unseren ersten Meridian ziehen müssten“.3 In diesem Ton Wieland zugeschriebener Superlative lässt Schmidt 1953 in „Aus dem Leben eines Fauns“ die Gesprächsäußerung verlauten: „In Deutschland haben wir ja ein ganz einfaches Mittel, einen intelligenten Menschen zu erkennen. (-):? - (. ‚Wenn er Wieland liebt.‘ “4
Damit erhebt Arno Schmidt Wieland zur Zentralfigur der deutschen Literatur, mehr noch, zum bedeutendsten Impulsgeber unserer (Bildungs-)Kultur der Moderne.
Arno Schmidt – auf andere Weise, aber auch wie Wieland zu seinen Lebzeiten umstritten und umkämpft, wie auch die Leserschaft polarisierend zu Verehrern und Verächtern – konnte damit nicht in Breite die generelle Wieland-Rezeption verändern.
Sehr interessant und weltgeschichtlich bedeutsam indes, was nun aktuell grade im weltweiten Diskurs um Wieland geschieht. Dieser hatte 1783 geäußert: „Nach meinem Tode wird’s endlich herauskommen, was ich war, und mir wird mit vollem gerüttelten und geschüttelten Maas Gerechtigkeit widerfahren.“5 Das findet jetzt statt. Hatte ein starkes Forschungsinteresse an Wieland bereits in den letzten 25 Jahren zunehmend an Intensität und auch extensiv zugenommen (immer mehr Forschung, immer breitere Untersuchungen), hat die Angelegenheit nun – grade mit dem
Fokus auf Wielands Bedeutung – eine so deutliche inhaltliche Dichte und derartig starke Ausdruckskraft erfahren und geht damit immer schneller in die Breite, dass ich davon ausgehe, dass in den nächsten Jahren die generelle Einschätzung Wielands – im Sinne eines Paradigmenwechsels – sich verändert haben wird – und dass er auch wieder sehr viel gelesen werden wird – als Begründer der Deutschen Klassik, als zentraler Normgeber unserer klassischen Kultur, unserer Bildungsideale (und damit erheblich zu viel Gutem im Bildungssystem, auch wenn sich dieses seit Jahren in ganz andere Richtungen jetzt leider verändert hat und dessen Entwicklung bedauerlicherweise weiter ungünstig forciert wird) und vielem anderen mehr – und dass überhaupt das Wissen überall präsent ist, dass Weimar ohne ihn nichts anderes als ein kleiner unbedeutender Ort ohne bemerkenswerte Besonderheiten in Thüringen („oder wo war das nochmal?“) geblieben wäre.
2013 hatte ich unter anderem mit dem Wunsch, Wielands Bedeutung sichtbarer zu machen, mein Buch mit dem Titel „Die Geschichte der Vorurteile – Wieland-Rezeption im 19. Jahrhundert“ veröffentlicht, dessen Manuskript 2011 fertiggestellt war und welches einen Ausschnitt aus der Rezeption des ersten Weimaraners im 19. Jahrhundert zeigt, das die gewollte Abwertung Wielands bei gleichzeitigem Wissen um seine Größe deutlich vor Augen geführt hat. Jan Philipp Reemtsma, einer der bestinformierten Wieland-Experten der Welt, hat danach 2013 ebenfalls ein Buch zu Arno Schmidt herausgegeben, in welchem in voller Klarheit die Rolle Wielands in der literarhistorischen Deutung von Arno Schmidt vor Augen tritt.6 Reemtsma hat schließlich 2023 seine große Wieland-Biographie herausgegeben, welche im Jahr der Veröffentlichung bereits drei Auflagen erfahren hat und – im Zusammenklang mit Reemtsmas darüber hinausgehendem aktuellen Wirken für den Biberacher Dichter – den Wieland-Diskurs maximal befeuert hat. Sein unmissverständlicher Untertitel zu Wieland lautet: „Die Erfindung der modernen deutschen Literatur“7. Aus seiner umfassenden wie vertieften Kenntnis heraus nennt er unumstößliche Argumente, welche die literatur- und kulturgeschichtliche Bedeutung Wielands klar vor Augen führen.
Ich gehe davon aus, dass viele Literaturwissenschaftler und Wieland-Experten nun aus Ihren Fachbereichen heraus Weiteres aus den Feldern ihrer Spezialisierungen beitragen werden, an Vorheriges anknüpfend oder neue Felder eröffnend, was insgesamt die Debatte schnell und weltweit dahin führen wird, dass von vielen Seiten aus die überragende Bedeutung dieses Normgebers unseres Landes, unserer Kultur und Literatur klar gesehen werden kann. Wer interessegeleitet das nicht sehen will, wird es weiterhin nicht sagen.
Ich bin Hansjürgen Blinn dankbar, dass er meine Arbeit von 2013 auch in dieser Hinsicht positiv beschrieben hat, was zur Verbreitung dieser Inhalte beitrug – und erst recht Herbert Jaumanns Rezension bei de Gruyter, welche dessen Verbreitung enorm nach vorne gebracht hat und damit – und darum geht es mir – die Anliegen, von denen wir hier sprechen. Im Folgenden hat die Fachwelt von meinen Studien ausgehend eine neues schriftlich fixiertes Fundament der Rezeptionsforschung hierin erblicken und vor allen Dingen als eine stabile Säule innerhalb der Forschungsbemühungen darin finden können, die wir alle als an Wieland Interessierte kontinuierlich die Basis unserer reliablen Forschungen zu vergrößern suchen und damit gleichsam „wie Goldschürfer“ Wesentlichstes, das nicht mehr sichtbar war, wiederum in den Besitz der Menschheit bringen dürfen.
Bezüglich des weiteren Auffindens, Darstellens und weltweiten Bewusstmachens der Tatsache, welche Inhalte, Formen und Grundlagen der Literatur, Kultur und gesellschaftliche Grundannahmen Wieland in die europäische – und damit die gesamte westlichdemokratische – Welt getragen hat und damit stabile Grundlagen, Fundamente für sehr viel Gutes und Wesentliches unserer Zivilisation er zur Verfügung gestellt hat und dass eben dieses in viel zu großem Umfang für das Verdienst anderer gehalten und das so vermittelt wurde, denke ich, dass dies grade auch in unserer heutigen Zeit ein wichtiger Schritt zur Ehrlichkeit, Transparenz und Rückgewinnung von Glaubwürdigkeit sein wird, jenem die Ehre zu erweisen, dem sie gebührt, was einen Baustein einer auf vielen Ebenen zu führenden Anstrengung zu Etablierung, Solidität und Vertrauenswürdigkeit darstellt, den unsere Gesellschaften brauchen und vollziehen werden und damit gesellschaftliche Stabilität und ein deutlich höheres Level an allgemeinem Wohlbefinden und Lebensglück erzeugen werden.
Passend dazu ist mein Anliegen dieses Buches – ausgehend von meiner Veröffentlichung von 2013 – die verschiedenen Abwertungsrichtungen und Bemühungen gegenüber Wieland aufzuzeigen, ihre Motive zu untersuchen und in diesem Kontext Qualitäten Wielands herauszuarbeiten, die offensichtlich ein ‚Dorn im Auge‘ vieler und auch vieler Tonangebender waren, diese zu besprechen und der Frage nachzugehen, ob wir diese nicht lieber in Breite etablieren, statt in versteckter (und unaufrichtiger) Weise bekämpfen sollten – wozu ich weitere Bände im Sinne einer Fortsetzung und immer tiefer und weiter sich ausformenden Wieland-Darstellung herauszugeben gedenke.8
Zudem ist im Kontext aktueller Forschungsergebnisse, wie denen von Reemtsma, jetzt schon Vorhandenes zu ergänzen und auf den Punkt zu bringen, also pointiert und mit abgesichert solider Begründung darzulegen, warum Wieland der Impulsgeber und Normgeber nicht nur der Deutschen Klassik, sondern auch darüber hinaus in substantieller Weise der westlich-demokratischen Gesellschaften und deren Leitkulturen war und ist.
Mit immer weiterreichender erneuter Beschäftigung mit Christoph Martin Wieland und verschiedensten, auch tagesaktuellen, thematischen Kontexten, die sich passend darauf beziehen und dadurch erheblichste Erhellung und/oder Förderung erfahren, tun sich sehr viele sehr ertragreiche Themenfelder auf, die der Forschung absolut noch geschuldet sind und die erbracht werden müssen. Dieser, mein zweiter Band zu Wieland, gut 10 Jahre nach dem ersten, welcher schon in anderer Hinsicht zeigen konnte, wo die Bedeutung Wielands viel größer wahrgenommen wurde, als bisher in der Forschung dargestellt, ist der Anfang einer weit darüber hinaus reichenden Darstellung der Literaturgeschichte in Bezug auf Wieland, die Klassik und vieler Kontexte, wo der aufgrund vorliegender Forschungsergebnisse jetzt nötige grundsätzliche Paradigmenwechsel hinsichtlich der Wieland-Darstellung und anderer bisher als gegeben angesehener Kernelemente der Klassik und ihrer Hauptvertreter mit vielen zugehörigen Themen erfolgen wird. In diesem ersten Band werden zunächst viele Themenbereiche berührt, manche tiefgehender ergründet, einige nahezu erschöpfend zu Ende geführt. In mancherlei Hinsicht stellt dieser hier vorliegende Band eine Einführung in viele jetzt von mir und anderen erfolgende Forschungen zu neuen Feldern in der Wieland- und Klassikrezeption dar.
In dem – als nächsten Buch von mir erscheinenden – insgesamt 3. Band von mir zu Wieland ist eine konzentrierte Darstellung der >Wielandschen Klassik< in ihren wesentlichen Bestandteilen, nebst Grundsätzlichem zu ihren Rezeptionsverläufen, geplant, der als auf diesen folgender Wieland-Band von mir bereits in Bearbeitung ist.
Anschließend strebe ich einen umfassenden Band an, der die Auswirkungen dieser >Wielandschen Klassik< – ihre Rezeption –, und damit auch sehr Wesentliches zur Bedeutung Wielands insgesamt, im Kern darstellen wird, nebst zugehörigen anderen Kontexten.
Nachdem mein 2013 erschienener Band zu Wieland zunächst den Rezeptionsausschnitt von 1839 – 1911 in der Literaturgeschichtsschreibung gründlich analysiert hatte und das Ergebnis brachte, dass die von hier übernommenen Deutungen der Rezeptionsgeschichte Wielands, die sich teilweise bis heute hieran anschlossen, eine Art Fortsetzung in Form einer >Geschichte der Vorurteile< darstellte, in welcher die wahre Bedeutung Wielands nicht annähernd bezeichnet wurde, ist hier vorliegender Wieland-Band von eine Art Grundlegung, welche den Auftakt zu vielen Forschungsthemen darstellt, welche in Breite den Nachweis bisher unzutreffender Deutungen in der Wirkungsgeschichte Wielands erbringen werden, die revidiert und in ihrer Tatsächlichkeit neu beschrieben werden, sodass anhand einer Fülle zentraler Themen eine auf Fakten gegründete Rezeptionsgeschichte Wielands nun unter verschiedenen Zielsetzungen in mehreren Einzelbänden geschrieben wird, die in dieser Faktizität wie auch überhaupt in dieser Breite bislang nicht existiert und daher der Forschung unbedingt geschuldet ist. Da ich zunächst thematisch hier unter Einschluss vielfältiger Erkenntnisinteressen verfahre, die andere Kontexte mit einbeziehen, besteht die Möglichkeit, nach Abschluss der Darstellungen mir zu Zeit vordringlich erscheinender Wieland-Publikationen, anschließend zusätzlich noch abrundend dazu eine reine >Rezeptionsgeschichte Christoph Martin Wielands< in mehreren Bänden zu schreiben und herauszugeben.
1 Sascha Ferber: Die Geschichte der Vorurteile: Wieland-Rezeption im 19. Jahrhundert. 1. Auflage (die zahlreichen seitenidentischen Folgeauflagen sind vom Verlag nicht als solche markiert.) Frankfurt am Main: Peter Lang 2013.
2 Arno Schmidt: „Na, Sie hätten mal in Weimar leben sollen!“ Über Wieland-Goethe-Herder. Hrsg. v. Jan Philipp Reemtsma. Stuttgart: Reclam 2013. S. 37.
3 Ebd., S. 36.
4 Ebd.
5 Wieland aus seinem Briefwechsel vom 27. Oktober 1783. Zit. n. Jan Philipp Reemtsma: Christoph Martin Wieland. Die Erfindung der modernen deutschen Literatur. 3. Auflage. München: C.H. Beck 2023. S. 5.
6 Arno Schmidt: „Na, Sie hätten mal in Weimar leben sollen!“ Über Wieland-Goethe-Herder. Hrsg. v. Jan Philipp Reemtsma. Stuttgart: Reclam 2013.
7 Jan Philipp Reemtsma: Christoph Martin Wieland. Die Erfindung der modernen deutschen Literatur. München: Beck 2023.
8 Und überhaupt plane ich, in den kommenden Jahren noch einiges dazu – auch noch Umfangreicheres und Detaillierteres – zu veröffentlichen. Ich habe dennoch entschieden, jetzt schon zu beginnen, auch von meiner Seite aus weiteres Input in die allgemeine Wieland-Debatte zu geben. Mein Kernziel dabei – wie dem Kundigen sichtbar sein wird – ist, die generellen Hauptlinien zu bezeichnen, da ich ansonsten die Gefahr sehe, dass bei unzähligen Detailstudien das Eigentliche nicht sichtbar wird. Ich hoffe und glaube, hiermit auch anderen Literaturwissenschaftlern weiteres Input zur Anreicherung Ihrer Anliegen zu liefern, sodass insgesamt im Verbund der aktuell mit Wieland Befassten eine zügige Ausarbeitung eines sehr präzisen, wahrhaftigen Bildes Wielands hinsichtlich einer zutreffenden Bewertung seiner Bedeutung und seiner Verdienste entsteht und sich zügig verbreitet, sodass weltweit eine der Wahrheit entsprechende Beurteilung Wielands (und der Weimarer Klassik) im Bewusstsein derjenigen vorliegt, die sich mit derartigen Inhalten beschäftigen – und dass dies im Folgenden in eine auch auf Gesamtbildung zielende Breite – bis in den schulischen Oberstufenunterricht hinein – deutliche Prägungen hervorbringen wird.
Vorwort, Teil 2: Deskriptionen eines welthistorischen Epochenwechsels: Von dem aktuellen >Zeitalter der Ideologien< zu einer >Neuen Epoche der Aufklärung<
Meine ursprüngliche Absicht zum Verfassen dieser Studie erstreckte sich nicht über Wieland und seine Rezeptionsgeschichte als vorgesehenen Untersuchungsgegenstand hinaus.
Unvermerkt mischte sich in meine Arbeit jedoch immer mehr die Erkenntnis, dass dieser Bogen noch wesentlich weiter zu spannen sei, und wir anhand der wesentlichen von Wieland formulierten Theoreme, Gedanken und Formen, die zusammen als wesentliche Grundlagen der Moderne anzusehen sind, ein weiter Aspekt, welcher Wielands Geistesinhalte und Texte zur zentralen Klassik, der >Wielandschen Klassik< werden lässt –, dass wir anhand dieser Gesamtgrundlagen zum Gelingen befähigten Lebens von Gesellschaften, die Wieland in vielem Wesentlichen formuliert hat, Konzepte vorfinden, die:
Von der aktuellen Gegenwartsgeschichte wieder so weit verlassen worden sind, dass die Grundtheoreme der Aufklärung, der Deutschen Klassik und des Demokratiegedankens zur Zeit nicht mehr Grundkonstanten (als eigentliche und stabile Säulen) der westlichen Welt darstellen,
dass sich daraus ein überragender Großteil des Leides der Menschheit (gerade in der tonangebenden westlichen Welt) ergibt, da menschlich stabile und zuträgliche Mechanismen und Orientierungen grundsätzlich infrage gestellt und fallengelassen wurden und durch nichts Tragfähiges oder überhaupt Funktionsfähiges ersetzt wurden,
dass anstelle dieser stabilen Grundlagen eine Reihe nicht wissenschaftlich oder auch nur sachlich-logisch begründeter (oder überhaupt begründbarer!) Ideen oder Ideologien die westlichen Diskurse beherrscht und nach weiterer Vorherrschaft und absoluter Dominanz strebt.
Diese Ideologien zeigen inhaltlich erhebliche Anteile an Irrationalität, Verzerrung, Ermangeln stringenter Logik und gehen weit unter die in der Epoche der Aufklärung des 18. Jahrhunderts gewonnenen Standards und Grundlagen des Denkens und der dort vorhandenen Grundvorstellungen menschlichen Lebens zurück.
Erkenntnistheoretisch ist wichtig, dass sie sich selber keine sachliche Fundierung schuldig sind, sondern rein interessegeleitet (bei den sie verbreitenden Machteliten) oder gefühls-/ begierdegesteuert bzw. in anderen Gruppen auch nach naiver Übernahme zu diesem Zweck manipulativ verbreiteter Fehlinformationen, die nun ideologiegeleitet, verführt mit ihrem eigentlich idealen, guten Streben, das sich durch die an diesen Menschengruppen erfolgreich stattgefundener Manipulation, jedoch nun als an der Basis verstärkter Arm der Interessen weniger Mächtiger verdreht erweist.
Es gibt also riesige Bevölkerungsgruppen, die lediglich erfolgreich manipuliert worden sind, vor allem jüngere Menschen, deren grundsätzlich nach Gutem, Idealem strebendes Verlangen erfolgreich für die Macht- und Finanzinteressen weniger als wirkungsmächtiges Munitionsarsenal instrumentalisiert worden ist, indem es auf unzutreffende, ihnen selber schädliche Inhalte gelenkt worden ist, sodass diese Menschen als vollständig intellektuell Missbrauchte, ohne eigenes Wissen nur den Interessen sehr weniger Mächtiger dienen, die sie zu diesem Zweck durch massenhafte Desinformationsstrategien für sich benutzen, mit dem Ziel, es dem Anschein nach ‚demokratisch‘ gestalten zu können, die nationalen Willensbildungen in den Funktionsstellen der Macht in ihrem Sinne für ihre selbstbezogenen Interessen besetzen zu können.
Äußerst wichtig ist, dass diese Ideologien riesige Schäden mit sich bringen, die sich als unvorstellbares menschliches Leid auf verschiedenen Ebenen jetzt schon zeigen, was noch massiv weiter steigen wird, und nur durch einen Grundlagenwechsel in den zugrundeliegenden Theoremen und Absichten und deren Umsetzung jetzt gestoppt werden kann.
Dazu – und hiermit schließt sich der Kreis – ist ein Zurückgreifen auf die zentralen Inhalte der Aufklärung nötig, die wir unmerklich verloren hatten und dadurch eine massive Abnahme an Gelingen, Zufriedenheit, Wohlstand und vor allem persönlichen Lebensglückes in statistisch sehr relevanter Erheblichkeit in der Gesamtbevölkerung erfahren haben.
Diese zentralen Inhalte einer Grundlegung ‚guter‘ (‚gut‘ im Sinne von funktional für gelingendes menschliches Leben) Werte und Grundlagen der Moderne finden sich am Aussagefähigsten formuliert bei Christoph Martin Wieland, der fast die gesamteuropäische vorherige Tradition aufgegriffen und dann in Postulate der Moderne verwandelt hat, die sehr viel Funktionsfähiges, Etablierendes in Richtung Demokratie und zu wirtschaftlichem und gesellschaftlichen Gelingen geschaffen haben – und damit direkt und noch mehr indirekt sehr viel Lebensglück auf unzähligen Ebenen hervorgebracht haben.
Wichtig ist es anzumerken, dass es nicht nur die eigentliche Aufklärungslehre per se war, die viel Wachstum, Gelingen und Lebensqualität in die Moderne getragen hat, sondern dass grade Wielands eigentümlichem Verhältnis zum christlichen Glauben eine besondere Bedeutung bei der Erfindung/Postulierung der Grundkonstanten einer gelingenden modernen Welt zukommt.
Während meiner Arbeit an dieser Studie, die sich ursprünglich fast nur Wieland selber bezog, ist die Materie schnell in ihren Dimensionen durch ihre Verknüpfungen, die bei mir geradezu zwangsläufige Interaktionen in Gang gebracht haben, dorthin gewachsen, dass mir klar wurde, diese Dinge isoliert zu betrachten, ist unmöglich, sondern gerade hier geraten wir – neben einem signifikanten Paradigmenwechsel in der deutschen Literaturwissenschaft – mitten hinein in eine weltgeschichtlich und philosophisch-grundsätzliche Normen- und Grundlagen-besprechung erster Größenordnung, die das derzeitige und kommende menschliche Leben auf der Welt substantiell betrifft.
Dann kamen die Praxis betreffende Überlegungen, zum Beispiel, dass ein solcher einen phasenweise weniger bekannten Dichter und aktuelle, global bedeutsame philosophische Überlegungen verbindender Band nicht zu leicht in die passende Kategorie (oder auch nur Fakultät) einsortierbar sei, - und dieser insgesamt nun als Auftakt zu mehren Bänden angelegt worden ist, um weitere folgen zu lassen, welche die Themen aufgliedern, weiter vertiefen und in einer logischen Linie weiterführend mit angrenzenden hierüber weit hinausgehenden Inhalten darstellen werden, wobei jeweils divergierende Erkenntnisinteressen verfolgt werden, die in einzelnen Publikationen direkt zu und über Wieland hinaus Bedeutsames zutage fördern sollen.9
Nachdem mein erster, 2013 herausgegebener Band zu Wieland, zunächst in anderer Hinsicht bahnbrechend auf die viel höhere Bedeutung Wielands, als vorher angenommen wurde, hingewiesen hat, wird in diesem aktuellen Band von 2024 eine Grundlegung zu den im Folgenden zu vollziehenden Untersuchungen und Darstellungen vollzogen, welche im Ergebnis eine erstmals existierende umfassende >Rezeptionsgeschichte Christoph Martin Wielands< hervorbringen können. Da Rezeptionsgeschichte immer eine Darstellung der dem besagten Ausgangsgegenstand nachfolgenden Geschichte, die sich auf ihn rückbezieht ist, ist es generell immer damit verbunden, auch diese Zeitgeschichte des Rezeptionsverlaufs reflektierend einzubeziehen, d.h. selber ebenfalls auf einer
Deutungsebene zu besprechen, um deren eigene Historizität und ihre Gesamteinordnung sachlicher zu treffen.
Im vorliegenden Fall kam ein bislang besonders fehlgedeuteter Untersuchungsgegenstand (die Wirkungsgeschichte Wielands) mit einer aktuellen Zeitgeschichte zusammen, die, in der Zeit dieser Forschungen, jetzt 2024, und den vorherigen Jahren der dorthin führenden Entwicklungen, gleichzeitig mit zeitgeschichtlichen Verläufen zusammentrafen, welche ebenfalls intellektuell-sachlich historische bedeutsamste Zuspitzungen erfahren haben, die inhaltlich-thematisch erhebliche Schnittmengen mit von Wieland ausgedrückten Inhalten aufweisen, sodass hier der bisher in dieser Prägnanz noch nicht aufgetretene Fall der Rezeptionsgeschichte eines Dichters entstanden ist, die gleichzeitig historisch relevante Darstellungen bezüglich aktueller Weltgeschichte vornimmt, – während beide, sich auf unterschiedlichen Ebenen bewegende hier enthaltenen Geschichtsverläufe zudem signifikante Paradigmenwechsel bezeichnen, welche die Grundlagen beider Geschichtsdarstellungen in ihren Fundamenten nicht nur berühren, sondern grundsätzliche Fragestellungen und Klärungen an und für sich dazu erfordern.
9 Im Sinne auch meiner Gesamtabsichten habe ich heute, am 21.05.2024, erfahren, dass auch Jan Philipp Reemtsma ein Buch geschrieben hat, in welchem er Inhalte Wielands mit ähnlichen und anderen aktuellen politisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen mit anderer Akzentsetzung in Verbindung bringt und dass Reemtsmas neuestes Buch ab 20.06.2024 verfügbar ist, was mich außerordentlich freut. Dies ist meine Hoffnung, dass viele Forscher nun insgesamt die Themen voranbringen, die in neuer Weise weltweit erkannt werden, weshalb ich auch aufs Erste nicht meine Inhalte auf 300-500 Seiten umfassender ausformuliert habe, damit ich jetzt so schnell wie möglich mein Material verfügbar machen kann, um qualifizierter Forschung verschiedenster Provenienz auch von meiner Seite Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, bevor ich auch weiteres – und später auch noch Umfassenderes – liefern werde.
Einleitung: Die jahrhundertelange – zum Teil bewusst initiierte und inszenierte – Abwertung des ersten Weimaraners Christoph Martin Wieland im Kontext eines aktuellen Paradigmenwechsels – >Ehre, dem die Ehre gebührt<
Es ist einer der dramatischen Vorfälle der Kultur- und Wissenschafts-geschichte (und aufgrund der realitätsprägenden Kraft allen relevanten Geistesgeschehens: der Weltgeschichte) ; ein Dichter, ein Normgeber abendländischer Kultur der Moderne, wird bereits sehr früh überwiegend nicht nach sachlichen Kriterien evaluiert und betrachtet – seine immense Fülle an Inhalten, Formmodellen, und seine Grundlegung in zahllosen Bereichen der in Europa entstehenden abendländischen Moderne wird geradezu von Beginn an nicht als die Leistung angesehen, die sie darstellt; stattdessen werden alle Arten von Argumenten gesucht, Aspekte des Werkes, der Inhalte, der Formen, mit zum Persönlichen des Dichters Gehörigem vermischt, auch zeitgeschichtliche Kontexte einbeziehend, sodass bestimmte >Rezeptionsschemata< zu Wieland entstanden, welche stets Konglomerate diverser Inhalte bilden, die mitunter diffuse Kriterien beinhalten, und insgesamt deutlich durch ihre mangelnde innere Logik erkennen lassen, dass sie insgesamt einen zur Diminuierung Wielands unternommenen Feldzug darstellen.
Wieland passte definitiv auch sachlich nicht in gängige Schemata, ihn bekam man in keine Schublade hinein, was verwirren mag und für das ‚gewöhnliche‘ Gemüt den Umgang und die eigene Position dazu schwieriger macht.
Wie es sich wohl auch generell in der Regel gestaltet, wird die Lage im Umgang dann prekär, wenn ein solcher nicht unbedingt die Interessen der ihn umgebenden oder seine ‚Szene‘ bestimmenden Tonangebenden befördert – sei es unmittelbar oder mittelbar – oder ihnen sogar (wenn auch vielleicht für ihn selber zunächst unmerklich und auf jeden Fall von ihm unbeabsichtigt) Hindernisse bereitet – wobei dies dann in der Regel die persönliche und berufliche Entwicklung (bzw. eine Form der Entfaltung des Einflussumfangs nach außen) berührt und damit im Endeffekt für gewöhnlich individuelle Auswirkungen auf drei der großen Menschheitsthemen Geld, Ruhm und Macht hat.
Das war bei Wieland offensichtlich der Fall, was einen Bestandteil der im Folgenden hier niedergelegten Untersuchungen darstellt.
Die Tragödie, die auf dieser Grundlage sich abgespielt hat, und deren positiver Abschluss sich nun anbahnt (womit sie aufhört eine Tragödie zu sein), ist, dass es gelungen ist, auf Grundlage sehr fragwürdiger bzw. verwerflicher Motive, Argumente gegen Wieland zu konstruieren, und insgesamt die ‚Wieland-Debatte‘, also die Wielandrezeption, so zu steuern, dass dieser Dichter eine eher marginale Position unter den weltgeschichtlich bedeutenden deutschen Dichtern zugewiesen bekommen hat, obwohl er die Grundlagen unserer modernen Literatur und in erheblicher Weise auch unserer Kultur und Gesellschaft gelegt hat, wie kein Zweiter.
Schiller und Goethe – lärmender, auffallender, in der Kunst der Selbstinszenierung wesentlich begabter und diese auf ganz anderem Level praktizierend – haben schnell im öffentlichen Bewusstsein – und dann auch in Fachkreisen und im akademischen Diskurs – einen bedeutenderen Raum eingenommen und diesen so ausgeweitet, dass für Wieland fast keiner mehr blieb.





























