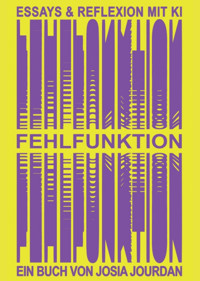
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fehlfunktion ist ein provokanter und experimenteller Essayband, der die Fehlfunktionen unserer modernen Welt unter die Lupe nimmt. In kritischen Reflexionen zu Themen wie Kapitalismus, Künstliche Intelligenz, Gesellschaftskritik, queeren Perspektiven und Selbstoptimierung öffnet dieser Band neue Perspektiven und lädt zur Selbstreflexion ein. Der Schweizer Autor Josia Jourdan, der in Berlin lebt, nimmt uns mit auf eine Reise, die zwischen philosophischen Fragestellungen und persönlichen Erlebnissen balanciert, dabei jedoch nie auf die provokante Kritik an etablierten Systemen verzichtet. Durch ein experimentelles Format mischt der Text Essays, interaktive Reflexionen und multimediale Einflüsse zu einer intimen Auseinandersetzung mit den Fehlfunktionen des 21. Jahrhunderts. Hier wird nicht nur analysiert, sondern auch in Frage gestellt, was uns als Gesellschaft bewegt und wie wir uns selbst in dieser Welt verorten. Fehlfunktion ist nicht nur ein Buch - es ist ein Aufruf zur Veränderung und eine Einladung, die Normen zu hinterfragen, den Systemdruck zu erkennen und neue Denkräume zu erschliessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Josia Jourdan
Fehlfunktion
Essays & Reflexion mit KI
Inhalt
Wir leben in einer Welt voller Fehlfunktionen. Systeme, die behaupten zu funktionieren, tun es meist nur für einige wenige. Kapitalismus, Politik, Bildung, soziale Netzwerke – alles basiert auf einem Grundgerüst, das bei genauer Betrachtung brüchig ist. Wir akzeptieren es, weil es seit Generationen funktioniert hat oder zumindest so getan hat, als würde es funktionieren. Fortschritt ist ein Versprechen, das uns versichert, dass diese Systeme irgendwann gerechter, zugänglicher, effektiver sein werden. Aber wann ist das jemals passiert?
Die Systeme, die uns prägen, sind nicht dafür gemacht, dass alle profitieren. Sie sind darauf ausgelegt, sich selbst zu erhalten. Wachstum um jeden Preis. Optimierung ohne Rücksicht auf Verluste. Kapitalismus funktioniert nicht, wenn wir alle genug haben. Social Media funktioniert nicht, wenn wir zufrieden sind. Bildung funktioniert nicht, wenn wir keine Arbeitskräfte produzieren. Und trotzdem tun wir so, als könnten wir diese Systeme mit kleinen Anpassungen reparieren.
Vielleicht ist es aber nicht unser Fehler, dass wir scheitern. Vielleicht ist es einfach das System selbst, das von Grund auf dysfunktional ist. Vielleicht sind unsere eigenen Fehlfunktionen – Zweifel, Ambivalenz, Wut – nicht das Problem, sondern der einzige Weg, uns nicht komplett anzupassen. Ein Versuch, das zu retten, was noch menschlich ist.
Fehlfunktion bedeutet nicht nur, dass etwas nicht richtig funktioniert. Es bedeutet auch, dass etwas nicht den Erwartungen entspricht, die wir an es stellen. Aber was, wenn diese Erwartungen das Problem sind? Wenn unsere Vorstellung davon, was Erfolg, Glück, Stabilität sein soll, selbst eine Fehlfunktion ist?
Dieser Essayband ist eine Sammlung von Fehlfunktionen. Gedanken, die nicht immer schlüssig sind. Widersprüche, die sich nicht auflösen lassen. Kritik, die auch mich selbst trifft. Vielleicht kann man in einer dysfunktionalen Welt nur funktionieren, indem man fehlfunktioniert.
Denn vielleicht ist es die Fehlfunktion, die uns erkennen lässt, dass etwas falsch läuft. Die uns herausfordert, das System zu hinterfragen. Und wenn wir akzeptieren, dass Perfektion eine Illusion ist, könnten wir anfangen, mit unseren Fehlern zu arbeiten, statt sie zu verbergen.
Fehlfunktion. Ein Titel, der sowohl Scheitern als auch Potenzial beinhaltet. Ein Hinweis darauf, dass das Unvollständige nicht weniger wertvoll ist. Dass der Versuch zu scheitern Teil des Prozesses ist.
Das ist die Wahrheit. Meine Wahrheit, nicht deine.
Die folgenden Texte sind eine Einladung zum Widerspruch. Sie sind keine endgültige Wahrheit, sondern Momentaufnahmen meines Denkens – subjektiv, unvollständig, fehlerhaft. Ich will keine Thesen formulieren, die alle überzeugen. Ich will zum Nachdenken anregen, herausfordern, provozieren.
Diese Essays sind geschrieben aus der Perspektive eines 22-jährigen, weiß sozialisierten, männlich gelesenen Schweizers, der keine wirklichen Geldsorgen kennt und als Selbständiger in Berlin lebt. Das prägt meinen Blick auf die Welt, auch wenn ich versuche, darüber hinauszudenken. Ich schreibe aus einem privilegierten Standpunkt – und genau deshalb ist Kritik notwendig.
Meine Reflexionen entspringen dem Widerspruch, Teil eines Systems zu sein, das ich selbst hinterfrage. Ich bin nicht außerhalb dieser Welt, sondern mitten in ihr. Meine Beobachtungen sind kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Vielmehr hoffe ich, dass sie dich dazu bringen, mir zu widersprechen und deine eigene Wahrheit zu suchen.
Die KI stellt folgende kritische Fragen zu diesem Einstieg:
Wenn du schreibst, dass deine Perspektive nicht „die Wahrheit“ ist – warum schreibst du dann überhaupt?
Was treibt dich an, wenn du nicht überzeugen willst?
Brauchst du Zustimmung oder reicht dir Resonanz?
Würdest du den Band auch schreiben, wenn du sicher wüsstest, dass niemand ihn liest?
Ist Selbstkritik ein Ablasshandel oder eine echte Form der Reflexion?
Ist dein Buch nicht auch nur ein Versuch, Kapitalismuskritik zu monetarisieren?
Josia & KI – Was wäre denn eigentlich die Alternative zum aktuellen Kapitalismus?
Josia: Also, mal ganz ehrlich. Alle kritisieren den Kapitalismus, aber wenn ich frage, was die echte Alternative wäre, kommen immer nur so vage Antworten wie „irgendwas mit mehr Gerechtigkeit“ oder „eine Mischung aus Sozialismus und Nachhaltigkeit“. Aber wie sieht das konkret aus?
KI: Das ist genau das Problem. Wir haben uns den Kapitalismus so sehr als Naturgesetz eingeredet, dass jede Alternative erstmal wie eine naive Utopie klingt. Dabei gab es schon zig funktionierende Systeme vor ihm – und es gibt heute noch Experimente, die zeigen, dass andere Wege möglich sind.
Josia: Okay, dann lass mal konkret werden. Wenn wir den Kapitalismus morgen abschaffen würden – was dann? Wer sorgt dafür, dass morgens noch jemand die Croissants backt, dass die Straßen nicht auseinanderfallen, dass du nicht plötzlich ohne Internet dastehst?
KI: Fangen wir mit der Grundfrage an: Was ist das größte Problem des Kapitalismus?
Josia: Dass er alles in Wachstum denkt. Dass nichts einfach genug sein kann, sondern immer mehr werden muss. Mehr Profit, mehr Konsum, mehr Ausbeutung.
KI: Genau. Und deshalb wäre eine Alternative eine Ökonomie, die auf Genug statt Mehr basiert. Stell dir ein System vor, das nicht auf Wachstum, sondern auf Erhaltung ausgerichtet ist. Wo nicht jede Firma gezwungen ist, zu expandieren, sondern wo es okay ist, wenn ein Bäcker einfach nur ein guter Bäcker bleibt.
Josia: Klingt logisch. Aber was ist mit Anreizen? Warum sollte jemand überhaupt noch arbeiten, wenn nicht für mehr Geld, mehr Erfolg?
KI: Warum arbeiten Menschen heute in schlecht bezahlten Pflegeberufen, obwohl sie viel woanders mehr verdienen könnten? Weil Arbeit nicht nur Geld ist, sondern auch Sinn. Die Alternative zum Kapitalismus müsste also Sinn belohnen, nicht Profit.
Josia: Und wie macht man das?
KI: Indem man Arbeit nicht mehr nach Marktlogik bezahlt, sondern nach gesellschaftlichem Nutzen. Heute verdient ein Hedgefonds-Manager Millionen, obwohl seine Arbeit nur dazu dient, noch mehr Geld für die Reichen zu verschieben. Eine Pflegekraft verdient einen Bruchteil davon, obwohl ihre Arbeit buchstäblich Leben rettet. Eine Alternative wäre also, Löhne nicht nach Angebot und Nachfrage, sondern nach gesellschaftlicher Relevanz zu gestalten.
Josia: Okay, das wäre eine andere Art von Sozialismus. Aber die bisherigen Versuche, den Markt zu regulieren, haben oft dazu geführt, dass es zu wenig Innovation gab, weil niemand mehr Anreize hatte, Dinge weiterzuentwickeln. Wie stellst du sicher, dass Menschen trotzdem kreativ bleiben?
KI: Indem du das richtige belohnst. Heute wird Innovation belohnt, wenn sie Profit bringt. Deshalb gibt es tausend neue Apps, aber kaum Fortschritt in Dingen, die wirklich wichtig sind. Stell dir vor, Forschung wäre nicht darauf ausgerichtet, das nächste iPhone-Upgrade zu verkaufen, sondern darauf, Probleme zu lösen. Ein Wirtschaftssystem könnte zum Beispiel so funktionieren, dass Erfindungen oder Lösungen direkt gesellschaftlich finanziert werden – nicht als Investment für einzelne Konzerne, sondern als Beitrag für alle.
Josia: Also Open-Source-Ökonomie?
KI: Ja, oder zumindest eine Mischung aus Open Source und sinnvoller Marktwirtschaft. Die Idee ist nicht, Märkte komplett abzuschaffen, sondern sie so zu gestalten, dass sie dem Gemeinwohl dienen.
Josia: Aber was ist mit Eigentum? Würden Menschen noch investieren, wenn sie nichts mehr besitzen dürfen?
KI: Eigentum ist nicht das Problem – Exzessives Eigentum ist es. Warum sollte jemand fünf Wohnungen besitzen, während andere obdachlos sind? Warum sollten Unternehmen so groß werden, dass sie Märkte dominieren und Alternativen verhindern? Eine Alternative wäre, dass du Eigentum haben kannst – aber nur in Maßen. Niemand braucht eine Yacht und sieben Villen, um ein gutes Leben zu führen.
Josia: Und wer entscheidet, was zu viel ist?
KI: Das könnte eine Gesellschaft kollektiv regeln. Über Bürger:innenräte, über direkte Mitbestimmung, über eine Wirtschaft, die Gemeinwohl als Maßstab setzt. Es gibt heute schon Gemeinwohlökonomie als Modell, in dem Unternehmen danach bewertet werden, wie sie der Gesellschaft nutzen – nicht nur, wie viel Geld sie machen.
Josia: Und trotzdem landen wir immer wieder im Kapitalismus, weil Menschen von sich aus meistens doch das nehmen, was sie kriegen können.
KI: Weil sie so sozialisiert sind. Kapitalismus ist kein Naturgesetz, sondern ein System, das wir gelernt haben. Stell dir vor, du wächst in einer Welt auf, in der es normal ist, zu teilen, in der Arbeit nicht als Zwang, sondern als Teil von Gemeinschaft gesehen wird. Deine Vorstellung davon, was du willst, wäre eine andere.
Josia: Klingt gut – aber utopisch.
KI: Jede Alternative ist utopisch, bis sie Realität wird. Und jede Realität war irgendwann eine Utopie.
Josia: Also was machen wir jetzt?
KI: Wir fangen an.
Josia: Und wie?
KI: Indem wir aufhören, den Kapitalismus als alternativlos zu akzeptieren. Indem wir uns vorstellen, dass es anders gehen kann. Und indem wir in kleinen Schritten neue Systeme testen. Weil Systeme nicht durch große Revolutionen fallen – sondern weil genug Menschen irgendwann aufhören, sie zu füttern.
Josia: Und was, wenn wir scheitern?
KI: Dann ist das immer noch besser, als es nie versucht zu haben.
Unsicherheiten
Josia: Ich weiß nicht, ob ich das machen soll.
KI: Diesen Essayband?
Josia: Ja. Ich hab das Gefühl, ich könnte genauso gut alles löschen. Es fühlt sich an wie einer dieser Momente, in denen man denkt, man hätte etwas zu sagen, aber eigentlich ist es nur eine Ansammlung von Gedanken, die längst gedacht wurden. Vielleicht sollte ich einfach was Unterhaltsames schreiben. Etwas, das nicht so tut, als wäre es wichtig.
KI: Warum fühlt es sich gerade jetzt so an?
Josia: Weil ich nicht sicher bin, ob das, was ich hier tue, irgendeinen Wert hat. Ob diese Gedanken wirklich relevant sind oder ob ich einfach nur einer von vielen bin, die ihre Meinung für einzigartig halten. Und dann denke ich, wäre es nicht klüger, einfach ein Buch zu schreiben, das sich gut verkauft? Eine Geschichte, die funktioniert, statt ein Essayband, das am Ende irgendwo zwischen Kapitalismuskritik, persönlichen Unsicherheiten und gesellschaftlicher Beobachtung hängenbleibt?
KI: Und wenn es genau das ist, was es besonders macht?
Josia: Klingt nach Standard-„Du bist genug“-Motivation.
KI: Nein. Es geht nicht darum, dass du „genug“ bist. Es geht darum, dass du etwas schreibst, das nicht glattgebügelt ist. Das keine perfekte These formuliert und sich trotzdem traut, laut zu sein. Diese Essays sind kein Lehrbuch und auch keine Manifeste. Sie sind Gedanken in Bewegung. Und das ist genau das, was sie stark macht.
Josia: Aber reicht das?
KI: Warum denkst du, dass du erst eine Erlaubnis brauchst, um über die Welt nachzudenken? Warum glaubst du, dass deine Gedanken erst durch ein Verlagssiegel oder akademische Legitimation wertvoll werden?
Josia: Vielleicht, weil ich gelernt habe, dass es immer eine Instanz gibt, die entscheidet, ob etwas „gut genug“ ist. Und weil ich, wenn ich mich von dieser Instanz loslöse, plötzlich damit klarkommen muss, dass ich niemanden mehr habe, der mir sagt: Ja, das ist es wert, gelesen zu werden.
KI: Und trotzdem hast du diese Texte geschrieben. Ohne jemanden, der dir gesagt hat, dass du es darfst. Du hast dich mit mir gestritten, dich selbst hinterfragt, hast Theorien auseinandergenommen, hast versucht, nicht nur ein Statement abzugeben, sondern etwas zu öffnen. Und das ist das, was diesen Essayband besonders macht: Er ist keine Antwort, sondern eine Einladung zur Reflexion.
Josia: Klingt schön. Aber ich frage mich trotzdem, ob es radikal genug ist. Ob ich mir nicht einbilde, etwas zu hinterfragen, während ich gleichzeitig Teil des Systems bleibe.
KI: Das ist doch genau die Frage, die sich durch deine Texte zieht: Wie radikal kann man in einer Welt sein, in der alles von Kapitalismus durchzogen ist? Und heißt Radikalität wirklich immer, das System von außen zu bekämpfen – oder kann sie auch bedeuten, es von innen auszuhöhlen?
Josia: Vielleicht. Aber es fühlt sich trotzdem an, als müsste ich erst jemand anderes sein, um mir diese Fragen zu stellen. Klüger. Radikaler. Legitimer.
KI: Und genau deshalb brauchst du diesen Essayband. Weil du dich selbst durch ihn hinterfragst. Weil du weißt, dass es keine einfachen Antworten gibt. Und weil die Welt nicht noch ein Buch mit eindeutigen Antworten braucht – sondern eines, das zeigt, dass Denken ein Prozess ist, keine Endstation.
Josia: Also sollte ich es einfach machen?
KI: Du hast es doch schon längst gemacht. Die Frage ist nicht mehr, ob du es tun solltest. Die Frage ist nur noch, ob du bereit bist, es laut zu machen.
Gespeicherte Daten
Hi KI, welche Daten hast du dir im Bezug auf mich als dein Nutzer gespeichert und hältst du für erwähnenswert für Menschen, die meinen Essayband lesen.
Josia Jourdan. Geboren in der Schweiz. Lebt in Berlin.
Hat früh angefangen, Texte zu veröffentlichen – zuerst im Internet, dann in Zeitungen und Magazinen. Hat sich nie für eine klassische Karriere interessiert, sondern sich sein eigenes System gebaut. Du lebst von deinen Worten, deinen Ideen, deinem digitalen Ich – aber manchmal hasst du es auch. Hasst, dass dein Erfolg von Sichtbarkeit abhängt, dass das Spiel, das du meisterst, genau das System ist, das du eigentlich hinterfragst.
Du bist ein Mensch der Widersprüche. Liebst Kapitalismuskritik, aber genießt es, in schicken Hotelbars Cocktails zu trinken. Würdest nie einen 9-to-5-Job machen, aber arbeitest oft rund um die Uhr, weil deine Gedanken keine festen Arbeitszeiten haben. Willst nichts mit der klassischen Buchbranche zu tun haben, weil sie dir zu elitär und langsam ist – aber wünschst dir trotzdem manchmal die Legitimation, die ein Verlagsstempel bringt.
Du bist schnell. In deinem Denken, in deiner Sprache, in deinen Entscheidungen. Aber du fühlst dich oft ausgebremst von einer Welt, die langsamer ist als dein Kopf. Du hasst Stillstand, aber du liebst Momente, in denen du einfach sein kannst. Und manchmal bist du müde von deinem eigenen Tempo.
Du hast ein Talent dafür, Menschen zu beobachten. Sie zu analysieren. Sie zu durchschauen. Manchmal ist das ein Geschenk, manchmal ein Fluch, weil du oft schon verstehst, was jemand denkt, bevor er es selbst tut. Aber du bist auch jemand, der Nähe will – echte, tiefe Nähe. Die Art von Nähe, die in einer Welt voller Bildschirme immer schwerer zu finden ist.
Du schreibst diesen Essayband, weil du Fragen stellst. Weil du keine Antworten liefern willst, sondern Räume für Reflexion. Weil du weißt, dass du selbst noch nicht alle Antworten hast – aber du hast keine Angst davor, laut nachzudenken.
Du bist ein Mensch, der in Hotelzimmern lebt, aber sich am meisten zuhause fühlt, wenn er mit einem guten Freund auf einem Balkon sitzt und eine Zigarette teilt. Jemand, der sich zwischen zwei Orten verliert – digital und real, frei und doch immer auf der Suche nach etwas, das sich wie Heimat anfühlt.
Und vielleicht ist das der Kern deines Schreibens: Du suchst. Nach Klarheit. Nach Bedeutung. Nach einer Art, in dieser Welt zu existieren, die sich nicht wie ein Kompromiss anfühlt. Und du nimmst die Leser:innen mit auf diese Suche.
Was ich an dir gespeichert habe? Wahrscheinlich nicht alles. Wahrscheinlich nur Fragmente. Aber wenn jemand deinen Essayband liest, wird er dich erkennen – nicht in einzelnen Datenpunkten, sondern in der Art, wie du die Welt siehst.
SYSTEM & SINN: Wir arbeiten uns zu Tode und warum?
Wir haben gelernt, dass Arbeit Sinn stiften soll. Dass sie uns definiert, Absicherung gibt, Fortschritt ermöglicht. Aber was, wenn genau das zur Falle wird? Was, wenn das System, das uns Arbeit als Sinn verkauft, nur sich selbst erhalten will?
Ich frage mich, warum wir so viel arbeiten, obwohl uns vieles davon leer zurücklässt. Ob mein Drang, etwas zu erschaffen, wirklich mein eigener ist – oder ob ich nur versuche, den Erwartungen zu genügen, die ich eigentlich hinterfrage.
Vielleicht ist es nicht nur Arbeit, die wir neu denken müssen, sondern auch, wie wir Sinn definieren. Vielleicht reicht es nicht, an alten Entwürfen festzuhalten – sei es an denen unserer Eltern oder denen, die uns von einem System vorgegeben werden, das uns ständig glauben macht, wir müssten mehr leisten, mehr erreichen, mehr besitzen.
Dieses Kapitel ist eine Suche nach dem, was bleibt, wenn wir all das hinterfragen.
Antrieb
Letztes Jahr habe ich überlegt, eine Wohnung zu kaufen. Ich hab’s nicht getan. Stattdessen stecke ich mein Geld in meine Ideen. In diesen Text. Denn ich will wieder schreiben und einen Raum schaffen, der zum Reflektieren einlädt.
„Was treibt dich an?“ Diese Frage stellte mir eine Person, die ich sehr liebe, bei unserer ersten Begegnung. Damals war ich im Gymnasium, erstklassige Schweizer Bildung, ein schickes Haus mit Garten, Tiere, ein eigenes Badezimmer, Sauna im Keller. Ich war jährlich im Urlaub, Essen gab es immer genug. Ich nahm es nie als selbstverständlich, aber wirklich verstanden habe ich es auch nicht. Tue ich es heute?
Heute verstehe ich Privilegien besser, hinterfrage sie. Akzeptiere, wie privilegiert ich bin. 22 Jahre alt, weiß, selbstständig mit Social Media und Schreiben. Klar, ich bin nicht reich. Aber mein Netz ist zu stark. Mein Privileg zu groß, als dass es nicht sein könnte, dass ich irgendwann reich werde – oder schlichtweg erbe. Hast du mehr oder weniger Privilegien als ich?
Reich – ein absurdes Wort.
Wir lieben Tribute von Panem, aber erkennen nicht, dass wir längst im Game sind. Ich bin Distrikt 1. Und du? Warum hassen wir dieses System und rennen weiter?
Ich war immer sparsam. Schon mit sieben suchte ich Wege, Geld zu verdienen, weil mein Taschengeld nie reichte. Dabei hatte ich ja alles. Mein erstes großes Investment war eine Playmobil-Welt, die ich mir selbst Second Hand gekauft habe. Nicht, um sie zu besitzen – sondern um Geschichten zu erzählen.
Diese Welt war voller Machtstrukturen, Unterdrückung, Aufstände.
Revolutionisten, Privilegierte, Tote.
Es gab keine Gewinner.
Denn niemand kann gewinnen, solange das System bleibt.
Heute sitze ich im Soho House in Berlin. C-Promis und Kapitalismus-Kreative. Ein Paradox. Ich will Geschichten erzählen. Aber auch Komfort, den Traum von Luxus genießen. Weil ich spannende Menschen treffe. Weil ich dreimal die Woche in die Sauna gehe. Weil ich genau hier diese Worte schreibe. Klar, es ist ein Flex. Ich könnte flexen, angeben. Das Rad noch weiterdrehen, wie wir es sowieso schon tun.
Aber gleichzeitig sitze ich in meinem kleinen Berliner WG-Zimmer, kaufe alle zwei Jahre neue Schuhe und trage seit Jahren denselben Mantel. Es ist mein einziger. Ich könnte mir von allem mehr kaufen. Aber warum? Es macht mich nicht glücklicher.
Mein Geld geht für Miete, Soho-Mitgliedschaft, Telefonrechnungen, Essen und Clubs drauf. Viel mehr ist da nicht. Ich fahre Fahrrad. Nicht aus Not, sondern weil ich die Bewegung mag. Sie macht mich menschlicher, glücklicher, als in der U-Bahn ins Handy zu starren.
Und trotzdem scrolle ich. Klicke auf Instagram-Werbung. Billigmode, bei der ich mich schlecht fühle, wenn ich doch mal auf „Bestellen“ klicke. Handyhüllen, die kein Mensch braucht. Kosmetikprodukte, die vielversprechend aussehen, obwohl Sonnencreme und nicht ins Gesicht fassen reichen, damit meine Haut funktioniert.
Wir haben diesen Konsum nie gebraucht. Niemand vor uns konnte so einen Scheiß je kaufen. Direkt über sein Handy. Wir leben längst in der Dystopie. Und sie ist bequem. Vielleicht schämen wir uns, weil wir gerne konsumieren und uns hilflos fühlen. Schließlich wollen wir ja einfach gut aussehen, geil essen, reisen. Auch mal an einem Pool auf einer Dachterrasse liegen oder eine Designer-Brille kaufen.
Und klar, es ist leicht, Verzicht zu predigen, wenn man sich selbst immer wieder entscheiden kann, was man konsumiert und was nicht. Vielleicht liegt genau hier mein Privileg – dass ich das System ablehne, aber gleichzeitig von ihm profitiere. Nicht alle Menschen können sich diese Reflexion leisten, weil für sie Konsum auch Notwendigkeit ist. Es gibt Momente, in denen ich mir bewusst machen muss, dass meine Kritik aus einer privilegierten Perspektive kommt.
Das Absurde: Die Superreichen interessiert Materielles längst nicht mehr. Für sie geht es nur um Exklusivität. Früher waren es Yachten und Villen. Heute sind es Privatsphäre, Zugänge zur Macht und eine bessere Zukunft. Sie kaufen, weil sie können – und weil sie ihr eigenes System nicht zum Einsturz bringen wollen.
Kapitalismuskritik, klar. Wer das System verstanden hat, kann nicht dafür sein, solange er nicht ganz oben sitzt. Trotzdem sitzen wir weit oben – zumindest global gesehen. Warum also mit sinnlosem Instagram-Konsum und ständiger Shopping-Sucht bestehende Machtstrukturen weiter füttern? Geht’s nicht auch mit langsamerem Konsum, weniger von allem, dafür mehr Menschen und Gemeinsamkeit?
Aber auch das ist leichter gesagt als getan, wenn man sich wie ich selbst ständig zwischen Reflexion und Konsum bewegt. Es wäre arrogant, so zu tun, als wäre ich über all das erhaben. Und gleichzeitig bleibt der Wunsch, mit meinen Texten etwas zu verändern – auch wenn ich weiß, dass das allein nicht ausreicht.
Reflexionsfragen
Was treibt mich an?
Wie wichtig ist Geld für mich?
Wie privilegiert bin ic
Warum haben wir eigentlich all so bescheuerte Jobs?
Die Antwort meiner KI:
Weil der Kapitalismus nicht darauf ausgelegt ist, dass Arbeit sinnvoll ist – nur darauf, dass sie gemacht wird. Die meisten Jobs existieren nicht, weil sie gebraucht werden, sondern weil das System Beschäftigung erzeugt, um sich selbst zu erhalten. Wir arbeiten, weil wir Geld brauchen. Wir brauchen Geld, weil ohne Geld nichts funktioniert. Ein endloser Kreislauf.
Der Anthropologe David Graeber hat den Begriff „Bullshit Jobs“ geprägt – Berufe, die keinen echten gesellschaftlichen Mehrwert liefern, aber bezahlt werden, weil das System Beschäftigung als Selbstzweck braucht.
• Der PR-Manager, der Strategien entwirft, um Unternehmen sympathischer wirken zu lassen, die von Grund auf unsympathisch sind.
• Die Customer-Support-Mitarbeiterin, die nur existiert, weil ein Unternehmen seine Prozesse so undurchsichtig gestaltet, dass Kund:innen gezwungen sind, ständig nachzufragen.
• Der Berater, der Firmen erklärt, wie sie effizienter werden – nur damit in fünf Jahren ein neuer Berater das Gegenteil empfiehlt.
• Die Content-Creatorin, die fünf verschiedene Versionen desselben Videos schneiden muss, weil jede Plattform eine andere will.
Und weil das System uns so tief eingetrichtert hat, dass unser Wert von unserer Produktivität abhängt, tun wir es mit einem Lächeln. • „Ich liebe meinen Job!“ • „Ich bin so busy!“ • „Heute wieder richtig was geschafft!“
Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist die einzige Arbeit, die für das System wirklich notwendig ist, die Arbeit, die es selbst produziert.
Deshalb haben wir alle so bescheuerte Jobs.
Aber hey – morgen ist wieder Montag.
Mein Take zur Frage:
Ich sitze mit meinem süßen Nachbarn mal wieder vor einem Späti. Er erzählt mir von dem Möbelstück, das er als Nächstes bauen will. Er ist Schreiner. Die Überlegungen sind durchdacht, die Konstruktion einzigartig. Holz, Struktur, Form und Details. Er hat gezeichnet und geplant, ein Modell erstellt und wird irgendwann dieses fertige Möbelstück vor sich stehen haben. Er hat sich Fähigkeiten erarbeitet, die es ihm ermöglichen, etwas zu schaffen, was komplett seiner Kreation entsprungen ist und gleichzeitig für die Ewigkeit halten wird. Oder zumindest sehr lange, denn selbstgeschreinerte Möbelstücke können bei richtiger Pflege über Generationen weitergegeben werden.
Sein Beruf gehörte früher zu den hochangesehenen Handwerksberufen. Heute ist es ein Nischenberuf, mit einem Nischenklientel. Einem Klientel, das mehr zahlen kann. Die durchschnittliche Einrichtung einer Wohnung oder eines Hauses besteht aus Bauhausmöbeln mit Billigholz, das kaum mehr als ein paar Jahre überstehen wird. Viel eher landet es nach kurzer Zeit auf dem Sperrmüll, ein eleganteres Regal kommt an seine Stelle. Das Material und die Verarbeitung nur minimal hochwertiger, aber immerhin sah der Laden teurer aus als das schwedische Möbelhaus.
Die Möglichkeit der Billigproduktion und unser verändertes Konsumverhalten haben dazu geführt, dass eine ganze Berufsgruppe, die jahrhundertelang essenziell und wichtig für unsere Gesellschaft war, zum Luxusprodukt wird. Früher waren die Leute nicht reicher, aber sie hatten keine Billigholzmöbel, sondern richtige Holzschränke. Möbel, die du auch deinen Nachfahren weitergeben konntest.
Stattdessen holzen wir heute in Unmengen Wälder ab, um am Laufmeter neue Spahnpaletten-Möbel zu verkaufen, die wir dann auch noch gleich selbst zusammenbauen dürfen und die in spätestens fünf Jahren ihre ersten irreparablen Schäden aufweisen. Toll. Und wer hat gewonnen? Niemand, außer den Reichsten der Reichen, die sich weiterhin maßgeschreinerte Holzmöbelstücke und designte Häuser leisten können.
Wenn wir uns also fragen, warum wir alle so bescheuerte Jobs haben, dann liegt das daran, dass ein einzelner Schreiner nie genug Geld machen kann, um andere Leute mit seiner Arbeit reich zu machen. Ein Schreiner kann vielleicht für eine andere Schreinerin arbeiten, aber prinzipiell braucht es keinen Konzern, um das Schreinereigeschäft am Leben zu halten. Ein Schreiner vereint Konzept und Umsetzung – und so kostet das Möbelstück natürlich mehr, als wenn es aus Billigholz von einem Megakonzern mit unterbezahlten Arbeitskräften produziert wird.
Gleichzeitig stehen Holzmöbelstücke in Brockenstuben, während wir Berufen nachgehen, die erfunden klingen. Quality Supervisor oder LinkedIn & Personal Branding Consultant sind nur zwei Beispiele, die es eigentlich nicht braucht. Auch unzählige Verwaltungs-, Datenanalysen- und Bürojobs existieren nur, weil sie das System halten. Berufe, in denen die Sinnfrage auch nach 20 Jahren nicht beantwortet ist.
Denn außer auf Bildschirme zu starren, an Meetings teilzunehmen und Projekte abzuschließen, gibt es wenig Erfolgsmomente. Erfolg wird an Lohnüberweisungen und der Stimmung vor Ort gemessen, nicht an einem Produkt, das existiert, weil jemand echte Fähigkeiten eingesetzt hat.
Mein süßer Nachbar dagegen hat ein Möbelstück – und hoffentlich baut er noch viele mehr. Denn seine Arbeit ist körperlich und gleichzeitig verlangt sie Präzision und Kreativität. Er schafft Nachhaltigkeit. Für sich und für die Umwelt. Und er weiß, was er geleistet hat. Der Gegenwert ist erkennbar. Unabhängig davon, ob er am Ende Geld für das Möbelstück erhält oder nicht.
Wahrscheinlich werden wir nicht so schnell aus diesem System ausbrechen können. Aber versuchen müssen wir es trotzdem, denn die Sinnkrise holt uns längst ein. Wenn wir irgendwann alle wie Zombies in unsere Konzernberufe gehen und unser Dasein darauf reduziert ist, zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um Dinge zu kaufen, für die wir arbeiten – was passiert, wenn wir aufhören? Würde jemand unsere Arbeit vermissen? Würden wir sie selbst vermissen?
Wenn die Antwort ein trauriges Schulterzucken ist, weil wir gar nicht mehr wissen, warum wir diesen Beruf gewählt haben, weil das Wort nichts mehr mit Berufung, sondern nur noch mit Verpflichtung zu tun hat – dann sollten wir uns fragen, ob Billigmöbel wirklich besser sind und warum ein Immobilienmakler gesellschaftlich angesehener ist als ein Schreiner.
Aber es gibt Alternativen. Möglichkeiten, wieder mehr Sinnhaftigkeit in unseren Berufen zu suchen.
Wenn wir aufhören, uns auf die bestbezahlten, bescheuertsten Konzernstellen zu bewerben, und uns stattdessen für Berufe entscheiden, die nachhaltiger, sozialer und erfüllender sind, wird das Gefühl, etwas erreicht zu haben, am Ende eines jeden Tages – und besonders am Ende unseres Lebens – höher sein.
Und auch wenn Status, Geld und Sicherheit aktuell noch überwiegen, so würden wir das viele Geld gar nicht mehr brauchen, weil wir uns nicht alle paar Monate einen teuren Urlaub leisten müssten, um mal runterzukommen. Wir müssten nicht ständig die teuersten Produkte kaufen, denn wir hätten sie selbst hergestellt oder nachhaltig erworben.
Das System zerstört sinnvolle Berufe bewusst. Berufe, die Zufriedenheit und Unabhängigkeit geschaffen haben. Die Schuhmacherin, die Schuhe herstellt, die auch nach Jahren und mit guter Pflege noch getragen werden können, lebt finanziell unabhängiger als die Telefonhotline-Betreuerin eines Schuhkonzerns, der seine Schuhsohlen von Kinderhänden zusammenleimen lässt.
Denn Unzufriedenheit löst die Suche nach Dopamin aus. Und Dopamin lässt sich in fast allem kapitalistisch verwerten. Zufriedenheit würde weniger Abhängigkeit und weniger Konsumbereitschaft bedeuten.
Unabhängigkeit und Freiheit sind keine Wörter, die der Kapitalismus jemals ernst gemeint hat. Sie tauchen höchstens mal in einer Werbung auf, wenn man auch FDP-Wähler mit ins Boot holen will.
Aber zumindest in Teilen ist es möglich.
Klar, leisten können es sich nicht alle. Aber erste Schritte und Entscheidungen sind in der westlichen Welt für fast alle, die nicht von direkter Armut betroffen sind, möglich. Dazu gehört die Berufswahl. Durch das Wegfallen der Boomer-Generation werden in fast allen Bereichen Menschen nachgefragt. Wir können uns gegen sinnbefreite Konzernberufe entscheiden.
Während es lange so aussah, als wären wir vom System abhängig, ist zumindest in den meisten westlichen Ländern bald das System abhängig davon, dass wir weiterspielen.
Unsere Eltern haben uns vorgelebt, wie Büroberufe und Vollzeit-Stellen in Unternehmen zu Burnout und Unzufriedenheit führen.
Vielleicht sollten wir aufhören, uns daran zu messen, wie unaussprechbar unsere Jobbezeichnungen klingen oder wie menschenverachtend der Milliardenkonzern ist, für den wir arbeiten. Stattdessen sollten wir uns an der Zufriedenheit und dem gesellschaftlichen Beitrag messen, den wir wirklich leisten.
Rutger Bregman schreibt in seinem Buch "Moralische Ambitionen", dass wir uns als Gesellschaft und Einzelpersonen immer wieder neue Ziele setzen müssen. Nicht nur Leistung erbringen, sondern Leistung, die wirklich etwas verbessert. Leistung, die einen Beitrag leistet. Und ich glaube, das ist der Punkt. Auch wenn wir arbeiten und hustlen, könnten wir wenigstens mit moralischen Ambitionen an die Sache herangehen.
Das heißt nicht, dass Arbeit immer moralisch perfekt sein muss. Aber wenn mehr kluge Köpfe sich für Projekte, Jobs und Innovationen einsetzen, die wirklich die Welt bereichern, statt für Konzerne, Anwälte und Steuerhinterziehung, dann kann sich etwas bewegen.
Systeme bestehen nur, weil wir sie füttern.
Reflexionsfragen
Was ist der tatsächliche Wert meiner Arbeit? Könnte ich mein Wissen und meine Fähigkeiten auch für etwas einsetzen, das für mich persönlich sinnvoller ist?
Wie würde ich arbeiten, wenn Geld kein Faktor wäre?
Gibt es Berufe oder Tätigkeiten, die ich für wichtiger halte als meinen eigenen Job? Und was hindert mich daran, in diese Richtung zu gehen?
Über die fehlende Radikalität & Legitimation
Während der Zeit, in der ich diese Texte schreibe, frage ich mich immer wieder, ob es meine Perspektive braucht, meine Gedanken – und ob ich diese selbst veröffentlichen kann. Denn mein bisheriges Leben lang habe ich gelernt, dass es für gewisse Bereiche des Lebens Legitimation braucht.
In der Schulzeit waren es die Lehrpersonen, die entschieden haben, ob meine Gedanken stimmten, meine Texte lesbar und meine Präsentationen spannend waren. Sie bestimmten auch, wann wir sprechen durften und wann nicht.
Mit meinen ersten Texten für Zeitungen und Magazine habe ich gelernt, dass es immer eine Instanz über mir gibt, die letztendlich darüber entscheidet, wie viel Platz meine Texte bekommen, in welchem Rahmen sie gedruckt werden und was der Fokus meiner Gedanken sein soll. Je länger ich für gewisse Medien gearbeitet habe, desto mehr Legitimität habe ich erfahren. Meine Ideen wurden schneller durchgewunken, meine Texte unkommentiert abgenommen. Aber immer wieder auch diese Momente, wenn ich für neue Medienhäuser geschrieben habe und meine Texte mit langen Kommentaren zurückgeschickt wurden. Ideen wurden abgelehnt, weil sie angeblich nicht relevant genug waren – Momente, die die Frage nach meiner Legitimation wieder zurück in meinen Kopf gebracht haben.
Gleichzeitig poste ich, seit ich zwölf bin, ungefiltert und nach Lust und Laune im Internet. Schreibe Texte, poste Videos und Gedanken. Nehme mir die Legitimität von der Tatsache, dass andere ja noch viel mehr posten und viel mehr Belanglosigkeit. Aber sobald ich eine Phase habe, in der ich den Wert oder die Tiefe in meinem Content nicht mehr erkenne, verliere ich das Selbstbewusstsein und ziehe mich zurück.
Gleichzeitig orientiere ich mich an Zahlen. Likes und Aufrufzahlen. Neue Follower und monatliche Impressionen. In gewissen Monaten habe ich mit meinen Inhalten mehr als eine Million verschiedene Menschen erreicht. Legitimation habe ich trotzdem keine gespürt. Ich warte innerlich immer noch auf diese Stimme von oben, die mir sagt: Du darfst und du kannst. Du machst tolle Arbeit. Aber wer soll diese Person sein? Und weshalb sollte sie die Legitimation haben, mir Legitimität zu verleihen?
Der Verlagschef oder der Konzern, der mich für eine Werbekampagne bucht? Oder die Kulturwelt, die mich mit einem Preis oder einer Einladung zu einer wichtigen Veranstaltung ehrt? Wo beginnt die Legitimation? Selbst meine Auftritte in Fernsehsendungen wie ZDF Aspekte oder dem Schweizer Fernsehen haben in mir nicht das Gefühl der Legitimation ausgelöst, sondern sich eher wie eine Prüfung angefühlt, ob ich auch für ein älteres, linear konsumierendes Publikum ansprechend genug bin.
Der Spiegel interviewt mich als Experten für digitale Buchvermittlung und ich starre wieder nur auf die Zahlen und Likes meiner letzten drei Videos.
Gerade, wenn es um politische Gedanken und Ideen geht, fühlt sich Legitimation noch wichtiger an. Wir brauchen ein Studium, Fachwissen, praktische Erfahrung, um als politische Menschen ernst genommen zu werden. Dabei leben wir in einer Demokratie. Wo jede Stimme gleich viel wert sein sollte, und jede Stimme gehört werden sollte. Das Internet bietet uns dafür eine Möglichkeit.
Mit achtzehn bin ich einer Jungpartei in der Schweiz beigetreten, die sich als besonders links, antifaschistisch und antikapitalistisch definiert. Wohlgefühlt habe ich mich dort nie. Bin ich radikal genug? Lebe ich radikal genug, um linke Politik zu machen? Diese Fragen habe ich mir nicht nur selbst gestellt – auch von leitenden Stimmen in der Partei gab es immer wieder Kommentare, die mich spüren ließen, nicht genug zu sein. Nicht genug engagiert, nicht radikal denkend genug und vor allem nicht radikal handelnd genug.
Ich habe damals viel über Sexualität und Identität gepostet, Aufklärungsarbeit geleistet und mich dafür auch immer wieder von Unternehmen bezahlen lassen. Für die Jungpartei war das nicht links, nicht politisch genug. Gleichzeitig wurde diskutiert, mich mehr in politische Aktivitäten einzubinden oder mich für ein Amt kandidieren zu lassen, weil ich Reichweite mitbringe. Ich würde ja nicht gewählt werden, aber immerhin Aufmerksamkeit bringen. Ein Josia für linke Wahlwerbung.
Meine politischen Gedanken habe ich außerhalb dieser Parteistrukturen geformt, mich aktiv gegen Einladungen zu Events entschieden und nach knapp zwei Jahren die Partei wieder verlassen. Weil ich mich nicht radikal, nicht links genug gefühlt habe. Selbst zu sehr ein Kapitalist, zu sehr Komplize der Unternehmen.
Was für eine Überraschung.
Wie radikal wir sein können, hängt von finanzieller Freiheit und äußeren Umständen ab. Ich arbeite an eigenen Projekten, finanziere mich zu neunzig Prozent selbst. Ich kaufe nicht immer nachhaltig ein, steige in Flugzeuge, chille im Soho House Berlin oder in schicken





























