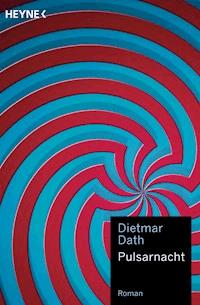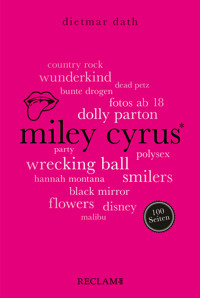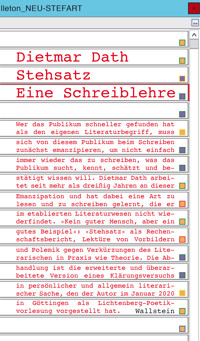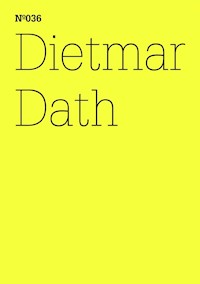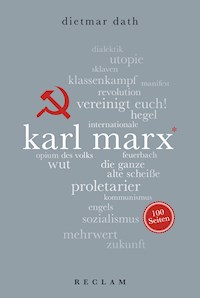16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrhunderten gibt es keine Kunst mehr. Sie gilt als überwunden – durch Techniken des Möglichen, von denen die Menschen nichts wussten, als sie noch auf der Erde lebten. Jetzt haben sie viele Welten besiedelt, viele intelligente Wesen kennengelernt. Auf Feldeváye aber, einem abgelegenen Planeten, kehrt die Kunst zurück – als Geschenk einer fremden Spezies. Ein junges Mädchen, Kathrin Ristau, stellt große Fragen: Was war Kunst, warum kommt sie wieder, was geschieht mit uns, wenn wir sie neu entdecken? Der Roman erzählt die Geschichte einer Frau, die auf die Fragen der Kunst bis ins hohe Alter persönliche und politische Antworten finden muss, weil nichts, das sie betrifft, von der großen Liebe über den Weg zum Ruhm bis hin zu den Schrecken von Krieg und Bürgerkrieg, sich den lebensentscheidenden Fragen nach der Kunst entziehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1072
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Seit Jahrhunderten gibt es keine Kunst mehr.
Sie gilt als überwunden – durch Techniken des Möglichen, von denen die Menschen nichts wussten, als sie noch auf der Erde lebten. Jetzt haben sie viele Welten besiedelt, viele intelligente Wesen kennengelernt.
Auf Feldeváye aber, einem abgelegenen Planeten, kehrt die Kunst zurück – als Geschenk einer fremden Spezies. Ein junges Mädchen, Kathrin Ristau, stellt große Fragen: Was war Kunst, warum kommt sie wieder, was geschieht mit uns, wenn wir sie neu entdecken?
Der Roman erzählt die Geschichte einer Frau, die auf die Fragen nach der Kunst bis ins hohe Alter persönliche und politische Antworten finden muss, weil nichts, das sie betrifft – von der großen Liebe über den Weg zum Ruhm bis hin zu den Schrecken von Krieg und Bürgerkrieg –, sich den lebensentscheidenden Fragen nach der Kunst entziehen kann.
Dietmar Dath, geboren 1970, studierte nach dem Abitur Physik und Literaturwissenschaften. Nach dem Studium arbeitete er als Übersetzer und Chefredakteur der Zeitschrift Spex, bevor er Kulturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde. Für seine Romane wurde Dietmar Dath mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kurd-Laßwitz-Preis, und stand mit seinem Roman Die Abschaffung der Arten auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis.
Dietmar Dath
FELDEVÁYE
Roman der Letzten Künste
Suhrkamp
Die Vignette auf Seite 5 wurde von Oliver Scheibler gestaltet.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4510.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlag: Büro Mario Lombardo, Berlin
eISBN 978-3-518-73718-7
www.suhrkamp.de
INHALT
I.
Ursprung
1:
Reise zu den Letzten Künsten
2:
Lasse Ristaus einzige Tochter
Liber Severini 1
II.
Auslöserinnen
1:
Verspätete Sitzung
2:
Kurze Jugend
Liber Severini 2
III.
Der Schmerz ist in der Hand, nicht im Handschuh
1:
Krankengeschichte
2:
Aus Tiefen
Liber Severini 3
IV.
Niemandsland besiedelt man am schnellsten
1:
Auf dem Puppendach
2:
Die Insel zerbricht
3:
Transfiguration
4:
In Haft
5:
Eine Prodniklaufbahn
6:
Cerrem zittert
Liber Severini 4
V.
Wie übersetzt man, was keine Sprache ist?
1:
Urwaldweben
2:
Eine Verabredung
Liber Severini 5
VI.
Unsere Flügel
1:
Die Lehrerin Waveele
2:
Auf dem Blätterteller
3:
Auftrag und Visite
4:
Der schnelle Mensch
Liber Severini 6
VII.
Riesendisteln
1:
Diplomatie
2:
Nomos und Liebe
3:
Alle Mayas, allerwege
Liber Severini 7
VIII.
Biest am Grund des Gartens
1:
Ein Lapith für Fajid Toril
2:
Fin de Partie
3:
Andere Arbeit, andere Liebe
4:
Weicher Staatsstreich
5:
Niederlage
6:
Wiedersehen
Liber Severini 8
IX.
Siegel im Fluß
1:
Rotes Haus am Wasser
2:
Gut wirtschaften, sich nicht erwischen lassen
3:
Brechung in der Linse
Liber Severini 9
X.
Mantel Flamme Samt
1:
Grenzwärts fliehen
2:
Was es nicht gibt
3:
Die Undankbarkeit des Gemeinwesens
4:
Kleine Bekehrung
5:
Envoi
6:
A commodius vicus of recirculation
7:
Fokussierung
8:
Überfall der Bilder auf die Bilder
9:
Öffnen
Liber Severini 10
XI.
Im Novum
1:
Entrückung aushalten
2:
Menneskerstufe
Dank
FELDEVÁYE
Für uns, weil wir wissen: So war es.
I. URSPRUNG
ach! wissenschaft ist pubertät. die kunst
ist das erwachsensein. begriffe sagen
nichts ohne sie: das höchste ist die welt
sehr lebbar machen. sie ist in uns drin.
Ronald M. Schernikau
1: Reise zu den Letzten Künsten
Feldeváye hatte sich als Zufallsziel ergeben.
Einig waren sich Klemens und Severin gewesen, dass man tief in die Himmel würde fliehen müssen, wenn man zusammen ein besseres Leben aufbauen wollte.
»Du und ich«, sagte Klemens nach einem kräftigen Zug an der gesunden Kräuterzigarette, »wir müssen es auf der Welt aushalten können. Sonst halten wir’s auch nicht miteinander aus. Wenn ich unzufrieden bin, kannst du mir nie das ersetzen, was ich von mir selber verlange, aber nicht hinkriege. Wenn der Ort, an dem ich arbeite, zu eng ist und zu dumm – machst du ihn mir schöner? Kannst du nicht. Musst du gar nicht wollen. Verschwendung. Du sollst ja du sein, nicht ich.«
Sie hatten einander auf dem Schattenspiegel kennengelernt.
Severin Rukeyser, Mitte dreißig, großgewachsen und schlank, mit weiblich schmalen Händen, männlich breiten Schultern, rothaarig – selbst auf den Armen wuchsen dichte kupferne Härchen, Klemens nannte den Freund bald »Fuchs« –, hatte im selben kleinen, exklusiven Produl gearbeitet wie der über zehn Jahre Jüngere; allerdings in einem anderen Zweig: Severin war als Spatiokomponist jung zu Ehren und Klientel gelangt, in einer nichtklinischen, nachbiotischen Tätigkeit also, immer dicht am Nomos; Klemens Erikson entwarf und verbesserte lehrreiche, ungefährliche Krankheiten.
Severin konnte sich bei der Arbeit kleiden, wie er wollte. Klemens wiederum lief selbst während der Freizeit oft im traditionellen weißen Kittel seines Berufszweigs herum.
»Aber die Kluft ist«, fand Severin, »bereits der ganze Unterschied zwischen uns.«
In Wirklichkeit gab es zahlreiche weitere Unterschiede. Denen verdankten die beiden, dass sie lange neugierig aufeinander blieben.
»Unter uns«, sagte der Fuchs ganz richtig, »gibt es viele Sterne, die wir nicht sehen, über uns nur einen. Die Richtung der Schwere ist anders als in der Natur, das Unnatürliche liegt uns.«
Von der Liebe abgesehen, lebte Severin asketisch, rauchte nur das Gesündeste, besorgte sich selten modische Leiden, benutzte sie noch seltener und trieb, wenn es ihn nach körperlicher Belastung verlangte, lieber Sport – er war ein geschickter Tennisspieler, ausdauernder Läufer, hochbegabter Surfer und kletterte auf alles, was nicht abgesperrt oder auf andere Art unzugänglich war. An Modisches glaubte er nicht, am wenigsten an die Tafeln: »Das sind doch, wie sagte man früher? Nur Fotos. In zweihundert Jahren wird man sich schämen für uns, dass wir diesen Blödsinn mitgemacht haben. Dass Leute glauben konnten, die Menschenseele ließe sich derart leicht einfangen, kopieren, wiedergeben.«
Severin las lieber, als sich in Tafeln kratzen zu lassen. Er hörte. Er schaute sich Videos an.
Lektüre, nicht Osmose, war sein Prinzip.
Die Privaträume des Fuchses, über die ganze Küstenstadt Chantierville verteilt, stets in den steilsten Gebäuden, waren voll mit Blattwerk, Ästen, Zweigen, Rindewällen. Er lebte im bäumlichen, waldigen Stil und hielt dort Reptilien, bevorzugt Schlangen.
Klemens Erikson war sinnlicher veranlagt, er liebte gutes Essen und hielt sein Gewicht mit induzierten Fieberdiäten unter Kontrolle (»Du bist«, spottete Severin, »wie alle Designer künstlicher Malaisen längst abhängig von deinem Zeug«).
Obwohl kein nachlässiger Bauchansatz störte, sah Klemens gemütlich aus, mit schlecht rasierten Bäckchen, wie ein aufgeweckter Hamster, und ungekämmtem braunem Haar. Er war von kräftiger, nie jedoch übergewichtiger Statur. Wer ihn nur oberflächlich ansah, hielt ihn vielleicht für etwas weich. Die klaren, kühlen, regsamen blauen Augen aber verrieten einen flinken Verstand.
»Diese Augen«, gab Severin zu, »das war’s für mich. Da wusste ich’s.«
Seine eigenen, braun, warm, tief, blickten melancholisch – es lag eine Schwermut darin, die er mit seiner rastlosen Selbstverbesserung, der steten körperlichen Bewegung und dem Verzicht auf alle gängigen Laster bekämpfte. Einzig bei der Liebe nahm der Fuchs sich in keinerlei Zucht.
Klemens dagegen wollte grundsätzlich nichts an sich bekämpfen: Er war seiner Sache meist sicher, beruflich wie persönlich. Das machte ihn stark und erlaubte dem Älteren, sich bei ihm Kraft zu holen, wenn der Alltag ihn bremste, niederdrückte, schwächte.
Severin liebte den Sprung von der höchsten Klippe ins wildeste Wasser.
Klemens mochte milden Tee aus blauen Blättern.
Severin ließ sich von Automaten an Kriege erinnern, die kein Lebender hatte ertragen müssen. Er rannte in Synesschlachten herum, rang dort mit Feinden, schoss und prügelte.
Klemens dagegen verlor sich, war er allein, in Bildern davon, wie es auf der Erde ausgesehen hatte, vor der Hidschra.
Severin liebte die tiefe Nacht, weil da die Lichter in Chantierville und den ganzen Küstenstreifen entlang aufflammten: Blinzelnde Zivilisation, elektrisches Wimmeln.
Klemens schätzte den frühen Abend, weil man dann Atem holte, Meer roch.
In vielem waren sie sich freilich einig: Beide mochten Wolken. Beide suchten Herausforderungen. Beide fanden Vorgesetzte lästig, die ihre Untergebenen mit albernen Befehlen bombardierten, nur um sich zu versichern, dass sie welche hatten.
Beiden gefielen die meterhohen Licht- und Schattenspiele an den Fassaden der Dünenwohnblocks. Beide fuhren mit Strandbuggys zwischen den brennenden Öltonnen Rennen, Severin als Reflextest, Klemens als Party. Beiden schmeckte Lakritz, beide waren kitzlig, mutig, gedächtnisstark, unruhige Schläfer, anfällig für Sonnenbrand.
Die Wahrheit über das, was sie von dem Ort forttreiben wollte, an dem sie einander begegnet waren, wurde ihnen erst klar, als sie einander schon ein Weilchen kannten: Severin hasste sein Los, seine Arbeitsbedingungen, die ganze Stadt Chantierville an der langen Küste, die doch als Urlaubsort der Allerglücklichsten weit übers lokale System hinaus den besten Ruf genoss. Er mochte Klemens vor allem deshalb, weil der diesen Hass als einer der wenigen im Produl verstand, sogar ein bisschen teilte, wenn schon nicht mit demselben Ingrimm pflegte.
»Nein. Schluss. Grauenhaft. Hier kann man nicht arbeiten. Hier kann man nicht atmen. Hier kann man sich nicht ausruhen«, war schließlich Severins Ansicht über den Schattenspiegel geworden. Klemens hatte zugestimmt: »Ist so. Es reicht. Obwohl sie uns gut behandeln und obwohl andere, die nichts können, weder Pragma- noch Nomotech, also weniger gebraucht und schlechter behandelt werden als wir, bestimmt viel bessere Gründe haben, sich zu beklagen, reicht es mir zuzuschauen, wie Menschen, und nicht nur die, hier jeden Tag belogen, ausgenutzt und verkauft werden.«
Das war bildlich gesprochen: Verkauft wurde hier niemand.
Geld, wie bei den Primitiven, in den verkommenen, von Sozialpathologien verschmutzten uralten Wiegen und Senken der galaktischen Zivilisation, etwa der Erde, der japetischen Gruppe oder auf den Luytenplaneten, vor allem im Orion- und im Carina-Sagittarius-Arm, gab es in der örtlichen Leuchtfeuerzone zwar noch. Aber über dieses primitive Medium wurde seit Jahrhunderten nur noch das arbeitsaufwendigste Sechstel der Ressourcenallokation geregelt, und in unaufgeräumten Ecken gab es einige wenige Spiele, die davon handelten.
Von »Verkaufen« im Zusammenhang mit dem zu reden, was in zeitgenössischen Produln geschah, hieß deshalb einfach, den Prodisten in Chantiervielle vorzuwerfen, sie würden ihre Leute nicht nach Verdiensten bevorzugen und benachteiligen, sondern nach anderen Kriterien. Gemeint war, es gäbe ungleichen Tausch und mithin Idiotinnen oder Mieslinge, die ihren kurzfristigen Vorteil suchten statt richtiger Lösungen für die Schwierigkeiten, die sie sich machten oder die man ihnen anvertraute.
Severin und Klemens hatten einige solcher Fälle erlebt. Nötigung, Gefälligkeiten, Resultatfälschung auf Gegenseitigkeit, sogar Beziehungsmissbrauch und sexuelle Abhängigkeiten waren vorgekommen, in langsamen Produln und verstaubten Admingruppen, hellen Wohntrakten und prachtvollen Festterrassen an der Küste. Severin und Klemens verabscheuten das alles, ohne sich darauf erst verständigen zu müssen. Sie weigerten sich, vielleicht ein bisschen zu skrupulös, noch zwei Jahre nach dem Kennenlernen, ihr Beisammensein explizit übers Erotische zu bestimmen – wer sie ein »Paar« oder, noch schlimmer, ein »Pärchen« nannte, wurde bald zu nichts mehr eingeladen, das sie zusammen unternahmen. Gewiss, sie hielten einander beim Strandspaziergang, Arm um die Hüfte. Sie schliefen im selben Bett. Sie sprachen im Atem des andern. Sie teilten alle Fächer in der Noos von Chantierville. Sie tauschten Coiflets ohne Kennungen. Sie liebten einander.
Aber »ich will nicht in deinen Hosen wohnen, Fuchs« – das war, wenn Klemens es sagte, kein bloßer Witz, und Severin war froh darüber.
Als sie einander schließlich Zugangscodesiegel zu ihren Wohnräumen schenkten, blieben diese Räume dennoch unter ihren Einzelnamen gemeldet. Gemeinsame Siegel lehnten sie ab, nicht wegen der Gemeinsamkeit, sondern »weil’s amtlich ist und nach der Erlaubnis des Integralleiters stinkt«, wie Severin höhnte.
Viele Bekannte verstanden so etwas nicht. Auch das war ein Grund, weshalb der Fuchs sich immer weniger wohl fühlte – im Produl, in der Stadt, auf dem Spiegel, im System.
»Manchmal habe ich nicht mal mehr Spaß an den Palmen, am weißen Sand, an den hellen Häusern, am Glas und Metall in der starken Sonne, an den Spiegelreflexen. Manchmal ist mir so schlecht, dass mir die dürrste Wüste und der eisigste Mond angenehmer wären.«
»Gut, hauen wir ab.«
»Und wohin?«
»Ich weiß es nicht. Milchstraßenauswärts? Oder quer übern Molekülring und den zentralen Balken weg. In die später besiedelten Spiralarme. Nordwesten. Jüngere Welten. Heißere Krusten. Zu deinen Wüsten und Eismonden. Hauptsache, weniger Leute.«
»Also Uneca. Oder Nitirak.«
»Senés ginge auch. Und La Sentinelle.«
»Oder gleich Feldeváye.«
»Ja. Du sagst es, Fuchs. Feldeváye.«
»Feldeváye.«
Ein Wort mit hellen Vokalen, aber Severin sprach es aus, als wäre es aus Sirup, goldenem Blut von Bäumen, die schwer duftende Rinde hatten. Natur, nicht die Pragmabiotik, die in seinen Wohnwänden steckte.
Feldeváye: ein Fluchtname und Auswegweiser.
Feldeváye: große Wüsten, freie Täler, reiche Nordnadelwälder, hoher Schnee, üppige südliche Dschungel voller Wasserfälle und Flüsse mit bewohnten Sandbänken, heitere Archipelgruppen in den gemäßigten Meeren, vier schöne Monde.
Die Sümpfe um die Brombeergegend, das alte Gras Spinifex, die Salzbüsche in der Steppe. Der Thomasgürtel im Eisregen.
Feldeváye: Lebewesen, die sich in Öl malen oder in Marmor hauen ließen, als wäre das noch üblich. Man hatte von pelzigen Fischen gehört, darunter Walen mit metallisch-rotem Fell, von Raubtieren, die aufrecht gingen und denen Feuer aus Kiemen sprühte, von den Sencassa mit Obsidianaugen, den Midrai mit Netzflügeln, von kleinsten Kreaturen auch, die Klemens besonders interessierten: »Es soll Plasmidenkolonien geben dort, die darauf programmiert sind«, verriet er Severin das Ergebnis erster Recherchen, »ihren Trägerinnen und Trägern Zugang zu sensorischen Erfahrungen unserer frühesten Vorfahren zu öffnen. Ganz andere taktile Sinne, eine Art erleuchteter Raumexistenz, die nicht mal du mit deinen Kompositionen suggerieren kannst. Und Rechnergärten auf den drei normalen Monden, groß wie Chantierville. Vom vierten ganz abgesehen: Arrhenius, dem Rätselball.«
»Träum weiter«, lachte Severin.
»Muss ich nicht, wir fahren ja hin«, erwiderte Klemens.
»Ganz anders als hier ist es da auch nicht. Die Storema ist dort, und es gibt Rengi. Dann noch die Lapithen …«
»Lapithen gibt’s hier aber keine. Nur Gerüchte. Alle paar Jahrzehnte heißt es, dass jemand einen gesehen hat, am Innenäquator: New Lazarus, Clutien, Dirgha. Auf Feldeváye und Arrhenius aber, da sind sie fleißig.«
»Wie auf den anderen vierzig Welten, und den hundertzwanzig danach. Aber wenn du deswegen hinwillst …«
»Bunte Mischung! Menschen, Storema, Lapithen …«
»Ein Paradies ist das nicht. Feldeváye hat eigene Minderheitenprobleme: Diese Lacs …«
»Na was, ungleichzeitige Entwicklung eben. Solche Lasten findest du überall, wo die Hidschra ihre erste Welle hingeschickt hat. Die dann halt oft zu spät angekommen ist. Klar, auch Feldeváye hat Admins und Prodisten, im ewigen Gezänk, weil der lange Arm des Integralleiters …«
»Sag’ ich doch. Wie überall.«
»Hör’ mal, das ist doch Blödsinn. Wie überall? Eine Gegend mit mehr Charakter wirst du nirgends finden. Sie haben einen Mond, der eine Sonne ist. Sie haben …«
»Schon gut. Ich will ja hin.«
Feldeváye: Jedes Klima war dort zu finden, vom Backofenzittern bodennaher Lüfte in den Wüstenstrichen bis zu Gewittern in den Zonen, wo die größten der Urbeen standen, zwischen Toveyn und Travers, Ammar und den Atollen. Reguliertes Wetter überwölbte Ellemi, Deyra, Pachetum und Kaderum, Laischa, Barbizek und andere Städte für die Künste, über deren Marmorplattendächern sich morgens kleine Quellwolken bildeten, die rasch ambossartige Gewitterwolken wurden und am Spätnachmittag Blitze schleuderten, Regengüsse freiließen, von Donner bebten. Die Omphaloi dieser Städte waren Dreh- und Angelpunkte in komplizierten Systemen von Warm- und Kaltfronten, wie es sie auf klimakontrollierten Welten, also auch auf dem Schattenspiegel, seit ewigen Zeiten nicht mehr gab.
»Naturbelassen«, wusste Severin, »sind sie auch auf Feldeváye nicht, sondern, wie alles dort, beschützt, geregelt. Vor vier-, fünfhundert Jahren, glaube ich, haben die Menschen und die Mennesker, vermittelt durch die Lapithen, sich auf Konfigurationen geeinigt, die so schön sind wie zweckmäßig. Tiermigration, Waldleben, Wetter – auf Feldeváye Ergebnis von Verträgen. Ein gänzlich zivilisiertes, völlig gerechtes Gestirn.«
Feldeváye: Wo man, wie die einschlägigen Synesszenarien wussten, das Buch las und ganze Regionen und Kulturen diesem Text gehorchten, von dem man milchstraßeneinwärts nur wusste, dass er Antworten enthielt. Einem Text gehorchen, wie tat man das? Waren ihre Coiflets sowas wie Steuerungscode für Roboter? Hieß »Text« nicht immer auch »Auslegung«, war das nicht ein Gehorsam im ewigen Aufschub?
Buch, Antworten: Codes für Unsinn aus der Zeit vor der Hidschra, für Skurrilitäten religiöser, politischer, wissenschaftlicher oder philosophischer Art. »Es gibt verschiedene Versionen«, fand der Fuchs heraus, »alle sind verwirrend. Die meisten sagen, das Buch habe ein Mensch geschrieben. Einige behaupten, die allererste, handschriftliche, illuminierte Ausgabe stamme von einem Lapithen und sei dem von den Menneskern diktiert worden. Ich habe eine Synesschleife gefunden, die sagt, es gäbe sogar zwei Bücher – eins mit den Antworten, ein anderes mit den Fragen. Das eine Buch, sagen sie, habe ein Mann geschrieben, das andere eine Frau.«
»Bwähh«, machte Klemens angewidert. »Geschlechterbinaritäten als Kulturgrundlage. Ganz toll. Sitzen die Frauen in der Höhle, gebären und säugen, werden sie von den Männern geschlagen, wenn die von der Jagd heimkommen? Erbt der älteste Sohn die Keule und den Speer? Soll heißen: Wollen wir nicht doch woandershin?«
»Ist doch alles bloß symbolisch«, lachte Severin, »ein Ja-Nein-Schema, ein Schwarzweißbild, mit dem auf die Kämpfe zwischen Admins und Prodisten angespielt wird. Du weißt doch, wie der Synesquatsch funktioniert: Man macht alles Mögliche, die alte Erde, das Innere eines Pulsars oder Feldeváye zum Schauplatz der Konflikte, die es auf allen zivilisierten Welten gibt. Und dass das dann zwei Texte sein sollen statt zwei Ungeheuer oder zwei Götter oder zwei Zahlen oder zwei Städte oder zwei Planeten, bitte, das ist halt Feldeváye. Literatur. Schöne Lügen.«
»Und die Leute dort, die das eine Buch lesen und ihm folgen, die lehnen das andere dann schön ab, und führen Kriege deswegen, Kreuz gegen Stern, Hammer und Sichel gegen Halbmond, Hakenkreuz gegen McDonald’s-M?« Klemens klang leiernd, entnervt.
»Also es heißt, das Buch mit den Fragen werde von denen bevorzugt, die schon die Geste des Antwortens ablehnen. Von denen, die Antworten insgesamt für was Schädliches halten. Da gibt’s wohl einige Hunderttausende. Und das Buch mit den Antworten wird dementsprechend von solchen verehrt, die Fragen lästig finden und … müßig. Wie gesagt, die Fragen, sagen viele Quellen, stammen von einem Mann, die Antworten von einer Frau, oder na ja … umgekehrt. Es gibt aber auch Schleifen, die behaupten, beide Bücher habe ein Mann geschrieben, um die Frauen zu manipulieren, und wieder andere, die sagen, beide seien von einer Frau verfasst worden, um sich entweder über die Männer oder aber sogar über alle Geschlechter lustig zu machen.«
»Alle Geschlechter. Also nicht nur diese beiden da, aus deiner Steinzeit.«
»Nee, alle. Alle, die es gab, gibt und je geben kann. Die Binarität ist ja nicht ewig, wir sind wohl nur wegen der Admin-Prodisten-Geschichte auf den meisten zivilisierten Welten wieder in …«
»Es wäre natürlich interessant, wenn man Auszüge aus dem Buch, oder ähm dem Buch und … dem anderen Buch lesen könnte.«
»Das«, Severin grinste angriffslustig, »ist eben der Witz: Es wird behauptet, man könne beide Bücher nur auf Feldeváye finden. Nur dort lesen also. Und nicht einmal dort ganz verstehen. Irgendetwas Technisches, sehr Raffiniertes, verhindert wohl, dass auch nur Teile des Texts die Schwerkraftmulde des Planeten verlassen. Lässt sich nicht in Coiflets oder CLPs ohne feldeváysche Nooscodierung …«
»Ach komm, was erzählst du? Spukmärchen.«
»Nee, wirklich. Sobald jemand auch nur Exzerpte verschickt, etwa per Radiopuls, erkennen große Filteranlagen, die in Satelliten und auf den vier Monden von Feldeváye untergebracht sein sollen, diese Zitate, und verstümmeln und entstellen sie, unrekonstruierbar. Haben die Lapithen eingerichtet. Ist Vertragsbedingung gewesen, dafür haben sie uns dann jede Menge Ports …«
»Verrückte Wolle.«
»Ja. So verrückt, dass sie stimmen könnte.«
Feldeváye: Heimat Letzter Künste.
Das jedenfalls sagte der Name, der von den vielen, die man dem Planeten gegeben hatte, der gebräuchlichste war. Er stammte aus einem Dialekt der Lacs, die dort gemeinhin zu den Ärmsten der Armen zählten, sich aber für eine Art Ureinwohner hielten, nicht ganz zu Recht, wie Klemens und Severin wussten.
»Feldeir«, das hieß: »Künste in der Neige«.
»Váye«, das hieß: sicherer Ort.
Die beiden Auswanderer ließen sich Zeit mit dem Aufbruch.
So erhielt ihr Traum Gelegenheit, erwachsen zu werden, weltzugewandt, realistisch.
Es kam ein Winter; man hatte höheren Orts beschlossen, am Küstenstrich um Chantierville einmal wieder Schnee zuzulassen. Klemens und Severin vergnügten sich damit. Sie verdampften das weiße Zeug mit Heizringen auf ihren Dächern und berauschten sich am heißen Nebel, oder sie warfen sich am Strand hinein. Schlaflosigkeit, eine gute und lustige, regierte die Winterwochen.
Die üblichen Touristen von den Schattenspiegelpolen kamen nicht mehr, die sonst gekommen waren, weil es hier immer warm gewesen war. Andere aber trafen dafür ein, die wussten, dass bei den Grotten, auf den grauen Hängen nördlich der Stadt, jetzt Eisflächen und Pisten zum Schlittschuhlaufen und Skifahren zu finden waren. Auf den entsprechenden exklusiven Vergnügungen ließ sich auch Severin gern sehen.
Der Fuchs sah, wie bei allen seinen Abenteuern, gut aus, wenn sich hinter oder vor ihm eine transgene Klapperschlange oder ein giftgrüner Hundskopfschlinger blitzschnell durch die frischen Flocken grub und ringelte.
Als der kurze Winter einem makellosen Frühling wich – man ließ sogar neue Vögel mit verwirrenden Liedern frei –, wurde es Zeit, die Reisepläne ernsthafter zu beraten.
»Aber Feldeváye, mach dir das klar, das ist so gut wie nirgends. Willst du da wirklich hin?«
Klemens, der auf seine ebenso umsichtige wie pragmatische Art die lange Reise zwischen den Sternen arrangierte, fragte, bevor er sich daranmachte, eine Insel zu organisieren, lieber noch einmal nach.
»Ja. Will ich. Aus zwei Gründen, bevor du mich damit quälst, ob’s welche gibt: Erstens wird es auf dem Schattenspiegel immer schlimmer. Ist dir aufgefallen, dass es in der koordinierenden Arbeitsgruppe des Produls, zu dem wir … gerechnet werden, jetzt Leute gibt, die nicht einmal die Vornamen von Kolleginnen, mit denen sie seit vier oder fünf Jahren jeden Tag zusammen in den Hallen sitzen, richtig aussprechen können? Und zweitens: Du hast nicht recht. Es ist nicht ›so gut wie‹ nirgends. Feldeváye, das ist wirklich nirgends. Das ist gar kein Ort, eigentlich. Das ist eine Geschichte, für Kinder mit großen Augen, denen man beibringt, ohne Schnittstellen Bilder zu machen, ohne Synes zu träumen, ohne Raumdeuter Musik zu spielen. Feldeváye, das ist noch gar keine Welt. Daraus muss man erst eine machen. Genau das könnten wir tun. Zusammen.«
Das halbe Jahr bis zur Abreise war das schönste im bisherigen Leben beider Männer.
Klemens Eriksons fünfundzwanzigster Geburtstag fiel in diese Zeit. Severin fielen große Geschenke ein: Er baute dem Pragmabiotiker einen Palast aus Herztrommeln, Rasseln und Silberblitzen, in dessen Festsaal sie am Morgen des betreffenden Tages geweckt wurden von verstärktem Meeresrauschen, dann in weite Hallräume entführt, von einem träge sich räkelnden Râga getragen. Feierliche, stolze, liebevolle Klänge – eine Musik, die Klemens hätte für immer bewohnen wollen, gerade weil er wusste, dass sie verschwinden musste.
Kaum dachte er das, umarmte ihn der Freund zum Ausklang, der mächtig um beide aufschäumte, bald freundlich verlangsamt, rallentando, verebbte, dann verschwunden war.
Abends feierten sie auf einem von Severin gemieteten Riesenfloß in der systemweit berühmten gläsern blauen Bucht von Seljana. Rot- und Weißweinspringbrunnen sprudelten, verbunden von kleinen Aquädukten, später war’s Champagner. Auf einer zwanzig Meter langen Tafel voller Fischgerichte, Meeresfrüchte und Vegetarischem leuchteten alle Farben; selbst Severin probierte von den Lachs-Rillettes und Klemens beschloss, als Dank für den Freund ein Virus zu züchten, das die Genüsse dieses Abends als Geschmackserinnerung wachrufen konnte: den gegrillten Hummer an Rosmarin-Knoblauchbutter, die Pfeffersardinen in Sherry-Essig mit glasierten Schalotten, den pochierten Seeteufel in Safransauce.
Severin fütterte damit auch seine Schlangen, die sich um Arme und Hals ringelten wie Modeschmuck, am liebsten mochten die Tiere gebackenes Wurzelgemüse mit Ingwerglasur, das sie annahmen, als wäre es Fleisch von kleinen Nagetieren: »Seht ihr, vegetarisch kann man lernen!«
Tatsächlich vermisste niemand Steaks und frittiertes Geflügel, wo es Chili-Satay-Nudeln, süßsaure Zwiebeln, Kartoffel-Cashew-Samosas oder Spinatsalat mit Nüssen gab.
Dreihundert Gäste waren gekommen, viele aus dem Produl, in dem Severin und Klemens arbeiteten. Niemand machte ein Aufhebens davon, aber es waren fast nur Menschen da – bis auf eine kleine Gruppe von Storariern, die sich am Rand eines Floßes wiegten, als wären sie Pflanzen. Rengi etwa hätten gewiss fehl am Platz gewirkt, wie noch lebende Nahrung aus dem Meer. Musik, von Severin gebaut, wogte und sprühte helle Kräusel in die von Körperwärme erhitzte Nacht, drehte sich langsam, eine Galaxie aus unwiederholbaren Einzelheiten, aus Frechheiten und Küssen.
Nicht einmal Severins neckische Flirts mit einigen der jüngeren Mädchen aus dem Produl, besonders einer plappernd überdrehten, aber atemberaubend hübschen bronzehäutigen Pragmaphysikerin namens Jasika Maelis, konnten Klemens das Fest verderben.
Als fast alle Gäste weg waren – wer blieb, wälzte sich in seligen Müdigkeiten auf den Pfefferminzschaumkissen, zu mehreren oder allein –, sagte Klemens allerdings, gespielt leichthin: »Hast du versucht, eine anzuwerben, dass sie uns begleitet? Als Mutter vielleicht, traditionshalber?«
Er wusste, dass Severin Kinder wollte. Er teilte den Wunsch.
»Diese Ziegen?« Severin blies schnaubend Luft aus den Nüstern, als wütendes Rennpferd, »Auf keinen Fall. Ich suche mir auf Feldeváye eine böse Füchsin, oder was die sonst da haben.«
Mir.
Nicht: uns.
Es war der erste Misston, wie ein Alarmlämpchen, das flackert, bevor es pulst, und pulst, bevor es grell leuchtet, und dann grell leuchtet, bevor es durchbrennt.
Keine Kurzschlüsse, ermahnte sich Klemens. Das half: Er war, wie stets, die Ruhe selbst.
Man musste jetzt rasch eine Insel beschaffen.
Severin, erfolgsverwöhnt und sorgenfrei, hielt diese Aufgabe zunächst für eine rein technische.
So wandte er sich an Jasika Maelis, lud sie zum gemeinsamen Essen ein, »um ihr ein paar Auskünfte zu entlocken«, und ignorierte die leise Verstimmung bei Klemens, der sie hinter einem wegwerfenden Witzchen versteckte: »Von mir aus. Solang ich nicht auch noch was mit ihr anfangen muss.«
Der Abend war fürchterlich.
Jasika strampelte schon mitten im Redefluss, als sie Severins Südviertelpenthouse betrat. Das Geplapper schien gar nicht den Gastgebern, sondern ganz einer selbstbezüglich berauschenden Funktionslust zugewandt, um die sich der Monolog im weiteren Verlauf ringelte wie eine Raupe mit unendlich vielen Segmenten – eigentlich ein einziger Satz, oder doch der Versuch dazu. Das Gekakel riss selbst beim Nudelsalat mit Datteln nicht ab, quoll zwischen dem Essen aus Jasikas Mund und schmierte Klemens und Severin die Ohren voll: »Na, ha, ja, mjamm, mmmh, toll ist das, wirklich, ich würd’ ja fast mitfliegen mit euch Süßen, wenn’s sowas Leckeres da jeden Tag gibt, auf eurer Insel, oder wie man vor tausend Jahren gesagt hätte: eurem Schiff, ja so haben sie das genannt, während der Hidschra, irre, nicht, als wär’s einfach so’n Boot, das man aber in dem Fall nicht fürs Wasser braucht, sondern um interstellare Distanzen zu überwinden, Kinder, nee, als würde man darauf nicht ewig lange wohnen müssen, ich mein, ist doch klar, die meiste Zeit kommt’s einem auf so einer Reise eher vor, als ob sich gar nix bewegt, also wenn schon diese Seefahrersprache sein muss, dann ist es ja doch so, als ob man mitten im leeren Meer sitzt, wisst ihr, wir in der Pragma und die andern in der Nomo, wir sitzen seit Ewigkeiten dran, das mal zu systematisieren, wir arbeiten auch mit so Leuten wie dir, Klemens, die sollen uns Tierchen züchten, nicht, Viren, dass man das besser wegsteckt, verarbeitet, diese Einsamkeit, in dieser Metrik, die einen da festhält, Stationarität, Axialsymmetrie, Leute, wirklich, eine Insel, klar, Killingvektorfeld, na, Fachsprache würde sagen: Die lokal registrierte Geometrie wird im Lauf der Zeit invariant, fühlt sich an, als wäre man, ist klar, also statische Beobachter rotieren selbst im Ramscoop nicht gegenüber dem asymptotischen Inertialsystem, wisst ihr, wenn ihr aus dem Fenster guckt, meine Lieben, das ist der schiere Wahnsinn, gut, ihr könnt Spürer und Taster direkt in eure Nerven legen lassen, dann verschiebt sich das alles vielleicht, muss, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja nicht mal skalierbar sein, andererseits, da kommt es dann wieder drauf an, was ihr für einen Antrieb wählt, klar, deswegen bin ich ja heute Abend hier, um euch die Entscheidung, wie sagt man, zu erleichtern, wobei ich allerdings gleich zugeben muss, dass ich so wahnsinnig viel darüber auch wieder nicht weiß, aber wahrscheinlich startet ihr ja von Sisela aus, ist am einfachsten, ein richtiger Hafen, abgekühlt seit weiß nicht wann, kein Planet, mehr eine Art Stein, der Schattenspiegel hat ihm ja sein ganzes Sonnenlicht geklaut, dem armen Brocken, was willst du machen, die Touristen kommen in letzter Zeit auch immer häufiger da an und shutteln dann gleich hier rüber, aber wenn ihr’s so macht, von Sisela aus mein’ ich, da könnt ihr dann auch gleich einen Exotank organisieren, bisschen Helium-3 dafür, Fusionsreaktor, dann wie gesagt, würde ich wirklich empfehlen, Ramscoop für die Fluchtgeschwindigkeitsphase, klassischer Trichter, ich würd’ mich da auf gar nix Raffiniertes einlassen, rein mit den Wasserstoffatomen, von mir aus Deuterium, ist das beste Isotop, kommt im lokalen Nichts häufig genug vor, weiter draußen könntet ihr einen Gürteldrescher nehmen, Materie-Antimaterie-Drive, kompakter Diracmotor, so die Sorte, die, ich weiß nicht, vielleicht im Luytenweltennetz üblich ist, virtuelle Elektron-Positron-Paarerzeugung, kleiner Beitrag zur Selbstenergie der Atome, läppert sich, Differenz von schwerer und träger Masse, Schwuppdiwupp, und zum Schluss, für die richtig weiten Strecken, dann einen Verkürzerkeil …«
Nach den mit wilden Gesten erläuterten Ideen zum Antrieb malte sie den beiden inselinterne Habitate aus, eine komplette Wohnwelt für Klemens und Severin samt Kultivation in biosphärischer Nachhaltigkeit. Der Vortrag ging bis tief in die Nacht. Klemens hörte bald überhaupt nicht mehr zu und machte sich lieber eigene Gedanken. Aus denen schälte sich allmählich eine durchaus unwillkommene Einsicht: Das Entscheidende waren eben nicht die technischen Probleme. Zu denen fiel, wie nicht zu überhören war, selbst einem Hohlkopf wie dieser Frau Maelis mehr als genug ein.
Das eigentlich Klärungsbedürftige, Brenzlige war die Ökonomie.
Witze übers Verkaufen von Menschen vergingen den beiden Auswanderungswilligen darüber zügig. Denn wo, wie zwischen den meisten Produln auf dem Schattenspiegel, eben nicht gekauft und verkauft wurde, wo kein Profit vorkam und keine Kredite vergeben wurden, musste man sich Gedanken über den gerechten Tausch machen. Maßstäbe taten not.
Klemens und der Fuchs waren darauf angewiesen, sich etwas überschreiben zu lassen, das sie nicht selbst herstellen konnten, das aber leider auch nicht leicht mit dem zu verrechnen war, was sie leisten konnten.
Ramscoops, storarische Gürteldrescher, Verkürzerkeile, Habitate, Pflanzensamen, Tiergenome und mehr: Wie eicht man das an Arbeitszeit in Synesarchitekturen, an nützlichen Seuchen? Zumal es um Mehrarbeit ging. Denn was im Produl erzeugt wurde, gehörte den lokalen Prodisten als Gesamtheit, nicht einfach einem Spatiomusiker und einem Krankheitenzüchter, die zufällig irgendwelche Ideen hatten.
»Wir schaffen das«, sagte Severin, als ihm Klemens erzählte, wie ihm dieses Problem beim Sermon der Frau Maelis aufgegangen war. Der Fuchs blies sich eine rote Locke von der Stirn und zeigte beim Lachen strahlende Zähne.
Auf jeden Eismond, in jede Einöde wäre Klemens ihm gefolgt.
Frau Maelis blieb eine Episode, auch wenn Severin sich noch ein paar ähnlich unfeine Affären erlaubte.
Manchmal, wenn Klemens, der mehr Zeit im Produl verbrachte als Severin, weil subzellulare Wesen intensivere Pflege brauchen als kontrapunktische Kathedralen, spätnachts oder frühmorgens den Freund besuchen ging, fand er ihn mit einem Mädchen, oft im knotigen Nest der Rautenphython.
Die beiden Menschen kraulten einander die Haare, die schönen Schlangen zischten.
Klemens ging auf den Balkon, bis sich die zwei gefasst hatten.
Manchmal badeten auch mehrere Leute mit dem Fuchs im künstlich kalten Teich, unter Wasser an den Beinen gekitzelt von schwimmenden, rotgelb geringelten Königsnattern, oder man liebte sich träge auf großen Ästen, wo Warane schweigend, mit glasigem Blick, dabei zusahen, wie Severins Hand auf einem weißen Hintern ruhte oder ein mokkabraunes Bein sich zwischen seine beiden hellen schob.
Klemens hatte so gut wie nie Lust, dabei mitzutun.
Lieber ging er raus, auf Balkone oder Dächer, rauchte und sah den Gleitern und Flugzeugen zu, den Frachtern und Inseln. Wenn er nicht zu erschöpft war von der Arbeit, blickte er hin und wieder sogar zur glitzernden Innenhülle des Schattenspiegels auf, zu den Positionslichtern und geodätischen Schienen, oder beobachtete die Feste auf anderen Dächern und Terrassen, weiter unten, weiter außen, raumwärts.
Allmählich nur wurde ihm dabei bewusst, dass er etwas empfand, das man mit Bakterien und Viren zwar simulieren konnte, womit er sich aber zuvor nie beschäftigt hatte. Wie hieß das? Fernweh?
Nein, korrigierte er sich, als das Meergrün der Bucht sich im Morgendämmer immer schärfer vom Horizonthimmelsblau schied, als würde es ausgedruckt – nicht Fernweh.
Heimweh.
Nach Feldeváye, wo ich noch nie gewesen bin.
Das Glück kam wieder. Es blieb eine Weile.
Severins Ausschweifungen hatten kleine Brüche gesetzt; aber etwas schwache Eifersucht kam Klemens ganz recht. Er mochte es, wenn seine gute Stimmung feinste Risse hatte, wenn die Aura ein wenig flackerte. Vollkommenheit? Lieber nicht.
Die Inselbeschaffung gab den Liebenden Auftrieb, brachte sie einander näher. Sie wollten nicht im Gewohnten bleiben; das war ihre tiefste Verbindung.
Der Fuchs vereinbarte die ersten Tauschkontakte. Verboten war Tausch nicht, in einer Wirtschaft wie der prodistischen, die vor Jahrhunderten dem Mangel entwachsen war, gab es bloß wenige Gründe und Gelegenheiten dafür. Das meiste bekam man überall, wo es Produln gab und deren Lamontiken, aber ein Ortswechsel wie der geplante schuf, wo nicht Mangel, so doch unalltäglichen Bedarf. Tausch hieß Aufstockung des Mehrprodukts, und daran machte sich Severin deshalb zuallererst.
Er wuchtete in seinen knapp bemessenen Freistunden während dreier Wochen ganze Kuppeldomstädte zusammen, unter Verwendung von Sinfonischem, Liedhaftem, Passamezzi, Blues und Ambientem, verschmähte auch Skizzen nicht, die sich in alten, von ihm verworfenen Dateien fanden.
Klemens und er rechneten, arbeiteten, rechneten wieder.
Diese Erkältung mit Bewegungserziehern war den Tauschpartnern so viel wert, jener musikalische Wandelgang wieder etwas anderes.
So schuf Klemens ein respiratorisches Syncytialvirus aus raffiniert tranchierten, in kunstvoll designte Hüllen eingebetteten Ribonukleinsäurefädchen, das den Atem der davon Befallenen um komplexes Wissen über Muster im Innersten von Wahrnehmung und Kommunikation bereicherte: »Die RSVs waren auf der Schule mein Spezialfach, mein Steckenpferd. Man kann sehr schöne, sehr irritierende hinkriegen, wenn man was von der … Kunst des Weglassens versteht. Beschränkung. Das ist, wie wenn du Fenster ohne Rahmen komponierst, oder Dächer ohne Häuser drunter, oder ein Satzzeichen ohne Satz. Die RSVs bleiben in der Lunge – häusliche Tierchen, asketisch, anders als Rubella oder Rubeola, die sich im ganzen Körper ausbreiten wollen. Man muss sie also dort zur Wirkung bringen, wo sie wohnen.«
»Verstehe«, lächelte Severin, »Steingartenanlegen, Ikebana. Oder Bonsaizucht.«
Klemens Eriksons neue Lungenleiden waren noch beliebter als Severin Rukeysers erfolgreiche Gebäude. Da zwischen ihnen beiden keine Konkurrenz herrschte, sondern nur der Ehrgeiz, genügend Tauschgut zu produzieren, freuten sich beide sowohl am je eigenen Erfolg wie an dem des andern.
Sie rechneten.
Arbeiteten.
Rechneten wieder.
Severin schuf eine Passacaglia, die den Ortssinn verwandelte: Innen schien außen, Kreisbewegungen fühlten sich linear an.
Klemens erfand eine mild berauschende Anämie.
Severin dichtete Tänze, mit denen man wie auf masselosen Kufen reiste.
Klemens setzte eine Bindehauterkrankung in die Welt, die den Befallenen Infrarotsicht verschaffte.
Stets wurde getauscht.
Die beiden bekamen mehr, als sie erwartet hatten. Am Ende hing in der kleinsten Werft von Sisela eine in luxuriösem Leichtbau gefertigte, mit allen Annehmlichkeiten planetarischen Lebens ausgestattete Insel, die selbst für Severins Schlangen genug Platz bot, in rot und weißblau, mit schwarzen Lamellenschirmen auf dem Haifischkopf, außerdem, wie von Jasika Maelis empfohlen, drei Gürteldreschern am Rücken (der mittlere saß einer Art Rückenflosse auf; das Ganze wirkte tatsächlich wie ein gigantisches Lebewesen), zwei Verkürzerkeilen rechts und links der gedrungenen Brücke, einem Diracmotor im Bauch und einem Exotank für den Treibstoff, an sieben Tragefasern aus Kohlemantelmaterie.
Der Fuchs und sein Freund richteten sich in der Insel ein.
Sie spielten mit der Technik, um sie kennenzulernen.
Sie ließen die Insel von der Systemwacht abnehmen.
Dann flogen sie los.
Der Schattenspiegel, hinter ihnen, sank ins ununterschiedlich Schwarze zurück, eine geruchsneutrale Erinnerung, ein Jugendirrtum.
Alle vier bis sechs Jahre ließen sich die Reisenden wecken und blieben jeweils wenige Wochen wach, um ihre Gesundheit nicht zu gefährden.
Langsam, schmerzlich, aber unumkehrbar wurden sie einander in dieser Zeit fremder.
Bei jeder Wachpause erkannte einer den andern schlechter wieder. Zu spät verstanden sie, wie ernst das war, wie unüberwindlich.
Geweckt vom Zentralrechner der Insel, die Klemens und Severin sicherheitshalber nicht getauft hatten – eine Art Aberglaube: Sie wollten nie heimisch werden –, verschafften sie sich in den stabilen Ökosphären Bewegung, frischten ihre Talente auf, spielten oder fanden sich vor besonderen Aussichten: dem Heliumblitz einer Sonne, die allen Wasserstoff im Kern verbrannt hatte, der chromatischen Veränderung im Lyman-Alpha-Wald, einer unwahrscheinlich sauberen Orbitreihe von sechs Gaswelten um einen weißen Zwerg, bizarr zackigen Gesteinsbrocken in diffusen Oortwolken um abgelegene Sterne, optischen und Röntgen-Pulsaren.
Supernovae, rote Riesen.
Schwarze Löcher.
Severin nahm freilich wenig inneren Anteil an diesen gewaltigen vistae.
Fast immer bewegte er sich während der Wachphasen stattdessen im Synes.
Dabei leitete er Energie und konvertible Flussmasse aus den Verkürzerkeilfütterungen der Inselplatten ins Syneskugelbett oder fütterte Spinor-Vektor-Gravitinos mit entgegengesetzten Chiralitäten in seine großen Aggregate.
»Unsern Treibstoff für Späßchen zu verheizen, ist das eine Idee von Frau Maelis?«, wollte Klemens betont beiläufig wissen.
Der Fuchs zuckte mit den Schultern. Klemens ließ das Thema fallen.
Später erklärte Severin beim Essen: »Es ist kein Hobby, sondern eine große Sache. Am Ende krieg ich, wenn alles klappt, in der Syneskugel eine Stadt aus Sound zusammen, die weitläufiger ist als der ganze Planet, wo wir hinwollen. Verstehst du? Mit solchen Energiemengen hab ich noch nie gearbeitet. Und wir brauchen das nicht alles. Es ist ja auf einen Rückflug berechnet, den es nie geben wird. Gönn’s mir doch. In einer unendlichen, offenen Symphonie wohnen, wie zu Zeiten, als es die Künste gab, reizt dich das nicht?«
»Du wirst uns in die Luft jagen«, sagte Klemens, ein bisschen zu ruhig.
Severin erwiderte matt: »Ach was, in die Luft jagen. Erstens gibt’s hier keine Luft. Zweitens falte ich uns schlimmstenfalls in die Dimensionslosigkeit zurück. Ich spiele mit der Eigenzeit, den Äquivalenzen – theoretisch kann ich Monate im Synes verbringen, und draußen im restlichen Inselganzen vergehen nur Minuten. Wenn die Insel ihrerseits relativ zum Restweltraum schnell genug fliegt, nahe genug an die Lichtgeschwindigkeit rankommt, ist außerhalb der Verkürzerkeilplatten alles sogar nochmal langsamer. Matrjoschkas aus Zeit …«
Er bleckte die Zähne und leckte sich über die Lippen.
Klemens musste lachen, zittrig allerdings, und eine Spur zu laut.
Im Hinausgehen, auf dem Weg zu seinen eigenen Experimenten, die er forcierte, um nicht wie ein Sitzengelassener vor sich hin zu brüten, fiel ihm auf, dass Severin jetzt einen Kittel trug, einen weißen sogar, wie früher auf dem Schattenspiegel Klemens, der dafür jetzt in schlampigen Overalls herumlief.
Im Labor machte er sich wieder an seine neue Form der Influenza, die, über subtile Programme, eincodiert in Viren durch neuartige Capside und Matrixproteine um die RNA-Segmente, das Hirn der Befallenen in die Lage versetzen sollte, selbständig synästhetische Ergänzungen zu Erlebnissen mit taktilen, visuellen und akustischen Reizmustern zu konstruieren. Klemens dachte dabei an Erlebnisse, die auf Feldeváye, in den Omphaloi der Urbeen, auf ihn und Severin warteten: Kunst.
Sein Plan war ehrgeizig: Er strebte danach, den Unterschied zu überbrücken zwischen den alten Künsten und dem, was Severin täglich im Synes erlebte, beim Bauen.
»Ich weiß nicht, ob das nützlich ist. Oder tückisch. Ich nenne die Kleinen ›Kunstide‹«, sagte er, und hoffte, der bescheidene Witz würde verstanden.
Severin interessierte das Geschenk nicht. Selbst auf ein verächtliches Schnauben oder Augenverdrehen verzichtete er.
Küsse und Umarmungen hatte er nie abgewehrt. Auch jetzt, nahm Klemens an, würde er sie zulassen. Das machte die Lage noch schlimmer.
»Kunstide. Hm«, murmelte der sonst tagelang Synesversunkene in einer der gemeinsamen Küchen und malmte dabei geistesabwesend auf einer Scheibe Toastbrot herum. Als Klemens sich, aus Trotz, weigerte, das für ein Gesprächsangebot zu halten, stand Severin auf und verschwand in einer der Schleusen zum Becken.
Dort war die Kugel, der Zugang zur Klangstadt.
Jeder ging seiner Wege. Die Insel war klein genug, dass man einander oft begegnete.
Das half nicht.
Kamen sie nach der Arbeit an ihren Projekten zusammen, etwa aus Anlass einer neuen Aussichtsmeldung des Zentralrechners, so ging es dabei immer schneller, bis sie aneinander Fehler fanden, einander mit Sticheleien zusetzten. Die Gespräche, die daraus hervorgingen, drehten sich im Kreis, fade, bramarbasierend, sterbend.
Auf der Aussichtsplattform, im von den schwarzen Fenstern abgedämpften Licht einer Stichflamme, die länger war als der Gesamtdurchmesser des Schattenspiegels, fragte Severin schließlich: »Gibt dir das eigentlich was? Diese ganzen Scheißwunder des Universums? Warum weckt uns die dumme Kiste? Ist alles nicht besser, als die Simulation wäre.«
»Vielleicht, damit du mal rauskommst aus deiner Kugel. Und deinen Bauten.«
Severin zog die Stirn in Falten: »Du redest von was, das du nicht kennst. Ich hab dich während der letzten drei Wachpausen dreimal eingeladen, mich in der Kugel zu besuchen und dir die Stadt anzuschauen. Immer hast du was anderes zu tun. Schaust nach deinen Collicinplasmiden und … Retrotransposonen, nach deinen Prionen und Viroidenkolonien in den Zwischenschleusen. Ja, ich weiß, wie das Zeug heißt. Ich merk mir das. Im Gegensatz zu dir, der nur weiß: Der Severin, der sitzt ständig in der Kugel. Du verseuchst die ganze Insel mit diesen …«
»Seuche. Das ist alles, was dir einfällt dazu. Was ich züchte, das sind … Zivilisationen. Wesen, die kleiner und feiner sind als jede Zelle, einfach mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte in Ruhe zu lassen und nur hin und wieder nachzugucken, in welche Richtung sie sich entwickeln, ob sie lernen, ob sie rechnen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, für dich wäre so ein …«
»Du dichtest deinen Kram nicht genügend ab. Darum geht’s mir. Das ist alles. Kein Werturteil über die Arbeit, nur über die Sicherheit.«
»Na, deine Schlangen …«
»Die Strumpfbandnattern sind tot. Alle. Deine … Zivilisationen sind durch die Abdichtung und haben sie infiziert und getötet.«
»Ach was. Das geht doch gar nicht. Wie denn?«
»Also irgendwas hat ja wohl den Fortpflanzungszyklus gestört, und es liegt doch sehr nahe, dass …«
»Das kannst du nicht beweisen. Ich habe alles dreimal überprüft. Es gibt keine Spuren von …«
»Natürlich nicht. Sie waren schon vier Jahre im Erdreich zersetzt, diese Spuren, als wir geweckt wurden, für dieses … Feuerwerk da draußen«, die Geste der rechten Hand warf weg, was gemeint war, tatsächlich ein Wunder des Universums.
Klemens seufzte.
Severin betrachtete ihn missmutig. Er fand den Freund jetzt dicklich, teigiger, auch fahler als früher: ein verfetteter Kater. Wahrscheinlich ließ der Virenbastler in den Schlafphasen seine Muskeln nicht genügend reizen, aus Angst vor Langzeitfolgen. Ein bisschen hypochondrisch war er ja immer gewesen, vielleicht eine Berufskrankheit.
Severin nahm einen Schluck Mokkabrühe aus einer langen Tasse, die Klemens hässlich fand. War das nicht ein Abschiedsgeschenk von Jasika Maelis? Stand das klobige Gefäß sonst nicht sogar auf der Deckelklappe seiner Liegekoje, trug er’s jetzt eigentlich absichtlich immer mit sich herum?
Klemens wusste, dass das peinliche Gedanken waren, wohl Folgen der Reisestrapazen. Er schnalzte mit der Zunge: »Ich glaub, was mich so reizt, ist das … Eingeschlossensein. Dass hier niemand ist, außer uns. Und dass wir, ich weiß nicht, wenn schon nicht im Kopf, dann doch irgendwie in den Knochen spüren, dass wir sehr, sehr … sehr lange unterwegs sind. Länger als vorgesehen, bei Geschöpfen wie uns. Die Insel fährt nicht. Sie schwimmt auf der Stelle.«
Er blinzelte, neigte den Kopf: ein Versöhnungsangebot, schwach, aber aufrichtig. Als der Ruhigere von beiden war er auf tapfere Art nicht bereit, die Freundschaft einfach so ausbluten zu lassen.
Severin lächelte gequält, nicht uneinverständig: »Na gut, dann machen wir jetzt was aus. Du kommst in die Stadtkugel, und ich zieh mir einen Keimschutzanzug an und geh mit dir zwischen deinen Krankheiten herum.«
Klemens war einverstanden. Er folgte Severin an die Membran.
»Nach dir«, sagte der Freund.
Er legte seine Hand auf den Rücken des Besuchers, als wollte er ihn in die Sphäre schubsen, was Klemens entschieden nicht gefiel: Gehen wir jetzt, wie abgemacht, zusammen, dachte er irritiert, oder nicht?
Die Raumblende teilte sich geräuschlos.
Der Synes nahm Klemens auf, ein Rasseln, Ratschen, Knarren krümelte in seinem Körper auf und ab, bis er sich in einer Art Unterführung oder Fußgängerpassage wiederfand, umgeben von grauen, schwach konturierten, humanoiden Gestalten, die rasch ausschritten, geschäftig, in zittriger Notation – lebende Wimpel refrainartiger Motive.
Albern, dachte Klemens. Es genügt Severin also nicht mehr, aus Tönen Bauten zu fügen und die eine Stadt zu nennen. Er muss auch noch Homunculi drin herumgeistern lassen. Und was ist das jetzt?
Da kniete ein bärtiger Mann in Leinenhemd und blauer Cordhose auf dem Boden und malte auf Steinkacheln, in Pastell: eine Paradiesszene, zwei Menschen, Mann und Frau, beide rothaarig. Der Mann gab der Frau den mythischen Apfel. Um den Ast des Baums wand sich zischend eine Strumpfbandnatter, in deren Augen Flämmchen tanzten.
Klemens drehte sich um. Fast wäre er zu Boden gerissen worden – einem der Schemen musste er ausweichen; geduckt, mit einem Kopf wie ein Stier, hastete der Schatten an ihm vorbei. Klemens ärgerte sich und rief ungeduldig: »Severin? Bist du … kommst du?«
Keine Antwort. Auch die übrigen Gespenster beachteten ihn nicht.
Er wandte sich um, der Genreszene mit dem Pflastermaler zu. Neben dessen rechtem Knie stand ein Schälchen, in dem etwas glitzerte: Münzen.
Sehr altes Geld.
War Severin jetzt dem Kitsch verfallen? Eine kaum kindergroße Figur schlenzte am Umriss des Malers vorbei, ging beim Gehen geschmeidig in die Knie, griff nach dem Schälchen, fischte einige der Münzen heraus. Eilig versuchte sie, in der Menge unterzutauchen. Aber Hände zeigten auf sie. Disharmonien quietschten. Lichtleisten in erregtem Morsetakt pulsten. Die ganze Kaverne schrie Klemens schmerzhaft ins Ohr, aus Orgelpfeifen, Rabenkehlen: »Dieb! Den Künstler bestohlen! Beraubt! Sie soll dem Künstler den Lohn zurückgeben!«
So aufdringlich kakophonisch setzte die plötzliche Verengung der Architektur allen Sinnen des Besuchers zu, dass der sich nicht anders zu helfen wusste, als das Ausklinksiegel im Kopf zu zerbrechen. Unsanft wurde er erst in einen von diesem Akt geöffneten Riss der Klanghülle gesaugt, dann an allen Gliedern mit frostigen Pfeilen gepiekt und schließlich auf die mit Samt bespannte Schwelle der Membran gespuckt, über die er die Kugel betreten hatte.
Es war dunkel im Synesbettzimmer.
»Licht. Licht, bitte«, krächzte Klemens schwach.
Vom Schock des Austritts geschwächt, sah er sich mit unsicherem Blick bestürzt und nervös um.
Kein Severin.
»He! He, Architekt!«, rief Klemens. Der Mund tat ihm weh, das Zahnfleisch war geschwollen und reizbar. Er richtete sich mühsam auf und rang um Gleichgewicht dabei. Severin schwieg.
Langsam, ziehend, enttäuschend kam ein Verdacht in Klemens auf, den er zunächst aus Abscheu vor so etwas gar nicht überprüfen wollte. Ein Rundgang durchs Kugelbett bestätigte, dass Severin nicht nur nicht mehr hier war, sondern seit längerer Zeit niemand in einer der Nischen gelegen oder gesessen hatte – außer ihm selbst.
Klemens legte die Hand auf eine der Kontaktflächen zum Zentralrechner und fragte: »Wie lange war ich im Synes? Echtzeit?«
»Vier Wochen«, sagte das Gerät.
Severin hatte sein Display verlangsamt, ihn in Bernstein gefangen.
Maelis hatte wirklich die besten Lebenserhaltungssysteme empfohlen: Nahrung, Muskelstimulation … Aber Severin?
Ein übler Streich, kindisch auch. Und zu welchem Zweck? Klemens ahnte es, und fragte die Maschine: »Severin Rukeyser – wo ist er?«
»Schlafkammer. Auf drei weitere Jahre. Oder bis ich euch beide gleichzeitig wecke, weil etwas Flugrelevantes geschehen ist. Er bat mich, keine Schlafunterbrechung wegen Sehenswürdigkeiten und Naturschauspielen mehr zu …«
»Danke. Reicht.«
Klemens ging in sein Labor und fand, was zu finden er befürchtet hatte.
Nur noch drei Zellen mit Viren- und Bakterienumwelten regten sich, die mittleren nämlich. Alle, die an Docks grenzten, in denen Severin seine Reptilien untergebracht hatte, waren leergebrannt. Sterilisiert. Gesäubert.
Ohne Nachricht, ohne Entschuldigungsnotiz, ohne wenigstens eine herausgestreckte Zunge oder Bekennerbotschaft. Patzig, pampig, kleinlich, böse.
Wenige Lichtjahre vor der Ankunft am Zielort erst sahen sie einander wieder.
Was Severin getan hatte, war kein Thema mehr: Jahrzehnte her, nicht der Rede wert. Ein nie ausgesprochener oder beschlossener Waffenstillstand wurde eingehalten.
Severin bequemte sich sogar zu einer Art Buße, indem er, als er zwei der Platten aus der Hülle der Insel nahm, um sie zur geometrodynamischen Stabilisierung seiner ehrgeizigen Synesveränderungen zu verwenden, in die Nische eine Art Tümpel gießen ließ und dort unglücklich verwachsene Seitenlinien der Reptilienzucht einquartierte, um Klemens, wie er sagte, »einen Spielplatz« zu schenken: »Die Biester haben eine Art Raumkoller. Es sind nicht eigentlich viable Mutanten. Mehr eine degenerierte Unterfamilie. Und wenn du möchtest, kannst du sie infizieren, mit, ich weiß nicht, neuen, interessanten Stämmen von … na, was du eben kultivierst.«
»Sehr schön«, sagte Klemens knapp, mit hässlicher Ironie.
Gleich nach der Landung auf dem Zielplaneten würde man sich trennen, beschloss er unglücklich. Severin ging ihm nur noch auf den Geist.
Der Fuchs verbrachte jetzt ganze Tage am Stück im Stadtkugelsynes.
Wie viele Monate oder Jahre es drinnen waren, ließ sich kaum ahnen – man konnte die Zeit ja auch umgekehrt anpassen. Nur noch zu schlechtem Sex, unfröhlichen Gelagen und stundenlangen Angebereien kam er heraus.
Und redete dann wie ein ekstatischer Prediger: »Wirklich, du musst es dir mal anschauen. So was hast du noch nicht erlebt. Wir werden auf Feldeváye einen eigenen Omphalos eröffnen, sie werden ein Urbeum hochziehen deshalb. Die Leute … sie werden staunen. Sie werden staunen.«
Grummeln, Nicken: Klemens gönnte Severin nicht einmal mehr Widerspruch.
Das Schlafen schien der Tonbaumeister aufgegeben zu haben; es war ihm vermutlich nicht genial genug, deshalb unter seiner Würde.
Klemens saß derweil im Kopf der Insel, etwas höher als dort, wo bei einem Fisch, an den der Bauplan entfernt erinnerte, das Maul gewesen wäre.
Er grämte sich im Abgedunkelten, mitternächtlich Stillen.
Schonte seine Augen in falschem Frieden. So sah er der Raumzeit rings dabei zu, wie sie mal gestaucht, mal gestreckt, mal gedreht wurde. Die Gürtel und der Verkürzerkeil arbeiteten mit den Diracmotoreffekten zusammen, wie Klemens einst mit Severin harmoniert hatte: geschwisterlich, nützlich und schön.
Diese Zeit, das Gemeinsame, dachte Klemens betrübt, war vorbei.
Menschen kriegten das eben schlechter hin als Maschinen.
Unter vier schönen Monden also wollte Klemens sich einen neuen Gefährten – oder eine Gefährtin – suchen. Severin, der hatte sich erledigt.
Nicht einmal beim Anflug war er dabei.
Klemens saß allein auf seinem weinroten ergonomischen Knautschthron und betrachtete seltsam gerührt die gelborange Sonne, den türkisfarbenen Planeten und zwei der vier Monde, Zemelo und Thyone.
Die andern beiden, Arrhenius und Jocelyn, waren von Feldeváye verdeckt.
Ein Himmelskörpersystem aus vagen Verheißungen: Klemens war sehr erleichtert, als der Anblick schließlich eine lang verschwundene und bestürzenderweise kaum vermisste Freude in ihm weckte. Doch, ja: Er hatte wirklich hierhergewollt, es gab hier, sagten die großen Kugeln, ein neues Leben für ihn, ob mit Severin oder ohne ihn.
Ein heftiger Ruck ging durch den Sessel, durch Klemens, die Brücke, die ganze Insel.
Etwas war schiefgegangen.
Die rechte Hand patschte aufs Kontaktfeld in der Armlehne.
Die Information erfasste sein Nervensystem wie eine Hitzewelle: zu früher Atmosphäreneintritt. Coiflets zerrissen. Die Koordinationsschlaufen des Zentralrechners hatten sich an nicht übereinstimmenden Eigenzeiten verschiedener Zonen und Zellen der Insel aufgehängt. Der Ablauf stockte, stolperte, stürzte zusammen.
Klemens musste manuell und gedanklich, per CLP, selbst steuern, eine Notlandung einleiten. Wertvolle Sekunden verlor er an einen dummen, beleidigten Gedanken: Der Fuchs ist schuld, mit seinen Lücken in den Verkürzerkeilplatten, mit seinem bescheuerten Stadtsynes, seinem Eskapismus im Bauch der Insel. Da hängt er drin, der Idiot, poliert seine nichtvorhandenen Fliesen und Kacheln, ringelt sich wie eine seiner Schlangen um musikalische Säulen, spreizt sich –
Ein schwerer Stoß drückte Klemens tief in den Sessel.
Er blinzelte, sah an sich hinunter.
Auf seiner weißen Hemdbrust waren zwei zackig-zittrige Streifen roten Bluts zu sehen, im grellen Notlicht, das ihn wecken sollte: Blut, seltsam. Das ist mir dann wohl gerade aus der Nase geschossen. Der nächste Stoß packte die Insel und drehte sie nach rechts, so dass Klemens aus dem Sessel gekippt und über den glänzenden Parkettboden gewischt wurde wie ein nasser Lumpen. Am Schleusenrand schlug er so heftig mit der Hüfte auf, dass der Schmerzblitz ihn zu spalten schien, vom Fußballen bis in die rechte Schulter. Kupfergeschmack breitete sich in seinem Mund aus. Er hatte sich auf die Zunge gebissen.
»Gaah! Femmp!«, schrie er, griff nach dem Schleusenrand, um sich irgendwo festzuhalten, und ärgerte sich über seine eigene Dummheit: Natürlich verstand ihn der Rechner so nicht. Also schloss er die Augen, in die Tränen der Wut und Frustration schossen, nahm sich zusammen und schrie noch einmal, so laut und deutlich er konnte: »Feld! Träges Feld!«
Diesmal verstand die Insel ihn. Klemens kam augenblicklich zur Ruhe, umgeben von einer Schutzblase, die ihn in die leere Mitte der Brücke trug, während links und rechts, oben und unten, vorn und hinten die Insel bebte. Er brachte sein Hirn in Ordnung, schob ein paar CLP-Menüs hin und her, die der Rechner in seinem Kopf ertasten sollte, und begann keinen Augenblick zu früh mit den Notlandungsprotokollen.
Die Fasern rissen.
Restantriebszellen, die nicht mehr gebraucht wurden, klinkten sich aus. Die Diracmaschinerie kam zu stehen, die Verkürzerkeilplatten kühlten ab. Nur die Gürtel rauschten und brausten noch, und mit denen sowie ausgefahrenen Tragflächen und einer Art scharfem Rückruder musste Klemens jetzt arbeiten.
Das hieß: die Insel steuern, als wäre sie eine antike Personenverkehrs- oder Frachtmaschine aus der Zeit vor der Hidschra. Er schloss seine Großhirnrinde mit den Außentastern kurz, die durch die glühende Hitze der Lufthüllenreibung hindurch den Planeten zu erfassen suchten, und mit den Hörschlaufen, in denen tausende unsortierter Luftraumkontrollcodes einander ins Wort fielen.
Wälder.
Gebirgszüge.
Dann die urbanen und para-urbanen Gebäudeballungen, in denen die Omphaloi leuchteten. Kurze, irrationale Hoffnung. CLP-Hilferufe.
Aber die Bitte um Überlassung von Landekennungen wurde abgewiesen. Coiflets von Feldeváye her drohten mit Abfangjägern und Abschuss. Klemens Erikson hatte keine Zeit, auf das Geschnatter, das Pulsen und Blenden einzugehen. Er musste die Insel stabilisieren; mehr, als zu diesem Zweck nötig war, konnte er von Feldeváye nicht erkennen, verrechnen, gebrauchen. Der stärkste der Verkürzerkeile wollte wieder anspringen, lief sinnlos heiß, pumpte. Die Insel schien zu glauben, sie sei aufgefordert worden, in einen höheren Raum zu springen. Gravitinoflüsse bildeten Strudel und Wirbel.
Panik würgte Klemens im Hals, er bezwang sie und beruhigte die Insel, so gut er konnte.
Lichter grellten.
Die Mittellinie ging verloren, das Höhenruder stammelte Blödsinn.
Trudeln.
Schweiß auf der Stirn, Herzpochen.
Unten Schneefelder. Blaue Verwerfungen. Die Keilplatten bockten erneut.
Risse in der Weltfläche unter ihnen traten auf, die Parität glitt auseinander, die Anzahl masseloser Fermionen entsprach nicht länger der eingepegelten Bosonenanzahl.
Gravitinos stoben auseinander wie Wasserspritzer aus einem feuchten Handtuch, das jemand auf eine Tischplatte schlägt.
Klemens ließ tasten, fluchte, fürchtete sich sehr.
Mehr Schneefelder.
Tiere.
Menschentrecks? Dörfer?
Eine arktische Region stürzte unter der Insel vorbei.
Klemens begriff, dass diese Gegend, eine der dünnstbesiedelten auf dem Planeten, seine einzige Chance für eine Notlandung bot.
Queranflug. Im konturenarmen Weiß markierte der Notpilot mit äußerster Konzentration ein Landefeld, ging in Querflug über, sah die rechte Flügelspitze sich über den vorgesehenen Landestreifen bewegen, zu schnell.
Er ließ die Insel einkurven, erlebte Übelkeit und Schwindel, war nah am Erbrechen. Winde bliesen viel zu stark. Falsch geschätzte Abdrift machte ihm zu schaffen. Das schrittweise Setzen der Klappen geriet zur Tortur. Flüche, Endanflug.
Auf zehn Grad gesetzte Klappen. Markierung des Aufsetzpunktes. Fall, Sturz.
Erschütterungen, die Klemens zu spüren glaubte, obwohl das unmöglich war.
Seitenwinde.
Rauschen, ein Wasserfall, ein Mahlstrom aus Blut im Kopf. Ziehen des Höhensteuers, Bremsversuche. Die Schnauze zu tief, viel zu tief. Verloren, entglitten, sinnloses Geschrei: »Scheiße! Verfluchte Scheiße, ver …«
Ein Schlag, dumpf und mächtig.
Das Gefühl, vom Kopf her geöffnet zu werden. Seimiges Zergehen der Trägheitsblase. Verwischter Sturm um Klemens, der, von falscher und richtiger Schwerkraft gepackt, sich überschlug, die Arme anzuwinkeln versuchte, die Beine anzog und in etwas hineingerammt wurde, als wäre er eine Axt.
Aufprall.
Ausfall.
Er kam vor Schmerz zu sich.
Das rechte Bein war gebrochen.
Klemens hatte eine halbe Stunde bewusstlos in einer Ecke der Brücke verloren, zusammengekrümmt, in den ungünstigsten Winkel geknautscht wie ein schlecht gepolstertes Möbelstück. Die Insel war schief ins Eis geschlagen.
Klemens fragte den Rechner nach Severin. Der Rechner wusste nichts.
Klemens beschloss, die Suche aufzuschieben. Er brauchte anderthalb Stunden, bis er sich durch die Gänge, von denen viele nur mit Flackerlicht beleuchtet waren, während es in einigen Räumen, auf nicht wenigen Decks brannte, in eine brückennahe medizinische Station geschleppt hatte, wo er sich vom Pharmasynes untersuchen und medikamentös behandeln, von der Robotik richten und schienen ließ.
Zwei Stunden lag er in einem Tank, der ihn wiederherstellen sollte.
Krücken waren in einem Schrank gestanden, der hinter einer zerbrochenen Außenwand befestigt gewesen war. Sie ließen sich nicht gebrauchen, der Feuerstrahl eines Triebwerkausfalls hatte sie aneinandergeschmolzen. »Eine Skulptur«, flüsterte Klemens.
Einen halben Tag später fand er Severin im Stadtkugelbett.
Der Synes war geborsten, der Fuchs dem Tode nahe. Eine große Glasscherbe steckte in seiner Brust, eine andere hatte seine rechte Schulter aufgeschnitten, der Freund hatte viel Blut verloren. Robotik half erneut.
Mit zwei halbwegs verständigen Transportgeräten schaffte Klemens den in Lebensgefahr Schwebenden auf eine weitere Krankenstation.
Severin hatte eine Lungenverletzung und einige von Atemmangel herrührende Hirnschäden erlitten, außerdem zahlreiche Frakturen und innere Verletzungen von erheblicher Schwere. Nur großer technischer Aufwand trennte ihn vom Tod. Nach mehreren Operationen, die Klemens von außerhalb des Operationssaals durch ein Panoramafenster verfolgte, wobei er zweimal vor Entkräftung einschlief, versetzten die Automaten Severin in ein künstliches Koma, dessen Kenndaten Klemens verrieten, dass die Rechner den Fuchs im Grunde bereits als tot betrachteten.
Las er die Diagnostik richtig, dann mochte sich das monate- oder jahrelang nicht ändern. Vielleicht nie mehr.
Das Schlimmste war die von fühlloser Technik mit größter Beiläufigkeit ausgespuckte Information, dass in Severins Blut große Mengen der von Klemens synthetisierten Kunstide gefunden worden waren.
»Er wollte mich überraschen. Mir eine Freude machen, damit, dass er mein Geschenk doch noch angenommen hat«, sagte Klemens zu den mechanischen Armen, die den Gefährten aufgeschnitten hatten. »Zu stolz, sich mit mir auszusöhnen. Aber nicht lieblos.«
Die Außenkameras zeigten Klemens keine Tiere, keine Menschen.
Viele Quadratkilometer weit gab es nichts als klirrkalte Einöde.
Er fragte sich, ob es schön wäre, zu erfrieren.
Lichter gingen an und aus. Notstrom schien sich krisselnd zu beklagen.
Die Apparate der Insel bereiteten sich aufs Versagen vor.
Klemens konnte hier drinnen nicht bleiben.
Severin würde sterben, wenn man ihn nicht irgendwohin brachte, wo es angemessene ärztliche Versorgung gab.
Wir sind da, dachte Klemens, sehr müde.
Endlich angekommen.
2: Lasse Ristaus einzige Tochter
Der Vater hatte es befohlen, also trug Kathrin ihre Schutzbrille jetzt den ganzen Tag. Nur in den Zelten nahm sie die Blende kurz ab.
Gehorsam war sie trotzdem nicht: Die Filter ließ sie meist abgeschaltet. Nur so nämlich sah sie die Berge, wie sie waren: das glitzernde Grauweiß, die harten grünen gefrorenen Wasser und schwarzen vertikalen Blöcke, die pelzigen Schneespitzen, das erhaben Schwarze.
Seit Wochen bewegte man sich auf die Felsfront zu.
Blau, grün, grau: »So sind deine Augen«, hatte Messame gesagt.
Immer, wenn Kathrin zum Gipfelschimmer schaute, dachte sie, das also sieht man, wenn man mir in die Augen guckt. Ich bin nicht hässlich; Meori lügt bloß immer, ich wär’s.
In Brillensicht wirkten die Bergspitzen rosa, das war ganz unmöglich.
Die Padurn allerdings glänzten durch die Brille grün, und ihr Atem war golden. Aber dieses Farbspiel machte für Kathrin die Tiere nicht schöner, weil es ja nicht die Wahrheit war.
»Es gibt einen Drall, vorn am Schlitten«, hatte sie am siebten Tag der Eisfahrt gemerkt und ihrem Vater gleich verraten, »die Padurn wollen immer zu den Bergen.«
Der Vater hatte so donnernd ins Mikrofon gelacht, dass Kathrin die Trommelfelle zitterten.
Dann war seine Stimme leise geworden, rauchig, und er hatte die alte Geschichte wiederholt, die er liebte, die sie kannte: »Den westlichen Gipfel nennen die Lapithen die Menneskerstufe. Nahe der Spitze, höher, als für uns gesund wäre, in der allerdünnsten Luft, fanden Menschen dort zu der Zeit, als man auf den Archipelen die letzten Urbeen baute, das ausgetrocknete und gefrorene Skelett eines Wildpadurs. Niemand kann erklären, was der in dieser Höhe gesucht hat.«
Warum der Vater das Rätsel liebte, wusste Kathrin nicht.
Er hatte es kaum nötig, sich damit interessant zu machen.