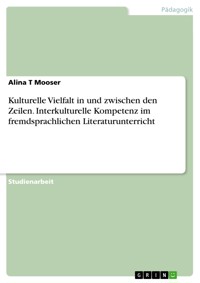29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Feminismus ist heutzutage ein Erfolgsrezept der Werbung. Vorreiter wie Dove haben Frauen aus der festgefahrenen, oft sexistischen Werberolle gelöst. Waren früher noch viel nackte Haut, anzügliche Headlines und vorwiegend junge, makellose Frauen Gegenstand der Werbung, so nehmen heute immer mehr Frauen mit realen Körpermaßen und realen Makeln einen Platz ein. Doch welche Unternehmen stehen mit ihren Produkten und ihrer Philosophie tatsächlich hinter einer feministischen Überzeugung? Findet sich die feministische Einstellung einer Marketingkampagne auch tatsächlich im eigenen Haus wieder? Oder nutzen einige Unternehmen "Femvertising" nur, weil es in breiten Teilen der Zielgruppe großen Anklang findet? Alina T Mooser geht diesen Fragen nach und untersucht in ihrer Publikation mithilfe der dokumentarischen Bildanalyse mehrere Beispiele des Femvertisings. Dabei prüft die Autorin die Glaubwürdigkeit der jeweiligen Werbebotschaften und fragt nach der Bedeutung der feministischen Werbeinhalte für unsere Gesellschaft. Aus dem Inhalt: - Femvertising; - Feminismus; - Sexismus; - Werbung; - Marketing
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Alice Schwarzer en vogue? Feminismus im 21. Jahrhundert
2 Sex Sells versus Femvertising — die Begrifflichkeiten
2.1 Der Begriff Feminismus
2.1.1 Kritik am heutigen Feminismus
2.1.2 Das Ende des Feminismus?
2.1.3 Ziele des Feminismus
2.1.4 Feminismus im 21. Jahrhundert
2.2 Der Begriff Sexismus
2.2.1 Sexismus in der Werbung
2.2.2 Positionen gegen Sexismus in der Werbung
2.3 Der Begriff #Femvertising
3 Die dokumentarische Methodik der Bildanalyse nach Ralf Bohnsack
3.1 Die formulierende Interpretation
3.2 Die reflektierende Interpretation
3.3 Begründung der Methodik
4 Erfolgsrezept #Femvertising
4.1 Beispiel Unilever
4.1.1 Dove, das Vorzeigebeispiel
4.1.2 Die dokumentarische Bildanalyse am Beispiel von Dove
4.1.3 Axe, das schwarze Schaf?
4.1.4 Die dokumentarische Bildanalyse am Beispiel von Axe
4.1.5 #UNSTEREOTYPE — Die Aufrichtigkeit von Axe und Unilever´s Werbewandel
4.1.6 Unilever´s Feminismusphilosophie innerhalb des Unternehmens
4.2 Beispiel Special K
4.2.1 Drop a Jean Size
4.2.2 #ownit
4.2.3 Die dokumentarische Bildanalyse am Beispiel von Special K
4.2.4 Die Glaubwürdigkeit von #ownit — zwei Perspektiven
4.2.5 Kellogg´s Feminismusphilosophie innerhalb des Unternehmens
4.3 Ehrliches #Femvertising am Beispiel von „Dear Daddy“
5 #Femvertising — ein nicht immer glaubwürdiger Verdienst an die Gesellschaft
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Dove Werbeanzeige.
Abb. 2: Dove Werbeanzeige (bearbeitet).
Abb. 3: Axe Werbeanzeige.
Abb. 4: Axe Werbeanzeige (bearbeitet).
Abb. 5: Working Mother Best Companies, Unilever.
Abb. 6: Special K Werbeanzeige.
Abb. 7: Special K Werbeanzeige (bearbeitet).
Abbildung 1: Working Mother Best Companies, Kellogg.
Abb. 8: Google Autovervollständigung
1 Alice Schwarzer en vogue? Feminismus im 21. Jahrhundert
Feminismus ist keine Gleichberechtigung. Feminismus ist tot. Feminismus ist schlecht. Feminismus ist der Versuch, hässliche Frauen in die Gesellschaft zu integrieren. Diese Sätze erscheinen, wenn man Google die Autovervollständigung von „Feminismus ist“ überlässt. (Abb.9) Die Ergebnisse der „weltgrößten Suchmaschine [sind] ein Blick in die Seele der Nutzer“ (Biermann, 2013). Ein Algorithmus von Google misst die Häufigkeit privater Suchanfragen und offenbart damit die relevantesten Fragen, Gedanken und Wünsche seiner NutzerInnen. Der Feminismus genießt im 21. Jahrhundert offenkundig keinen allzu positiven Ruf. Meinungsspaltend in jeglichen gesellschaftlichen Schichten und ausschlaggebend für unzählige Diskussionen und Debatten, beweist er, dass der Kampf um Gleichberechtigung und ein adäquates Rollenbild der Frau auch im Jahr 2017 noch immer zu keinem akzeptablen Ziel gelangt ist. Das Ideal, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer genießen dürfen, lebt noch immer fort und gilt für Länder wie Saudi Arabien, in denen das Leben der Frauen vollkommen von Männern fremdbestimmt wird, aber auch für westliche Länder wie Deutschland, die beiden Geschlechtern mehr Chancen als jemals zuvor bieten, in der Gleichberechtigung aber nach wie vor „gravierende Unterschiede“ bestehen. (BMFSFJ, 2012) Das Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen setzt sich in Deutschland und international für das weibliche Geschlecht ein, denn die Möglichkeiten sind noch immer ungleich. „[S]ei es bei der Berufswahl, bei der Gründung einer Familie oder beim Aus- und Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Moderne Gleichstellungspolitik setzt […] an diesen Übergängen an“ (BMFSFJ, 2012). Feminismus hat viele Gesichter. Das macht ihn so kontrovers. Oft scheint es, als könnten sich die jungen Frauen, vor allem aus westlichen Ländern nicht so recht mit der Bewegung identifizieren. Sie sind nicht persönlich betroffen und fühlen sich von der Gesellschaft nicht ungerecht behandelt; feministisches Engagement à la Alice Schwarzer mutet für sie altmodisch oder gar überzogen an. Demgegenüber hat sich der Feminismus des 21. Jahrhunderts aber auch bis hin zur Popkultur des Abendlands etabliert. Berühmte Persönlichkeiten und Idole wie Schauspielerin Emma Watson oder Megastar Beyoncé bezeichnen sich als Feministinnen und machen damit die vermeintlich verstaubte Theorie zu einem erstrebenswerten Charakteristikum der eigenen Persönlichkeit. Dieser Umstand ist auch der Werbeindustrie nicht entgangen und so muss sie sich als vermeintlicher Spiegel der Gesellschaft (Bergler, Pörzgen & Harich, 1992, S. 19)neuen, verstärkten, und in diesem Fall schon lange geforderte Belangen anpassen. Waren es früher noch viel nackte Haut, anzügliche Headlines und vorwiegend junge, schlanke und makellose Frauen, die oft im wahrsten Sinne des Wortes als Gegenstand der Werbung fungierten, so werden sie heute durch Botschaften und Botschafterinnen starker, unabhängiger Frauen ersetzt. Frauen mit realen Körpermaßen und realen Makeln, freigemacht von gesellschaftlichen Rollenklischees und Vorurteilen. Doch während sich in Fernsehen und Zeitschriften die Werbeinhalte mit frauenbestärkendem Gedankengut füllen, stellt sich unumgänglich die Frage, inwiefern der Bezug zum eigentlichen Produkt — dessen Fehlen bekanntlich schon in sexistischer Werbung keine Seltenheit war — eine Rolle spielt. Welches Unternehmen steht mit seinen Produkten, aber auch in seiner Philosophie tatsächlich hinter einer feministischen Überzeugung? Welches Unternehmen macht sich diese wiederum lediglich zunutze, um ein Phänomen aufzugreifen, das offensichtlich in breiten Teilen der jeweiligen Zielgruppe großen Anklang findet? Wie steht es um die Situation in unternehmensinternen Positionen? Lässt sich die Philosophie, die die Marke augenscheinlich so passioniert vertritt, auch in eigenem Hause wiederfinden? Hat ein Unternehmen in der heutigen Zeit mehr Chancen auf Erfolg, wenn seine Marke dem Sexismus den Kampf ansagt und sich stattdessen pro-weiblichen Botschaften verschreibt? Wie viel Feminismus verträgt die Bewerbung eines Produkts, ohne unglaubwürdig zu werden? Und existiert neben all den Bestrebungen, den Feminismus mithilfe von Werbung in Einklang mit der eigenen Marke zu bringen, auch so etwas, wie die Werbung für das offensichtlich verkaufsfördernde Hilfsmittel an sich — die reine Werbung für Feminismus?
Ziel dieser Arbeit ist es, diesen Fragen anhand von Werbeanzeigen drei verschiedener Marken auf den Grund zu gehen. Hierfür wird die dokumentarische Methode der Bildinterpretation herangezogen, die in Kapitel 3 eine genauere Erläuterung erfährt. Zunächst geht Kapitel 2 aber auf die Begrifflichkeiten ein, die für diese Arbeit hohe Relevanz haben und befasst sich somit mit der Bedeutung von Feminismus, Sexismus und dem Internetneologismus Femvertising. Kapitel 3 stellt wie bereits erwähnt das methodische Vorgehen vor und beschreibt dieses anhand einer Untergliederung in die beiden Arbeitsschritte der formulierenden und der reflektierenden Interpretation. Das Kapitel endet mit der Begründung der angewandten Methode. Kapitel 4 befasst sich mit dem Kernstück dieser Arbeit, dem Feminismus in der Werbung, und zieht dafür Beispiele heran, die die Frage nach ge- oder misslungenem Femvertising stellen. Dabei werden ausgewählte Marken der Unternehmen Unilever und Kellogg´s einer genaueren Betrachtung unterzogen und entsprechende Werbeanzeigen der jeweiligen Marken mittels der dokumentarischen Bildanalyse nach Ralf Bohnsack abgehandelt. Das Kapitel widmet sich zusammenfassend dem kritischen Punkt der Glaubwürdigkeit der Marken in ihren feministischen Bestrebungen und schließt mit einem Exempel, das die Frage nach der Existenz von Femvertising in seiner reinsten Form stellt und den Versuch einer Antwort unternimmt. Im abschließenden fünften Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und Ausblick auf die Zukunft feministischer Werbeinhalte, deren Aufrichtigkeit und der Frage nach ihrem Verdienst für die Gesellschaft gegeben.
2 Sex Sells versus Femvertising — die Begrifflichkeiten
Im nachfolgenden Kapitel werden die für diese Arbeit signifikanten Begrifflichkeiten erläutert. Nach einem Exkurs in die Geschichte von Feminismus und Sexismus, schließt der Abschnitt mit der Erläuterung des erst vor zwei Jahren geprägten Begriffs des Femvertising.
2.1 Der Begriff Feminismus
Der Begriff Feminismus lässt sich nicht eindeutig definieren, da schon die Wortherkunft nicht eindeutig ist. Klar ist aber, dass er „kein ausgeformtes, in sich widerspruchsfreies Konzept“ (Schenk, 1983, S. 80) ist, sondern „vielmehr ein Sammelbegriff für verschiedene weltanschauliche Positionen und Strömungen in der Frauenbewegung“ (Schenk, 1983, S. 80). Deshalb sei an dieser Stelle gesagt, dass auch in der vorliegenden Arbeit die ganze Vielfalt des Feminismusbegriffs ohne Anspruch auf Vollständigkeit behandelt wird, denn die verschiedenen Positionen und Strömungen „lassen sich nicht vereinheitlichen, ohne Wesentliches auszublenden“ (Pöge, Franke, Mozygemba, Ritter & Venohr, 2014, S. 19). Viele davon stehen „oft […] unverbunden nebeneinander und beziehen sich häufig nicht aufeinander“ (Pöge, Franke, Mozygemba, Ritter & Venohr, 2014, S. 21). Trotz der unterschiedlichen Theorien, haben sie „das wissenschaftlich-politische Interesse an der Verfasstheit von Geschlechterverhältnissen und die Kritik an allen Formen von Macht und Herrschaft, die Frauen diskriminieren und deklassieren“ (Becker-Schmidt, Knapp, 2007, S. 7).
Allgemein sei also gesagt, dass im deutschen Sprachgebrauch der Begriff erst ab dem Jahr 1980 (Gerhard, 1988, S. 302) eine nicht-abwertende oder biologisierende Definition erhielt. Der Feminismus wird beschrieben als eine „Richtung der Frauenbewegung, die, von den Bedürfnissen der Frau ausgehend, eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen, beispielsweise der traditionellen Rollenverteilung, und der patriarchalischen Kultur anstrebt“ (Dudena ,2017). In den Jahren zuvor beschrieben beispielsweise Der Große Brockhaus oder Meyers Enzyklopädisches Lexikon den Feminismus noch als „weibisches Wesen bei (homosexuellen) Männern“ (Gerhard, 1988, S. 302) oder als „[…] das Auftreten weiblicher Eigenschaften bei einem männlichen Tier oder bei einem Mann“ (Gerhard, 1988, S. 302). Im angelsächsischen und romanischen Sprachgebrauch findet sich jedoch schon ein früherer Zusammenhang mit dem Begriff und verweist auf die „Zusammenfassung aller Bestrebungen, den Frauen in allen Lebensbereichen, in Staat, Gesellschaft und Kultur, gleichen Einfluß und eine mit den Männern gleichberechtigte Stellung zu verschaffen“ (Gerhard, 1988, S. 302). Es wird unter anderem angenommen, dass das Wort zu Zeiten der Französischen Revolution unter dem Frühsozialisten Charles Fourier entstand. Er galt als Begründer einer feministischen Gesellschaftstheorie und befasste sich mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau. In seinem Werk Le Nouveau monde amoureux erkannte er die weibliche Emanzipation an: „Die Natur hat beide Geschlechter gleichermaßen mit der Fähigkeit zu Wissenschaft und Kunst ausgestattet“ und so dürfe die Gesellschaft nicht die „Dummheit begehen, die Frauen auf Küche und Kochtopf zu beschränken“ (Notz, 2011, S.10). Ebenso heißt es, dass die Frauen in der Französischen Revolution mit ihren Frauenclubs und Frauenzeitschriften, aber auch die Frauenrechtlerin Olymp de Gouges, sowie die Frauen der Denkschule der Saint-Simonisten den Weg des französischen Feminismus ebneten. (Gerhard, 1988, S. 302) Knäpper (1984, S. 67) wiederum verweist auf andere Autoren, die die französische Schriftstellerin George Sand für die Schöpfung des Begriffs verantwortlich machen. So prägte sie den Feminismus offenbar nicht in seiner Theorie, jedoch durch ihre eigene Lebensweise. Auch in den USA stellten die Frauen bereits im Jahr 1848 die Männerdomäne an den Pranger und forderten ihre Rechte ein. In ihrer Declaration of Sentiments belegten sie die männliche Vorherrschaft mit 18 anklagenden Fakten, wie beispielsweise das fehlende Wahlrecht, das fehlende Recht auf Bildung oder das fehlende Recht auf Eigentum und Lohn:
He has never permitted her to exercise her inalienable right to the elective franchise.
He has denied her the facilities for obtaining a thorough education — all colleges being closed against her.
He has taken from her all right in property, even to the wages she earns.(Declaration of Sentiments, 1848)
Britische Frauen, die der Antisklavereibewegung angehörten, forderten in der Mitte des 19. Jahrhunderts eigene Rechte, wie Wahl- und Bürgerrechte. In Deutschland dagegen ging die Emanzipierung von Frauen nur stockend voran. Der Feminismusbegriff hatte eine despektierliche Prägung, die allen voran von den GegnerInnen der Bewegung Verwendung fand. Frauenrechtlerinnen distanzierten sich von dem Begriff, um ihre Abneigung gegenüber der freien Liebe oder der „Zigarre rauchenden Emanzipation“ (Gerhard, 1988, S. 303) zu demonstrieren; so waren es lediglich die radikalen Frauen der linken Flügel der Frauenrechtsbewegungen, die sich mit dem Begriff schmückten, „sich besonders kämpferisch für Frauenrechte einsetzten“ (Schenk, 1983, S. 79) und damit „feministische Politik in Deutschland als anstößig oder zumindest des Radikalismus verdächtig“ (Gerhard, 1988, S. 303) gelten ließen. Somit bestand die Notwendigkeit einer neuen Frauenbewegung in Deutschland. Sie knüpfte nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs bewusst an die internationalen Ziele des Feminismus an und verstand sich selbst explizit als eine feministische Bewegung, die sich von den bescheidenen und selbstbeschränkten Bewegungen der vergangenen Frauenbewegung freimachte. (Gerhard, 1988, S. 302) Feminismus bedeutet demnach nicht nur „die Loslösung aus der sozialen, politischen und ökonomischen, sondern vor allem auch aus der psychischen Abhängigkeit vom Mann“ (Schenk, 1983, S. 80).
2.1.1 Kritik am heutigen Feminismus
Der heutige Feminismus muss sich viel Feindseligkeit gefallen lassen: Ihm werden „Jahre der männerfeindlichen Hetze, des geschürten Misstrauens, der Warnungen vor Frauenschändern und sexuellem Missbrauch mit Steckbriefen auf Damentoiletten“ (Lau, 2005) bescheinigt, sein Image sei so schlecht wie das der Deutschen Bahn und Feministinnen seien eine ‚Herde hysterischer und irrationaler she-revolutionaries’ (Hark & Kerner, 2007). In einer Geschlechterdebatte der Zeit