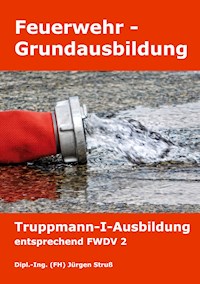
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Diese Textausgabe Feuerwehr-Grundausbildung wurde unter anderem auf Wunsch vieler Feuerwehrkameraden, die als Ausbilder in der Feuerwehr-Grundausbildung tätig sind, erstellt. Mit diesen fachlichen Informationen besteht jetzt die Möglichkeit, dass sich jedes Feuerwehrmitglied auf die vorgeschriebene Grundausbildung selbst vorbereiten kann. Das Ausbildungspersonal, das in der Grundausbildung tätig ist, kann sich genau über den fachlichen Inhalt informieren, sowie der Teilnehmer selbst, der etwas nachlesen kann. Eine einheitliche Feuerwehr-Grundausbildung zur optimalen Vorbereitung auf die verschiedensten Feuerwehreinsätze im gesamten Feuerwehrbereich ist das höchste Ziel dieser Ausarbeitung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Textausgabe „Feuerwehr-Grundausbildung“ wurde unter anderem auf Wunsch vieler Feuerwehrkameraden, die als Ausbilder in der Feuerwehr-Grundausbildung tätig sind, erstellt. Mit diesen fachlichen Informationen besteht jetzt die Möglichkeit, dass sich jedes Feuerwehrmitglied auf die vorgeschriebene Grundausbildung selbst vorbereiten kann. Das Ausbildungspersonal, das in der Grundausbildung tätig ist, kann sich genau über den fachlichen Inhalt informieren, sowie der Teilnehmer selbst, der etwas „nachlesen“ kann. Eine einheitliche Feuerwehr-Grundausbildung zur optimalen Vorbereitung auf die verschiedensten Feuerwehreinsätze im gesamten Feuerwehrbereich ist das höchste Ziel dieser Ausarbeitung.
INHALTSVERZEICHNIS
1 Die Feuerwehr - Grundausbildung
2 Rechtsgrundlagen / Organisation
2.1 Allgemeines
2.2 Die Gemeinde als Träger des Brandschutzes
2.3 Arten der Feuerwehr
2.4 Pflichten der Bevölkerung
2.5 Ausübung unmittelbaren Zwanges
2.6 Dienstvorschriften
2.7 Brand- und Hilfeleistungsgesetz des jeweiligen Bundeslandes
2.8 Verordnungen
2.9 Satzung der Feuerwehren
2.10 Ausrüstung
2.11 Mindeststärke
2.12 Gliederung
2.13 Dienstgrade und Funktionen
2.14 Verkehrssonderrechte
2.15 Rechte und Pflichten des Feuerwehrangehörigen
2.15.1 Rechtsbestimmungen
2.15.2 Dienstbetrieb
2.15.3 Dienstbetrieb in der Feuerwehr
2.15.4 Rechte und Pflichten
3 Brennen und Löschen
3.1 Brennen
3.1.1 Voraussetzungen für eine Verbrennung
3.1.2 Erscheinungsformen des Feuers
3.1.3 Brandklassen
3.2 Löschen
3.2.1 Löschmittel
4 Fahrzeugkunde
4.1 Grundlagen der FW-Fahrzeugnorm
4.2 Begriffsbestimmungen
4.3 Beladepläne
4.3.1 Beladepläne Löschgruppenfahrzeuge (Auszug)
4.3.2 Beladepläne Tanklöschfahrzeuge (Auszug)
4.4 Erkennungsmerkmale
5 Löschwasserversorgung
5.1 Zentrale Wasserversorgung
5.2 Unabhängige Löschwasserversorgung
5.3 Beschilderung
5.4 Richtige Bedienung von Unterflurhydranten
5.5 Richtige Bedienung von Überflurhydranten ohne Fallmantel
5.6 Richtige Bedienung von Überflurhydranten mit Fallmantel
5.7 Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche und unterirdische Löschwasserbehälter
6 Gerätekunde
6.1 Persönliche Ausrüstung
6.1.1 Feuerwehrschutzanzug
6.1.2 Feuerwehrhelm
6.1.3 Feuerwehrschutzhandschuhe
6.1.4 Feuerwehrsicherheitsschuhwerk
6.2 Schläuche, Armaturen, Löschgeräte
6.2.1 Schläuche
6.2.2 Armaturen
6.2.3 Löschgeräte
6.3 Rettungsgeräte
6.4 Geräte für einfache technische Hilfeleistung
6.5 Sonstige Geräte
7 Rettungspraxis
7.1 Einsatz von Rettungsgerät
7.2 Einsatz von Rettungsgerät - Einsatzübung
8 Lebensrettende Sofortmaßnahmen – 1. Hilfe
9 Löscheinsatz
9.1 Löscheinsatz - Einführung
9.2 Grundübungen
9.2.1 Grundübung 1 – Einsatz mit Bereitstellung – Wasserentnahmestelle: Unterflurhydrant
9.2.2 Grundübung 2 – Einsatz mit Bereitstellung – Wasserentnahmestelle: Offenes Gewässer
9.2.3 Grundübung 3 – Einsatz mit Bereitstellung – Wasserentnahmestelle: Löschwasserbrunnen
9.2.4 Grundübung 4 – Vornahme von Sonderrohren
9.2.5 Grundübung 5 – Einbeziehung tragbarer Leitern
10 Technische Hilfeleistung
10.1 Technische Hilfeleistung - Einführung
10.2 Grundübungen
11 Gefahren der Einsatzstelle
12 Unfallverhütung
12.1 Allgemein
12.2 Unfallversicherungsschutz
13 Vorbeugender Brandschutz - Brandsicherheitswachdienst
1 DIE FEUERWEHR - GRUNDAUSBILDUNG
Die Feuerwehr-Grundausbildung ist neben dem Ausbildungsdienst in der Feuerwehr Grundlage zur Ausübung von Funktionen in Einheiten der Feuerwehren. Die neue FWDV 2 „Musterausbildungsplan Truppmann“ bildet die Grundlage der Ausbildung für den Feuerwehrdienst.
Die jahrelange Ausbildung von Angehörigen der Feuerwehr zeigt, dass mit Hilfe eines geeigneten Medieneinsatz und vorbereiteter Unterlagen ein gezielter Unterrichtsablauf einfacher zu verwirklichen ist. Somit ist bei entsprechender methodischer Vorbereitung das gesteckte Lernziel erreichbar. Das Absolvieren von Ausbilderlehrgängen an den Landesfeuerwehrschulen sollte weiterhin die Grundlage eines Kreisausbildenden sein.
Dieses Begleitbuch für die Grundausbildung als Textausgabe soll dazu beitragen, dass die zukünftigen Feuerwehrangehörigen sich gezielt auf die FW-Grundausbildung vorbereiten und den „miterlebten“ Ausbildungsstoff in aller Ruhe nacharbeiten kann.
Da der Brandschutz und die Hilfeleistung Aufgaben der Bundesländer sind, haben diese eigene Gesetze erlassen. Es kann deshalb hier nur grob auf länderinterne Regelungen eingegangen werden.
Nach der FWDV 2 „Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren“ sind von den insgesamt 70 Stunden „Feuerwehr-Grundausbildung“ drei Stunden zivilschutz-bezogene Ausbildung im Rahmen der „Erweiterung des Katastrophenschutzes“ und 16 Stunden „Lebensrettende Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe)“ vorgesehen.
Der Katastrophenschutz gehört jedoch nicht zur Einrichtung jeder Freiwilligen Feuerwehr, sondern ist nur für besonders hierfür vorgesehene Einheiten bestimmt; die Stunden werden hier nicht abgehandelt. Dafür wurden jedoch die Themen „Löschwasserversorgung“ und „Brandsicherheitswachdienst“ mit drei zusätzlichen Stunden abgehandelt, da diese Themen in die FW-Grundausbildung unbedingt hineingehören.
Zu den 67 Stunden (ohne Katastrophenschutz) sollten mit abgehandelt werden:
2 Stunden „Löschwasserversorgung“
1 Stunde „Brandsicherheitswachdienst“
Die 16 Stunden „1. Hilfe“ werden in den meisten Bereichen von Angehörigen der entsprechenden Hilfsorganisationen durchgeführt; ein Nachweis über die Teilnahme wird oft schon vor Beginn des Truppmann-I-Lehrgangs gefordert.
Die Feuerwehrdienstvorschrift FWDV 2 sieht im Musterausbildungsplan „Truppmann“ den Teil 1 „Feuerwehr-Grundausbildung“ (70 Stunden) und den Teil 2 „Ausbildungsdienst in der Feuerwehr“ (80 Stunden) mit insgesamt 150 Ausbildungsstunden vor.
Als Ausbildungsziel ist in jedem Fall der spätere Einsatz der Ausbildungsteilnehmenden als Truppmitglied in den Feuerwehreinheiten anzusehen.
Bestehen auf Ebene der Bundesländer besondere Ausbildungsanleitungen für die Grundausbildung, so sind hier aufgeführte Unterrichts- und Ausbildungsstunden diesen jeweiligen Vorschriften anzupassen.
Ausbildungsziel: Die Teilnehmenden haben gelernt, grundlegende Tätigkeiten eines Truppmitglieds in Gruppe, Staffel oder Trupp auszuüben.
2 RECHTSGRUNDLAGEN / ORGANISATION
Inhalte:
o Aufgaben, Träger und Arten der Feuerwehr o Verpflichtung nach Verpflichtungsgesetz o Funktionsträger o Rechte und Pflichten o Pflichten der Bevölkerung o §§35 und 38 StVO
Groblernziele:
„Die grundlegenden gesetzlichen Regelungen des Brandschutzes, soweit diese für die Funktion als Truppmann auf Gemeindeebene erforderlich sind, und die wichtigsten Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts wiedergeben oder erklären können“
Empfohlene Methode:
Lehrvortrag (LV); Unterrichtsgespräch (UG)
2.1 Allgemeines
Die gesetzliche Grundlage für die Feuerwehren bildet das Gesetz über Brandschutz und die Hilfeleistung der einzelnen Bundesländer. Inhaltlich bestehen nur geringe Unterschiede, die aber hier nicht näher untersucht werden sollen.
Die Organisation
„Feuerwehr“
wird zu unterschiedlichen Notlagen gerufen.
Die Zuständigkeit wird durch Gesetz der
Berufsfeuerwehr (BF)
oder
Freiwilligen Feuerwehr (FF)
oder
Werkfeuerwehr
oder
Pflichtfeuerwehr
aufgetragen.
Wenn es die Schadenslage erfordert, können auch mehrere Feuerwehren (meist BF und FF) gemeinsam tätig werden, um Gefahren für Menschen, Tiere und Sachwerte bei Bränden, Unglücksfällen sowie bei Notständen abzuwehren.
2.2 Die Gemeinde als Träger des Brandschutzes
Drei „Ebenen“ in jedem Bundesland sind für bestimmte Aufgaben zuständig:
1. Die Gemeinden führen den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung in ihrem Gebiet durch und stellen hierfür eine entsprechende leistungsfähige Feuerwehr auf, rüsten sie aus, unterhalten sie und setzen sie ein. Auch die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, das Bereithalten von erforderlichen Anlagen, Mitteln und Geräten für die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung gehören zu den wichtigsten Aufgaben, die die Gemeinde zu erfüllen hat.
2. Die Landkreise führen übergemeindliche Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung durch, wie
Ausbildungslehrgänge,
Beratung der Gemeinden in Fragen des Brandschutzes und der Hilfeleistung,
Einrichten und Unterhalten der Anlagen zur überörtlichen Alarmierung und Nachrichtenvermittlung,
eine ständig besetzte Feuerwehr-Einsatzleitstelle (FEL) evtl. in der feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und
Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen und Durchführung von Alarmübungen.
3. Jedes Bundesland führt zentrale Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung durch:
Einrichtung und Unterhaltung von Feuerwehrschulen
Richtlinien und Verordnungen für die Einheitlichkeit im Lande ausarbeiten und bekannt geben
2.3 Arten der Feuerwehr
Befindet sich die Schadensstelle auf dem Gebiet einer Gemeinde mit mehr aus 100.000 Einwohnern (in den neuen Bundesländern gilt eine Sonderreglung) so wird die hierfür aufgestellte Berufsfeuerwehr tätig werden. Neben dieser Berufsfeuerwehr ist eine Freiwillige Feuerwehr oder in besonderen Fällen eine Pflichtfeuerwehr aufzustellen.
Betriebe können zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung eine haupt- oder nebenberufliche Werkfeuerwehr aufstellen.
Bestehen in einem Betrieb erhöhte Brandgefahren, so kann hier die Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer Werkfeuerwehr zwingend vorgeschrieben werden.
2.4 Pflichten der Bevölkerung
Zu den allgemeinen Pflichten der Bevölkerung hinsichtlich der Brandbekämpfung und Hilfeleistung gehören neben der Meldung eines bemerkten Brandes oder eines Unglücksfalles an die nächste Feuermelde- oder Polizeidienststelle auch das Befolgen von Sicherungsmaßnahmen, die der Einsatzleiter der Feuerwehr angeordnet hat, die Verpflichtung zur Hilfeleistung und das
Bereitstellen oder Benutzen von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen.
2.5 Ausübung unmittelbaren Zwanges
Die Gesetzte über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der einzelnen Bundesländer sehen z.T. die Ausübung unmittelbaren Zwanges durch die Angehörigen der Feuerwehr vor. Für diese Aufgabe, z.B. Räumungsmaßnahmen gegen Personen, ist jedoch die Polizei zuständig.
2.6 Dienstvorschriften
Bundeseinheitliche Feuerwehrdienstvorschriften gelten für die Ausbildung bzw. den Einsatz der Feuerwehren und werden in den einzelnen Bundesländern eingeführt.
Für die Ausbildung zum Truppmitglied (Grundlagenausbildung) sind folgende Dienstvorschriften von Bedeutung:
FwDV 1
„Grundtätigkeiten im Lösch- und
Hilfeleistungseinsatz“
FwDV 2
„Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren“
FwDV 3
„Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz“
FwDV 7
„Atemschutz“
FwDV 10
„Tragbare Leitern“
PDV/DV 810.3
„Sprechfunkdienst“
2.7 Brand- und Hilfeleistungsgesetz des jeweiligen Bundeslandes
Jedes Bundesland regelt die Aufgaben der Gemeinden, der Landkreise und seine eigenen selbst. Einzelheiten können dem jeweiligen Brand- und Hilfeleistungsgesetz entnommen werden.
2.8 Verordnungen
Zum Brand- und Hilfeleistungsgesetz werden sogenannte „Verordnungen“ erlassen. Diese beinhalten besondere Regelungen, z.B.:
Verordnung über die Mindeststärke der Feuerwehr (s. nächste Seite)
Verordnung über Ausrüstung der Feuerwehren
2.9 Satzung der Feuerwehren
Im Normalfall beschließt der Rat der Gemeinde oder Stadt die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr. Damit keine allzu großen Unterschiede in diesen Festlegungen der Gemeinde/Stadt erfolgen, werden auf Grund
der Gemeinde- bzw. Stadtordnung und
des Brand- und Hilfeleistungsgesetzes
von der Brandschutz-„Abteilung“ des Innenministeriums bzw. vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Mustersatzungen für Freiwillige Feuerwehren ausgearbeitet und durch Erlass bekannt gegeben.
Auszug aus einer Mustersatzung:
§1 Organisation und Aufgaben: Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde.
(Bayern: Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr werden in der Regel von einem Feuerwehrverein gestellt).
Sie besteht aus überörtlich einsetzbaren Brandschutzeinrichtungen und den in den Ortsteilen A-Stadt, B-Dorf, C-Hausen unterhaltenen Ortsfeuerwehren. Sie erfüllt die der Gemeinde nach dem Brand- und Hilfeleistungsgesetz obliegenden Aufgaben.
2.10 Ausrüstung
Bereits im Brandschutzgesetz wird im Rahmen der Aufgaben der Gemeinde/Stadt darauf hingewiesen, dass die Gemeinde/Stadt neben der Aufstellung und Unterhaltung der Feuerwehr diese auch auszurüsten hat. Nach der Größe der Feuerwehr richtet sich auch die Ausrüstung, z.B.:
Persönliche Ausrüstung,
Fahrzeuge,
Geräte zur Brandbekämpfung und
Geräte zur technischen Hilfeleistung.
Die Mindestausrüstung wird durch Verordnung festgelegt.
2.11 Mindeststärke
Je nach den örtlichen Verhältnissen ist laut besonderer Verordnung eine gewisse Mindeststärke von Feuerwehrangehörigen nachzuweisen:
Wenn es die Größe des Ortes erfordert, muss die Stärke der Wehr dementsprechend erweitert werden, um die Aufgaben zu erfüllen.
2.12 Gliederung
Ein Stellenplan gibt Auskunft über die erforderlichen
Führungskräfte und
Funktionsträger
der Freiwilligen Feuerwehr und sollte der Verordnung über die Mindeststärke und Ausrüstung entsprechen.
2.13 Dienstgrade und Funktionen
Entsprechend dem Stellenplan tragen die Führungskräfte und Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Dienstgrad- und Funktionsabzeichen.
Dienstgrade werden aufgrund einer Führungstätigkeit nach Erfüllung der Voraussetzungen
Dienstjahre
besuchte Lehrgänge und
persönliche Fähigkeit
den Feuerwehrangehörigen verliehen; sie können den Feuerwehrangehörigen nicht aberkannt werden.
Je nach Bundesland werden Dienstgradabzeichen getragen als:
Unterarmabzeichen,
Oberarmzeichen,
Kragenspiegel,
Schulterstücke oder
Schlaufen um Schulterstücke
Feuerwehrangehörige, die eine bestimmte Funktion ausüben, tragen an ihrer Dienst- und Einsatzkleidung Funktionsabzeichen.
Je nach der hierfür gültigen Verordnung werden Funktionsabzeichen getragen von z.B.:
Maschinisten,
Atemschutzgeräteträgern,
Sprechfunkern,
Wehrführern,
Führungskräften auf Gemeinde-, Kreis- oder Landesebene,
Jugendfeuerwehrwarten und
Musikern.
Damit besonders bei größeren Feuerwehreinsätzen Führungskräfte besser erkannt werden können, tragen Führungskräfte wie z.B.:
Gruppenführer
Wehrführer (Ortsbrandmeister)
Zugführer
Kreisbrandmeister, -inspektor, -inspekteur
Helmfunktionsabzeichen (rote Balken bzw. Ringe) am Feuerwehrhelm.
2.14 Verkehrssonderrechte
Befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen auf einer Einsatzfahrt, so dürfen unter entsprechender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verkehrssonderrechte in Anspruch genommen werden.
Von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO) befreit der §35 u.a. die Feuerwehr, soweit die Einsatzfahrt zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben (Brandbekämpfung / Hilfeleistung) erforderlich ist.
Da die Feuerwehr nahezu immer zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben gerufen wird, können dann auch diese Sonderrechte nach §35 StVO ausgenutzt werden, um den Einsatz der Feuerwehr durch Verkehrsvorschriften nicht zu erschweren und eine eventuelle Menschenrettung zu verzögern. Der Führer eines Feuerwehrfahrzeuges wird aber durch die Inanspruchnahme des §35 StVO nicht von der allgemeinen Sorgfaltspflicht im Verkehr entbunden (§1 StVO).
Besondere Vorsicht ist geboten:
beim Kreuzen von Vorfahrtstraßen,
beim Überqueren von Straßenkreuzungen bei rotem Ampellicht,
beim Durchfahren von Straßenbahn- und Verkehrsinseln und
beim Befahren von Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung.
Damit die übrigen Verkehrsteilnehmer die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr rechtzeitig wahrnehmen können, müssen diese Fahrzeuge durch einen roten Farbanstrich kenntlich gemacht werden und durch optische (Kennleuchte für blaues Blinklicht) und akustische (Einsatzhorn) Warneinrichtungen auf die hoheitliche Aufgaben hinweisen.
Andere Verkehrsteilnehmer haben der Feuerwehr sofort „freie Bahn“ zu schaffen, wenn die „Sondersignale“ der Feuerwehrfahrzeuge erkannt wurden: Es kann also bei Einsätzen der Feuerwehr Wegerecht nach §38 StVO in Anspruch genommen werden.
Blaues Blinklicht allein darf nur zur Warnung an Unfall- oder sonstigen Einsatzstellen oder bei Begleitung von Fahrzeugen oder von geschlossenen Verbänden verwendet werden.
2.15 Rechte und Pflichten des Feuerwehrangehörigen
2.15.1 Rechtsbestimmungen
Die Rechte und Pflichten der Angehörigen der Feuerwehren werden im Brandschutz- bzw. Feuerwehrgesetz geregelt.
Um bei Körperschädigungen, die aus Feuerwehrdienstunfällen herrühren, die Angehörigen der Feuerwehr sozial abzusichern, wurden die Feuerwehrunfallkassen gebildet.
Die Feuerwehrunfallkasse stellt sicher, dass materielle Schäden bzw. materielle Notlagen von Betroffenen, bzw. deren Familien, abgewendet werden.
Die Leistungen dieser Unfallkassen sind weitaus höher als in normalen gesetzlichen Unfallversicherungen.
Allerdings ist bei jeder Tätigkeit der Feuerwehr das Einhalten der Unfallverhütungsvorschriften unerlässlich. Durch laufende Unterweisungen sollen die besonderen Unfallgefahren im Feuerwehrdienst herausgestellt und deren Vermeidung angestrebt werden.
Die Gemeinden als Träger des Brandschutzes sind verpflichtet, die Feuerwehrangehörigen sozial abzusichern; sie also bei der Feuerwehrunfallkasse zu versichern, die auch die entstandenen Kosten trägt.
2.15.2 Dienstbetrieb
Die deutschen Feuerwehren sind im Deutschen Feuerwehrverband (DFV) zusammengeschlossen. Der DFV vertritt die Interessen seiner Mitglieder (Landesverbände bzw. Landesgruppen).
Die Jugendfeuerwehren innerhalb des DFV bilden die Deutsche Jugendfeuerwehr.
Die Landesfeuerwehrverbände sind die Vertretungen der Feuerwehren im Bereich der Bundesländer.
Die Kreisfeuerwehrverbände werden je nach Satzung gebildet durch
die
Delegiertenversammlung
,
den
Feuerwehrausschuss
, bestehend aus
den Wehrführern,
dem Kreisjugendfeuerwehrwart und
dem Vertreter der angeschlossenen Werkfeuerwehr,
dem
Vorstand
, bestehend aus
dem Vorsitzenden,
seinem gewählten Stellvertreter und
dem Geschäfts- und Kassenführer.
2.15.3 Dienstbetrieb in der Feuerwehr
Durch eine Satzung der Freiwilligen Feuerwehr ist festgelegt welche Besonderheiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes beachtet werden müssen. Dazu zählen z.B.:
Wann und wo ist Feuerwehrdienst?
Wie wird der Feuerwehrangehörige bei einem durchzuführenden Feuerwehreinsatz alarmiert?
Welche taktischen Einheiten (Trupp, Staffel, Zug, Bereitschaft) sind vorhanden und werden von wem geführt?
Welche besonderen Aktionen müssen von der Feuerwehr durchgeführt werden (Dienstplan)?
An die Feuerwehrführung einer Freiwilligen Feuerwehr werden besondere persönliche und fachliche Voraussetzungen und Anforderungen gestellt. Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr kann jeder Gemeindeeinwohner werden, der mindestens 16 Jahre alt, gesund und allen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen ist. Jeder Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr kann bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres aktiv Dienst in der Wehr verrichten. Nach Überschreiten dieser Altersgrenze können in der Altersabteilung die Kameradschaft und der Zusammenhalt fortgesetzt werden.
Besteht innerhalb der Ortsfeuerwehr eine Jugendabteilung (Eintrittsalter mindestens 10 Jahre), so können die Mitglieder bei Erreichen des 16. Lebensjahres in die aktive Wehr übernommen werden. Darüber entscheidet das Ortskommando, dem der Ortsbrandmeister bzw. Wehrführer vorsteht.
Mit seinem freiwilligen Eintritt in die Wehr unterwirft sich jedes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr den in der Satzung festgelegten Pflichten.
2.15.4 Rechte und Pflichten
Die aktive Wehr muss so organisiert sein, dass der Brandschutz und die Hilfeleistung sichergestellt sind. Es muss also eine leistungsfähige Wehr mit entsprechender personeller Besetzung, je nach Gebietsgröße und Objekten, aufgestellt werden.
Zu den Pflichten gehören
am Dienst und an Ausbildungslehrgängen regelmäßig und pünktlich teilzunehmen,
sich bei Alarm unverzüglich zum Dienst am Alarmplatz einzufinden (meistens Feuerwehrhaus),
den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzukommen,
im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den anderen Mitgliedern der Wehr gegenüber kameradschaftlich zu verhalten und
die ihm anvertrauten Ausbildungsgegenstände gewissenhaft zu pflegen und zu schonen.
Alle Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr hat neben diversen Pflichten durchaus auch Rechte, wobei das Wahlrecht in der Wehr von besonderer Wichtigkeit ist. Die Funktionsträger in der Wehr, wie z.B. der Ortsbrandmeister bzw. Wehrführer, Gruppen- und Zugführer werden nach der Satzung von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr vorgeschlagen und später in ihrem Amt bestätigt.
3 BRENNEN UND LÖSCHEN
Inhalte:
o Verbrennungsvoraussetzungen o Verbrennungsvorgang (Oxidation) o Verbrennungsprodukte (Atemgifte) o Brandklassen o Hauptlöschwirkungen (Kühlen, Ersticken) o Löschmittel
Groblernziele:
„Die Zusammenhänge zwischen Verbrennungsvoraussetzungen und den Löschwirkungen der Löschmittel in Grundzügen erklären können“
Empfohlene Methode:
Unterrichtsgespräch (UG) Versuche
3.1 Brennen
Die Verbrennung ist ein chemischer Vorgang, bei dem sich ein brennbarer Stoff unter Feuererscheinung (Licht- und Wärmeentwicklung) mit Sauerstoff verbindet.
3.1.1 Voraussetzungen für eine Verbrennung
Um brennbare Stoffe zum Verbrennen zu bringen, müssen mehrere Vorbedingungen vorliegen:
1. Brennbarer Stoff muss vorhanden sein
2. Sauerstoff muss ungehinderten Zugang zum brennbaren Stoff haben
3. Zündtemperatur des brennbaren Stoffs muss erreicht sein
4. Mengenverhältnis





























