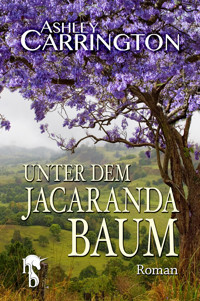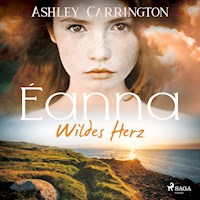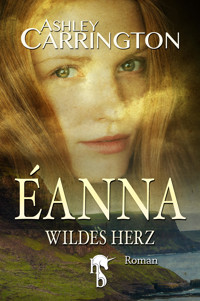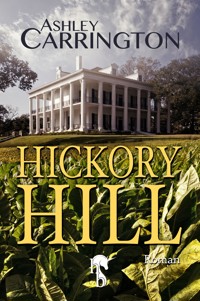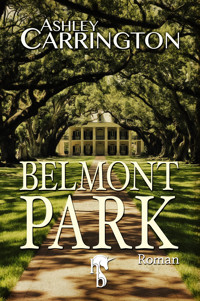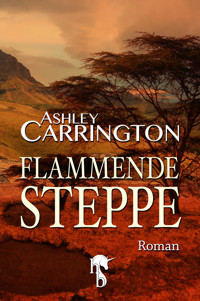
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Südafrika zur Zeit des Burenkrieges: Lena van Rissek wächst Ende des 19. Jahrhunderts in der Provinz Transvaal auf Leeuwenhof, der Farm ihrer Eltern, auf. Eigentlich soll die älteste Tochter von Stefanus van Rissek den Nachbarssohn Fabricius Bloem heiraten, sie fühlt sich aber viel mehr zu ihrem Halbbruder Julian hingezogen. Auch der Einzelgänger ist innerlich zerrissen wegen seiner Zuneigung zu Lena. Doch mit dem Auftauchen des britischen Lieutenants Lionel Faulkner werden Lenas Gefühle auf eine harte Probe gestellt: Eigentlich müsste sie ihn verachten, schließlich gehört er zu den verhassten Engländern. Lena findet dennoch nach und nach immer mehr Gefallen an dem jungen Offizier. Schließlich bricht der Burenkrieg aus. Bitteres Elend beherrscht den Alltag von Lena und ihrer Familie. Und die beiden Liebsten der jungen Farmerstochter kämpfen auf verschiedenen Seiten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ashley Carrington
Flammende Steppe
Roman
Für Monsignore Hanspeter Steinbach in herzlicher Zuneigung und Verbundenheit. Desiderium sinus cordis.
Teil 1 Leeuwenhof
1
Nichts hatte wirklich ein Ende oder einen Anfang. Im Strom der Zeit waren selbst Geburt und Tod nur willkürlich gesetzte Zäsuren, die etwas begrenzen sollten, was doch ewig im Fluss war und sich so wenig fassen ließ wie das gleißende Licht eines heißen Sommertages oder das sternerfüllte Dunkel der Nacht über der schier endlosen Weite Südafrikas. Zu dieser Erkenntnis gelangte Lena van Rissek jedoch erst, als sie selbst schon Mutter erwachsener Kinder war und ihr die Jahre ihrer Jugend auf Leeuwenhof wie aus einem fernen Traum erschienen.
Damals, in jener Zeit, kurz bevor Julian in ihrer aller Leben trat und sie, Lena, aus dem Dornröschenschlaf ihrer so trügerisch heilen, beschaulichen und sehr begrenzten Welt riss, damals waren ihr solche Gedanken jedoch so fremd wie die Einsicht, dass zwischen dem Schwarz und Weiß von Gut und Böse, von Richtig und Falsch ein erschreckend unübersehbares Labyrinth aus Grauzonen existierte.
Natürlich hatten die Ereignisse, die sich zu ihrem persönlichen Schicksal verdichteten, nicht mit jenem rätselhaften Brief begonnen, ja nicht einmal mit den Geschehnissen, die sich fast zwanzig Jahre vorher im fernen Kimberley zugetragen hatten. Die Kette der Ereignisse, die Julian schließlich nach Leeuwenhof brachten, hatte lange vor jenem milden Septembertag des Jahres 1896 eingesetzt. Später, im Rückblick, sollte es Lena jedoch so vorkommen, als hätte für sie alles mit diesem Tag im Frühling begonnen, an dem Adriaan, ihr ältester Bruder, vom Einkauf in Jonkheersdorp mit einem Brief für ihren Vater nach Leeuwenhof zurückkehrte.
»Ein Brief für dich, Pa! Aus Kimberley!«, rief Adriaan, bevor er noch die Pferde vor dem Farmhaus zum Halten gebracht hatte, und schwenkte ihn aufgeregt über seinem Kopf.
Adriaan, mit siebzehn der älteste von Stefanus van Risseks vier Kindern und fast drei Jahre älter als Lena, neigte sonst gar nicht zu Aufgeregtheiten, ganz gleich welcher Art. Darin sowie in seiner kräftigen Statur war er ganz das Ebenbild ihres Vaters. Doch wenn es schon ein besonderes Ereignis war, zum Einkauf nach Jonkheersdorp fahren zu dürfen, was seit oupa Willems Zeiten höchstens einmal im Monat, manchmal auch nur alle zwei Monate infrage kam, so war ein Brief eine noch größere Seltenheit.
Lena konnte sich nicht erinnern, dass irgendjemand auf Leeuwenhof jemals einen Brief erhalten hätte. Wozu auch? Die Welt der van Risseks umschloss die Farm am Vaal River, die Höfe ihrer befreundeten Nachbarn sowie die Siedlung Jonkheersdorp mit der einzigen Kirche im Umkreis. Vereeniging, die nächste Eisenbahnstation und gute vierzig Meilen entfernt, lag schon außerhalb ihrer vertrauten Welt, ganz zu schweigen von Pretoria, dem Regierungssitz der freien Burenrepublik von Transvaal, oder gar Johannesburg, dem Sodom und Gomorra der raffgierigen uitlanders, wie oupa Willem und Tante Sophie die Stadt der Goldbergwerke und Ausländer stets voller Abscheu zu nennen pflegten.
Nein, die burischen Farmer schrieben sich keine Briefe. Nicht, dass sie des Schreibens und Lesens nicht mächtig und von hinterwäldlerischer Einfalt gekennzeichnet gewesen wären, wie es die verhassten Engländer ihnen in ihrer heimischen Presse gern unterstellten. Weit gefehlt. Die meesters in den abgelegenen Farmschulen, so armselig diese Lehmhütten auch waren, nahmen ihre Aufgabe als Lehrer ernst und brachten mit jeder neuen Generation ein angemessenes Maß an Bildung in die Farmstuben, die der eines englischen Farmers mit Sicherheit um einiges überlegen war. Schon die täglichen Lesungen in der Heiligen Schrift, die kein aufrechter boer versäumte, sowie die sonntäglichen Gottesdienste auf der stoep des Farmhauses vor der versammelten Familie und den schwarzen Arbeitern machten diese Kenntnisse notwendig.
Aber zu Feder und Papier zu greifen und einen Brief abzufassen, war eine völlig andere Sache. Welchen Sinn hatte es auch, sich Briefe zu schreiben, kam man doch spätestens alle Vierteljahr zum nagmaal, zur Feier des Abendmahls, in Jonkheersdorp zusammen und sah sich darüber hinaus auch noch bei Beerdigungen, Hochzeiten und anderen besonderen Anlässen? Und wenn es außer der Reihe einmal etwas wirklich Wichtiges zu bereden gab, dann schwang man sich eben aufs Pferd und machte einen Besuch bei seinen Nachbarn. Damit hatte es sich. Aber Briefe schreiben? Unvorstellbar!
Und nun sprang Adriaan vom Kutschbock, mit einem Brief für seinen Vater in der Hand. Und dieser rätselhafte Brief kam noch nicht einmal aus dem eigenen Land und auch nicht aus der benachbarten zweiten Burenrepublik, dem Oranjefreistaat, sondern er kam aus Kimberley, und das lag bekanntlich in der britischen Kapkolonie!
Lena war mit ihrer anderthalb Jahre jüngeren Schwester Deleana aus der Küche hinaus auf die stoep, die überdachte Veranda, getreten, als das schwarze Küchenmädchen Sarie die Rückkehr des jungen baas gemeldet hatte. Tante Sophie, eine gedrungene Person von unermüdlichem Arbeitseifer und mit stets korrekt sitzender Haube und gestärkter Schürze, folgte ihnen auf dem Fuße, an den kräftigen Händen noch Mehl. Als Hanna van Rissek bei der Totgeburt ihres fünften Kindes im Wochenbett gestorben war, war ihre verwitwete, kinderlose Schwester nach Leeuwenhof gekommen, um ihrem Schwager in seiner Trauer beizustehen und vorübergehend im Haushalt und bei der Erziehung seiner vier halbwüchsigen Kinder zur Hand zu gehen. Das war vor acht Jahren gewesen und längst war Leeuwenhof zu ihrem Heim und der Haushalt zu ihrem unumstrittenen Herrschaftsbereich geworden.
»Ein Brief? Wer sollte Pa denn schreiben? Wir kennen niemanden in Kimberley!«, sagte Deleana altklug und tat die Sache damit ab, denn sie interessierte allein, ob Adriaan ihr den geblümten Stoff für ihr neues Sommerkleid mitgebracht hatte, das Pa ihr versprochen hatte.
»Sei nicht so vorlaut!«, wies Tante Sophie sie sofort zurecht und schoss ihr einen jener Blicke zu, der auch bei ihren schwarzen Bediensteten und Farmarbeitern gefürchtet war.
»Hoffentlich hat Adriaan den hellen und nicht den dunklen Stoff genommen!«, raunte Dele ihrer älteren Schwester zu. »Er hat mir jedenfalls versprochen, Pa zu sagen, dass es den dunklen nicht mehr gegeben habe. Tante Sophie wird zwar erst maulen, aber mit oupas Hilfe kriege ich sie schon dazu, dass sie ihn mir lässt und mir ein neues Sommerkleid näht.«
Tante Sophie, die sonst stets an den seltenen Einkaufsfahrten nach Jonkheersdorp teilnahm, schon um ein scharfes Auge darauf zu halten, dass kein unnötiges Geld ausgegeben wurde, hatte sich an diesem Morgen nicht wohl genug gefühlt, um sich die gut zwei Stunden auf holpriger Wegstrecke hin und noch einmal zurück zuzumuten. Und da ihr Vater dringende Arbeiten zu erledigen hatte und Nägel brauchte, war Adriaan diesmal allein gefahren. Eine günstige Gelegenheit, wie Deleana hoffte, um ihrer Tante und ihrem Vater mithilfe ihres Bruders ein Schnippchen zu schlagen.
»Versprochen hat Adriaan dir das nicht, Dele. Er wollte darüber nachdenken«, stellte Lena klar und wischte sich die Hände an der Küchenschürze trocken. Und wie sie ihren Bruder kannte, der es mit Ehre und Wahrheit sehr genau nahm, glaubte sie kaum, dass ihre Schwester mit dem hellen Stoff rechnen durfte. Um einer zu großen Enttäuschung vorzubauen, fügte sie deshalb hinzu: »Ich an deiner Stelle hätte mich sowieso für den dunklen entschieden. Erstens wird er nur halb so schnell schmutzig und zweitens steht er dir zu deinem blonden Haar auch entschieden besser.«
»Aber der helle Stoff ist viel hübscher!«, widersprach Dele trotzig.
»Lass das bloß nicht oupa und Tante Sophie hören!«, flüsterte Lena mahnend. »Sie würden dir sonst wegen deiner Eitelkeit eine Strafpredigt halten!« Sie zwinkerte ihrer Schwester zu, um ihren Worten die Schärfe zu nehmen.
»Pah!«, sagte Dele großspurig. »Was versteht oupa denn schon von hübschen Kleidern!« Doch sie senkte dabei nicht nur die Stimme, sondern auch den Kopf. Denn vor oupa Willem hatte man, so alt er auch war, ebenso wie vor ihrer resoluten Tante besser einen Heidenrespekt, wenn man sich das Leben nicht schwerer machen wollte, als es auch so schon war.
Oupa Willem, mit seinen dreiundsiebzig Jahren so dürr und hager wie ein Ladestock und von Wind und Wetter gegerbt wie ein langer Streifen biltong, die sonnengetrocknete Fleischdelikatesse der Buren, saß nur wenige Schritte von ihnen entfernt in seinem Stuhl auf der Veranda und schmauchte Pfeife. Sein zotteliger grauer Bart war von hässlichen braungelben Flecken gesprenkelt. Das kam vom Pfeifensud und weil oupa Willem sabberte, wie Tante Sophie immer wieder schimpfte, ohne dass er sich jedoch etwas aus ihrem Gezeter machte, ganz im Gegenteil.
Sein zerknittertes Gesicht, das den stummen Vorwurf erfunden haben konnte, trug wie üblich einen grimmigen Ausdruck, denn sein Sohn Stefanus hatte wieder einmal eine seiner Anweisungen an die Schwarzen rückgängig gemacht und ihnen andere Befehle gegeben. Schon vor über einem Jahrzehnt hatte er die Leitung der Farm an seinen einzigen Sohn abgetreten – sehr widerstrebend und auch nur notgedrungen. Wenn er nicht den schweren Unfall mit dem Ochsenwagen gehabt und davon einen steifen linken Arm sowie eine Gehbehinderung zurückbehalten hätte, hätte er auf Leeuwenhof noch immer das Regiment in alter Strenge geführt. Doch in all den Jahren, die seitdem vergangen waren, hatte er sich noch immer nicht damit abfinden können, dass nun sein Sohn Stefanus das Sagen hatte und von ihm höchstens noch Vorschläge, aber keine Befehle mehr entgegennahm.
Lena bemerkte, wie ihr Großvater einen Augenblick erstarrte, als er Adriaans Ruf vernahm. Und auch Tante Sophie reagierte äußerst merkwürdig, öffnete sie doch wie in ungläubigem Erschrecken den Mund, um ihn schon im nächsten Moment mit der flachen Hand zu verschließen, ohne sich um das Mehl an ihren Fingern zu kümmern.
»Ein Brief …? Aus Kimberley?«, stieß Willem van Rissek aus und seine grimmige Miene wich einem Ausdruck der Bestürzung. »Gib ihn mir, jong.«
Er schoss förmlich aus seinem Stuhl hoch, dessen Rückenlehne und Sitzfläche aus geflochtenen rienu, Lederriemen, bestanden, und streckte die Hand fordernd nach dem Brief aus.
»Er ist an Pa gerichtet«, sagte Adriaan.
»Zeig schon her!«, rief oupa Willem ungeduldig.
Tante Sophie gab keinen Ton von sich.
Adriaan blieb zögernd neben dem leichten Zweispänner stehen und blickte zu seinem Vater hinüber.
Stefanus van Rissek kam mit Hendrik, seinem zweitgeborenen Sohn, der von so stillem, aber verlässlichem Wesen wie die kleine Quelle hinter dem Obsthain war, vom Kraal über den Hof. Er war ein stämmiger, breitschultriger Mann in abgewetzter, selbst gefertigter Lederkleidung und mit einem dichten, bis auf die Brust reichenden Vollbart, der noch so pechschwarz war wie einst sein Haupthaar, das nun bereits sichtlich grau zu werden begann. »Was gibt es, Adriaan?«, rief er schon aus einem Dutzend Schritte Entfernung. »Habe ich richtig gehört? Du bringst einen Brief aus Jonkheersdorp?«
»Ja, Pa. mijnheer Ohlsson, der Posthalter, ist extra über die Straße zu Cornelius in den Laden gekommen, um ihn mir auszuhändigen. Es wollten natürlich alle wissen, was es damit auf sich hat. Aber ich konnte ihnen nichts sagen, weil auch ich mit dem Absender nichts anzufangen weiß«, antwortete Adriaan und reichte seinem Vater den Brief. »Er kommt aus Kimberley. Absender ist eine gewisse Claire Rounard. Sagt dir der Name etwas, Pa?«
Stefanus van Risseks Hand zuckte bei dem Wort »Kimberley« von dem Brief zurück, als hätte er sich daran verbrannt. Und als der Name Claire Rounard fiel, wich das Blut aus seinem Gesicht.
Lena sah, wie der Blick ihres Vaters zu oupa hinüberging, dessen Gesicht zu einer starren finsteren Maske geworden war, und anschließend kurz zu Tante Sophie, um sich dann schnell wieder auf den Brief zu richten.
»Claire Rounard. Ja, das tut er … in der Tat«, murmelte Stefanus mit merkwürdig rauer Stimme und nahm das Schreiben mit deutlichem Zögern an sich. Einen Moment stand er reglos da, dann straffte sich sein Körper, er steckte den Brief scheinbar gleichgültig in seine Hosentasche und wechselte, als träfe häufig Post auf Leeuwenhof ein, das Thema, indem er fragte: »Hast du die Nägel und die Quasten bekommen?«
Adriaan sah ihn verständnislos an. »Ja, natürlich, ich habe alles bekommen, was auf der Liste stand … Aber sag mal, willst du denn nicht lesen, was diese Claire Rounard dir da aus Kimberley geschrieben hat und was sie von dir will?«
»Sicher, zu seiner Zeit«, antwortete Stefanus knapp und in einem barschen Ton, der sonst so gar nicht seine Art war, fügte er hinzu: »Wir haben noch zwei Stunden Tageslicht und jede Menge Arbeit. Also stehlt nicht Gott die Zeit mit neugierigen Fragen und untätigem Herumstehen, sondern geht gefälligst wieder an die Arbeit. Adriaan, spann die Pferde aus und sieh zu, dass sie gut abgerieben werden. Hendrik, wir machen drüben im Kraal weiter!« Damit drehte er sich abrupt um und ging mit schnellen Schritten, die etwas Überstürztes an sich hatten, über den Hof zurück zum großen Ochsengehege.
Alle vier Geschwister blickten ihrem Vater nach, verdutzt und verwirrt von seinem merkwürdigen Benehmen, das ohne Zweifel dieser Brief ausgelöst hatte. Hendrik zuckte mit den Schultern und beeilte sich dann, seinem Vater zu folgen.
»Kimberley! Ein noch größerer Sündenpfuhl als Johannesburg! Soll der Teufel beide holen!«, schnaubte oupa Willem verächtlich und machte eine Handbewegung, als wollte er die Diamantenstadt in der Halbwüste wegwischen wie eine lästige Schmeißfliege. Mit finsterer Miene sackte er wieder in seinen Lehnstuhl und biss auf den Pfeifenstiel, dass es knackte.
Schweigend, ohne ein Wort der Ermahnung an Lena und Deleana, wandte sich Tante Sophie um und verschwand im Haus. Deutlicher hätte sie ihre Verschwörung gar nicht zum Ausdruck bringen können.
Deleana überwand die Verblüffung als Erste. Sie lief zu ihrem Bruder. »Hast du den hellen Stoff gekauft?«, fragte sie ihn mit einem erwartungsvollen Glänzen in den Augen.
Adriaan sah an seiner Schwester vorbei. »Nein, ich habe den dunklen genommen. Oder hast du wirklich erwartet, dass ich lüge und mich gegen Gottes Gebot versündige, nur um deine kindliche Eitelkeit zu befriedigen?«
Deleana machte ein langes Gesicht. »Du hattest es mir aber versprochen!«, maulte sie.
»Komm mir nicht damit, Dele! Das hast du dir bloß eingeredet!« Er klang nun ärgerlich. »Du solltest dankbar sein, dass Pa und Tante Sophie dir überhaupt ein neues Kleid erlaubt haben, nachdem du doch erst letztes Jahr das gestreifte bekommen hast.«
»Das war ein altes, abgetragenes von Lena, nur ein bisschen umgenäht!«, sagte Deleana verdrossen.
»Ach was, Lena gibt viel zu sehr acht auf ihre Sachen, als dass sie abgetragen wären, wenn sie aus ihnen herausgewachsen ist. Und jetzt lass mich damit zufrieden«, sagte er ungehalten, schob seine Schwester beiseite und spannte zusammen mit Tambu, dem schwarzen Stallknecht vom Stamm der Hottentotten, die Pferde aus.
An diesem Abend herrschte eine seltsame Atmosphäre beim Essen. Adriaan erzählte von dem Klatsch und den politischen Nachrichten, die er in Jonkheersdorp erfahren hatte. Doch diesmal schien sich niemand dafür zu interessieren. Ihr Vater hörte überhaupt nicht hin und rührte sein Essen kaum an. Mit abwesendem Blick saß er am Tisch. Auch Tante Sophie und oupa Willem schien der Appetit vergangen zu sein, denn sie stocherten ebenfalls auf ihren Tellern herum. Lena und ihre Geschwister wussten, dass das sonderbare Verhalten der Erwachsenen mit dem Brief zusammenhängen musste. Aber niemand von ihnen traute sich, auch nur eine vage Frage in dieser Richtung zu stellen.
Wie es auf Leeuwenhof und auch fast allen anderen Burenfarmen seit Generationen der Fall war, wurde nach dem Abendessen aus der Bibel vorgelesen, vorzugsweise aus dem Alten Testament.
An diesem Abend war Lena mit Vorlesen an der Reihe, doch sie konnte sich nur mit größter Mühe auf den Text aus dem Buch Exodus konzentrieren. Sie hatte zudem den Eindruck, dass ihr niemand zuhörte. Kaum hatte Tante Sophie ihr nach etwa zwanzig Minuten mit einem kurzen Auftippen ihrer Stricknadel auf die Tischkante zu verstehen gegeben, dass sie mit dem Ende des Kapitels aufhören konnte vorzulesen, da erhob sich ihr Vater auch schon abrupt und ging mit einem gemurmelten Gutenachtgruß nach draußen.
Lena griff zu ihrer Handarbeit, während Hendrik und Adriaan in der anderen Ecke der Küchenstube ihre Gewehre einer völlig überflüssigen Reinigung unterzogen und sich dabei leise unterhielten.
Als es allmählich Zeit für sie und ihre Schwester wurde, zu Bett zu gehen, begab sich Lena mit der großen Kanne zum Brunnen, um frisches Wasser für ihre Waschkrüge zu schöpfen.
Zwischen den Rundhütten der Schwarzen mit ihren Wellblechdächern, die sich etwas abseits des Farmhauses hinter den Viehkraals zusammendrängten, flackerte das unruhige Licht eines offenen Feuers. Die Nacht war klar und kühl nach der Wärme des Frühlingstages.
Lena hatte die Kanne gefüllt, als die erregte Stimme ihres Großvaters an ihr Ohr drang, gefolgt von einer scharfen Antwort ihres Vaters.
Sie blieb stehen und sah zum schweren Ochsenwagen hinüber, der voll beladen ein sechzehnköpfiges Gespann verlangte. Der achtzehn Fuß lange Planwagen, gebaut von einem bekannten Wagenmacher in Graaff-Reinet, stammte aus der legendären Zeit des Großen Trecks, den oupa Willem noch als Halbwüchsiger miterlebt hatte und von dem er stundenlang fesselnd zu erzählen wusste, besonders von den blutigen Gefechten mit den kriegerischen Bantustämmen und der tollkühnen Überquerung der mächtigen Drakensberge.
Doch an diesem Abend stand oupa Willem nicht dort auf der anderen Seite des Wagens und unterhielt sich mit ihrem Vater über den Exodus der Buren aus der britischen Kronkolonie vor gut sechzig Jahren. Sie stritten sich und ihr Streit hing mit dem Brief zusammen, den Adriaan am späten Nachmittag gebracht hatte, daran hegte Lena nicht den geringsten Zweifel.
Unwillkürlich ging sie einige Schritte auf den Wagen zu, der sich als schwarze Silhouette vor dem Nachthimmel abhob, um vielleicht das eine oder andere Wort aufzuschnappen. Es war nicht recht zu lauschen, aber ihre Neugier war stärker als ihre Gewissensbisse.
»… diese unselige Frau!«, schimpfte oupa Willem.
»Rede von ihr nicht ständig als ›diese Frau‹, als hätte sie keinen Namen und kein Gesicht!«, entgegnete ihr Vater heftig. »Sie hat einen Namen und der ist Claire!«
»Magtig! Ob nun Claire oder ›diese Frau‹, sie ist tot. Punktum! Und damit sollte dieses unerfreuliche Kapitel in deinem Leben, nein, in unser aller Leben ein für alle Mal abgeschlossen und vergessen sein!«
Lena hörte ihren Vater bitter auflachen. »O ja, du und Mutter, ihr habt es euch schon immer sehr leicht damit gemacht. Du willst nicht daran erinnert werden, ich weiß, aber ich habe ›diese Frau‹ Claire geliebt!«
»Dummes Zeug!«, ging oupa schroff darüber hinweg. »Dieses Weib hatte dir den Kopf verdreht, weiter nichts. Geliebt hast du allein Hanna, die Mutter deiner Kinder, und erzähl mir nicht etwas anderes!«
»Ja, ich habe Hanna geliebt«, gab ihr Vater mit belegter Stimme zu, »aber anders … nicht so wie Claire.«
»Ich will ihren Namen nicht mehr hören!«, herrschte oupa ihn an. »Sie ist tot. Meinetwegen pflege du deine lächerlichen Erinnerungen an die Torheiten deiner Jugend, aber lass uns und Leeuwenhof aus dem Spiel.«
»Du vergisst Julian!«
»Ich will nichts mehr hören!« Oupa Willem schrie fast.
»Warte!«, rief ihr Vater. »Die Zeiten, da ich mich deinem Willen zu beugen hatte, sind schon seit einigen Jahren vorbei. Ich verlange …«
Lena bekam nicht mehr mit, was ihr Vater verlangte, denn sie eilte hastig zum Farmhaus zurück, weil sie fürchtete, bemerkt zu werden, wenn oupa Willem wutentbrannt hinter dem Wagen hervorstürzte.
»Wo bist du bloß so lange gewesen?«, fragte Deleana, mit der Lena eine kleine Kammer teilte, als sie ihren Wasserkrug auf der schmalen Waschkommode auffüllte.
»Ich habe mir die Sterne angeschaut«, log Lena und schämte sich dafür.
Ihre Schwester verdrehte die Augen. »Manchmal bist du richtig komisch, fast so wie Pa und oupa und Tante Sophie!«, warf sie ihr missmutig vor.
»Danke, wie nett von dir«, sagte Lena, ohne jedoch ernstlich böse zu sein, kannte sie doch die Launen und Sprunghaftigkeit ihrer Schwester. Rasch zog sie sich bis auf Leibchen und Schlüpfer aus, streifte das lange Nachthemd über und entledigte sich erst dann, ganz wie es die Schicklichkeit gebot, ihrer Unterwäsche.
»Ich möchte zu gern wissen, warum sie sich wegen dieses blöden Briefes bloß so seltsam anstellen«, überlegte Deleana laut, vor ihrem Bett kniend, bereit zum gemeinsamen Nachtgebet. Doch derlei Dinge beschäftigten sie nicht wirklich, jedenfalls nicht länger als ein Schmetterling brauchte, um von einer hübschen Blüte zur anderen zu flattern. »Aber eigentlich soll es uns ja egal sein. Was interessiert es uns auch. Sag mal, glaubst du, Tante Sophie lässt diesmal einen kleinen weißen Rüschensaum am Kragen meines neuen Kleides zu?«
»Wenn du einen guten Augenblick bei ihr erwischst …« Lena ließ den Satz unbeendet und meinte dann: »Komm, lass uns beten. Es ist schon spät.«
Sie sagten ihr Nachtgebet und Lena fügte den vertrauten Worten hinterher noch in Gedanken die Bitte um Vergebung für ihr Lauschen und ihre Lüge mit den Sternen hinzu, bevor sie das Licht löschte und in ihr Bett schlüpfte.
Dele redete noch eine Weile leise über ihr Kleid und welchen Schnitt sie sich wünschte, ohne dass sie eine Entgegnung von ihrer Schwester erwartete.
Lena war froh darüber, dass Dele ihr eigenes Geplapper genügte, denn ihr stand der Sinn wahrlich nicht danach, sich mit ihr über Schnittvorlagen, Rüschensäume und gebauschte Ärmel zu unterhalten. Ihre Gedanken kamen nicht von dem los, was sie auf dem Hof von dem erregten Wortwechsel zwischen ihrem Vater und oupa Willem aufgeschnappt hatte, und sie wusste, dass sie in dieser Nacht noch lange wach liegen würde. Zu viel ging ihr durch den Kopf und gab ihr Rätsel auf.
Dass ihr Vater noch eine andere Frau als ihre Mutter geliebt hatte, war für sich schon eine Sensation und aufregend genug, um ihre Fantasie tage-, ja wochenlang zu beflügeln. Doch wer war diese mysteriöse Claire Rounard und wie konnte eine Tote ihrem Vater einen Brief aus Kimberley schreiben?
Und vor allem: Wer war Julian?
2
Als ihr Vater den Brief am nächsten Morgen nicht mit einem einzigen Wort erwähnte und sich auch in den folgenden Tagen darüber ausschwieg, so als existierte er überhaupt nicht, nahmen Lenas Geschwister das zwar mit Verwunderung zur Kenntnis, doch diese Verwunderung war von sehr flüchtiger Natur. Die brennende Neugier, die Lena insgeheim empfand, und die blühende Fantasie fehlten ihnen völlig.
»Pa wird schon wissen, warum er sich nicht über den Brief auslässt«, meinte Adriaan, als sie im Geschwisterkreis einmal darüber redeten.
Hendrik nickte auf seine bedächtige Art. »Es wird etwas sehr Persönliches gewesen sein«, sagte er bedeutsam, als wäre er nach intensivem Nachdenken zu einer gewichtigen Erkenntnis gelangt.
Dass Hendrik etwas langsam im Kopf und von schlichtem Gemüt war, hatte Lena an ihrem Bruder nie als Mangel empfunden und würde es auch zukünftig nicht tun. Seine Warmherzigkeit und seine Sanftmut wogen in ihren Augen mehr als reichlich auf, was ihm an Geistesgaben fehlen mochte. Sie hing sehr an Hendrik, mehr noch als an Adriaan, der sie häufig wie ein kleines Kind behandelte und alles abtat, was sie sagte. Doch in diesem Fall wünschte sie, dass Hendrik mehr Interesse und so etwas wie Spekulationsfreude gezeigt hätte. Denn wenn sich ihre älteren Brüder offen Gedanken über den Brief und seine Absenderin gemacht hätten, hätte sie vielleicht eine Möglichkeit gefunden, das beizusteuern, was sie aufgeschnappt hatte, ohne sich dadurch in ein allzu schlechtes Licht zu stellen.
»Also ich hätte schon gern gewusst, was es mit dieser Claire Rounard aus Kimberley auf sich hat«, warf Lena vorsichtig und in der Hoffnung ein, das Gespräch über den mysteriösen Brief am Leben zu erhalten.
Ihre Schwester zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Was kümmert uns eine Person, von der wir nie gehört haben und die zudem in Kimberley lebt«, sagte sie ohne jedes Interesse. Sie hatte für nichts anderes als für ihr neues Kleid Gedanken und wann sie es wohl zu welcher Gelegenheit zum ersten Mal tragen und zur Schau stellen konnte.
»Ja, wenn Pa nicht darüber reden will, dann geht sie uns auch nichts an!«, bekräftigte Adriaan und sein bestimmter Ton ließ keinen Widerspruch zu. »Und deshalb werden wir ihm auch keine Fragen danach stellen.« Damit war die Angelegenheit für ihn, Hendrik und Deleana erledigt.
Nicht jedoch für Lena. Wenn sie sich auch an Adriaans Anordnung hielt, ihren Vater nicht mit Fragen zu belästigen, so konnte sie den Brief und was sie von oupa Willem und ihrem Vater zufällig auf ihrem nächtlichen Gang zum Brunnen gehört hatte doch nicht aus ihren Gedanken verbannen.
Darüber nachzusinnen und sich aus den wenigen Bruchstücken eine spannende Geschichte auszudenken, war ihr eine willkommene Ablenkung bei ihren Pflichten, mit denen Tante Sophie sie betraut hatte. Aber mit solchen Geschichten beschäftigte sie ihren Geist nicht nur gern beim Versorgen der Hühner, beim Kochen von Seife und bei all den vielen anderen Arbeiten, die auf einer Farm nun mal anfielen und die nicht allein von ihren Schwarzen zu bewältigen waren. Auch wenn sie mal eine Stunde ganz für sich hatte und dann durch den Obsthain streifte oder hinunter zum Vaal River zu ihrem Lieblingsplatz unter den Weiden lief, sann sie darüber nach, während sie die Libellen beobachtete, die dicht über der Wasseroberfläche tanzten, und dem Treibholz in den schlammigen braunen Fluten des breiten Flusses nachsah. Oft las sie hier auch in Van Dykes Enzyklopädie der Weltgeschichte, dem einzigen Buch, das ganz allein ihr gehörte und das sie wie einen Schatz hütete, obwohl der feste Einband fehlte und es schon sehr zerfleddert war. Die Geschichten, die da über unvorstellbar ferne und fremde Kulturen aufgezeichnet waren, über ihren Aufstieg und Untergang, faszinierten sie, auch wenn sie vieles nicht verstand. Leider ging das Buch nur bis zum Buchstaben K und sie hätte gern gewusst, was unter den anderen Buchstaben Weltgeschichte gemacht hatte. Aber als sie einmal zaghaft die Frage geäußert hatte, ob es nicht möglich sei, irgendwo den zweiten Band zu erstehen, da hatte Tante Sophie auf ihr Ansinnen mit scharfer Missbilligung reagiert und erklärt, dass alles, was ein rechtschaffener Mensch aus einem Buch zu erfahren habe, in der Bibel zu finden sei.
»Ich wünschte, Rachel wäre hier. Mit ihr könnte ich sprechen«, seufzte sie eines Nachmittags vor sich hin, als sie wieder einmal im Schatten ihrer Lieblingsweide am Flussufer saß. Rachel Boshof war ihre beste Freundin und genauso alt wie sie. Sie lebte mit ihren Eltern und Geschwistern auf Groen Veld, einer der benachbarten Farmen. Mit Rachel konnte sie über alles reden und vor ihr hatte sie keine Geheimnisse, ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester, die einfach nichts für sich zu behalten vermochte. Wie schade, dass Rachel und sie sich bloß so selten sahen. Was hätte sie ihr jetzt nicht alles zu erzählen!
Über zwei Wochen waren seit dem Eintreffen des Briefes auf Leeuwenhof vergangen und der Frühling neigte sich merklich den heißen Monaten des Sommers zu. Sie hatte den Rock ihres wollenen Kleides so weit hochgeschoben, dass ihre Beine über die Knie hinaus bis an den Rand ihres langen Schlüpfers entblößt waren. Sie liebte es, wenn der warme Wind über ihre nackte Haut strich, und das Wissen, dass es nicht nur skandalös unschicklich war, sondern auch zutiefst sündig, den eigenen Körper so zu entblößen und daran auch noch Gefallen zu finden, dieses Wissen steigerte den heimlichen Genuss noch. Manchmal spürte sie sogar das Verlangen, sich all ihrer Kleidungsstücke zu entledigen und nackt, wie Gott sie geschaffen hatte, hier zu stehen und überall auf ihrem Körper den warmen Wind und den Sonnenschein zu spüren. Und wann immer sie dieser Gedanke überfiel, schoss ihr das Blut vor Scham, aber auch aus einer ihr unerklärlichen inneren Erregung heraus, heiß ins Gesicht.
Lena lachte kurz auf. »Tante Sophie würde der Schlag treffen, wenn sie mich so erwischen würde!«, rief sie einem Blaureiher zu, der oberhalb von ihr am Ufer entlangstolzierte und im Röhricht nach Beute Ausschau hielt, die er mit seinem langen Schnabel aufpicken konnte.
Sie zupfte ihren Rock wieder eine Handbreit herunter und dachte über die letzten zweieinhalb Wochen nach. Auf der Farm ging scheinbar alles seinen normalen Gang, was zu dieser Jahreszeit bedeutete, dass die Arbeit kein Ende nahm. Die mielies, der Mais, schoss kräftig aus dem Boden und verlangte die ganze Aufmerksamkeit der schwarzen Farmarbeiter, die über die Felder gingen, den Boden lockerten, Käfer vernichteten und das hartnäckig nachwachsende Unkraut ausmachten. Die Obstbäume standen in voller Blütenpracht und wurden umsummt von den Bienenschwärmen aus den eigenen Bienenstöcken, um die sich allein oupa Willem kümmerte. Die Imkerei auf Leeuwenhof war das Einzige, wo ihm niemand hineinredete und wo allein er bestimmte, was getan wurde.
Schaf- und Rinderherden machten in diesen Wochen ebenfalls viel Arbeit, weil – wie in jedem Jahr – auch diesmal wieder gefährlichen Krankheiten vorzubeugen war. Zwei trächtige Stuten brachten zudem durch komplizierte Geburten, bei denen ein Fohlen tot zur Welt kam, die männlichen van Risseks mehrfach um den Nachtschlaf; allein oupa Willem ließ sich nicht um seine Bettruhe bringen.
»Ich habe genug Nächte gewacht!«, prahlte er. »Aber da ging es nicht um eine Stute, die nicht weiß, wie sie ihr erstes Fohlen zu kriegen hat, sondern darum, wann die Xhosas oder Zulus ihren nächsten Angriff unternehmen und ob wir beim kommenden Sonnenaufgang noch leben oder von Assegais dahingeschlachtet in unserer Wagenburg liegen würden. Also macht mal nicht so viel Worte um die paar schlaflosen Nächte!«
Ja, und Dele lag Tante Sophie so lange in den Ohren, bis diese an die Arbeit des Zuschneidens und Nähens ging. Den Saum aus weißer Rüsche oder Spitze am Kragen gestand sie ihrer Nichte jedoch nicht zu.
»Dafür bist du noch mindestens drei Jahre zu jung, Kind!«, erklärte Tante Sophie zurechtweisend, als Dele wieder einmal nachbohrte, um sie anderen Sinnes zu stimmen. »Weiße Rüschen- oder Spitzenkragen sind etwas für junge Frauen, die alt genug sind, dass ein Mann ihnen den Hof machen darf.«
»Ja, und du bist noch nicht einmal alt genug, um dir einen ordentlichen Zopf zu flechten oder eine Schleife zu binden, die nicht ständig aufgeht«, warf Adriaan spöttisch ein und spielte damit auf Deles Nachlässigkeit und mangelnde Ausdauer an.
Dele maulte über Tante Sophies Unnachgiebigkeit, schoss Adriaan einen wütenden Blick zu und streckte ihm hinter seinem Rücken die Zunge heraus, was Hendrik bemerkte und mit einem gutmütigen Schmunzeln bedachte. Derweil saß oupa Willem auf der stoep und paffte seine Pfeife.
Ja, das Leben auf Leeuwenhof schien in seinen vertrauten Bahnen zu verlaufen. Doch Lena spürte nicht nur, sondern wusste, dass der Schein trog. Was ihre Geschwister übersahen oder anders interpretierten, sprach für sie eine deutliche Sprache: dass oupa Willem in den ersten Tagen nach dem Eintreffen des Briefes kein Wort mit Pa redete und aus angeblichem Unwohlsein sogar mehrfach den gemeinsamen Mahlzeiten fern blieb; dass Tante Sophie ihrem Schwager sichtlich aus dem Weg ging und die abendliche Bibellesung ungewöhnlich kurz hielt, als könnte sie nicht schnell genug in ihre Kammer kommen, wo sie dann laut und wie beschwörend die Psalmen betete; dass Pa einen in sich gekehrten und oftmals abwesenden Eindruck machte. All das verriet Lena, dass die Angelegenheit mit dem Brief und mit jenem geheimnisvollen Julian noch längst nicht beigelegt, sondern noch immer unter der Oberfläche scheinbarer Normalität gegenwärtig war.
Am Ende der ersten Woche beobachtete Lena, wie ihr Vater und oupa Willem sich wieder einmal stritten. Ihren heftigen Gesten nach zu urteilen, schienen sie sich ordentlich in die Haare geraten zu sein. Doch hören konnte sie kein Wort, denn die beiden Männer standen weit draußen auf dem veld. Wenige Tage später kam es im Haus zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen ihnen. Tante Sophie schickte sie sofort nach draußen, kaum dass oupa Willem die Stimme erhoben hatte.
»… mir nicht ins Haus«, hörte Lena ihren Großvater erregt sagen. »Nur über meine Leiche!«
»Ich bin hier der baas! Finde dich endlich damit ab. Ich habe mich lange genug von dir schurigeln lassen. Damit ist es ein für alle Mal vorbei!«, entgegnete ihr Vater nicht minder erregt. »Und in diesem Fall werde ich um keinen Preis nachgeben. Um keinen Preis, hast du mich verstanden? Das bin ich mir schuldig – und nicht nur mir! Ich lasse mich nicht noch einmal von dir erpressen!«
Was oupa ihm darauf antwortete, bekam Lena nicht mehr mit, denn Tante Sophie schubste sie aus der Tür ins Freie. »Und komm erst gar nicht auf den sündigen Gedanken, irgendwo am Fenster lauschen zu wollen!«, warnte sie.
Nach diesem Streit war oupa Willem tagelang geradezu unausstehlich. An allem und jedem hatte er etwas auszusetzen und zu nörgeln. Sogar mit Tante Sophie, mit der er sich sonst so gut verstand, legte er sich an und einmal hörte Lena ihren Großvater wütend zu ihr sagen: »Du hast ein Rückgrat aus Maisbrei, Sophie! Aber was kann man schon von Weibern erwarten!« Und damit knallte er die Tür zu seiner Kammer zu.
Danach gab es keine hässlichen Szenen mehr. Lena reimte sich zusammen, dass oupa Willem sich schließlich damit abgefunden hatte, seinen Willen nicht durchsetzen zu können, worum auch immer es bei dem Streit mit ihrem Pa gegangen war.
Irgendwie hatte sie den Eindruck, als machte sich ihr Vater aber noch immer Sorgen. Manchmal beobachtete sie ihn dabei, wie er mit bedrückter Miene in die Ferne schaute, ohne dabei jedoch einen bestimmten Punkt auf dem veld zu fixieren. Dann spürte sie ganz stark den Wunsch, ihm zu helfen. Doch sie wusste nicht, wie.
In der letzten Oktoberwoche fuhr ihr Vater nach Jonkheersdorp und Lena war froh, dass sie ihn begleiten durfte. Es war eine schweigende Fahrt, aber das machte ihr nichts aus. Aus einem ihr selbst unerfindlichen Grund fühlte sie sich ihrem Vater so nahe wie nie zuvor.
Jonkheersdorp bestand in seinem Kern aus nicht mehr als vier, fünf Dutzend Häusern an zwei rechtwinklig zueinander verlaufenden staubigen Straßen, die sich auf dem großen Marktplatz kreuzten. Hier waren die Kirche und auch der outspan für die schweren Ochsenfuhrwerke der Farmer aus der Umgebung.
Lena wunderte sich nicht, als ihr Vater den Posthalter aufsuchte und einen Brief aufgab. Sie stellte keine Fragen, doch dass er an eine Adresse in Kimberley gerichtet war, darauf hätte sie sogar ihr kostbares Silbermedaillon verwettet, das einmal ihrer Mutter gehört und das Pa ihr zu ihrem vierzehnten Geburtstag geschenkt hatte.
Sie blieben nicht lange in Jonkheersdorp, denn es gab eigentlich auch nichts, was sie besorgen mussten. Die wenigen Sachen, die sie in Rykloff Wagenaars Winkel einkauften, sollten Lena wohl nur darüber hinwegtäuschen, dass in Wirklichkeit der aufzugebende Brief der alleinige Anlass für diese Fahrt gewesen war.
Nach dem kurzen Einkauf suchten sie die Kirche auf, wo ihr Vater in einem langen, stummen Gebet in der Bank verharrte. Dann fuhren sie zurück nach Leeuwenhof.
»Du bist so bedrückt, Pa«, rutschte es Lena heraus, als sie sein trauriges Gesicht sah. »Schon seit vielen Tagen. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, damit du nicht mehr so traurig bist.«
Berührt und betroffen zugleich warf er einen Blick auf seine älteste Tochter. »Sieht man es mir so deutlich an, meintiere?«
Sie nickte. »Seit der Brief gekommen ist.«
Er schwieg einen langen Moment, dann seufzte er und sagte etwas, was sie erst viel später verstehen sollte: »Nichts hat wirklich einen Anfang oder ein Ende, Lena.«
»Wie meinst du das, Pa?«
»Dinge, die man längst für abgeschlossen und für vergessen gehalten hat, hat man in Wirklichkeit Jahre, ja Jahrzehnte immer mit sich getragen«, sagte er, ohne dass es damit mehr Sinn für Lena ergab.
»Und deshalb bist du so bedrückt?«, fragte Lena, der es eigentlich egal war, dass sie nicht verstand, was er damit meinte. Es reichte ihr und erfüllte sie mit einem warmen Empfinden der Zuneigung, dass er überhaupt mit ihr über das redete, was keinen von ihren Geschwistern interessierte, geschweige denn jemand in seiner Gegenwart anzuschneiden gewagt hätte.
»Ja, das bin ich«, gab er zu und lachte dann unsicher auf. »Aber andererseits bin ich auch … nun ja, freudig aufgeregt. Alle Dinge haben nun mal zwei Seiten.«
»Bist du aufgeregt wegen …« Sie stockte und fasste sich dann ein Herz. »… wegen Julian?«
Ihr Vater sah sie überrascht an. »Woher hast du diesen Namen?« Lena erzählte es ihm.
Er lächelte nachsichtig, als sie beteuerte, diese Wortfetzen nur zufällig aufgeschnappt zu haben. »Ja, es stimmt. Ich bin wegen Julian bedrückt und zugleich auch voll freudiger Aufregung.« Er legte eine nachdenkliche Pause ein, während er das Gespann über eine Gruppe sanfter kopjes, kleiner Hügel, lenkte, und fragte dann: »Und jetzt möchtest du wissen, wer dieser Julian ist und worum es bei der ganzen Aufregung geht, nicht wahr?«
Lena brannte darauf, genau das zu erfahren, erinnerte sich jedoch der Worte ihrer Brüder. Und deshalb antwortete sie mit artiger Zurückhaltung: »Du wirst es uns schon sagen, wenn du meinst, dass wir es wissen sollen … und wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, Pa.«
Liebevoll tätschelte er ihren Arm. Doch sein Lächeln hatte etwas Gequältes, als er mit einem schweren Seufzer erwiderte: »Ja, der richtige Zeitpunkt … Wann ist er gekommen? Allzu oft weiß man das erst hinterher, wenn man ihn verpasst hat.«
Lena erwartete, dass ihr Vater sie nun in das Geheimnis um Julian und diese Claire Rounard einweihen würde. Doch stattdessen fiel er in ein tiefes, brütendes Schweigen, das den ganzen restlichen Weg zurück nach Leeuwenhof anhielt.
Erst war sie enttäuscht, tröstete sich dann jedoch damit, dass zwischen ihr und ihrem Vater in dieser geheimnisvollen Sache durch ihr Gespräch ja doch ein Band stillschweigender Übereinkunft entstanden war, von dem weder ihre Geschwister noch sonst jemand auf der Farm auch nur eine vage Ahnung besaß. Lena fasste sich in Geduld, sagte ihr doch ihr Gefühl, dass er nicht mehr fern sein konnte: der richtige Zeitpunkt.
3
Zwei Wochen nach der Schafschur stattete Simon Ohlsson Leeuwenhof einen überraschenden Besuch ab. Der grauhaarige Ohlsson führte in Jonkheersdorp zusammen mit seiner verwitweten Schwester Ester ein kleines Geschäft für Kurzwaren, das nicht genug zum Leben und doch zu viel zum Sterben abwarf. Deshalb hatte er den Postdienst im Dorf übernommen, um sich dadurch noch ein bescheidenes Zubrot zu verdienen. Angeblich hatte er die lange Fahrt auf sich genommen, weil er einige Lämmer kaufen und dieses Geschäft gern mit Stefanus machen wollte. Doch Lena ahnte, was ihr Vater wusste, nämlich dass dies nur ein Vorwand war, abgesprochen zwischen den beiden Männern, als Stefanus seinen Brief in Jonkheersdorp aufgegeben hatte.
Pa hat Antwort auf seinen Brief bekommen und Simon Ohlsson bringt sie ihm, damit niemand außer ihnen davon weiß und kein Gerede aufkommt, sagte Lena in Gedanken zu sich selbst und traf damit die Wahrheit.
An jenem Tag waren zufällig auch ihr Nachbar Hennig Bloem und sein Sohn Fabricius, mit sechzehn das älteste seiner Kinder, mit einem Fuhrwerk neuer Fässer von Bloemhof herübergekommen, das im Westen an Leeuwenhof grenzte. Stefanus van Rissek und Hennig Bloem waren schon in ihrer Jugend Freunde gewesen und gemeinsam stolz darauf, dass unter ihrer Leitung ihre beiden Farmen mit Abstand zu den am besten bewirtschafteten und ertragreichsten im Bezirk von Jonkheersdorp geworden waren.
Bloemhof hatte mit Bonga, der vom Stamm der Griquas war, den fähigsten Fassbinder weit und breit. Dafür konnte es niemand auch nur annähernd mit der Schmiedekunst von Titus aufnehmen, einem baumlangen Zulu mit dem Kreuz eines Ochsen, der vor vier Jahrzehnten als Hirtenjunge nach Leeuwenhof gekommen war und ganz zufällig seine Begabung im Umgang mit Hammer und Amboss entdeckt hatte. Wenn es etwas Besonderes zu schmieden gab, kam Hennig Bloem damit nach Leeuwenhof, wo Titus sich der Sache annahm. Dafür belieferte er seinen Freund und Nachbarn regelmäßig mit Fässern aus Bongas Fassbinderwerkstatt.
Fabricius, ein schlaksiger Bursche mit den kantigen Gesichtszügen seines Vaters, nutzte die Gelegenheit, um Adriaan und Hendrik mit seinem neuen Gewehr zu beeindrucken, das er von seinem Vater zu seinem sechzehnten Geburtstag geschenkt bekommen hatte.
»Ein 7-mm-Mauser-Karabiner aus Deutschland!«, erklärte er stolz und warf Lena einen erwartungsvollen Blick zu, als erhoffte er, dass ihr nun vor maßloser Bewunderung der Unterkiefer herunterfiel.
»Was du nicht sagst«, meinte Adriaan mit einem Anflug von Neid, denn er besaß nur ein älteres Lee-Enfield-Gewehr. Dass es sich um einen deutschen Mauser-Karabiner handelte, den Fabricius da vom Wagen geholt hatte, dafür hatte es bei ihm und Hendrik nur eines einzigen Blickes bedurft. Sie waren wie fast alle männlichen Buren mit einer Flinte in der Hand groß geworden. Mit dem Sattel eines Pferdes verwachsen zu sein und eine fast traumwandlerische Treffsicherheit mit dem Gewehr, das war seit über zwei Jahrhunderten eine aus dem Überlebenskampf geborene und auch in Friedenszeiten ebenso hochgehaltene wie selbstverständliche burische Tradition.
»Ich habe auch einen neuen Patronengurt für die Mauser-Ladestreifen bekommen«, fuhr Fabricius fort. »Fünf Patronen passen in so einen Streifen, die damit alle auf einmal geladen werden. Bei der neuen Lee-Metford, dem besten Gewehr der verdammten Engländer, müssen die Patronen dagegen immer noch einzeln geladen werden.«
Adriaan hätte sonst was dafür gegeben, solch ein modernes Gewehr zu besitzen. Doch eher hätte er sich die Zunge abgebissen, als das jetzt vor Fabricius einzugestehen.
Auch Hendrik zeigte sich nicht beeindruckt, empfand im Gegensatz zu seinem älteren Bruder aber auch keinen versteckten Neid. Der Gedanke, sich so einen Mauser-Karabiner zu wünschen, kam ihm gar nicht. Er war mit seiner alten Tower-Flinte vollauf zufrieden. Erst neulich hatte er eine Antilope auf zweihundert Yards mit einem sauberen Schuss erlegt, und das bei nicht ganz idealen Lichtverhältnissen. Ein neues, schneller schießendes Gewehr machte niemand zu einem besseren Schützen. Es verleitete höchstens dazu, mehr Munition zu vergeuden.
Lena wusste mit einem Gewehr umzugehen, interessierte sich jedoch so wenig für technische Details, wie sich ihre Brüder Gedanken über die Art ihrer Handarbeiten machten.
Dele war von ihnen die Einzige, die Fabricius den Respekt zollte und ihm die Bewunderung schenkte, die er als stolzer Besitzer des Mauser-Karabiners erwartete. Sie machte ihm wegen dieses wunderbaren Geschenkes die gebührenden Komplimente und fragte ihn nach diesem und jenem.
Fabricius tat es sichtlich wohl. »Ja, es gibt nichts Besseres als das!«, beteuerte er und strich fast liebevoll über den Lauf des Karabiners. Das wollte Adriaan so nicht hinnehmen. »Kann schon sein, dass man damit beim Laden Zeit spart. Aber ob du mich damit ausstichst, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich hol dir mit meiner Lee-Enfield jeden Vogel genauso schnell vom Himmel wie du mit deiner Mauser und Hendrik sticht dich sogar noch mit seiner alten Tower aus!«
»Wenn man gleich beim ersten Mal trifft, braucht man gar keinen zweiten Schuss … schon gar nicht fünf«, fügte Hendrik trocken hinzu.
Fabricius grinste breit, hatte er doch nur darauf gewartet, herausgefordert zu werden. So gut ihr Verhältnis sonst auch war, was ihre Reit- und Schießkünste betraf, bestand seit vielen Jahren eine Rivalität zwischen ihnen, besonders zwischen Adriaan und ihm. Jeder wollte der Beste sein. Doch wer von ihnen der Beste war, hatte bisher nie abschließend geklärt werden können. Und das gab dieser Rivalität ihren Reiz.
Nun war also das erhoffte Stichwort gefallen. Fabricius warf sich in die Brust und fragte fast gönnerhaft: »Und du glaubst wirklich, mir mit deinem alten Prügel das Wasser reichen zu können? Bist du bereit, das auch unter Beweis zu stellen, oder willst du es bloß bei Worten belassen, Adriaan?«
»Such dir aus, wann du die Niederlage einstecken willst!«, forderte Adriaan ihn auf, das breite Grinsen erwidernd.
»Warum klären wir das nicht gleich hier und jetzt?«, schlug Fabricius vor.
Adriaan zuckte mit den Schultern. »Von mir aus. Ich hätte dir die bittere Enttäuschung sonst gern noch etwas erspart«, stichelte er. »Nimm Abschied von deinen Träumen, mich ausstechen zu können«, erwiderte Fabricius schlagfertig.
»Ihr macht ein Wettschießen?«, stieß Dele aufgeregt aus.
Adriaan warf ihr einen leicht herablassenden Blick zu. »Haben wir uns vielleicht so angehört, als ginge es uns ums Einsammeln von Ochsendung?« Er wandte sich wieder dem Nachbarssohn zu. »Also gut, schießen wir es aus. Aber stehend freihändig und auf bewegliche Ziele.«
»Einverstanden.«
»Nun, dann lasst uns am besten runter zum Vaal gehen.«
»Ich hol schnell unsere Gewehre und Munition!«, bot Hendrik sich an.
»Darf ich mit, Adriaan?«
»Dele und Lena können meinetwegen ruhig zusehen«, kam Fabricius Adriaan bevor. »Oder hast du vielleicht Angst, dich vor deinen Schwestern zu blamieren?«
»Pah!«, wehrte Adriaan ab. »Ich habe bloß nicht gewusst, dass du Zuschauer brauchst, um einen einigermaßen sauberen Schuss zustande zu bringen. Aber wenn du Dele und Lena unbedingt dabeihaben willst, soll es mir recht sein.«
Fabricius warf Dele und Lena einen Blick zu, als erwartete er so etwas wie ein Lächeln des Dankes, dass sie mitgehen und bei dem Wettkampf dabei sein durften.
Lena war nicht halb so versessen darauf wie ihre Schwester, die aus ihrer Freude keinen Hehl machte. Sie zog die friedvolle Stille und den Duft dort wachsender Mimosen und Eukalypten krachenden Schüssen und Wolken beißenden Pulverdampfes allemal vor. Aber weil sie Fabricius’ Gefühle nicht verletzen wollte, behielt sie das für sich.
In diesem Augenblick kam der Einspänner von Simon Ohlsson in Sicht. Und als wenig später Tante Sophie nach ihr rief, damit sie ihr bei der Bewirtung der Gäste gefälligst zur Hand ging, statt im Hof Maulaffen feilzuhalten, da ärgerte sie sich diesmal nicht darüber, dass dieser Tadel immer nur ihr, der älteren Schwester, galt und dass Dele stets mit ihrer Nachsicht rechnen konnte. Nein, diesmal folgte sie dem scharfen Ruf ihrer Tante sogar mit einer gewissen Erleichterung, auch wenn sie vor Adriaan und Fabricius so tat, als wäre sie enttäuscht, nicht mit ihnen hinunter zum Fluss gehen und beim Wettschießen dabei sein zu können. Dele lächelte ihr verstecktes, triumphierendes Lächeln, das solchen Situationen vorbehalten war, in denen Lena Dinge tun musste, die ihr erspart blieben.
Lena lächelte ihr eigenes Lächeln – in Gedanken. Sollte Dele nur ihr Vergnügen mit Fabricius, Adriaan und Hendrik unten am Fluss haben und ihnen mit ihrem oberflächlichen Geplapper auf die Nerven fallen. Sie blieb zehnmal lieber zu Hause und in der Nähe von Pa und Simon Ohlsson. Kein Wettschießen konnte auch nur annähernd so spannend sein wie das Geheimnis um Julian und Claire Rounard, das ihr schon seit Wochen keine Ruhe mehr ließ – und das nun kurz davorstand, gelüftet zu werden. Jedenfalls hoffte sie, dass mit dem unerwarteten Besuch des Posthalters der »richtige Zeitpunkt« in unmittelbare Nähe gerückt war.
Lena versorgte die Männer, die auf der schattigen Veranda Platz genommen hatten, mit frischem Kaffee sowie Ingwerplätzchen und Honigbrot, das mit Butter aus dem kühlen Steinkeller zu ihren eigenen Lieblingsspeisen gehörte. Wie immer, wenn Buren in diesen unruhigen Zeiten zusammenkamen, wandte sich das Gespräch rasch der Politik zu und da insbesondere der aggressiven Politik der britischen Krone. England setzte die freien Burenrepubliken unter immer stärkeren politischen Druck. Das Ziel war allen klar: Das britische Empire, unersättlich in seiner imperialistischen Expansion, streckte seine Hände nach dem Oranjefreistaat und dem Transvaal aus, um sie seinem Kolonialreich einzuverleiben.
»1806 sind sie mit ihrer Flotte in Kapstadt gelandet und haben uns, nachdem wir dort schon hundertfünfzig Jahre gesiedelt hatten, um unser Land gebracht und uns kurzerhand zu britischen Untertanen erklärt!«, wetterte Hennig Bloem. »Kraft ihrer Kanonen!«
»Der Teufel hole die Engländer!«, schimpfte oupa Willem und spuckte treffsicher von der Veranda in den Sand des Hofes.
»Dann haben sie uns jahrelang geknechtet und uns die blutigen Grenzkriege mit den Xhosas am Great Fish River ausbaden lassen«, fuhr Hennig Bloem grimmig fort. »Sie haben es so schlimm getrieben, dass uns gar nichts anderes übrig geblieben ist, als unsere Heimat und die unserer Vorfahren aufzugeben und jenseits der Grenzen der Kapkolonie eine neue Heimat zu suchen und Wildnis urbar zu machen.«
»Ha, der große Exodus unseres Volkes in den dreißiger und vierziger Jahren!«, rief oupa Willem. »Den legendären Großen Treck, ich habe ihn noch erlebt, jongs! Wie Gottes erwähltes Volk aus der Gefangenschaft der Ägypter ins gelobte Land gezogen ist, so haben wir damals die Fesseln unserer britischen Knechtschaft abgeworfen, sind mit gerade geborenen Babys und Alten auf unsere veld schoner gestiegen und haben nach Jahren des Treckens endlich unser gelobtes, uns von Gott vorbestimmtes Land gefunden!«
Simon Ohlsson nickte zustimmend. »Ja, das haben wir. Und dem Allmächtigen sei Dank für seine Vorbestimmung und Führung«, sagte er, schien aber nicht so recht bei der Sache zu sein, wie Lena zu beobachten meinte.
Oupa Willem deutete mit seiner Pfeife in die Runde, so als wollte er jedem Einzelnen mit dem langen Stiel vor die Brust pochen. »Ja, ich war dabei, kaum älter als Lena. Aber ich habe die Arbeit eines Mannes getan auf diesem Treck – und gekämpft wie ein solcher. Magtig, ihr könnt euch ja gar keine Vorstellungen von den jahrelangen Entbehrungen und den ständigen Gefechten mit den Kaffern machen, die wir zu erdulden hatten. Ich habe in der Wagenburg am Blood River gekämpft, als mindestens zwölftausend bis an die Zähne bewaffnete Zulukrieger uns Stunde um Stunde angegriffen haben. Ein Meer von Lanzen und Assegais funkelte an jenem Morgen des 1. Dezember im Jahre des Herrn 1838 in der Sonne, während wir kaum vierhundertachtzig Mann zählten. Doch wir haben sie besiegt und die Macht der Zulus an jenem Tag ein für alle Mal zerschlagen. Das Blut vieler Buren hat den Boden getränkt, nicht nur beim Blood River, sondern auch später, als …«
»Lass mal gut sein, Vater«, fuhr Stefanus ihm sanft ins Wort. »Wir alle kennen sowohl die Geschichte unseres Volkes im Allgemeinen als auch deine Geschichten im Besonderen.«
»Und wenn schon. Ihr könnt sie euch gar nicht oft genug anhören, denn ihr könnt eine Menge daraus lernen!«, grollte oupa Willem.
Hennig Bloem tauschte mit Stefanus einen wissenden, mitfühlenden Blick und kam dann wieder auf die Engländer zu sprechen, in deren Ablehnung sie sich alle einig waren. »Die Rotröcke sind zehnmal schlimmer als die Zulus oder die Xhosas es in ihren besten Jahren waren. Sie haben Natal an sich gerissen. Und als in Kimberley Diamanten gefunden wurden, haben sie uns auch darum betrogen und diese Ecke der Halbwüste, an der sie nie Interesse gezeigt hatten, einfach ihrer Kapkolonie zugeschlagen.«
»Und jetzt, wo in Johannesburg das Gold die leeren Kassen unserer Republik füllt, wollen sie auch uns und den Oranjefreistaat in die Knie zwingen und unter den verfluchten Union Jack bringen«, erregte sich Stefanus.
Simon Ohlsson blickte nachdenklich über den Rand seines Kaffeebechers hinweg. »Wisst ihr noch, wie dieser Hundesohn Shepstone, diese Marionette des britischen Premierministers im Januar 1877 in Pretoria einmarschiert ist und unsere Republik einfach annektiert hat?«
Hennig verzog das Gesicht, als hätte er auf eine bittere Zitrone gebissen. »Eine Schande, dass es ihm ohne jede Gegenwehr gelang, in unserer Hauptstadt die britische Fahne aufzuziehen.«
»Aber bei Majuba haben wir es ihnen gezeigt!«, meldete sich oupa Willem wieder zu Wort. »Ich war dabei, als wir die rooineks unter unserem Generalkommandanten Joubert vernichtend geschlagen haben. Das war 80/81.«
»Nicht nur du warst dabei, Vater«, sagte Stefanus etwas gequält. »Wir alle waren damals auf Kommando. Aber wenn ich mich recht entsinne, hast du nicht zu jenem Teil des Kommandos gehört, der die Engländer vom Berg vertrieben und General Sir Pomeroy Colley eine so schmähliche Niederlage bereitet hat.« Oupa Willem machte eine gereizte Handbewegung. »Ich weiß, wo ich war, jong!«, brummte er und herrschte seine Enkelin an: »Lena, siehst du nicht, dass ich keinen Kaffee mehr habe?«
Lena eilte schnell zu ihm um den Tisch.
»Ja, bei Majuba haben wir das vierjährige britische Joch abgeworfen und uns unsere Unabhängigkeit wieder erkämpft«, sagte Simon Ohlsson stolz. »Premier Gladstone musste einen Friedensvertrag mit uns unterzeichnen und unsere Eigenständigkeit garantieren.«
Hennig lachte freudlos auf. »Der Friedensvertrag von Pretoria und die London Convention von 1884 sind doch das Papier nicht wert, auf dem sie abgefasst sind.«
»Immerhin haben wir unsere Souveränität zurückbekommen«, gab Ohlsson zu bedenken.
»Was heißt das schon. Die Briten haben es nie ernst gemeint, sondern uns nur in Ruhe gelassen, weil sie damals in Ägypten gebunden und dort genug Ärger hatten, um sich nicht auch noch mit uns anlegen zu können«, erklärte Hennig nüchtern.
»Politiker wie Cecil Rhodes haben nie einen Hehl aus ihrem Ziel gemacht, Afrika von Kapstadt bis nach Kairo unter britische Vorherrschaft zu bringen. Und nachdem wir jetzt nicht mehr nur ein armer Bauernstaat sind, sondern reiche Goldminen und wohl noch andere kostbare Bodenschätze besitzen, ist es nicht nur machtpolitisch, sondern auch wirtschaftlich äußerst sinnvoll, diese Politik voranzutreiben.«
»Sollen sie es doch versuchen«, meinte Stefanus. »Diesmal werden wir bestens vorbereitet sein und diesmal wird niemand unsere vierkleur über Pretoria einholen und dort den Union Jack hissen!«
Die vierkleur war die vierfarbige Fahne der Transvaal-Republik und zeigte untereinander jeweils einen grünen, roten, weißen und blauen Streifen.
Zehn Minuten später wandte sich Simon Ohlsson an Stefanus und fragte: »Können wir mal nach den Lämmern schauen? Ich muss bald den Rückweg antreten.«
»Natürlich«, sagte Stefanus und erhob sich mit ihm. »Bleib du nur hier sitzen, Hennig. Ich bin gleich wieder zurück.«
Lena folgte den beiden Männern mit ihren Blicken, wie sie über den Hof gingen, und dachte, dass Simon Ohlsson ihrem Vater jetzt wohl einen Brief aushändigen würde, der aus Kimberley in Jonkheersdorp eingetroffen war.
Simon Ohlsson verließ Leeuwenhof eine Stunde später mit zwei Lämmern, die mit gefesselten Hufen und jämmerlich blökend auf der Ladefläche seines Einspänners lagen.
Es muss eine gute Nachricht sein, die Pa bekommen hat, sagte sich Lena, denn ihr Vater machte am Abend einen ungewöhnlich aufgekratzten Eindruck. Er nahm sich sogar die Zeit, sich von Adriaan lang und breit erzählen zu lassen, dass das Wettschießen zwischen ihm und Fabricius acht zu zwölf zu seinen Gunsten ausgefallen war. »Er hat sich herausgeredet, noch nicht recht vertraut mit dem neuen Karabiner zu sein«, sagte Adriaan lachend. »Dabei weiß er so gut wie ich, dass er mir auch nach tausend Schuss noch immer nicht das Wasser reichen kann.«
»Nur keinen Hochmut, Sohn«, tadelte Stefanus ihn, lachte jedoch ebenfalls und fügte verheißungsvoll hinzu: »Und Mauser-Karabiner finden ihren Weg nicht allein nach Bloemhof.« Adriaans Augen leuchteten bei diesem indirekten Versprechen seines Vaters auf. Auch sie würden solche wunderbaren Karabiner mit fünfpatronigen Ladestreifen aus deutscher Waffenherstellung erhalten! Denn ihr Vater war kein Mann, der so etwas nur dahersagte, ganz im Gegenteil. Er überlegte sich alles sehr genau, bevor er redete.
Adriaan konnte es nun nicht erwarten, dass sein Vater für sich und seine Söhne Mauser-Karabiner bestellte und er ein solches Gewehr endlich sein Eigen nennen durfte.
Lena dagegen wartete auf etwas ganz anderes, das ihr so wichtig war wie Adriaan und Fabricius ein Karabiner der deutschen Waffenschmiede Mauser. Nur musste sie sich nicht so lange wie ihr Bruder in Geduld üben, denn schon fünf Tage nach Simon Ohlssons Besuch auf Leeuwenhof überraschte ihr Vater sie und ihre Geschwister nach der abendlichen Bibellesung mit der Mitteilung: »Ich fahre morgen nach Vereeniging.«
Die Überraschung war groß. Allein Tante Sophie und oupa Willem reagierten auf seine Ankündigung nicht mit Erstaunen, sondern mit stummer Missbilligung, die sich in ihren verkniffenen Gesichtern ausdrückte.
»Du fährst zum Waffenhändler?«, rief Adriaan aufgeregt.
»Nein, dafür wird die Zeit nicht reichen«, antwortete sein Vater zu Adriaans sichtlicher Enttäuschung. »Doch sei beruhigt, die Gewehre sind bestellt, schon seit Langem. Hennig Bloem hat seine nur zufälligerweise ein paar Wochen eher erhalten als wir.«
»Aber was willst du dann in Vereeniging?«, fragte Dele, die sich nicht vorstellen konnte, dass ausgerechnet ihr Vater plötzlich Interesse am Besuch einer fremden Ortschaft, ja fast schon einer richtigen Stadt haben sollte.
»Ich fahre zum Bahnhof«, erklärte ihr Vater mit etwas angespannter Stimme. »Wir bekommen Besuch.«
Aufgeregt hielt Lena den Atem an. Der richtige Zeitpunkt! Jetzt war er da!
Hendrik sah ihren Vater verständnislos an. »Besuch? Wer sollte uns besuchen, der dafür mit der Eisenbahn fahren müsste, Pa?«
»Ihr kennt ihn nicht. Ich kenne ihn selbst nicht, jedenfalls nicht persönlich, sondern nur brieflich«, antwortete ihr Vater knapp. »Doch er ist mit uns verwandt … Sein Name ist Julian … Julian Rounard und er kommt aus Kimberley. Er ist nur ein halbes Jahr älter als du, Adriaan. Ich hoffe, ihr werdet euch gut verstehen.«
»Noch nie gehört«, sagte Adriaan verblüfft. »Und ich habe gedacht, wir würden all unsere Verwandten kennen. Wieso erfahren wir erst jetzt, dass jemand von unserer Familie in Kimberley wohnt?«
»Weil ich es bisher auch nicht gewusst habe.«
»Und wie lange wird dieser Julian bleiben?«, wollte Dele wissen.
»So lange, wie er will.«
Oupa Willem stieß seinen Stuhl abrupt zurück und stand auf. »Mir ist es hier zu stickig. Ich brauche frische Luft!«, brummte er gereizt und schlurfte zur Tür.
»Dann lass dich nicht aufhalten, Vater!« In der Stimme seines Sohnes lag eine ungewohnte Schärfe.
»Und ich werde mich früh zu Bett begeben. Manches strengt mich doch über Gebühr an«, sagte Tante Sophie und ging ebenfalls.
»Will jemand morgen mit mir zum Bahnhof fahren, um Julian abzuholen?«, fragte ihr Vater nun.
Bis nach Vereeniging war es ein weiter Weg. Bei den ausgesprochen schlechten Straßen musste man mit dem Wagen mindestens vier Stunden veranschlagen, und das für jede Strecke! Sich acht Stunden lang in brütender Hitze auf holprigen Sandpisten durchrütteln zu lassen, nur um einen Verwandten, von dem sie noch nie ein Sterbenswort gehört hatten und der deshalb ja wohl nur sehr fern mit ihnen verwandt sein konnte, am Bahnhof zu begrüßen – nein, das klang nicht verlockend, sondern ausgesprochen abschreckend. Und so fielen Adriaan, Hendrik und Dele sofort genug Ausflüchte ein, warum sie ihren Vater gerade morgen nicht auf dieser langen Fahrt begleiten konnten.
»Und wie steht es mit dir, Lena?« Ein kaum merkliches Lächeln umspielte die Mundwinkel ihres Vaters, als hätte er den Ausgang dieses Gesprächs vorausgesehen – ihre Entscheidung eingeschlossen.
»Ich fahre mit«, sagte sie und hatte Mühe, sich ihre Aufregung nicht anmerken zu lassen. »Es wird bestimmt interessant, Pa.«
»Ja, das denke ich auch.«
»Todlangweilig wird es und vor allem heiß und staubig!«, meinte Dele, als sie ihr Nachtgebet gesprochen hatten und zu Bett gingen. »Wie kannst du nur so einfältig sein, dich darauf einzulassen?«
»Ich weiß nicht, ob ich deshalb einfältig bin. Findest du es denn nicht auch aufregend, dass jemand aus Kimberley zu uns nach Leeuwenhof auf Besuch kommt und zudem auch noch mit uns verwandt ist?«
»Weshalb sollte ich wegen eines Fremden aufgeregt sein?«, fragte Dele gelangweilt zurück und fügte dann gehässig hinzu: »Außerdem kenne ich keinen Verwandten, der nicht entweder fad, hochnäsig, einfältig oder unansehnlich ist. Warum also sollte da ausgerechnet dieser Julian Rounard eine Ausnahme machen? Bestimmt ist er alles zusammen und jemand will ihn loswerden, weshalb man ihn wohl auch zu uns nach Leeuwenhof geschickt hat!«
»So etwas zu sagen ist nicht nett, Dele!«
»Ich will auch nicht nett sein, sondern schlafen«, entgegnete ihre Schwester spitz, drehte sich auf die Seite und gab sich ihren eigenen Träumen hin, in denen kein Platz für fremde Verwandte war.
Lena konnte dagegen lange nicht einschlafen. Ihre Gedanken kreisten unablässig um den Fremden aus Kimberley, wegen dem sich ihr Vater mit oupa Willem und wohl auch mit Tante Sophie so heftig in die Haare bekommen und überworfen hatte, wie das nie zuvor geschehen war.
Was mochte wohl der Grund dafür sein? Welch ein Geheimnis war mit diesem Julian Rounard verbunden? Morgen würde sie es wissen. Und bevor der Schlaf sie endlich übermannte, betete sie inständig zu Gott, dass Dele mit ihrer Annahme, was das Wesen ihres geheimnisvollen, unbekannten Verwandten betraf, in jeder Beziehung unrecht haben möge.
4
Es schien mitten in der Nacht zu sein, denn die Dunkelheit lag noch wie eine pechschwarze Decke über dem veld, als Sarie zu Lena in die Kammer kam und sie aus dem Schlaf holte. Augenblicklich war sie wach.
»Schon Zeit zum Aufstehen, Sarie?«
»Ja, der baas lässt bereits die Pferde einspannen!«, raunte das schwarze Mädchen, mit dem Lena noch bis zu ihrem zehnten Lebensjahr zwischen den pondoks der Schwarzen gespielt hatte, ohne sich Gedanken über die Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen zu machen. Als sie zehn geworden war, hatte Tante Sophie ihr verboten, weiterhin mit den schwarzen Kindern zu spielen. Und sie hatte ihr auch verboten, von nun an barfuß und ohne kappie herumzulaufen. Nackte Haut zu zeigen war unschicklich und sich außerhalb des Hauses ohne eine Haube sehen zu lassen, die den Kopf züchtig bedeckte und das Gesicht davor bewahrte, von der Sonne gebräunt zu werden, gehörte sich laut Tante Sophies ständigen Ermahnungen auch nicht. Jedenfalls nicht für ein weißes Mädchen aus gutem Haus, das mit zehn nicht länger Anspruch auf die sorglose Freiheit und Gedankenlosigkeit eines Kindes besaß, sondern sich nun daran zu orientieren hatte, was sich für einen weißen Erwachsenen schickte und was nicht.
»Danke, Sarie«, flüsterte Lena mit einem Anflug von Bedauern, dass von der einst fröhlichen, unzertrennlichen Freundschaft ihrer Kinderzeit nur noch eine gegenseitige Zuneigung übrig geblieben war. »Ich beeile mich.«
Sarie nickte, stellte die nur auf kleinster Flamme brennende Petroleumlampe auf die Waschkommode und huschte aus der Kammer.
Lena sprang aus dem Bett und schlüpfte aus ihrem Nachthemd. Sie war schnell gewaschen und angezogen. Wie gern hätte sie ihr hübsches lindgrünes Sommerkleid getragen, das einen so herrlichen Kontrast zu ihrem langen schwarzen Haar bildete. Aber der feine Staub der roten Erde, der für dieses Land so charakteristisch war, würde bei der weiten Fahrt den zarten Lindton des Stoffes in ein unansehnliches, schmutzig stumpfes Rotgrün verwandeln, lange bevor sie Vereeniging erreichten. Deshalb war es besser, dass sie ihr einfaches nussbraunes Alltagskleid trug, dem der Staub der Landstraße nicht viel anhaben konnte. Immerhin besaß es eine hübsche doppelte Knopfleiste, tröstete sie sich.