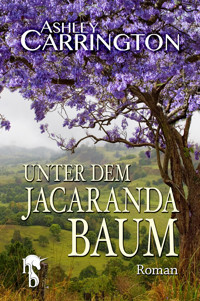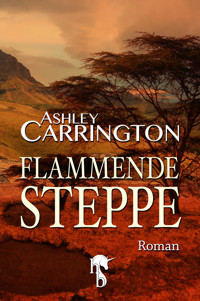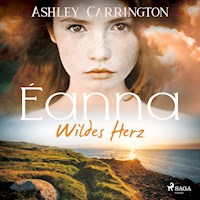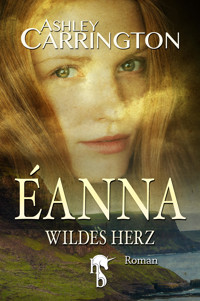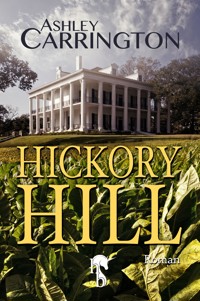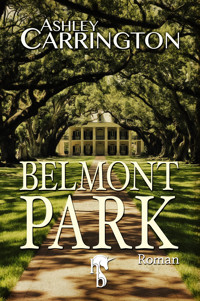6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
England, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der junge Patrick O'Brien und seine Gefährtin Abigail Dixon müssen ihre Heimat verlassen. Denn der ehemalige Wildhüter und das 13jährige Mädchen haben zu lange schon Freier und Zuhälter hereingelegt, auch von einem Lord werden sie gejagt. In Südafrika wollen die beiden als Siedler einen Neuanfang in der Freiheit wagen. Doch in der Fremde trennen sich die Wege des ungleichen Paares, denn Patrick tritt einer Gruppe gesetzesloser Elfenbeinjäger bei. Abigail verliert seine Spur. Doch sie will Patrick, der sie in England beschützte, nicht vergessen. Aus tiefstem Herzen hofft Abigail, ihn eines Tages wiederzusehen … Eine große Auswanderersaga aus dem Bestsellerkosmos von Ashley Carrington – angesiedelt im England und Südafrika zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ashley Carrington
Küste der Verheißung
Roman
Für Willy Zingg, Buschpilot, Abenteurer der Kalahari
Teil 1 Strandgut
1
Er rannte um sein Leben. Hunger und Angst trieben ihn voran. Seine linke Hand krallte sich in das Fell des toten Hasen und presste das Tier an seine Brust. Mit dem rechten Arm versuchte er, sein Gesicht vor den überfrorenen Zweigen zu schützen, während er durch das dichte Unterholz flüchtete. Die Schläge machten ihn halb blind und hinterließen blutige Striemen auf seiner Haut, doch er spürte keinen Schmerz und auch nicht die Kälte; dafür war seine Angst zu groß. Er spürte nur den Hasen in seiner linken Hand, der immer schwerer zu werden schien. Aber irgendeine Stimme in seinem Hinterkopf versicherte ihm, dass dieser Albtraum aus Angst und Hunger ein gutes Ende haben würde, wenn er bloß an diesem schweren, wunderbar fleischigen Tier festhielt, als hinge sein Leben davon ab, und in einem sehr direkten Sinne tat es das auch. Der Hase war das Leben. Ließ er ihn fallen, würde er nicht mehr die Kraft aufbringen zu rennen.
Sein Herz hämmerte und in seinen Ohren rauschte das Blut wie ein reißender Wildbach zur Frühjahrsschmelze. War es George Boogan, der ihm an diesem kalten, schneegrauen Novembermorgen auf den Fersen war? Oder hatte er es mit dem jungen O’Brien zu tun? Tom Dale konnte es jedenfalls nicht sein. Der hielt sich in Chipping bei seiner Zukünftigen auf, das wusste er aus erster Hand. Also blieben nur Boogan und O’Brien. Er hoffte, dass es der Wildhüter persönlich war, der ihm im Nacken saß. Boogan hatte in den letzten Jahren Fett angesetzt und war längst nicht mehr so schnell wie früher. Ihm konnte er entkommen.
»Bleib stehen!«, schrie eine scharfe und gar nicht atemlose Stimme hinter ihm im Wald, als er über den quer liegenden Stamm einer vom Sturm gefällten Buche sprang. »Zwing mich nicht zu schießen!«
Panik wallte in John Tyler auf. Es war nicht Boogan, wie er gehofft hatte, sondern Patrick O’Brien. Eine Hitzewelle jagte durch seinen Körper und trieb ihm den Schweiß aus allen Poren. Gehetzt warf er einen Blick über die Schulter zurück. Sein Vorsprung schrumpfte immer mehr zusammen. Er konnte die große, schlanke Gestalt von O’Brien schon zwischen den Bäumen ausmachen.
Ein Schuss zerriss den trügerischen Frieden des frühen Morgens. John Tyler schrie auf. Doch die geballte Ladung Schrot traf ihn nicht in den Rücken, sondern fuhr hoch über seinem Kopf in die Bäume. Schnee rieselte aus den weißen Kronen. Er stolperte, fing sich wieder und rannte weiter.
Die Bäume wurden weniger. Vor ihm lag eine kleine Waldlichtung. Schnee, so dünn und weiß wie ein frisch gebleichtes Laken, bedeckte den gefrorenen Boden. Wenn er es noch rechtzeitig über die Schneise und drüben über den Three Fox Brook schaffte, hatte er eine Chance, Patrick O’Brien zu entkommen. Das Unterholz auf der anderen Seite war so dicht wie das verfilzte Haar der alten Lynnford, die schon seit Jahren weder Kamm noch Bürste zur Hand nahm. Dort konnte er sich verstecken und seinen Verfolger abschütteln. Der Schneefall der letzten beiden Tage war zu gering gewesen, um schon tief ins Unterholz vorgedrungen zu sein. Er würde also keine Spuren hinterlassen, denen man so leicht folgen konnte wie einer Fährte im Neuschnee. Am Waldrand verfing sich sein linker Schuh in einem Zweig, der unter seinem Tritt nicht brach, sondern hochgerissen wurde und ihm zwischen beide Beine geriet. Er stürzte der Länge nach hin. Kaltes Laub, von Raureif überzogen, klatschte ihm ins Gesicht. Augenblicklich rappelte er sich wieder auf und rannte auf die Lichtung hinaus. Sein Griff um den Hasen hatte sich nicht einmal beim Fall auch nur für eine Sekunde gelockert. Der Sturz hatte ihn jedoch wertvolle Zeit gekostet. Er schaffte es nicht einmal bis zur Mitte der Waldschneise.
»Halt! Keinen Schritt weiter!«, schrie Patrick O’Brien ihm zu. »Die zweite Ladung geht nicht in die Bäume, sondern in deine Beine! Bleib verdammt noch mal stehen!«
Ganz deutlich hörte John Tyler, wie der Hahn des Gewehrs einrastete. Es war ein scharfes metallisches Klicken, das in der Stille des Morgens weit trug und alle anderen Geräusche zum Schweigen zu bringen schien.
John Tyler erstarrte, wie zu Eis gefroren. Ertappt! Auf frischer Tat beim Wildern ertappt! Er wusste nur zu gut, welche Strafe darauf stand. Lord Harland kannte keine Milde, was das betraf. Ihm war, als wollte sein Herz bersten und ihm die Brust aufreißen. Einen Moment lang lahmte das Entsetzen jeden weiteren Gedankengang.
»Dreh dich um!«
John Tyler drehte sich um, den Hasen noch immer krampfhaft an die Brust gepresst, als könnte ihn das Tier vor dem Verderben schützen.
Patrick O’Brien ließ die doppelläufige Flinte, die er zum gezielten Schuss an die Schulter gesetzt hatte, sinken. »Mein Gott, du?«, stieß er bestürzt hervor.
»Lass mich laufen!«, keuchte John Tyler. Sein Atem kam bei der Kälte als Dampfwolken in schnellen, kurzen Stößen aus seinem Mund.
Patrick O’Brien ging auf ihn zu. »Das kann ich nicht, das weißt du. Boogan ist nicht weit. Er wird den Schuss gehört haben und jeden Augenblick hier sein. Mein Gott, warum hast du das bloß getan?«
»Die Kinder haben Hunger, Pat.«
»Ich weiß, was Hunger ist, John.« Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, da bereute er sie auch schon, kannte er doch John Tylers Schicksal.
»Aber du weißt nicht, wie es ist, eine Frau und drei Kinder zu haben – und ein viertes auf dem Friedhof, das nicht einmal alt genug geworden ist, um seinen eigenen Namen aussprechen zu können!«, stieß John Tyler hervor. »Anne weint fast jede Nacht, weil sie Angst hat, dass wir es nicht schaffen, James, Emily und Mary über den Winter zu bringen. Die Kinder sind so dünn, dass man ihre Rippen zählen kann. Und die wirklich harten Monate liegen erst noch vor uns. Pat, ich flehe dich an, lass mich laufen … um der Kinder willen!« Und damit kniete er sich vor ihn in den Schnee.
Patrick O’Brien starrte verstört und ärgerlich zugleich auf ihn hinunter. Er sah einen hageren Mann, dessen schäbige, fast nur noch aus Flicken bestehende Kleidung für den Winter viel zu dünn war. Ein Familienvater und Mann von einunddreißig Jahren, der vor ihm, dem acht Jahre Jüngeren, kniete und ihn anflehte, ihn laufen zu lassen.
»Komm hoch!«, fauchte er ihn an, weil er sich in seiner Haut zusehends unwohler fühlte. Was sollte er bloß tun?
John Tyler war ein aufrechter, gottgläubiger und hart arbeitender Mann gewesen. Bis vor anderthalb Jahren hatte er vermutlich nicht einmal im Traum daran gedacht, auf den Ländereien von Lord Harland zu wildern. Aber vor anderthalb Jahren hatte er auch noch eine gute Stellung im Steinbruch und keinen steifen rechten Arm gehabt. Jener unglückselige Unfall mit dem überladenen Fuhrwerk, bei dem ihm mehrere Felsbrocken den rechten Ellbogen und die Hand zertrümmert hatten, hatte ihn zum Krüppel gemacht und ihn um seine Zukunft betrogen. Denn wer hatte in einem Landstrich wie den Cotswold Hills, wo das Leben selbst für einen gesunden, kräftigen Mann hart war, schon Arbeit für jemanden, der nur einen Arm gebrauchen konnte?
»Steh auf!«, zischte Patrick O’Brien und schämte sich für seinen warmen Mantel aus Schafwolle und seine Stiefel, die er Grimes aus der Sattlerei abgekauft hatte. Sie waren noch wie neu und saßen wie angegossen. »Ich weiß, dass es schwere Zeiten für dich und Anne sind. Aber knie nicht vor mir wie vor einem Priester.«
John Tyler richtete sich auf. Sein Blick war ein einziges stummes Flehen.
Aus dem Wald hinter ihnen war das Geräusch eines Mannes zu hören, der durch das Unterholz brach. Gedämpft zwar, aber wer immer da kam, würde nicht lange brauchen, um zu ihnen auf die Lichtung zu gelangen.
Boogan! – schoss es Patrick O’Brien durch den Kopf. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit. »Lass den Hasen fallen, und verschwinde!«
John Tyler schluckte. »Ich kann nicht, Pat. Ich kann nicht mit leeren Händen nach Hause kommen.«
»Dann muss ich dich Mr. Boogan übergeben.« Er hob wieder den Lauf der Flinte.
»Wenn du das tust, werde ich nach Australien deportiert und sehe meine Frau und meine Kinder nie wieder. Du weißt, wie Lord Harland ist. Das kannst du nicht machen, Pat. Du bist nicht so wie Boogan. Und es ist doch bloß ein Hase. Die Wälder sind voll von Wild. Lass mir den Hasen, ich flehe dich an!«
Patrick O’Brien brach der Schweiß aus und er wünschte, er hätte an diesem Morgen eine andere Route eingeschlagen. Dann stünde er nicht hier und müsste auch nicht die bisher schwierigste Entscheidung seines Lebens treffen. »Tut mir leid, ich kann es nicht. Es ist meine Pflicht«, begann er mit belegter Stimme.
John Tyler sah ihm in die Augen. »Es ist nur ein Hase, und meine Kinder haben Hunger, Pat … Bitte!«, flüsterte er, drehte sich um und ging mit hölzernen Schritten auf den Wald zu. Er hielt den Rücken gerade und den Kopf aufrecht. Patrick O’Brien packte die Flinte fester. Ein Schauer durchfuhr ihn. »Bleib stehen, oder ich schieße dich zum Krüppel!«, rief er, erschrocken darüber, dass die Situation völlig seiner Kontrolle entglitt, denn er spürte, dass seine Flinte noch weniger Macht über John Tyler besaß als seine Worte.
»Das bin ich schon«, erwiderte John Tyler bitter. Ihn trennten nur noch wenige Schritte vom Three Fox Brook und dem rettenden dunklen Wald mit seinem Labyrinth aus Hohlwegen. Er spürte förmlich, wie Patrick O’Brien den Zeigefinger um den Abzug legte und Druck ausübte.
»Noch einen Schritt weiter – und ich drücke ab!« So etwas wie Panik lag in der Stimme von Patrick O’Brien.
John Tyler hielt im Schritt inne, wandte jedoch nicht den Kopf. Sein Herz raste. Tonlos bewegten sich seine Lippen und formten die Worte, die im Angesicht von Patrick O’Brien laut auszusprechen ihm sein Stolz verboten hatte: Tu es nicht! Denk an damals, Pat, als du ein kleiner Junge warst und dich zu früh auf das Eis des Dorfteiches gewagt hast. Du bist eingebrochen, und ich habe dich im letzten Moment zu fassen gekriegt. Erinnerst du dich? Du musst dich erinnern! Ich habe dir das Leben gerettet. Du bist mir etwas schuldig. Aber ich will nicht mehr als diesen Hasen und meine Freiheit. Du bist mir diesen Hasen schuldig, Patrick O’Brien!
Patrick O’Brien zog den Abzug durch. Mit einem scharfen Knall löste sich der zweite Schuss aus seiner Flinte und wurde vom Wald als Echo zurückgeworfen. Die Schrotladung schoss aus dem herumgerissenen Lauf und schlug ein gutes Stück rechts von John Tyler wie Hagelschauer in Gebüsch und Bäume.
Der Wilderer wankte in einem kurzen Anfall der Schwäche vor unendlicher Erlösung und rannte dann los. Augenblicke später hatte ihn der Wald verschluckt.
Die rauchende Schrotflinte in beiden Händen, stand Patrick O’Brien wie benommen in der Mitte der Lichtung. Was, um Gottes willen, hatte er bloß getan?
2
George Boogan, ein stämmiger Mann von vierzig Jahren und untersetzter Gestalt, stürzte unter lautem Fluchen zu Patrick auf die Schneise hinaus. Er trug einen langen Mantel aus Kaninchenfell und eine ebensolche Mütze auf seinem kantigen Kopf, dessen schwarzes Haar schon stark zurückgewichen war. Nur die Augenbrauen waren noch so dicht wie die Borsten einer neuen Schuhbürste. Eine blutige Linie zog sich quer über seine linke Wange, wo ihn ein scharfer Ast wie eine Messerklinge gezeichnet hatte.
Boogan hatte zwei Schüsse gezählt. Als er seinen zweiten Gehilfen nun wie versteinert mit rauchender Flinte in der Hand auf ein Gebüsch auf der anderen Seite starren sah, glaubte er zu wissen, was passiert war.
»Du hast den Mistkerl erwischt, ja? Gut gemacht, O’Brien!« Boogan war ganz außer Atem und stützte sich auf seine Flinte, die aus der Werkstatt eines sehr guten Waffenschmieds stammte und sogar Verzierungen am Schloss und auf dem Schulterstück aufwies. »Es wurde auch mal wieder Zeit, ein Exempel zu statuieren, und das tut man am besten schon gleich zu Beginn des Winters, damit nicht noch mehr von diesem Pack denken, sie könnten in den Wäldern ungestraft ihre Schlingen auslegen und Seine Lordschaft berauben.«
Patrick brachte kein Wort über seine Lippen.
Boogan deutete auch das Schweigen falsch. »Keine leichte Sache, auf jemanden zu schießen und ihn niederzustrecken. Ich weiß, wovon ich rede. Aber manchmal muss es sein. Wenn wir dem Gesetz nicht Geltung verschaffen, dann versinkt das Land in Chaos«, versicherte er und schlug ihm aufmunternd auf die Schulter. »Und jetzt zeig mir, wo er liegt.«
Patrick schüttelte den Kopf und öffnete den Mund. Er fühlte sich wie ein Karpfen an Land. Seine Lungen schienen nicht genügend Luft zu bekommen. Die Angst saß ihm wie eine Bleiplatte auf der Brust. »Ich … ich weiß nicht, Mr. Boogan.«
»Na, wir finden ihn schon. Du wirst ihn schon nicht verfehlt haben.«
Patrick nahm all seinen Mut zusammen. »Ich … ich habe ihn nicht getroffen, Mr. Boogan. Er … er ist mir entwischt.«
Ein verdatterter Ausdruck trat auf das Gesicht des Wildhüters, dann wurden seine Züge hart. »Du hast ihn entkommen lassen? Du, der beste Schütze der Cotswold Hills?«, fragte er scharf.
»Er war einfach zu schnell.« Patrick wich dem Blick seines Vorgesetzten aus.
Boogan schaute ihn ungläubig an, blickte zum Wald hinüber, suchte mit den Augen die Lichtung ab und sah Patrick dann prüfend ins Gesicht. »Was ist hier vorgefallen, O’Brien? Und versuch nicht, mir etwas vorzumachen!«
»Nichts ist vorgefallen, Mr. Boogan«, log Patrick und bemühte sich, den Eindruck eines Mannes zu machen, der zerknirscht war, weil ihm der Wilderer entwischt war, der sich aber darüber hinaus nichts hatte zuschulden kommen lassen. »Ich habe wirklich alles drangesetzt, um den Kerl einzuholen, aber er war einfach schneller als ich.«
»Ich habe zwei Schüsse gehört, und sie kamen aus deiner Flinte!«
Patrick wagte nicht, ihm in die Augen zu schauen. »Ja, ich habe geschossen, aber ich habe ihn nicht getroffen.« Boogans Augen wurden ganz schmal, als blendete ihn die Sonne. Dabei schwamm sie blass und konturlos in den grauen Wolken, die tief über den dicht bewaldeten Bergzügen hingen. »Du vergeudest dein Pulver nicht. Wenn du schießt, dann bist du auch in Reichweite deines Ziels – und dann sitzt die Kugel. Selten brauchst du eine zweite.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, wenn du ihn mit zwei Schüssen nicht getroffen hast, dann wolltest du ihn nicht treffen!«
»Das ist nicht wahr! Ich habe aus dem Laufen geschossen, und Sie haben doch selbst gesehen, wie dicht hier das Unterholz steht«, erwiderte Patrick hastig. »Vielleicht habe ich ihn ja getroffen, zumindest mit ein paar Schrotkugeln, aber zum Stehen gebracht hat ihn das nicht. Glauben Sie mir, ich habe getan, was ich konnte, um den Wilderer zu stellen.«
»Du lügst!« Boogans Stimme war so kalt und scharf wie ein Rasiermesser.
»Mr. Boogan …«
»Halt den Mund!«, schnitt der Wildhüter ihm das Wort ab. Zorn rötete sein Gesicht. »Für wie dumm hältst du mich, dass du meinst, ich könnte die Spuren nicht deuten? Glaubst du, ich hatte keine Augen im Kopf? Da, drei Fußspuren kommen hinter uns aus dem Wald – die von dir, von mir und dem Wilderer. Und dort«, er wies auf die Stelle, wo John Tyler gestanden und sich vor ihm niedergekniet hatte, »ist der Kerl stehengeblieben. Da sind nicht nur zwei Abdrücke im Schnee, sondern bestimmt mehr als ein Dutzend auf kleinster Fläche. Glaubst du, ich wüsste nicht, was das bedeutet?«
»Die Spuren sind von mir. Ich … ich bin dort stehengeblieben, nachdem ich den zweiten Schuss abgefeuert hatte, und habe mich umgeschaut, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich dachte, Sie wären ganz nahe hinter mir und wir könnten ihn vielleicht in die Zange …«
»Genug der Lügengeschichten!«, schrie Boogan ihn an. »Du weißt, wer der Wilderer ist. Den Namen, O’Brien!«
Patrick presste die Lippen zusammen. Wie konnte er John Tyler ans Messer liefern, nachdem dieser ihm einmal das Leben gerettet hatte?
»Den Namen, O’Brien!«
»Ich habe ihn nicht erkannt, Mr. Boogan.« Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn.
Mit routiniertem Schwung hängte sich Boogan die Flinte um die linke Schulter, als wollte er für das, was gleich kam, die Hände frei haben. Patrick rechnete damit, dass Boogan einen seiner gefürchteten Wutanfälle bekommen und ihm seine Fäuste zu schmecken geben würde, und er wusste, dass er sich vor den Schlägen nicht schützen, sondern sie als verdiente Strafe hinnehmen würde.
Doch Boogan schrie ihn weder an, noch schlug er auf ihn ein. Er trat nur ganz nahe an ihn heran, und das machte ihm mehr als alles andere Angst.
»Jetzt hör mir mal ganz genau zu, Patrick O’Brien«, begann der Wildhüter mit einer Stimme, die so leise und furchteinflößend war, als hätte ihm der Teufel die seine geliehen. »Du hast den Wilderer erkannt, das lese ich sowohl aus den Spuren als auch aus deinem Gesicht. Nein, warte, sag noch nichts. Du könntest es später bereuen. Hör mich zu Ende an. Ich weiß, dass du den Wilderer erkannt hast, und ich nehme an, dass du einen guten Grund zu haben glaubst, mir seinen Namen nicht zu nennen. Es ist jemand aus dem Dorf, jemand, den du vermutlich schon zeit deines Lebens kennst und den du bisher eines Verbrechens wie dem der Wilderei nicht für fähig gehalten hast. Und deshalb bist du verwirrt und weißt nicht, was du tun sollst. So ist es doch, nicht wahr?«
Patrick sagte keinen Ton.
»Gut, du bist noch jung, erst fünf Jahre in dieser verantwortungsvollen Position als mein zweiter Jagdgehilfe«, fuhr Boogan scheinbar verständnisvoll fort, »und du bringst es nicht übers Herz, einen aus dem Dorf für sein schändliches Tun zur Verantwortung zu ziehen. Dabei weißt du, dass Wilderei nicht von ungefähr unter strenger Strafe steht. Denn ein Wilderer ist ein gemeiner, hinterhältiger Dieb, der die Eigentumsrechte eines anderen verächtlich mit Füßen tritt und damit eine Gefahr für jeden anständigen, gesetzestreuen Bürger darstellt. Niemand ist vor ihm sicher!«
John Tyler wollte nur einen Hasen für seine hungernde Familie, war Patrick versucht, zu entgegnen. Nur einen einzigen Hasen aus dem reichen Wildbestand von Lord Harland. Einem Wildbestand, den nicht einmal die vielen Jagdgesellschaften spürbar verringern können, ganz gleichgültig, wie viel Enten, Fasane, Füchse und Rotwild im Feuer der satten Ladies und Gentlemen, die nicht wissen, was Hunger ist, ihr Leben lassen – des bloßen Vergnügens an der Jagd wegen. Doch kein Wort kam ihm über die Lippen.
Boogan wartete. Als Patrick noch immer stumm blieb, atmete er tief durch. »Ich habe deinen Vater geschätzt, obwohl er ein Ire war. Er war ein guter Kutscher und immer loyal zu seiner Herrschaft, und deine Mutter stand ihm in Pflichtbewusstsein und Ehrerbietung in nichts nach.«
»Lassen Sie meine Eltern aus dem Spiel, Mr. Boogan«, stieß Patrick gepresst hervor. »Sie haben nichts mit dem hier zu tun.«
»O doch! Ich dachte, du wärst aus demselben Holz geschnitzt wie sie. Deshalb habe ich dich aus dem Stall herausgeholt, dich unter meine Fittiche genommen, dir alles über den Wald und das Wild beigebracht und dich zu meinem zweiten Gehilfen gemacht. Aus dir kann eine Menge werden. Vielleicht wirst du eines Tages, wenn meine Augen zu schwach und meine Beine zu müde für diese Aufgabe geworden sind, meine Nachfolge antreten und Wildhüter Seiner Lordschaft sein. Du hast es in dir, und es liegt ganz in deiner Hand, was aus dir wird, mein Junge. Also zerstör jetzt nicht deine eigene Zukunft. Vergiss die Kumpanei. Deine Loyalität gilt allein Seiner Lordschaft. Und nun sag mir endlich den Namen, dann will ich alles vergessen und darauf verzichten, diesen Vorfall zu melden.«
Patrick zögerte. Es war ja so leicht. Nur zwei Worte trennten ihn von der Sicherheit, seine Anstellung zu behalten und im Sommer, wenn Tom Dale nach Chipping übersiedelte und in die Werkstatt seines Schwiegervaters eintrat, zum ersten Gehilfen des Wildhüters aufzurücken. Die Beförderung war ihm sicher. Damit stand nur ein Name zwischen ihm und einem Wochenlohn, der um anderthalb Shilling höher lag als sein bisheriger und der es ihm dann endlich ermöglichen würde, um Maggies Hand anzuhalten und für sie und die Kinder, die sie zusammen haben würden, zu sorgen. Denn wenn Mann und Frau die Lust des Fleisches teilten, blieben Kinder meist nicht aus, und ihm sollte es recht sein, solange es Maggie war, die mit ihm die Lust der Zeugung teilte und ihm die Kinder schenkte. All das lag in greifbarer Nähe. Nur ein Name stand ihrem Glück im Wege. Er brauchte bloß John Tyler zu sagen, und alles wäre in Ordnung …
Nein, nichts wäre danach in Ordnung, widersprach da sofort eine Stimme in ihm. Nichts wäre danach jemals wieder in Ordnung. Wie könnte er den Mann verraten, der ihm einst das Leben gerettet hatte, und hoffen, seine Selbstachtung zu bewahren und nicht vor Abscheu vor sich selbst ausspucken zu müssen, wann immer er seinem Abbild im Spiegel begegnete?
Ein Kloß von der Größe eines Ochsenfrosches saß ihm in der Kehle und wollte nicht weichen, sosehr Patrick auch schluckte. »Ich habe den Mann nur von hinten gesehen … flüchtig … und weiß nicht, wer er war.«
»O’Brien, mach dich nicht unglücklich!«, warnte ihn Boogan. »Den Namen! Spuck den gottverdammten Namen aus, und alles ist gut!«
Steif wie eine Marionette an den Fäden eines ungeübten Puppenspielers, schüttelte Patrick den Kopf. »Ich kann Ihnen mit keinem Namen dienen, weil ich ihn nicht weiß«, beharrte er.
Boogan sah ihm an, dass er daran festzuhalten gedachte. »Du verdammter Narr! Du hältst den Kopf für einen Wilderer hin. Aber gut, wenn es das ist, was du willst … Geh mir aus den Augen, und warte in deinem Cottage. Du hast zwei Stunden Zeit, um dich zu besinnen.«
»Es gibt nichts, wessen ich mich besinnen müsste.«
»Verschwinde!«, schrie Boogan ihn an, riss seine Flinte herum und hieb ihm den Kolben gegen die Brust. Patrick fiel rücklings in den Schnee, genau auf die Stelle mit John Tylers verräterischen Spuren. »Du bist die längste Zeit mein Gehilfe gewesen. Ich werde Seiner Lordschaft Bericht erstatten. Soll er entscheiden, was mit dir geschieht.«
Patrick rutschte durch den Schnee, sodass nichts mehr an eindeutigen Spuren zurückblieb, die gegen ihn Verwendung finden konnten, und richtete sich dann auf. Bleich und nur mit Mühe das Zittern unterdrückend, das plötzlich seine Glieder befiel, wich er vor Boogan zurück. Dann drehte er sich um und begann zu laufen.
»O’Brien!«, rief Boogan ihm mit wutentbrannter Stimme nach. »Du machst den Fehler deines Lebens und wirst es bitter bereuen. Du hast zwei Stunden, um zur Vernunft zu kommen, hast du gehört? Zwei Stunden!«
3
Warum nur? – fragte sich Patrick immer wieder, während er durch den Wald und dann die Landstraße hinunter zu seinem Cottage rannte. Warum nur? Warum musste ihm ausgerechnet John Tyler vor die Flinte laufen? Hätte es denn nicht der schmierige Ned Correy sein können oder Oriel Cutliffe, dem man nachsagte, dass er nicht nur gewilderten Tieren mit Vergnügen die Kehle durchschnitt, sondern auch mal einem durchreisenden Fremden, der unvorsichtig genug war, sich ohne Begleitung in die Wälder zu wagen? Ein Gerücht nur, zugegeben, aber es hätte es ihm doch leichter gemacht, ihn zu stellen und Boogan zu überantworten. Jeder andere als John Tyler wäre ihm recht gewesen. Jeder!
Das Cottage, in dem er und sein älterer Bruder Sean aufgewachsen waren, und das er seit dem Tod seiner Mutter im vergangenen Frühjahr ganz allein bewohnte, lag von der Straße ein Stück zurück versetzt. Es war ein schlichtes Haus, aus dem orangefarbenen Kalkstein errichtet, für den diese Region bekannt war, mit kleinen Fenstern und einem tief heruntergezogenen Dach, das dem Cottage das Aussehen verlieh, als duckte es sich zwischen den hohen alten Bäumen in seiner Nachbarschaft.
Patrick stieß die Tür auf und sank in der Wohnstube auf einen Hocker am Küchentisch. Der niedrige Raum war zugleich auch Küche und früher zudem noch Schlafstelle für ihn und Sean gewesen, denn außer diesem Zimmer gab es nur noch eine kleine Kammer, die sich seine Eltern geteilt hatten – und die er mit Maggie hatte teilen wollen.
Er versuchte einen klaren Gedanken zu fassen, doch es war ihm unmöglich. Erinnerungen und Ahnungen durchzuckten ihn wie Blitze, die bei einem schweren Gewitter grell am Himmel aufleuchten, um Sekunden später schon von neuen hellen Lichtzacken abgelöst zu werden.
Patrick dachte an seinen Bruder und wünschte, wenigstens er stünde ihm jetzt zur Seite. Doch Sean war tot. Mit fünfzehn war er davongelaufen, zur See gegangen und von seiner letzten Fahrt nach Indien vor drei Jahren nicht mehr zurückgekehrt. Wenige Monate später hatte ein Lungenleiden seinen Vater dahingerafft. Seine Mutter hatte nach dem Tod seines Vaters jeden Lebenswillen verloren und war in Apathie versunken. Sie war ihm im Jahr darauf ins Grab gefolgt. Ihr Herz hatte eines Nachts einfach aufgehört zu schlagen.
»Es ist niemand mehr da«, murmelte er. »Nur noch Maggie …«
Seine Gedanken irrten von einem »Wenn« zum nächsten »Hätte«, um immer wieder zu John Tyler zurückzukehren. Hätte er ihn auf der Lichtung am Three Fox Brook zum Krüppel geschossen oder gar getötet, er hätte nichts zu befürchten gehabt. Im Gegenteil, er hätte sich mit einem einzigen gezielten Schuss das Wohlwollen Seiner Lordschaft gesichert, der ihm bisher kaum Beachtung geschenkt hatte.
Und Boogan hätte ihn im Sommer zu seinem ersten Gehilfen ernannt. Alles wäre gut gewesen …
Er fühlte sich wie in Trance. Die Angst jedoch verließ ihn nicht einen Augenblick. Sie lag ihm wie eine eiskalte Hand an der Kehle. Zwei Stunden, hatte Boogan gesagt. Wie viel war davon schon verstrichen? Eine Stunde? Anderthalb? Noch war nichts verloren. Boogan stand zu seinem Wort. Er brauchte ihm nur den Namen des Wilderers zu geben. Nur der Name, und dann …
Patrick sprang abrupt auf, als wollte er dem feigen Einreden dieser inneren Stimme entkommen. Wie ein verstörtes Tier lief er hin und her. Dann beschloss er, sich einen Tee zu machen. Als er den Kessel füllte, goss er mehr Wasser daneben als hinein, so sehr zitterten seine Hände. Und an der offenen Feuerstelle stellte er sich so ungeschickt an, als hätte er nie zuvor ein Feuer entfacht.
Er aß trockenes Brot, in der Hoffnung, dieses elende Gefühl der Schwäche zu überwinden. Doch schon nach wenigen Bissen revoltierte sein Magen. Er stürzte aus dem Cottage und erbrach sich. Danach stand er schweißüberströmt, nach Atem ringend und wie nach einer langen Krankheit entkräftet, an die Hauswand gelehnt in der Kälte.
Wilder Zorn auf John Tyler wallte in ihm auf. Wie konnte er von ihm verlangen, dass er für ihn den Kopf hinhielt? Das war verdammt nicht fair. War es denn seine Schuld, dass Tyler diesen schrecklichen Unfall gehabt hatte? Außerdem hatte er doch gewusst, auf was er sich einließ, wenn er hier wilderte. Jedem im Harland County war bekannt, dass Seine Lordschaft Wilderei mit aller Härte verfolgte. Ob verzweifelt oder nicht, Tyler hatte mit dem Feuer gespielt, und nun sollte er, Patrick O’Brien, sich für ihn die Finger verbrennen? Nein, das war zu viel verlangt. Und Tyler sollte ihm bloß nicht damit kommen, dass er ihm wegen der Sache mit dem Dorfteich noch etwas schuldig war. Das lag jetzt schon fünfzehn Jahre zurück und hatte mit diesem Leben überhaupt nichts mehr zu tun. Und überhaupt: Wenn er sich richtig erinnerte, hätte Tyler damals gar nicht einzugreifen brauchen. Gut, er war im Dunkeln auf dem dünnen Eis eingebrochen und in Panik geraten. Aber das war nur der erste Schock des eisigen Wassers gewesen. Daran wäre er bestimmt nicht gestorben. So tief war der Teich an der Stelle doch gar nicht, als dass er hätte ertrinken können. Ja, er hätte es auch allein zurück ans Ufer geschafft. Sein Vater hatte von Tylers Eingreifen viel zu viel Aufhebens gemacht. Nicht von ungefähr war er für seinen Hang zu dramatischen Geschichten bekannt gewesen. Das war eben das irische Blut in ihm. Nicht, dass er Tylers Mut und Geistesgegenwart von damals infrage stellen wollte. Dafür war er ihm etwas schuldig. Aber das Leben verdankte er ihm nicht. Und somit bestand für ihn auch keine Verpflichtung, ihn zu decken und damit alles aufs Spiel zu setzen, was er sich in vielen Jahren harter Arbeit erkämpft hatte. Niemand konnte das von ihm verlangen. Er war nun mal kein Märtyrer. Und wenn er es einmal nüchtern betrachtete, hatte er doch nie viel mit den Leuten aus dem Dorf zu tun gehabt. So ganz hatten sie seinen Vater, den Seine Lordschaft aus Irland mitgebracht hatte, als er von seinem Militärdienst in Irland zurückgekommen war, in der Gemeinde nie akzeptiert. Sein Vater war immer der Ire geblieben und er der Sohn des Iren. Nein, sogar nach dreiundzwanzig Jahren hatte er für die Menschen in Harland noch immer nicht den Stallgeruch des Fremden abgelegt. Allein Maggie sah ihn mit anderen Augen …
Patrick straffte sich. Maggie! Er musste auch an sie denken. Boogan wollte den Namen. Und als zweiter Gehilfe des Wildhüters war er ihm und Seiner Lordschaft stärker verpflichtet als John Tyler. Die Zeiten waren schwer, nicht nur für die Tylers, und da musste jeder für sich selber sorgen. Kaum hatte er sich dafür entschieden, den Namen des Wilderers preiszugeben, fühlte sich Patrick auch gleich viel besser. Er bereute jetzt, nicht schon auf der Lichtung diesen Schritt getan zu haben. Aber Boogan hatte ihm ja zwei Stunden Bedenkzeit eingeräumt, in denen er sich »erinnern« konnte. Der Wildhüter war ein harter Mann, doch er war nicht ohne Verständnis, und irgendwie hatte er etwas für ihn übrig. Natürlich musste er mit einer empfindlichen Strafe rechnen, ein halbes Jahr Nachtgänge bei gekürztem Lohn etwa, aber das würde er überstehen.
Was mit John Tyler geschehen würde, diesen Gedanken verdrängte er mit aller Gewalt.
Und dann hörte er die Kutsche.
4
Mit finsterer Miene und einem dicken Schal um den Hals, der Mund und Nase verbarg, saß Boogan oben auf dem Kutschbock neben dem bulligen Jack Thompson, dem man ein feines Gespür für Pferde und wie man sie behandeln musste auf den ersten Blick gar nicht zugetraut hätte. Es war empfindlich kalt auf dem ungeschützten Sitz. Statt um einige Grad zu klettern, waren die Temperaturen mit Anbruch des Tages noch weiter gesunken.
Boogan hätte es vorgezogen, den Weg zu Fuß oder auf dem Rücken eines Pferdes zurückzulegen, was ihm körperliche Bewegung verschafft und ihn warm gehalten hätte. Aber Seine Lordschaft hatte sich dazu entschlossen, sich dieser unerfreulichen Sache persönlich anzunehmen und mit zu O’Briens Cottage zu fahren. Und da er es auch noch für nötig erachtet hatte, Mr. Edgar Millar, seinen Verwalter, ins Bild zu setzen und ihn aufzufordern, ihn zu begleiten, war ihm nur der Platz auf dem Kutschbock geblieben.
Der Wildhüter versuchte nicht daran zu denken, wie angenehm warm es im Innern der Kutsche sein musste, im Vergleich zu seinem luftigen Platz auf der harten Bank. Zwei Lagen von jeweils sechs Backsteinen, im Ofen erhitzt und von dunkelgrünen Filzbeuteln umschlossen, füllten einen hölzernen Kasten im Boden der Kutsche zwischen den weich gepolsterten Sitzbänken. Seine Lordschaft und Mr. Millar hatten mit Sicherheit keine kalten Füße. Die Wärme, die aus den Backsteinen unter ihren Stiefeln aufstieg, sorgte zudem auch dafür, dass es nur einer weichen Decke um die Schultern bedurfte, um der Kälte mit einem wohligen Gefühl zu trotzen.
Boogan stieß einen tiefen Seufzer aus. Was nutzte es, sich in neidvollen Gedanken zu ergehen. So war nun mal die Hierarchie auf dieser Welt. Als Wildhüter stand er gesellschaftlich um einiges über dem Kutscher, der im Gegensatz zu ihm Harland House noch nie betreten hatte und dies auch nie tun würde – so wie er seinerseits es nicht erleben würde, durch den Haupteingang ins Haus zu gelangen und Seiner Lordschaft einmal in einem der Salons gegenüberzusitzen und sich mit ihm zu unterhalten, so wie es Edgar Millar tat. Doch zu Festlichkeiten der Herrschaft wurde auch dieser nicht eingeladen. Ein Verwalter, auch wenn er einer noch so guten Familie entstammte, konnte nun mal nicht zur feinen Gentry zählen und mit ihnen an einem Tisch sitzen.
Ja, so lagen die Dinge, und von Patrick O’Brien hatte er erwartet, dass er sich seiner eigenen Stellung in dieser Hierarchie ebenso klar bewusst war. Die Loyalität, die man von einem Stallburschen erwarten durfte, konnte keinen Vergleich mit der Verpflichtung aushalten, der ein Wildhüter und seine Gehilfen unterlagen. Die Loyalität, die Patrick O’Brien Seiner Lordschaft schuldete, durfte keine Einschränkungen und kein Zögern kennen. Man konnte nicht gut Freund mit den Leuten aus dem Dorf und gleichzeitig Lord Harland treu ergeben sein. Wasser und Feuer ließen sich nun mal nicht mischen. Und wer dennoch so dumm war, es zu versuchen, der verlor nicht nur Wasser und Feuer, sondern verbrühte sich auch noch an dem Dampf, der dann entstand.
»Narr!«, grollte Boogan leise vor sich hin.
Jack Thompson fühlte sich dadurch angesprochen und ermuntert, seiner Neugierde nachzugeben. »Bei allem Respekt, Mr. Boogan«, sagte der Kutscher, als sie das hohe schmiedeeiserne Tor von Harland House passierten und der Landstraße durch den Wald in Richtung Dorf folgten, »aber ich kann einfach nicht glauben, dass der junge O’Brien mit Wilderern unter einer Decke stecken soll.«
»Niemand hat gesagt, dass O’Brien mit Wilderern unter einer Decke steckt!«
»Aber wie ich gehört habe …«
»Ich weiß nicht, was Sie gehört haben, Thompson, doch es war mit Sicherheit nicht die Wahrheit!«, fiel Boogan ihm ins Wort.
»Sie wissen natürlich besser darüber Bescheid, Mr. Boogan, und können mir bestimmt sagen, womit der junge O’Brien Seine Lordschaft so in Rage gebracht hat«, versuchte es der Kutscher auf die einschmeichelnde Tour.
»Das könnte ich in der Tat«, bestätigte Boogan schroff, dachte jedoch nicht daran, ihn ins Vertrauen zu ziehen. Er war vielmehr äußerst verärgert, dass irgendjemand offenbar einiges von dem aufgeschnappt hatte, was er bei den Stallungen zu Seiner Lordschaft gesagt hatte. Aber vielleicht hatte Thompson seine Halbwahrheiten ja auch von einem Dienstmädchen, das Lord Harland im Gespräch mit dem Verwalter gehört und nichts Besseres zu tun gehabt hatte, als eine sehr fantasievolle Version der tatsächlichen Begebenheiten unter den Bediensteten von Harland House zu verbreiten.
Der Kutscher reagierte auf die Zurückweisung des Wildhüters mit einem grimmigen »Ganz wie Sie meinen, Mr. Boogan!«, und versank wieder in Schweigen.
Boogan war es recht so. Ihm war nicht nach Reden zumute und nach klatschsüchtigem Geschwätz schon gar nicht. Ihm ging genug anderes durch den Kopf. Er wünschte, er hätte die Sache mit dem jungen O’Brien allein und unter vier Augen regeln können. Er war sicher, er hätte ihn zur Vernunft und den Namen von ihm in Erfahrung gebracht: Aber mit seiner Entscheidung, den Verwalter mitzunehmen, hatte Seine Lordschaft ihm das Heft aus der Hand genommen. Er fürchtete, dass ihm gleich nur die Rolle des Beobachters blieb.
Edgar Millar würde das Reden übernehmen, und Boogan ahnte bereits, dass es für O’Brien nicht gut ausgehen würde. Niemand kam mit dem Verwalter klar, Seine Lordschaft einmal ausgenommen, und das lag nicht allein daran, dass es zu seinen undankbaren Aufgaben gehörte, die Pacht einzutreiben und gelegentlich säumige Pächter kurzerhand von ihren Parzellen zu vertreiben. Es hatte viel eher damit zu tun, dass er nie auch nur eine Gefühlsregung zeigte. Er, Boogan, brachte ihm zwar den Respekt entgegen, den Edgar Millar als Verwalter von ihm erwarten durfte, doch persönlich mochte er ihn nicht. Edgar Millar war so kalt wie ein toter Fisch.
Wenn man von Harland House kam, stieß man zunächst auf das Cottage der O’Briens, das einen halben Kilometer oberhalb des Dorfs ganz für sich allein stand. Erst wenn man um die nächste Kurve bog, sah man die Häuser von Harland. Diese abgesonderte Lage war nicht ohne Symbolik.
»Er scheint uns ja schon erwartet zu haben. Wenn das nicht dreist ist«, stellte Thompson fest, als das Cottage in Sicht kam.
Boogan bemerkte, dass die Stimme des Kutschers jetzt einen geringschätzigen, feindseligen Unterton besaß. Er hatte sein Urteil über Patrick O’Brien also schon gefällt und ihn für schuldig befunden, obwohl ihm über dessen Vergehen bisher nichts als Gerüchte bekannt waren.
Patrick stand vor der offenen Tür, sichtlich um Haltung bemüht, als die herrschaftliche Kutsche genau auf einer Höhe mit ihm anhielt. Das Gefühl der Übelkeit, das er überwunden zu haben glaubte, kehrte augenblicklich zurück.
Die Räder waren noch nicht ganz zum Stillstand gekommen, da sprang Boogan schon vom Kutschbock. Er wollte seine Chance nützen und der Erste sein, der mit Patrick sprach.
Doch Edgar Millar machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Als hätte er geahnt, dass ihm der Wildhüter zuvorkommen wollte, stieß er den Kutschenschlag auf und war schon ausgestiegen, bevor Boogan um das Gefährt zu Patrick auf die andere Seite gelaufen war.
Der Verwalter war von kleiner, schmaler Gestalt. Boogan überragte ihn auch dann noch um einen Kopf, wenn Millar seine Stiefel mit den besonders hohen Absätzen trug. Zwar gehörte er nicht dem Adel an, doch zumindest seine Gesichtszüge waren aristokratisch – und wie aus kaltem Granit gemeißelt. An den Schläfen zeigte sein schwarzes Haar graue Strähnen. Der lange schwarze Mantel mit dem Fuchspelzkragen saß so angegossen wie seine Lederhandschuhe. In der rechten Hand hielt er eine Reitgerte.
Obwohl Boogan wusste, dass er dem Verwalter den Vortritt lassen musste und sich nur zu äußern hatte, wenn er dazu aufgefordert wurde, unternahm er den Versuch, das Schlimmste zu verhindern.
»Bestimmt wolltest du dich gerade auf den Weg zu mir machen, weil dir endlich eingefallen ist, wer der Wilderer heute Morgen war, der dir am Three Fox Brook entkommen ist, nicht wahr, O’Brien?«, fragte er suggestiv.
Noch bevor Patrick zu einer Antwort ansetzen konnte, griff Edgar Millar ein. »Wenn ich Ihrer Hilfe bedarf, was sehr unwahrscheinlich ist, werde ich es Sie wissen lassen, Boogan«, sagte er scharf.
»Entschuldigen Sie, Mr. Millar«, murmelte Boogan und trat einen Schritt zurück. Er brauchte nicht zum Kutschbock hochzublicken, um zu wissen, dass Thompson jetzt schadenfroh grinste.
Lord Harland setzte den Fuß nicht aus der Kutsche. Das wäre unter seiner Würde gewesen. Er beobachtete die Szene durch den offen stehenden Kutschenschlag und war von dort, wo Patrick stand, nur als schemenhafter Umriss zu erkennen.
»Und jetzt zu dir, O’Brien!«, sagte der Verwalter mit kühler Herablassung und tippte mit der Spitze seiner Reitgerte an seine Brust. Es war nur eine ganz leichte Berührung und zugleich doch demütigender als eine Ohrfeige.
Boogan sah, wie Patrick das Blut ins Gesicht schoss, und er wusste schon jetzt, was kommen würde.
»Sir, ich möchte Ihnen erklären …«, begann Patrick.
»Erklärungen? Dir steht es nicht zu, irgendwelche Erklärungen abzugeben, O’Brien! Dieses Recht besitzt nur ein Gentleman, nicht jedoch jemand wie du!«, fuhr ihn der Verwalter augenblicklich an. »Du hast im Dienste Seiner Lordschaft gestanden und das Vertrauen aufs Schändlichste missbraucht, das man dir auf so großzügige Weise entgegengebracht hat. Du hast Mr. Boogan und dadurch auch Seiner Lordschaft nicht nur Treue und Gehorsam verweigert, sondern dich auch noch der Beihilfe zur Wilderei schuldig gemacht!«
»Sir, das ist nicht wahr!«, widersprach Patrick. »Ich habe nie auch nur …«
»Willst du mich der Lüge bezichtigen?«, fragte Edgar Millar und fixierte ihn mit eisig durchdringendem Blick.
»Nein, Sir, aber …«
»Ich glaube, O’Brien will nur …«, meldete sich Boogan zaghaft zu Wort – und hätte sich im nächsten Moment am liebsten die Zunge abgebissen. Was, zum Teufel, mischte er sich da noch ein?
Edgar Millars Reaktion erfolgte auf der Stelle. »Ich brauche keinen Übersetzer oder Zeichendeuter, Mister Boogan!« Der Kopf des Verwalters ruckte kurz zum Wildhüter herum und der Blick, mit dem er ihn bedachte, war eine letzte stumme Warnung, sich ja nicht noch einmal ungefragt einzumischen. Dann wandte er sich wieder Patrick zu. »Ich weiß sehr wohl, was du willst. Du willst uns Sand in die Augen streuen und deine Wildererfreunde decken. Aber dafür hast du dir den Falschen ausgesucht!«
Patrick erkannte in diesem Moment, dass er nicht mehr darauf hoffen konnte, seine Anstellung zu behalten. Er würde auf Lord Harlands Ländereien nie wieder Arbeit finden, das sah er in den Augen von Edgar Millar. Der Verwalter hatte sein Urteil über ihn längst gefällt, und er würde dieses Urteil nicht mehr ändern, was immer er auch sagte. Jetzt galt es nur noch, seine Haut zu retten. Das bedeutete, dass er geradezu gezwungen war, zu seiner alten Geschichte zu stehen und jedes Wissen abzustreiten. Gab er nämlich John Tyler preis, machte er sich zum Mitschuldigen, denn dadurch lieferte er ja den Beweis, dass er bisher gelogen und Tyler ausreichend Möglichkeit gegeben hatte zu flüchten. Daraus konnte man ihm einen Strick drehen und ihn wegen Komplizenschaft vor Gericht bringen – und dann drohte ihnen beiden die Deportation in die gefürchtete Sträflingskolonie Australien. Wie es hieß, überlebte auf den Sträflingsschiffen, die für die lange Reise um den Globus bis zu acht Monate brauchten, oftmals nur die Hälfte der Verbannten …
Die Angst ließ Patrick jeden Respekt vergessen. »Das ist alles nicht wahr, Sir! Ich weiß nichts! … Ich habe versucht, den Wilderer zu stellen …«
»Du lügst!«
»… aber er war schneller als ich«, fuhr Patrick unbeirrt und mit dem Mut der Verzweiflung fort. »Und ich habe ihn auch nicht erkannt. Er hatte einen zu großen Vorsprung, und im Unterholz war zu der Morgenstunde ja noch alles im Dämmerlicht. Ich weiß nicht, wer der Wilderer war, ja ich weiß noch nicht einmal, ob dieser Mann, wer immer es war, überhaupt gewildert hat. Ich habe nicht gesehen, dass er irgendetwas mit sich getragen hat.« Absolut nichts zu wissen, war jetzt seine einzige Chance, der Verhaftung und Verbannung zu entgehen.
»Ich glaube dir kein Wort!«, sagte der Verwalter.
Aus der Kutsche kam ein dezentes Klopfen. Edgar Millar wandte sich um. Eine Hand in einem warmen Pelzhandschuh tauchte kurz im Kutscheneinstieg auf und erteilte dem Verwalter den klaren Befehl, sich zu Seiner Lordschaft zu begeben.
»Wage es ja nicht, dich von der Stelle zu rühren!«, drohte Edgar Millar, ging zur Kutsche und beugte sich hinein, um zu hören, was Seine Lordschaft ihm zu sagen hatte.
Patrick zitterte innerlich vor Furcht, welches Schicksal ihm drohen mochte. Er wusste, welche Macht Lord Harland besaß. Wenn er wollte, konnte er sogar dafür sorgen, dass er sein Ende am Galgen fand. Das Recht stand immer auf der Seite der Mächtigen. Die Gesetze waren von ihnen gemacht, nicht um Gerechtigkeit zu erreichen, sondern um die angeblich gerechten Interessen der Reichen und Adligen vor dem einfachen Volk zu schützen. Und darum gingen die ehrenwerten Richter ja wohl auch lieber zu den Bällen und Jagdgesellschaften der Gentry, als sich in den Dörfern auf den Erntedankfesten oder in den Städten auf den Märkten zu zeigen.
Der Verwalter kehrte, offenbar mit neuen Instruktionen, zu Patrick und Boogan zurück. Sein Gesicht verriet nichts, als er sich dem Wildhüter zuwandte und sagte: »Seine Lordschaft möchte wissen, ob O’Brien dem Mann nahe genug auf den Fersen war, um ihn erkennen zu müssen.«
Patrick hielt den Atem an. Ein Wort über die Spuren auf der Lichtung, und er war verloren. Ihm war, als spürte er schon den rauen Hanf des Stricks um seinen Hals.
Boogan hielt dem stechenden Blick des Verwalters ohne mit der Wimper zu zucken stand. »O’Brien war weit vor mir, ich konnte ihn nicht sehen. Und es stimmt, was er sagt, es herrschte Zwielicht im Wald. Dass er ihm nachgerannt ist, so schnell er vermochte, und ihn mit zwei Schüssen zum Stehenbleiben zu bringen versucht hat, steht für mich außer Frage.«
»Ist das alles, Boogan?«
»Ja, Sir. Alles andere ist nur Spekulation.«
Patrick hatte Mühe, sich seine Erleichterung und Dankbarkeit nicht anmerken zu lassen.
»Ich muss jedoch zugeben, dass ich sehr enttäuscht war und mir von O’Brien in dieser Situation mehr erwartet hätte«, fügte der Wildhüter hinzu. »Er mag die Wahrheit sagen, doch mein Vertrauen hat er verloren.«
Der Verwalter würdigte ihn keiner Erwiderung. Sein Blick sowie seine Reitgerte richteten sich wieder auf Patrick. »Ich glaube dir kein Wort, O’Brien. Aber um deines Vaters willen, den Seine Lordschaft stets als treuen und aufrechten Mann gekannt hat, will Seine Lordschaft auf eine Anklage gegen dich verzichten. Pack deine Sachen!«, befahl er ihm. »Ich gebe dir fünf Minuten – und keine Sekunde langer!« Er zog eine silberne Taschenuhr hervor und ließ den Deckel aufklappen.
Patrick sah ihn einen Moment verstört an, dann rannte er ins Haus. Er zerrte einen alten Kleidersack aus der Truhe am Fußende seines Bettes und stopfte alles an Kleidern und Schuhen hinein, was er besaß. Viel war es nicht. Die Sachen seiner verstorbenen Mutter hatte er Mrs. Walton, Maggies Mutter, geschenkt. Und was gab es sonst noch, was er unbedingt mitnehmen musste? Natürlich seine Ersparnisse der letzten Jahre, die sich auf ein Pfund und vier Shilling beliefen. Schnell holte er den kleinen Lederbeutel aus seinem Versteck, in dem sich auch die Brosche seiner Mutter befand, das Hochzeitsgeschenk seines Vaters, eine kleine Kamee, das Teuerste, was seine Mutter je besessen hatte. Er hatte die Brosche Maggie am Tage ihrer Hochzeit schenken wollen …
Fünf Minuten! Um Gottes willen, wie viel Zeit blieb ihm noch? Er lief aus der Schlafkammer in den Küchen- und Wohnraum. Wie in Trance warf er Bestecke auf die Kleider, zwei Becher, einige verbeulte Teller, die blechern schepperten, als sie im Sack landeten, eine Handvoll Kerzenstummel, eine Sturmleuchte sowie den stoffbezogenen Flick- und Nähkorb seiner Mutter.
»Die fünf Minuten sind um!«, rief der Verwalter von draußen. »Thompson, mach dich an die Arbeit!«
»Sehr wohl, Sir.«
Die breitschultrige Gestalt des Kutschers füllte im nächsten Moment den Türrahmen und verdunkelte den Raum. »Sieh zu, dass du hier rauskommst. Deine Zeit ist abgelaufen. Den Rest deiner Klamotten wird sich das Feuer holen!«
»Du sollst das Cottage anzünden?«, fragte Patrick ungläubig. »Ja, so lautet der Befehl Seiner Lordschaft, und nun raus mit dir! Ich will nicht auch noch wegen dir Ärger bekommen«, zischte der Kutscher und trat zur Feuerstelle.
Hastig nahm Patrick das hölzerne Kreuz vom Haken über der Tür und das erinnerte ihn an die kleine Bibel, die sein Vater aus Irland mitgebracht hatte, obwohl er des Lesens und Schreibens unkundig gewesen war. Fast hätte er das ihm teure Buch, so zerfleddert und abgegriffen es auch war, vergessen. Als es im Sack war, griff er zu seiner Flinte und ließ seinen Blick ein letztes Mal durch den Raum schweifen, der mehr als zwanzig Jahre sein Zuhause gewesen war. Dann trat er vor das Haus.
»Gib mir die Flinte!«, befahl Edgar Millar.
Patrick zögerte. »Sie gehört mir. Mein Vater hat sie mir kurz vor seinem Tod geschenkt, als Mr. Boogan …«
Der Verwalter ließ ihn nicht ausreden. »Die Flinte hat deinem Vater nie gehört. Seine Lordschaft hat sie ihm und dann dir nur überlassen. Jetzt wirst du sie zurückgeben!«
Das war eine glatte Lüge und Wut stieg in ihm auf. »Aber ich weiß …«
»Willst du Seine Lordschaft der Lüge bezichtigen?«, schnitt Edgar Millar ihm das Wort ab.
Patrick bekämpfte seine maßlose Wut, in die sich nun auch Hass mischte, denn er war sich seiner Ohnmacht bewusst. »Nein, Sir«, antwortete er mit heiserer Stimme.
»Dann gib sie endlich her!« Er riss Patrick die Flinte aus den Händen.
Indessen hatte Thompson den mit Stroh gefüllten Sack, der Patrick als Matratze auf seinem Bett gedient hatte, aus der Schlafkammer in die Küchenecke gezerrt, unter den klobigen Tisch geschoben sowie Hocker, Truhe und den offenen Küchenschrank drum herum aufgestellt. Das Feuer würde leichtes Spiel haben, das Cottage bis auf die Grundmauern niederzubrennen.
Flammen loderten auf und Thompson brachte sich in Sicherheit. Edgar Millar reichte ihm die Flinte. »Sie wird nicht mehr gebraucht. Zertrümmere sie und wirf sie ins Feuer!«
Es verursachte Patrick förmlich körperliche Schmerzen, mit ansehen zu müssen, wie der Kutscher seine Flinte, auf die er so stolz gewesen war, am Lauf packte und mit aller Kraft gegen den Türrahmen schlug. Das Schulterstück splitterte und flog in die Flammen, als wüsste es, dass es sowieso dort landen würde. Zwei weitere brutale Schläge sorgten dafür, dass die Flinte nicht mehr repariert werden konnte. Dann landeten auch diese Teile in den Flammen, die schon laut prasselten und an den Dachbalken hochleckten.
»Mach, dass du aus der Gegend verschwindest, O’Brien. Wenn du dich bei Sonnenuntergang noch irgendwo hier herumtreibst, wird Seine Lordschaft dafür Sorge tragen, dass man dich in Eisen legt. Und lass dich nie wieder auf Lord Harlands Ländereien blicken!«, sagte Edgar Millar auf seine kalte, emotionslose Art, bevor er in die Kutsche stieg. »Hast du mich verstanden, O’Brien?«
»Ja, Sir.« Patricks Stimme zitterte vor ohnmächtigem Hass und Demütigung.
Wortlos kletterte Boogan auf den Bock. Thompson löste die Bremse und brachte das Gespann mit einem Schnalzen und sanftem Zügelklatschen in Bewegung. Die Kutsche entfernte sich in Richtung Dorf.
Patrick wich vor der Hitze des Feuers zurück, das mittlerweile das ganze Dach erfasst hatte, doch er verließ den Ort nicht. Noch nicht. Er stand am Straßenrand und wartete, bis das Feuer sein Werk der Vernichtung vollendet hatte. Die unruhig tanzenden Flammen warfen ihren zuckenden Schein auf sein versteinertes Gesicht. Erlebte er dies wirklich? War ihm tatsächlich all das seit den frühen Morgenstunden zugestoßen? Oder war es nur ein Albtraum, aus dem er gleich erwachen würde?
Das Feuer blieb. Ebenso die Kälte. Der Albtraum war Wirklichkeit.
5
Das Dachgebälk stürzte in sich zusammen. Ein gewaltiger Funkenregen stieg aus der Ruine empor. Noch einmal loderte das Feuer auf. Flammen schossen aus Fenstern und Türrahmen, als wollten sie nach ihm greifen. Dann begann das Feuer aus Mangel an Nahrung langsam in sich zusammenzufallen. Rauch quoll aus den schwelenden Trümmern im Innern.
Wie betäubt hatte Patrick in die Flammen gestarrt und er hatte nicht einmal den Kopf gewandt, als die herrschaftliche Kutsche aus dem Dorf zurückgekommen war. Der Verwalter hatte ihm etwas zugerufen, doch die Worte waren nicht bis in sein Bewusstsein vorgedrungen, sie waren von den Flammen mit verzehrt worden.
Nun jedoch, da das Feuer erstarb, wich die Betäubung von ihm. Sein Gesicht glühte, doch seine Füße waren wie Eisklumpen. Die Kälte war ihm wie ein schleichendes Gift in die Glieder gekrochen und hatte sich bis in seine Brust ausgebreitet.
Patrick fuhr sich über die Augen, als müsste er erst wieder zu sich kommen. Um Himmels willen, wie lange stand er hier schon regungslos in der Kälte? War er nicht mehr ganz bei Sinnen, wollte er sich zu alldem auch noch den Tod holen? Was hielt ihn hier bloß noch? Das Cottage war eine rauchgeschwärzte Ruine und dem Verwalter war es mit seiner Drohung todernst. Er machte besser, dass er Harland County so schnell wie möglich hinter sich ließ.
Er schulterte seinen Sack und ging wie ein Seemann, der noch nicht weiß, wohin ihn die nächste Reise führen würde, die Landstraße hinunter. Er bemühte sich, seine Gedanken zu ordnen und sich für die nächsten Tage und Wochen einen Plan zurechtzulegen. Es gelang ihm nicht. Er war ein einfacher Stallbursche gewesen und dann fünf Jahre lang der zweite Gehilfe des Wildhüters. Aber er besaß kein Zeugnis, das er vorweisen konnte, wenn er sich andernorts um eine neue Anstellung bewarb. Und was sollte er sagen, wenn man ihn fragte, welcher Herrschaft er bisher gedient hatte? Und vor allem, warum er gegangen war und kein Zeugnis von seinem Herrn erhalten hatte. Zudem kannte sich die Gentry doch viel zu gut und traf sich zu häufig, als dass der Grund seiner Entlassung ein Geheimnis bleiben könnte. Nein, kein Großgrundbesitzer weit und breit würde ihm Arbeit geben.
Patrick erschauderte, zwang sich jedoch, optimistisch zu sein. Irgendeine Arbeit würde er schon finden. Und wenn er sich nur weit genug weg von Harland County als Wildhütergehilfe bewarb, in der Grafschaft Kent etwa oder in Devon, und ihm zudem eine plausible Geschichte einfiel, warum er kein Zeugnis vorlegen konnte, würde er schon eine Chance haben. Er hatte ja auch noch seine Ersparnisse. Wenn er jeden Penny dreimal umdrehte, konnte er sich mit dem Geld bis zum nächsten Frühjahr über Wasser halten. Und bis dahin sollte er wohl Arbeit gefunden haben.
Die ersten Häuser des Dorfs, fast alle aus dem orangefarbenen Kalkstein der Umgebung errichtet, tauchten vor ihm auf. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass niemand zu ihm zum Cottage herausgekommen war, obwohl man das Feuer und den Rauch auch in Harland hatte sehen müssen. Aber nicht von ungefähr trug nicht allein der Bezirk, sondern auch das Dorf den Namen der Harlands. Ihnen gehörte nicht nur das Land, sondern auch alles andere, angefangen vom Steinbruch über die Mühle und das Sägewerk bis hin zum einzigen Krämerladen des Orts. Und Patrick erinnerte sich nun wieder jenes bitteren Kommentars von Tom Dale, der ihm einmal auf einem gemeinsamen Inspektionsgang gesagt hatte, dass Seiner Lordschaft nicht nur Land, Häuser und alle profitablen Geschäfte in der Gegend gehörten, sondern auch die Menschen, nur wäre das den wenigsten bewusst. Harland war kein großer Ort. Er zählte weniger als zweihundert Seelen und auf der Straße war es noch nie sehr geschäftig zugegangen. Doch an diesem Morgen wirkte das Dorf fast wie ausgestorben.
Sie wissen es längst! – fuhr es Patrick durch den Sinn, als Joshua Granger, der alte Kerzenzieher, der sonst immer ein freundliches Wort für ihn gehabt hatte, ihm einen halb mitleidigen, halb furchtsamen Blick schenkte, den Kopf schüttelte, sich dann rasch umdrehte und in seinem Haus verschwand. Sie wissen längst, dass ich nicht mehr zu ihnen gehöre und ein Ausgestoßener bin. Dafür hat Mr. Millar bereits gesorgt. Es hat schon seinen Grund gehabt, warum Seine Lordschaft und Mr. Millar erst noch ins Dorf gefahren sind. Sicher hat der Verwalter die Dörfler gewarnt, auch nur ein Wort mit mir zu reden.
Seine Vermutung fand er bestätigt, als er zum Haus von Mary Smither kam, deren Mann vor zwei Jahren an Schwindsucht gestorben war. Vor dem Haus standen ihre beiden halbwüchsigen Söhne. Sie starrten ihn mit einem Blick an, als befände er sich auf dem Weg zum Galgen. Im nächsten Moment riss Mary Smither, der er noch im Herbst mit einigen anderen Dorfbewohnern beim Ausbessern ihres Dachs zur Hand gegangen war, die Tür auf. »James! George! Kommt sofort rein!«, rief sie mit aufgeregter Stimme. »Habt ihr denn nicht gehört, was Mr. Millar gesagt hat?« Wie die Wiesel huschten die beiden Jungen an ihrer Mutter vorbei ins Haus, die jeden Augenkontakt mit Patrick vermied und schnell die Tür wieder schloss. Ihm war, als hätte man ihn geohrfeigt und ihm ins Gesicht gespuckt.
Wut stieg in ihm auf. »Ich hoffe, das Dach hält noch lange dicht, Mrs. Smither!«, rief er mit zornigem Hohn.
Dann bog er in die nächste Gasse ein, die ihn zum Haus von Maggie und ihrer Familie führte. Greg Walton, Maggies Vater, erwartete ihn schon, als er um die Ecke kam. Er stand mehrere Schritte vor dem Haus, die Beine leicht gespreizt und einen knorrigen Stock in den Händen, als befürchtete er einen Angriff.
»Du gehst besser gleich weiter, O’Brien!« Es war kein Ratschlag, sondern ein Befehl. Und dass er ihn nicht mehr mit seinem Vornamen anredete, raubte ihm jegliche Hoffnung.
»Ich muss mit Maggie sprechen, Mr. Walton.«
»Für dich und Maggie gibt es nichts mehr zu besprechen. Du bist erledigt, O’Brien! Und ich lasse nicht zu, dass du meine Tochter mit ins Unglück ziehst!«, fuhr Greg Walton ihn an. »Mach, dass du hier wegkommst! Damit tust du nicht nur dir, sondern uns allen einen Gefallen!«
Patrick unterdrückte seinen aufwallenden Zorn. »Ich habe Sie immer für einen anständigen Mann gehalten. Aber jetzt geben Sie mir noch nicht einmal eine Chance …«
»Komm mir nicht mit dem Gefasel!«, schnitt Greg Walton ihm barsch das Wort ab. »Mir ist egal, was du getan oder nicht getan hast. Irgendeine große Dummheit musst du jedenfalls begangen haben, denn sonst hättest du Seine Lordschaft und Mr. Millar nicht so gegen dich aufgebracht. Jeder löffelt die Suppe, die er sich eingebrockt hat, alleine aus. Ich muss an meine Familie und an Maggies Zukunft denken und mit dir hat sie keine mehr. Außerdem habe ich nicht die Absicht, meine Arbeit im Sägewerk aufs Spiel zu setzen. Wer dich ins Haus lässt, kann das Dorf gleich mit dir verlassen.«
»Ist es das, was Millar im Dorf verbreitet hat?«
»Ja, und sehr unmissverständlich. Die Pest könnte nicht schlimmer sein als das, was an dir klebt, O’Brien, und das ist die Ächtung durch Seine Lordschaft!«
»Bitte, geben Sie mir nur fünf Minuten!«, beschwor Patrick ihn. »Ich liebe Maggie und ich weiß, dass Maggie mich liebt.«
Greg Walton verzog das Gesicht. »Lieben? Heb dir deine Liebe für die Landstraße auf, denn das ist alles, was dir von nun an bleibt!«
»Ich möchte doch nur noch ein Mal mit Maggie sprechen. Ich flehe Sie an, nicht so herzlos zu sein. Ich schwöre auch, dass ich nicht versuchen werde, sie zu überreden, mit mir zu gehen«, versprach Patrick in seinem brennenden Verlangen, mit ihr zu reden. Denn obwohl sein Verstand ihm sagte, dass Maggie mit ihren noch nicht einmal achtzehn Jahren niemals ohne den Segen ihres Vaters irgendeine Entscheidung treffen würde, klammerte sich sein Herz doch an die schwache Hoffnung, dass Maggie ihm ein geheimes Zeichen geben und mit ihm gehen würde.
»Maggie und mit dir gehen?« Greg Walton lachte verächtlich. »Du bist mir ein wahrer Schwachkopf. Aber ich weiß dich zu kurieren, O’Brien. Das ist sehr schnell getan.« Er rief nach seiner Tochter.
Als Maggie in der Tür erschien und Patrick ihr noch sehr mädchenhaftes Gesicht mit den haselnussbraunen Augen sah, wurde das Gefühl der Sehnsucht in ihm fast übermächtig. Er war versucht, zu ihr zu eilen, ihre Hand zu nehmen und in ihren Augen zu lesen, was sie vor ihrem Vater nicht zu sagen wagte, nämlich, dass sie ihn mit Leib und Seele liebte, immer und ewig, und dass sie auch in der Stunde der Not nicht von seiner Seite weichen würde, um keinen Preis. »Er will mit dir reden, Maggie«, rief Greg Walton seiner Tochter zu. »Hast du ihm was zu sagen?«
»Nur, dass er uns in Ruhe lassen soll, Vater«, antwortete sie mit belegter Stimme. »Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben.«
Patrick zuckte zusammen. Ein eisiger Dorn schien sich in sein Herz zu bohren. »Maggie, wie kannst du so etwas sagen?«, rief er erschüttert. »Haben wir einander nicht versprochen, dass …«
»Ich erinnere mich an kein Versprechen, Patrick O’Brien!«, fiel Maggie ihm mit schriller Stimme ins Wort und ihre Mutter tauchte an ihrer Seite auf. »Ich erinnere mich nur daran, dass ich einmal der dummen Meinung gewesen bin, du wärst ein Mann, auf den Verlass ist und der weiß, was er will. Aber das war ein Irrtum. Du bist ein Versager, Patrick O’Brien. Und mit einem Versager will ich nichts zu tun haben. Geh mir aus den Augen!«
Ohne eine Erwiderung abzuwarten, wandte sie sich um und kehrte ins Haus zurück. Patrick brannte das Gesicht. Ihm war, als hätte das ganze Dorf gehört, was Maggie ihm an den Kopf geworfen hatte. Wie konnte sie nur so etwas Grausames, Kaltherziges sagen? Hatte sie beim Erntedankfest in der Dunkelheit beim Mühlrad nicht seine Küsse mit spürbarer Leidenschaft erwidert und sogar zugelassen, dass er ihre Brüste gestreichelt hatte? Und all das, was sie füreinander empfunden hatten, sollte auf einmal nicht mehr sein?
Er brachte keinen Ton heraus. Als er auf das knochige, schmale und abgehärmte Gesicht von Maggies Mutter sah, die noch nicht vierzig und deren Haar schon mehr grau als braun war, da hatte er plötzlich das Gefühl, einen Blick in die Zukunft zu werfen und ein Bild von Maggie zu erhaschen, wie sie ausschauen würde, wenn sie erst vierzig war und neun Kinder zur Welt gebracht hatte, von denen nur vier älter als fünf Jahre geworden waren. Als er sich bei dem Gedanken ertappte, schämte er sich, Maggie in ihrer Mutter gesehen zu haben. Doch es nahm seinem Schmerz die unerträgliche Schärfe.
Greg Walton holte ihn aus seiner Sprachlosigkeit und Lähmung. »Du hast gehört, was Maggie gesagt hat. Also verschwinde endlich, bevor ich dir Beine mache, O’Brien?«
»Nicht nötig, Mr. Walton«, erwiderte Patrick gepresst und legte sich den Sack erneut über die linke Schulter. »Ich geh schon von selbst. Nur eins noch …«
»Was?«, blaffte Maggies Vater.
»Ich habe bis heute nicht gewusst, wie groß Ihre Angst und die all der anderen im Dorf vor Lord Harland ist«, sagte Patrick mehr verwundert als vorwurfsvoll.
Greg Walton fühlte sich sichtlich getroffen. »Heb dir deine klugen Worte für deine nächste Gesellschaft auf, und die wird wohl aus Landstreichern bestehen!«, zischte er.
»Er hat recht gehabt«, sagte Patrick mehr zu sich selbst, während er die Gasse wieder hinaufging. »Ihr gehört ihm wie das Land, das ihr für ihn bewirtschaftet, ohne jemals genug für euch und eure Familien zu haben, und die Häuser, in denen ihr wohnt. Ihr gehört ihm wie das Wild im Wald, nur wisst ihr es nicht … oder wollt es nicht wissen.«
»Verschwinde!«, schrie Greg Walton, bückte sich nach einem Stein und warf ihn ihm nach. Er traf den Sack.