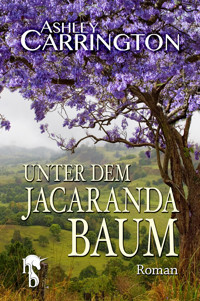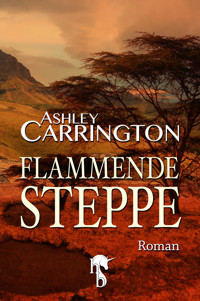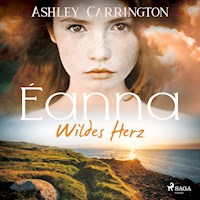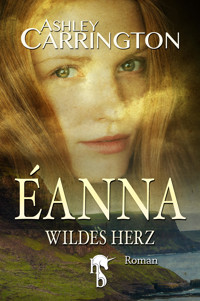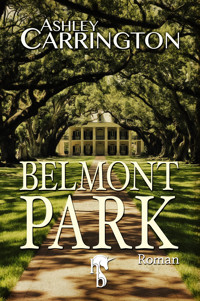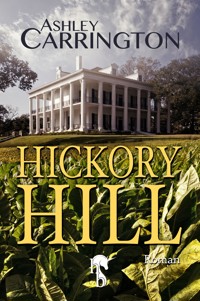
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alice Shadwells Welt gerät aus den Fugen: Sie erhält die erschütternde Nachricht, dass ihr über alles geliebter Vater auf seiner Tabakplantage in Virginia bei einem Reitunfall ums Leben gekommen ist. Obwohl es mit ihrer Gesundheit nicht zum Besten steht, beschließt das junge Mädchen, ihre Heimat England zu verlassen und das Erbe ihres Vaters anzutreten. Doch auf der Plantage im fernen Amerika, auf der sie eine glückliche Kindheit verbracht hat, soll Alice niemals ankommen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ashley Carrington
Hickory Hill
Roman
Für R. M. S., der mich auf den Weg zu neuen Ufern führte.
Erstes Buch
Frühjahr 1772
1
Wie ein schwerer nasser Schwamm erfüllte die Dunkelheit die enge Schiffskabine. Die Feuchtigkeit drang auch durch die feinsten Ritzen und bedeckte alles mit einer dünnen Schicht, fein wie Morgentau, doch so salzig wie das Meer.
Nichts half gegen diese klamme, salzige Nässe. Kein Winkel des Schiffes war frei davon. Sooft sie auch abgewischt wurde, stets kehrte sie wieder. Zu lange war der Dreimaster FairWind schon dem stürmischen Wetter des eisigen Atlantiks ausgesetzt, um noch eine trockene Stelle an Bord aufzuweisen.
Starr vor Kälte lag Mary Bancroft in ihrem schmalen, harten Kajütbett. Die feuchten, kratzigen Wolldecken hatte sie bis zum Kinn hochgezogen. Sie war vollständig angekleidet und trug unter den Decken noch einen breiten wollenen Schal um ihre Schultern. Doch ein Gefühl der Wärme und Geborgenheit wollte sich einfach nicht einstellen. Ihr war, als hätte sich die klamme Kälte auch schon in ihrem Körper festgesetzt. Was hätte sie jetzt für ein kleines wärmendes Feuer gegeben, für den warmen Schein flackernder Flammen.
Mary unterdrückte einen tiefen Seufzer und starrte in die beklemmende Dunkelheit, die ihr voll böser Verheißungen schien, und schmeckte Salz auf der Zunge. Die FairWind stampfte und rollte schwer in der aufgewühlten See. Und jedes Mal, wenn ein Brecher donnernd über das Vorschiff hereinbrach, ging ein bedrohliches Zittern und Ächzen durch den Dreimaster, durchlief die ganze Länge des Schiffes und ließ auch Marys Koje erzittern. Einen Augenblick schien es, als wollte sich die FairWind der zerstörerischen Naturgewalt beugen und sich in die eisige Tiefe drücken lassen. Doch dann bäumte sich das Schiff jedes Mal wieder auf, schüttelte die Wassermassen ab und ging mit der Zähigkeit eines ausdauernden Kämpfers, dem Ermüdung und Resignation fremd sind, den nächsten heranrollenden Wellenberg an.
Mary Bancroft wusste, dass die FairWind ein gutes, solides Schiff war. Es hatte schon ganz andere Stürme bestanden. Das hatten ihr alle versichert. Der Bootsmann, der Erste Offizier und sogar Captain Taylor, als er einmal halbwegs nüchtern gewesen war, was selten genug der Fall war. Auch Richard Campbell hatte Vertrauen in die FairWind, und das beruhigte sie am meisten, denn seine Worte waren stets mit Bedacht gewählt. Was er sagte, hatte Hand und Fuß. Darauf konnte man bauen. Außerdem hörte sich nachts unter Deck alles viel schlimmer an, als es in Wirklichkeit war. Mit dieser Erkenntnis hatte sie sich auch zu beruhigen versucht.
Und doch, sie vermochte einfach kein Auge zuzutun. Aber das lag nicht allein daran, dass es ihr unmöglich war, das unaufhörliche Heulen und Toben des Sturmes in der Takelage und das Ächzen und Knarren der Planken und Spanten zu überhören. Es lag auch an Sally und ihrem angsterfüllten Gestammel, das aus dem anderen Kajütbett der engen Kabine an ihr Ohr drang.
Die siebzehnjährige Kammerzofe Sally Lee kauerte wie ein Häufchen Elend auf ihrer Koje, ihre Lippen bewegten sich in einem unaufhörlichen, monotonen Gebet. Und dieses angsterfüllte Beten war schlimmer als alles andere. Es machte die feuchte Dunkelheit noch beklemmender.
»Sally!«, rief Mary mit zurechtweisender Stimme, als sie den endlosen Strom immer wiederkehrender Worte nicht länger ertragen konnte.
Die Zofe schien sie nicht zu hören.
»Sally!« Diesmal war Marys Stimme scharf und schneidend. »Hör endlich mit dem Gewimmer auf! Du machst dich ja verrückt damit … und mich auch!«
Jäh brach das Gemurmel ab. Nach einem Moment der Verwirrung kam Sallys zitternde Stimme aus der Dunkelheit. »Ich … ich … habe gebetet … für unsere Rettung«, sagte sie aufschluchzend.
»Du hast jetzt lange genug gebetet! Nun reicht es! Dein Gestammel raubt einem die letzten Nerven!«, erwiderte Mary ungehalten und wurde sich in dem Augenblick, als sie das sagte, bewusst, dass die schrecklich langen Tage dieser stürmischen Überfahrt ihre Spuren hinterlassen hatten. Einlenkend fügte sie deshalb hinzu: »Es ist gut, dass du für uns gebetet hast. Doch nun hab auch Vertrauen in Ihn … und in die Zuverlässigkeit des Schiffes und seiner fähigen Mannschaft. Auch dieser Sturm geht vorbei. Es wird alles gut werden, Sally. Versuch jetzt etwas zu schlafen.«
»Schlafen?«, wiederholte Sally Lee wehklagend.
»Ja, schlafen.«
»Wie könnt Ihr bloß an Schlaf denken?«, zeterte die Zofe. »Wo uns jeden Moment die See verschlingen kann.«
Mary zwang sich, Sally nicht wieder anzufahren. »Das bildest du dir nur ein. Wir sind in einen ungemütlichen Sturm geraten, doch weit davon entfernt, ernstlich in Gefahr zu sein. Das hat Captain Taylor gesagt.«
»Der Captain ist ein gottloser Trunkenbold. Nicht einen Penny würde ich für sein Wort geben!«
»Seine Einschätzung deckt sich aber mit der seines Ersten Offiziers und Mister Campbells, und deren gesunden Menschenverstand wirst du doch wohl nicht in Zweifel ziehen wollen, oder?«
Sally überging diesen Einwand. »Ich werde jedenfalls kein Auge zutun! O Gott, warum konnten wir nicht in London bleiben?«, klagte sie. »Warum haben wir uns nur von der Herrin dazu überreden lassen, mit auf diese schreckliche Reise zu gehen?«
»Weil wir es gut bei Miss Alice haben und sie uns mehr als großzügig entlohnt«, half Mary geduldig dem Gedächtnis der Kammerzofe nach. »Oder solltest du schon vergessen haben, dass Miss Alice dir einen halben Jahreslohn als Bonus für die Reise gegeben hat?«
»Für kein Geld der Welt würde ich es noch einmal tun«, jammerte Sally Lee, die jetzt nicht gern daran erinnert werden wollte, dass niemand sie gedrängt hatte, in Miss Alices Diensten zu bleiben und mit ihr und ihrer Gesellschafterin Mary Bancroft die Seereise über den Ozean anzutreten. »Die See wird uns nie wieder freigeben! Ich weiß es!«
»Du redest dummes Zeug.«
»Und sollte uns das Schicksal wirklich verschonen, was erwartet uns dann?«, fuhr Sally mit einer Mischung aus Angst und Anklage fort. »Die Wildnis von Amerika! Es soll dort überall Indianer geben, und keiner ist seines Lebens sicher!«
»Virginia ist kein wildes Land, das von blutrünstigen Indianern unsicher gemacht wird!«, widersprach Mary, ärgerlich über Sallys maßlose Übertreibungen. »Virginia ist eine der blühendsten Kolonien Englands und nicht minder zivilisiert. Also erzähl nicht solche Schauermärchen.«
»Was kümmert mich Virginia? England ist meine Heimat. Und verflucht sei der Tag, an dem ich an Bord dieses Schiffes ging!«, rief Sally.
»Niemand hat dich dazu gedrängt: Es war deine ganz persönliche freie Entscheidung, Sally!«, wies Mary sie zurecht.
»Frei? Was hab’ ich denn gewusst? Wo die Herrin von allem so geschwärmt hat. Konnte ich da ahnen, was in Wirklichkeit passieren würde?«, beschwerte sich die Zofe voller Selbstmitleid. »Niemand hat mir auch nur ein Wort davon erzählt, wie es sein würde.«
»Wenn es dir in Virginia nicht gefällt, steht es dir frei, mit dem nächsten Schiff nach London zurückzukehren«, erinnerte Mary sie. »Miss Alice hat versprochen, deine Passage nach England zurück zu bezahlen, falls du dich dazu entschließen solltest.«
»Ich soll diese grässliche Reise noch einmal machen?«, rief Sally entrüstet und entsetzt zugleich. »Nie wieder werde ich nach dieser Fahrt einen Fuß auf ein Schiff setzen. Der Herr sei mein Zeuge!«
Mary Bancroft zuckte im Dunkeln die Achseln. »Dann wirst du dich wohl oder übel an den Gedanken gewöhnen müssen, für immer in Virginia zu bleiben.«
Darauf wusste Sally Lee nichts zu erwidern und sie versank in ein finsteres Grübeln.
Mary war dankbar für Sallys Schweigen. Zumindest nahm sie ihr nervtötendes Gemurmel nicht wieder auf. Sie hatte Verständnis für Sallys dumpfe Angst vor der furchteinflößenden Gewalt der unbändigen See. Sie war ja selbst nicht frei von Furcht. Doch wofür sie nicht das geringste Quäntchen Verständnis aufzubringen vermochte, war ihre Undankbarkeit. Es war einfach nicht gerecht, jetzt so zu tun, als hätte irgendjemand sie zu dieser Überfahrt überredet oder gar gedrängt.
Was Mary betraf, so bereute sie es nicht, dass sie Alice Shadwells Angebot, mit ihr nach Virginia zu gehen, angenommen hatte. Sie war knapp siebzehn Jahre alt gewesen, als sie als Gesellschafterin in Alice Shadwells Dienste getreten war. Zwei Jahre lag das nun schon zurück. Es waren gute Jahre gewesen.
Alice war nur knapp drei Jahre älter als Mary und nie so etwas wie eine Herrin für sie gewesen. Auch wenn sie bei Miss Alice angestellt war, so war ihr Verhältnis doch mehr das einer tiefen Freundschaft zwischen zwei Freundinnen, die einander blindlings vertrauten.
Nein, sie hätte es wahrhaft nicht besser treffen können. Der einzige Schatten, der von Anfang an auf ihrer tiefen Freundschaft lag, waren Alices angegriffene Gesundheit und die Sorge, ob sie jemals kräftig genug sein würde, um ein ganz normales Leben zu führen.
Alice Shadwell hätte diese anstrengende Reise eigentlich nie antreten dürfen. Doch sie hatte alle guten Empfehlungen in den Wind geschlagen und ihren Willen durchgesetzt. Und was Mary im Stillen befürchtet hatte, war dann auch wirklich eingetreten: Ihr gesundheitlicher Zustand, zu Beginn der Reise schon nicht gerade der allerbeste, hatte sich von Woche zu Woche verschlechtert. Alice Shadwell war mittlerweile nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das Schlimmste stand zu befürchten, nämlich dass sie die Küste Virginias nicht mehr sehen würde.
Das Gefühl, zur Tatenlosigkeit verdammt zu sein und außer tröstenden Worten nichts weiter tun zu können, bedrückte Mary stärker als alles andere, stärker als die Strapazen der Schiffspassage, die zermürbende Kraft des tagelangen Sturmes und Sallys Hysterie.
Mary wünschte plötzlich, Sally würde etwas sagen, damit sie etwas erwidern und sich in ein Gespräch flüchten konnte, wie nichtig oder überspannt die Dinge auch sein mochten, die Sally beschäftigten.
Doch die Kammerzofe verharrte in ihrem dumpfen Schweigen, und so lauschte Mary auf das Heulen des Sturmes und die rauen Stimmen der Seeleute, die dann und wann in abgerissenen Wortfetzen zu ihnen in die Kabine drangen.
2
Mary Bancroft war gerade in einen benommenen Halbschlaf gefallen, als ein leises, aber energisches Klopfen an der Kabinentür sie plötzlich hochfahren ließ. Sie brauchte einen Augenblick, um zu sich zu kommen. Dann sah sie den schwachen Lichtschein, der unter der Türschwelle hindurch in die Kajüte sickerte.
Es klopfte wieder.
»Ja? Wer ist da?«, fragte Mary und hörte, wie Sally sich nun jäh aufrichtete.
»Mein Gott, es ist etwas passiert!«, stieß die Kammerzofe hervor. »Ich wusste doch, dass diese Reise ein schreckliches Ende nehmen würde!«
»Still!«, brachte Mary sie zum Schweigen, als nun eine Stimme jenseits der Tür zu vernehmen war.
»Miss Bancroft?«
»Ja?«
»Ich bin es, Richard Campbell. Entschuldigt, wenn ich Eure Nachtruhe störe, doch es ist wichtig.«
Sally zog die Luft scharf ein, als erwartete sie im nächsten Moment die Nachricht, dass die FairWind leck geschlagen und nicht mehr zu retten sei.
»Eure Herrin, Miss Shadwell …«, wollte Richard Campbell fortfahren.
»Einen Augenblick!« Mary schlug die klammen Decken zurück und sprang aus der Koje.
»Ihr werdet mich doch nicht allein lassen, nicht wahr?«, fragte Sally verängstigt. »Das werdet Ihr mir doch nicht antun! Wartet auf mich! Ich komme mit!«
»Du bleibst hier!«, sagte Mary bestimmt. »Sollte Miss Alice deiner Dienste bedürfen, werde ich dich holen.« Hastig fuhr sie mit der Hand durch ihr volles blass goldenes Haar, das ihr bis auf die schlanken Schultern fiel. Es fühlte sich strähnig und salzverkrustet an, doch jetzt war keine Zeit mehr, zur Bürste zu greifen und ihrem Haar wieder etwas Glanz und Form zu geben. Sie wusste auch, dass ihr Kleid zerknittert war, und sie hasste es, Richard Campbell so unter die Augen zu treten.
Mit einem unterdrückten Seufzer zog sie den breiten wollenen Schal enger um die Schultern und hielt ihn vor ihrer sehr fraulichen Brust zusammen. Dann straffte sie sich, trat zur Tür und schob den Riegel zurück.
Vor ihr stand Richard Campbell, ein schlanker, hochgewachsener Mann von siebenundzwanzig Jahren, der Sohn eines angesehenen Londoner Kaufmanns und der einzige weitere Passagier der FairWind. Er trug keine Perücke. Sein dunkles, sanft gewelltes Haar war windzerzaust und gab ihm ein wagemutiges Aussehen. Und der Umhang, den er über seine tadellose Kleidung geworfen hatte, glänzte im Licht der Laterne, die er in der Linken hielt, vor Nässe.
Mary zog die Tür hinter sich zu.
»Ich bedaure aufrichtig, wenn ich Euch aus dem Schlaf geholt habe«, entschuldigte er sich noch einmal mit seiner tiefen, vollen Stimme.
Mary lächelte gequält. »Seid unbesorgt. Tiefer Schlaf war mir nicht vergönnt gewesen.«
Er nickte mitfühlend. »Ich selbst war voller Unruhe und vermochte nicht zu schlafen. So bin ich kurz an Deck gegangen. Doch der Sturm und die Brecher ließen mich schnell erkennen, dass mein Platz nicht dort oben das Deck ist.« Der Anflug eines Lächelns glitt über sein ausdrucksvolles Gesicht mit den dunklen, ernsten Augen, deren feine Lachfältchen in den Winkeln jedoch erkennen ließen, dass er Fröhlichkeit und Humor ebenso schätzte wie eine ernste, anspruchsvolle Unterhaltung.
»Ja, und dann?«, fragte Mary erwartungsvoll.
»Ich glaubte, Eure Herrin rufen gehört zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher, Miss Bancroft«, erklärte er. »Bei diesem Sturm fällt es manchmal schwer, sein eigenes Wort zu verstehen. Doch ich dachte, ich sollte Euch zumindest davon unterrichten – auch auf die Gefahr hin, dass ich mich geirrt hätte.«
»Das ist sehr aufmerksam von Euch, und ich bin Euch sehr zu Dank verpflichtet.«
»Vielleicht solltet Ihr …«, begann Richard Campbell, brach dann aber abrupt ab. Er wandte den Kopf und blickte den Gang hinunter. »Habt Ihr es auch gehört?«
»Ja.« Mary hatte die schwache Stimme ihrer Herrin im selben Augenblick gehört wie er. Und sie hatte plötzlich Schuldgefühle, dass sie die Nacht nicht an ihrer Seite verbracht hatte, sondern in der Kabine mit Sally. Die Tatsache, dass Alice ausdrücklich darauf bestanden hatte, änderte kaum etwas daran.
»So habe ich mich also doch nicht getäuscht.«
»Bitte entschuldigt mich … Und vielen Dank noch mal«, sagte Mary hastig und eilte zu Alice Shadwell, die in ihrer Kabine auch nachts eine Lampe brennen hatte.
Alice saß halb aufrecht im Bett, von mehreren weichen Kissen im Rücken gestützt. Die Lampe, die an einem massiven Haken unter der rauchgeschwärzten Decke hing und mit den Bewegungen des Schiffes hin und her schwankte, warf ihren unsteten Schein auf das schmale, ausgezehrte Gesicht einer Todkranken. Alices Haut, die im Fieber zu glühen schien, spannte sich straff über den Wangenknochen, die mit erschreckender Deutlichkeit hervortraten. Und ihre großen Augen, die so voller Lebensfreude sprühen konnten, blickten müde und glanzlos aus tiefen Höhlen. Langes blondes Haar umfloss wie ein goldenes Vlies ihr eingefallenes Gesicht.
Ihre Augen leuchteten auf und bekamen einen schwachen Glanz, als Mary in die Kabine trat und zu ihr ans Krankenlager eilte.
»Alice!«
»Ich weiß, es ist nicht recht, dass ich dich um deinen Schlaf bringe …«
»Psst«, machte Mary, die es schmerzte, ihre Herrin und zugleich Freundin so geschwächt von der Krankheit zu sehen, und zwang sich zu einem Lächeln. »Ich bin geradezu dankbar, dass ich etwas tun kann. Ich konnte sowieso nicht schlafen und habe mich nur ruhelos hin und her gewälzt. Und Sally ist alles andere als eine angenehme Gesellschaft.«
Alice Shadwell nickte kaum merklich. »Sie ist eine tüchtige Zofe, aber sie hat nicht deinen Willen und deine innere Festigkeit, Mary.«
Mary wollte nicht auf Sally herumhacken. Das war nicht ihre Art und sie wechselte schnell das Thema. »Außerdem hätte ich dich gar nicht erst allein lassen sollen. Mein Platz ist hier an deiner Seite.«
Schwach schüttelte Alice den Kopf. »Nein, nein, du bekommst schon wenig genug Schlaf. Du hast so viel für mich getan, all die Jahre …«
»Fang nicht wieder davon an!«
»Es ist die Wahrheit …«
»Ich will nichts davon hören!«, fiel Mary ihr energisch ins Wort und berührte schnell Alices Stirn. Sie brannte heiß unter ihrer Hand, und Mary hatte Mühe, sich ihren Schreck nicht anmerken zu lassen.
Das Fieber war gestiegen!
»Ich werde dir kühle Umschläge machen und dir noch etwas von der Medizin geben, die der Arzt dir in London verschrieben hat.«
»Nein!«, widersprach Alice mit erstaunlich kräftiger Stimme und hielt Marys Hand fester. »Weder die Medizin noch die Umschläge können mir jetzt noch helfen.«
»Ganz sicher werden sie dir helfen!«, entgegnete Mary bestürzt. »Doktor Latimer hat einen ausgezeichneten Ruf und seine Medizin …«
Alice Shadwell ließ sie nicht ausreden. Nüchtern sagte sie: »Mary, ich habe nicht mehr lange zu leben. Du weißt es, und ich weiß es.«
Die Worte trafen Mary wie scharfe Messerstiche und sie zuckte unwillkürlich zusammen. »Das … das darfst du nicht sagen, Alice! … Ja noch nicht einmal denken!«
Ein schwaches Lächeln huschte wie ein Schatten über das vom Tod gezeichnete Gesicht. »Mary, versuch nicht, mich oder dich über die Schwere meiner Krankheit hinwegzutäuschen. Es ist so, wie ich es gesagt habe. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit auf dieser Welt.«
»Alice!«
»Nein, sag nichts«, bat Alice sie eindringlich. »Das Schicksal wird seinen Lauf nehmen, und wir beide wissen, dass ich Virginia niemals wiedersehen werde.«
Mary schüttelte stumm den Kopf.
»Es wäre schön gewesen, wenn ich die weiten fruchtbaren Täler und die blauen Berge in der Ferne noch einmal hätte sehen können«, fuhr Alice fort, und ein Anflug von Trauer schwang in ihrer Stimme mit. Doch sie hatte sich gleich wieder unter Kontrolle. »Aber es ist mir nun mal nicht bestimmt, und damit habe ich mich längst abgefunden.«
»Aber ich nicht!«, brach es verzweifelt aus Mary heraus.
Alice drückte die Hand ihrer treuen Gesellschafterin. Mary hatte Licht und Freude in ihr von Krankheit und Kummer beherrschtes Leben gebracht, und sie war es, die nun in diesen schweren Stunden des Trostes bedurfte. Sterben mochte ein schweres Joch sein, doch die Schmerzen der trauernden Hinterbliebenen waren oft ungleich länger und stärker.
»Verzweifle nicht meinetwegen«, sagte Alice mit leiser, sanfter Stimme. »Ich fürchte den Tod nicht, dafür habe ich schon zu lange mit ihm gelebt. In gewisser Weise bin ich dankbar dafür, dass es bald vorbei sein wird … Möge der Herr mir meine sündigen Gedanken verzeihen. Aber es ist die Wahrheit. Es wird für mich eine Erlösung sein …« Sie verstummte und schloss für einen Moment erschöpft die Augen.
Für eine Weile herrschte Schweigen in der Kabine, denn Mary wusste nicht, was sie auf Alices schonungslose Offenheit erwidern sollte. Das Wüten des Sturmes klang wie Hohn in ihren Ohren, und quietschend schwang die Laterne am Haken unter der Decke hin und her.
»Ich habe nach dir gerufen, weil ich etwas sehr Wichtiges mit dir zu besprechen habe«, ergriff Alice Shadwell schließlich wieder das Wort und schlug die Augen auf.
»Einzig und allein deine Genesung ist von Bedeutung!«, erwiderte Mary fast störrisch.
Alice ignorierte den Einwand. »Du weißt, weshalb wir diese Reise nach Virginia angetreten haben.«
Mary nickte stumm und wischte sich die Tränen aus den Augen. Vor nicht ganz einem halben Jahr hatte Alice Shadwell aus Virginia die erschütternde Nachricht erhalten, dass ihr Vater, Henry Shadwell, auf seiner Tabakplantage HickoryHill einen tödlichen Reitunfall erlitten hatte. Und da Alice sein einziges Kind war, hatte sie sich trotz ihrer desolaten körperlichen Verfassung dazu entschlossen, in ihre Heimat zurückzukehren und ihr Erbe anzutreten, wie ihr Vater es gewünscht hatte.
Mary erinnerte sich wieder daran, was Alice ihr in den Jahren ihres Zusammenseins über ihre Kindheit, die sie auf HickoryHill verbracht hatte, erzählt hatte. Stundenlang hatte sie ihr Land und Leute im fernen Amerika geschildert, besonders in den Wintermonaten, wenn die Abende lang und sie ihrer Handarbeiten überdrüssig waren. Sie hatte nichts von Alices zauberhaften Schilderungen des weiten Landes am Oberlauf des James River vergessen.
Alice Shadwell war schon von Geburt an ein anfälliges Kind gewesen und hatte mehr Zeit im Krankenbett verbracht als in den weitläufigen Gärten von Hickory Hill oder an den Ufern des James River. Im Alter von acht Jahren hatte ihr Vater – ihre Mutter war schon wenige Jahre nach ihrer Geburt an Gelbfieber gestorben – Alice nach England geschickt und sie in die sichere Obhut von Margaret und George Wickman gegeben.
Die Wickmans waren enge, vertrauenswürdige Freunde von Henry Shadwell, vermögende Leute, die nicht nur ein feudales Stadthaus in Londons bester Wohngegend unterhielten, sondern sich auch noch eines nicht minder komfortablen Sommerhauses bei Brighton rühmen konnten. Bei ihnen wusste Henry seine anfällige Tochter in guten Händen. Nur schweren Herzens hatte er sich von seinem einzigen Kind trennen können, doch die Ärzte hatten ihm nachdrücklich zu diesem Schritt geraten, da Alice das heiße und im Sommer besonders feuchte Klima Virginias nicht vertrug und ihre Genesung keine Fortschritte machte. Henry Shadwell hatte auch auf die Kompetenz der berühmten Londoner Ärzte gehofft und sie schließlich nach England gebracht. Nur für ein, zwei Jahre hatte es sein sollen. Doch sie war nie so zu Kräften gekommen, dass eine Rückkehr nach Virginia auch nur zur Diskussion gestanden hätte.
So hatte denn Alice die folgenden vierzehn Jahre ihres Lebens im Haus der Wickmans verbracht, völlig zurückgezogen und abgeschieden von der Außenwelt, immer im Kampf mit ihrer schwachen Gesundheit. Bis dann die Nachricht vom jähen Tod ihres Vaters, der sich den Strapazen einer Seereise nach England fast jedes Jahr unterzogen hatte, um seine Tochter zu besuchen, sie erreicht hatte.
»Du hättest auf Doktor Latimer hören und diese Reise niemals antreten dürfen«, sagte Mary und bereute, dass sie sich dem Wunsch ihrer Herrin, die ihr wie eine geliebte Schwester ans Herz gewachsen war, nach Virginia zurückzukehren, nicht noch energischer widersetzt hatte.
»Mag sein, dass es ein Fehler war«, gab Alice unumwunden zu. »Vielleicht auch nicht. Wäre ich in England geblieben, es hätte mir doch nicht mehr als einen Aufschub gebracht, ein paar Wochen möglicherweise. Wer weiß es schon … Doch lass uns nicht über Dinge reden, deren Lauf wir nicht mehr bestimmen können. Ich habe während der letzten Wochen hier auf der Fair Wind Zeit genug gehabt, um mit mir und dem, was geschehen soll, ins Reine zu kommen. Und ich sehe die Dinge nun ganz klar.«
»Was meinst du damit?«, fragte Mary und runzelte verständnislos die Stirn.
»Du weißt, ich bin das einzige Kind meines Vaters«, begann Alice jetzt. »Wenn ich nicht mehr bin, gibt es keinen direkten Erben, der Hickory Hill übernehmen und fortführen kann.«
Marys Gesicht verschloss sich. »Ich möchte nicht darüber sprechen, was ist, wenn du nicht mehr …« Sie stockte, weil sie das Wort einfach nicht über ihre Lippen brachte. Es war, als glaubte sie, dass der Tod sich noch einmal von Alice abwenden würde, wenn sie sich weigerte, ihn zur Kenntnis zu nehmen.
»Aber ich will!«, erwiderte Alice nachdrücklich, und in ihren Augen funkelte ein Feuer, wie Mary es nur in den besten Tagen ihrer Herrin gesehen hatte. Unbeugsame Entschlossenheit sprach aus diesen Augen, die so trügerisch vor Leben sprühten. »Ich will es, und du wirst mir zuhören! … Es gibt einige entfernte Verwandte, die ich nie in meinem Leben gesehen habe. Ein Halbbruder meines Vaters soll angeblich in South Carolina leben. Mein Vater und er haben sich nie leiden können. Vater hat sich immer geweigert, ihn auf Hickory Hill zu empfangen. Ich weiß nicht genau, was diese Feindschaft begründet hat, doch Andeutungen meines Vaters konnte ich entnehmen, dass dieser Halbbruder nicht mal die Anrede Mister verdiente, geschweige denn zu den Gentlemen zu zählen war. Aus Vaters Briefen weiß ich zudem, dass sie während der letzten zehn Jahre keinen Kontakt mehr miteinander hatten.«
Mary fragte sich bang, worauf Alice bloß hinauswollte. Doch sie zügelte ihre Neugier und wartete geduldig auf weitere Erklärungen.
»Der Gedanke, dass dieser entfernte und offenbar zwielichtige Verwandte möglicherweise nach meinem Tod seine Hand auf Hickory Hill legt, ist mir unerträglich«, fuhr Alice mit einer Erregung fort, die ihr bei ihrem kritischen Gesundheitszustand nur schaden konnte. »Das darf einfach nicht geschehen!«
»Bitte, reg dich nicht so auf!«, bat Mary flehentlich. »Du musst dich schonen!«
Alice schien sie nicht gehört zu haben. »Hickory Hill darf unter keinen Umständen in seine Hände fallen, hast du mich verstanden?«
Mary erkannte, dass Alice das Thema nicht fallen lassen wollte, bevor sie nicht einen Ausweg gefunden hatte. Und wie sehr es ihr auch widerstrebte, sich über das Gedanken zu machen, was nach Alices Tod zu geschehen habe, so musste es doch wohl sein.
»Was willst du also tun?«, fragte Mary, denn sie ahnte plötzlich, dass ihre Herrin schon eine Entscheidung getroffen hatte.
»Ich will, dass du nach meinem Tod mein Erbe antrittst«, sagte Alice Shadwell entschlossen. »Du sollst Herrin auf Hickory Hill werden!«
3
Sprachloses, ungläubiges Schweigen folgte Alices Worten. Das Spantenwerk knarrte und ächzte. Unruhig pendelte die Lampe unter der niedrigen Decke. Das Tosen der aufgepeitschten See schien für einen Moment nachgelassen zu haben, denn Mary glaubte, in diesem Augenblick des Schocks das Pochen ihres Herzens vernehmen zu können.
Ihr stockte der Atem. Das Blut wich aus ihrem gefällig geschnittenen Gesicht. Sie fühlte den Anflug eines Schwindels und schwankte auf dem harten Stuhl. Verständnislosigkeit trat in ihre grün-grauen Augen und wich dann einem Ausdruck, der von ungläubigem Staunen geprägt war.
»Alice!« Sie hatte Mühe, nicht die Kontrolle über ihre Stimme zu verlieren. »Alice! … Das kann … unmöglich … dein … Ernst sein!«, brachte sie schließlich stockend hervor.
»Wenn ich je in meinem Leben etwas aus tiefster Seele ernst gemeint habe, dann das, was ich eben gesagt habe, Mary. Ja, du sollst Herrin auf Hickory Hill sein!«, bestätigte Alice Shadwell noch einmal. »Und mag es dir im Augenblick auch unmöglich erscheinen, so glaube mir, das ist es ganz und gar nicht!«
»Alice, du weißt nicht, was du sagst. Es ist völlig absurd. Ja, absurd ist genau das richtige Wort. Ich kann und will nicht deine Erbin sein!«, widersprach Mary heftig. »Ich bin deine Gesellschafterin, deine Dienerin …«
»Du bist meine Freundin und mehr als das!«, fiel Alice ihr ins Wort. »Es gibt niemanden auf der Welt, der mir näher steht als du. Und niemand anders als du soll Hickory Hill bekommen. Wie sehr ich Margaret und George auch mag, aber du hast dich stets aufopfernd um mich gekümmert, hast mich in den letzten beiden schlimmen Jahren gepflegt und mir immer wieder neuen Lebensmut gegeben. Und jetzt ist es an mir, dir etwas zurückzugeben … und die einzige Möglichkeit, die mir noch bleibt, dir meine Liebe und Dankbarkeit zu beweisen, besteht darin, dass ich dich zu meiner Erbin mache.«
»Um Gottes willen, du brauchst mir nichts zu beweisen!«, schluchzte Mary mit tränenerstickter Stimme auf. »Ich will Hickory Hill nicht! Bitte vergiss auf der Stelle, was du da gesagt hast.«
Alice schüttelte den Kopf. »Nein, das werde ich nicht tun. Ich könnte nicht ruhig sterben, wenn ich wüsste, dass die Plantage meines Vaters an einen Mann fällt, den mein Vater verabscheut hat. Vielleicht bin ich noch im Tod egoistisch, dass ich dir diese Bürde auflaste, aber ich bin überzeugt, dass du in der Lage bist, auch eine große Verantwortung zu übernehmen.«
»Alice, ich weiß sehr wohl, dass dein Wunsch aus tiefstem Herzen kommt, und ich möchte auch, dass du weißt, wie glücklich und traurig zugleich du mich mit dem Wunsch machst, ich möge dein Erbe antreten«, sagte Mary beherrscht und eindringlich. Sie musste Alice zur Vernunft bringen, musste sie unbedingt davon überzeugen, dass ihre Idee undurchführbar war.
»Ich mag für dich mehr als nur eine Gesellschafterin sein«, fuhr sie fort. »Aber für die Welt da draußen und den Halbbruder deines Vaters bin ich genau das und nichts sonst. Niemand würde deinen Letzten Willen respektieren. Würdest du wirklich ein solches Testament aufsetzen, das mir Hickory Hill zuspricht, man würde es anfechten und mich vor Gericht bringen. Man würde mir vorwerfen, die Unzurechnungsfähigkeit einer Todkranken ausgenutzt und dieses Erbe erschlichen zu haben. Genau das würde eintreten, und ich hätte auch nicht die geringste Chance, so ein Gerichtsverfahren finanziell durchzustehen, geschweige denn zu gewinnen. Ich hoffe, du siehst ein, wie unsinnig dein Vorhaben ist.«
Alice hatte ihr schweigend zugehört, ohne dass jedoch das merkwürdige Lächeln von ihrem Gesicht gewichen war. Sie hatte diese Einwände ganz offenbar erwartet, denn sie zeigte nicht den geringsten Anflug von Überraschung oder Nachdenklichkeit.
»All das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen«, bestätigte sie Marys Vermutung. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich darüber gegrübelt habe. Und obwohl ich deine Chancen im Falle eines Prozesses längst nicht so gering einschätze, wie du das tust, so möchte ich doch diese Schwierigkeiten nicht auf deine Schultern legen, denn das Erbe soll für dich ja nicht zur Plage werden. Ich habe deshalb lange darüber nachgedacht, wie sich all das vermeiden ließe. Und ich habe eine Antwort gefunden, die dir deine Befürchtungen nehmen wird.«
»Sollten wir nicht besser ein anderes Mal darüber reden?«, fragte Mary bittend. »Du hast dich jetzt schon genug angestrengt.«
»Nein!«, sagte Alice Shadwell mit energischer Stimme. »Wir müssen jetzt darüber reden. Und nun höre meine Antwort: Es wird keinen Erbschaftsprozess geben, weil du nämlich einfach an meine Stelle treten wirst.«
Mary sah sie verständnislos an. »Ich soll an deine Stelle treten?«, wiederholte sie verwirrt. »Mary, ich weiß wirklich nicht, was du dir …«
»Du wirst als Alice Shadwell auf Hickory Hill eintreffen«, erklärte Alice mit vor Erregung leuchtenden Augen. »Und Mary Bancroft wird sterben. Hier auf der Fair Wind. Du wirst in meine Haut schlüpfen.«
Mary starrte sie fassungslos an. Ihre Sorge wuchs. Ob Alice schon im wachen Zustand Fieberträume hatte? Sie, Mary Bancroft, sollte sich als Alice Shadwell ausgeben? Diese Idee konnte doch nur einem Fieberwahn entsprungen sein.
»Sag nichts!«, fuhr Alice hastig fort, denn sie brauchte nur in das verstörte Gesicht ihrer Gesellschafterin zu sehen, um zu wissen, was in diesem Moment in Mary vorging. »Ich weiß, es klingt zuerst wahnwitzig, ja geradezu verrückt. Aber ich bin geistig noch nicht verwirrt. Warte! Lass mich ausreden! Du wirst sagen, das mit dem Rollentausch ist unmöglich, doch ich sage dir, das ist es nicht! Wir können es tun, und zwar ohne großes Risiko für dich. Hast du schon mal in den Spiegel geschaut und dabei daran gedacht, wie sehr wir uns doch ähneln?«
Mary zögerte. »Nun ja, da ist schon was Wahres dran. Aber das genügt doch nicht!«
»Richtig, es ist nur eine Nebensächlichkeit«, sagte Alice, sich ihrer Sache ganz sicher, »wenn auch eine wichtige Nebensächlichkeit. Es ist ein Geschenk des Schicksals, dass wir uns in vieler Hinsicht ähnlich sind. Wir könnten glatt Schwestern sein, haben wir doch etwa das gleiche Alter, die gleiche Figur und Haarfarbe … und ist dein zweiter Vorname nicht auch Alice?«
Mary blinzelte unsicher. »Ja …«
»Siehst du!«, rief Alice zufrieden. »Es ist, wie ich es schon sagte, ein Wink des Schicksals. Es ist dir bestimmt, Herrin von Hickory Hill zu sein.«
»Nein, Alice. Das kann ich nicht glauben. Du machst es dir zu einfach.«
Alice machte eine wegwischende Handbewegung. »Vergiss nicht, dass ich fast fünfzehn Jahre abgeschieden in London gelebt und nie mehr den Boden Virginias betreten habe. Als kleines Mädchen ging ich fort von Hickory Hill, und niemand wird sich an mich erinnern können, niemand kennt die erwachsene Alice Shadwell. Habe ich nicht recht?«
»Mag sein«, räumte Mary widerstrebend ein.
»Ich habe in London bis auf meinen Vater nie Besuch empfangen, sodass uns auch von da her keine Gefahr droht. Die Voraussetzungen könnten gar nicht besser sein. Du wirst all meine Papiere besitzen, meine Garderobe und meinen Schmuck, dazu sämtliche Briefe meines Vaters, die ich alle aufbewahrt habe, als hätte ich schon vor Jahren gewusst, dass sie einmal wichtig sein würden. Und es ist kein Unrecht, wenn du dich als Alice Shadwell ausgibst, denn du tust es auf meinen Wunsch und zu deinem eigenen Schutz! Mary, du musst es tun!«
Mary bemühte sich, ihre Gedanken zu sammeln. »Was du da sagst, mag ja auf Virginia und Hickory Hill zutreffen«, erwiderte sie und bemühte sich um Sachlichkeit, denn sie wusste, dass sie ihr nur mit handfesten Argumenten diese verrückte Idee würde ausreden können. »Aber du hast Captain Taylor, die Mannschaft der Fair Wind, Mister Campbell und Sally vergessen. Sie wissen sehr genau, wer Alice Shadwell ist und wer Mary Bancroft. Sie werden sich nicht täuschen lassen.«
»Du irrst! Keiner der Seeleute hat mich je zu Gesicht bekommen, weder der Captain noch einer seiner Offiziere«, korrigierte Alice sie mit fast triumphierender Stimme. »Hast du vergessen, dass wir erst nach Einbruch der Dunkelheit an Bord der Fair Wind gingen? Und während der ganzen Reise war ich nicht einmal kräftig genug, um auch nur für fünf Minuten an Deck zu gehen.«
»Aber mich kennt man!«
»Nicht, wenn du nach dem Tod deiner Gesellschafterin, die dir so viel bedeutet hat, trauerst und tief verschleiert gehst«, kam Alices Antwort prompt.
»Möglich, aber da ist noch Sally. Sie hat auf jeden Fall äußerst scharfe Augen. Sie wird sich nicht täuschen lassen.«
»Auch daran habe ich schon gedacht«, erwiderte Alice eifrig. »Sally ist ein einfaches Mädchen und eine gute Kammerzofe, mit deren Diensten ich immer zufrieden war. Aber sie ist empfänglich für die Verlockungen des Geldes, das ist ihre große Schwäche und in diesem Fall unser großer Vorteil. Wir werden sie einweihen müssen, das ist unumgänglich. Doch wenn sie erst weiß, dass ihr Schweigen nicht zu ihrem Schaden sein wird, ist nichts von ihr zu befürchten. Sie ist viel zu sehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht, um sich das, was sie aus ihrem Schweigen gewinnen kann, entgehen zu lassen. Nein, Sally Lee ist das geringste unserer Probleme, du wirst sehen. Sie lässt sich leichter lenken als ein Kind.«
»Und wie willst du Richard Campbell für deinen Plan gewinnen?«, fragte sie.
»Richard Campbell ist ein Gentleman durch und durch«, sagte Alice, »ein richtiger Mann, intelligent und empfindsam. Ich bin sicher, dass wir nicht nur auf sein Verständnis und sein Schweigen zählen können, sondern auch auf seine tatkräftige Unterstützung in dieser Sache.«
»Woher willst du das wissen?«, fragte Mary erstaunt. »Er hat sich als sehr teilnahmsvoll und hilfsbereit erwiesen, das stimmt. Doch ob er gewillt ist, sich in ein Täuschungsmanöver einzulassen, halte ich für sehr zweifelhaft. Er wird es sich bestimmt zehnmal überlegen, ob er sich an einer strafbaren … Verschwörung beteiligen soll, denn wenn man es recht betrachtet, ist es genau das.«
»Du übertreibst, Mary. Was ich zu tun beabsichtige, ist nichts weiter als eine Notlüge, um sicherzugehen, dass mein Letzter Wille auch Wirklichkeit wird. Doch nun zu Mister Campbell. Ich kenne ihn besser als du«, erwiderte Alice. »Zwar habe ich ihn noch nicht in meine Pläne eingeweiht, aber ich habe doch in dieser Richtung schon mal vorgefühlt, und seine Reaktion war sehr ermutigend. Weißt du überhaupt, dass er dir sehr gewogen ist und deine Gesellschaft über alle Maßen schätzt?«
Mary errötete. Dass Richard ihr Sympathie entgegenbrachte, war ihr nicht entgangen. Die Sorge um Alice beherrschte ihr Denken und Fühlen jedoch in einem solchen Maße, dass sie weder die Zeit hatte noch das Verlangen verspürte, ihre Gefühle für ihn einer genaueren Prüfung zu unterziehen.
»Ich schätze Mister Campbell ebenfalls«, gab sie zurückhaltend zur Antwort. »Aber das ist auch alles, Alice. Bitte gib deine unsinnige Idee auf. Sie führt zu nichts. Und jetzt bestehe ich darauf, dass du deine Kräfte schonst und versuchst, ein wenig Schlaf zu finden.«
Alice sank schwer atmend in die Kissen zurück. »Ich gebe nicht auf«, flüsterte sie mit geschlossenen Augen. »Ich kann nicht aufgeben. Rede mit Richard, wenn es Tag ist. Bitte, versprich mir, dass du es tust!«
Mary biss sich auf die Lippen. »Ich verspreche es dir!«, sagte sie, weil sie wusste, dass auch das Gespräch mit Richard Campbell nichts daran ändern würde, dass dieses Vorhaben einfach zu absurd war, um verwirklicht werden zu können. Aber wenn es Alice beruhigte, würde sie mit ihm reden.
»Gut«, hauchte Alice. »Morgen … Vergiss es nicht! … Uns bleibt nicht mehr viel Zeit … nicht mehr viel Zeit …« Ihre Stimme ging in ein unverständliches Murmeln über und verstummte dann. Sie fiel in einen unruhigen, von Albträumen beherrschten Schlaf.
Schmerz und Hoffnungslosigkeit breiteten sich in Mary aus. Sie durchlitt all die Qualen, die der Verlust eines geliebten Menschen mit sich bringt.
Sachte zog Mary die Decken zurecht, damit Alice es warm hatte. Dann versuchte sie, auf dem harten Stuhl eine einigermaßen bequeme Haltung zu finden. Es würde eine lange Nacht werden. Sie würde nicht zu Sally in die Kabine zurückkehren, sondern bei Alice wachen. Es blieb so wenig, was sie noch für Alice tun konnte.
Mary lauschte dem Wüten des Sturmes. All diese Geräusche waren ihr vertraut und flößten ihr keinen Schrecken mehr ein. Die Angst, die sie erfüllte, verband sich mit etwas anderem.
Gegen ihren Willen beschäftigte Mary all das, was Alice gesagt hatte. Sie ging immer wieder im Geiste durch, was ihre todkranke Herrin sich in den Kopf gesetzt hatte. Es war irrwitzig, aber dennoch bereitete es ihr ein nicht geringes Vergnügen, sich zumindest auszumalen, wie es sein könnte.
Herrin auf Hickory Hill.
Ein Traum!
Ein Traum, der so zart und vergänglich war wie die weißen Schaumkronen der Wellen. Ein kräftiger Windstoß, und sie lösten sich in verwehende Gischt auf.
4
Irgendetwas bohrte sich schmerzhaft in Marys Rücken und ließ sie auffahren. Vom Schlaf noch leicht benommen, öffnete sie die Augen und brauchte einen Moment, um zu begreifen, wo sie war.
Sie richtete sich im Stuhl auf, und ihr erster Blick galt Alice. Ihr Atem ging schnell, aber regelmäßig. Sie schlief also noch, und das war gut.
Mary wusste, dass ein neuer Tag angebrochen war, obwohl hier in der fensterlosen Kabine davon nichts zu merken war. Die Lampe unter der Decke brannte noch immer mit unruhigem Schein.
Den Geräuschen nach zu urteilen, hatte der Sturm ein wenig von seiner Kraft verloren. Aber das konnte täuschen. Schon mehrmals hatte es so ausgesehen, als wollte der Sturm sich endlich legen und die Fair Wind freigeben, doch dann war er jedes Mal erneut mit ungebrochener Kraft über das Schiff hergefallen und hatte neue, haushohe Wasserberge gegen den Dreimaster geschleudert. Der Orkan gönnte sich vermutlich auch diesmal nur eine Atempause, um schon bald wieder sein zerstörerisches, nervenzehrendes Werk fortsetzen zu können.
Mary beschloss, in ihre Kabine hinüberzugehen, um sich ein wenig frisch zu machen, soweit die Umstände dies zuließen. Sie sehnte sich nach einem langen heißen Bad. Doch das war ein Wunsch, auf dessen Erfüllung sie wohl noch lange warten musste.
Als sie sich erhob und ihre verspannten Glieder streckte, spürte sie, wie zerschlagen sie war. Auf Zehenspitzen schlich sie hinaus, um Alice nicht aufzuwecken. Nach einem letzten besorgten Blick auf ihre todkranke Herrin schloss sie behutsam die Tür der Kajüte hinter sich.
Fast noch vorsichtiger betrat sie ihre eigene Kajüte. Sally schlief ebenfalls noch; das war Mary sehr recht. Sie hatte jetzt nicht das geringste Verlangen, sich mit Sally zu unterhalten und von ihr über Miss Alices Zustand ausgefragt zu werden.
Mit einem feuchten Tuch, das in der in die Kommode eingelassenen Waschschüssel lag, fuhr sich Mary über das Gesicht. Als Morgentoilette war das nicht viel, aber doch besser als gar nichts. Gern hätte sie ein frisches Kleid angezogen, doch dann hätte sie die schwere Kiste, die all ihre Kleider und persönlichen Besitztümer enthielt, unter der Koje hervorziehen müssen, und dann wäre Sally sicherlich aufgewacht. Also verzichtete sie darauf, sie würde sich später umziehen.
Lautlos, wie sie gekommen war, schlüpfte Mary Minuten später wieder aus der engen Kajüte hinaus in den Gang, der wie ausgestorben im Licht einer blakenden Wandlaterne vor ihr lag. Einen Augenblick stand sie unschlüssig vor ihrer Kabine und überlegte, was sie nun tun sollte. Sie sehnte sich nach frischer Luft und dem weiten Blick über das Meer. Doch sie hatte nicht daran gedacht, ihr warmes Cape mitzunehmen, das in der Kabine an einem Haken hing. Und oben an Deck würde es kalt sein.
Später, dachte Mary und ging den Gang hinunter, bis sie zu Richard Campbells Kabine kam. Sie hob die Hand, um anzuklopfen, zögerte dann jedoch. Vom Ende des Ganges, dort, wo die geräumige Kajüte von Captain Taylor lag, drang ein erregt geführter Wortwechsel an ihr Ohr.
Deutlich erkannte Mary Captain Taylors raue Stimme. Ganz offensichtlich war er bereits wieder betrunken, trotz der frühen Morgenstunde. Sie wunderte sich, wie ein Mann, der dem Alkohol mehr Zeit als der Führung des Schiffes widmete, zu einem so verantwortungsvollen Kommando gekommen war, denn immerhin war die Fair Wind ja ein stolzer Dreimaster und kein kleiner Küstenschoner. Und hätte sie nicht gewusst, dass Mister Raleigh, der Erste Offizier, im Ruf eines außergewöhnlichen Navigators stand und die Mannschaft fest im Griff hatte, sie hätte sich ernstlich Sorgen um das Schicksal der Fair Wind und ihrer Besatzung gemacht.
Ihr war so, als gehörte die zweite Stimme, die sich dort mit Captain Taylor stritt, zu Mister Raleigh. Sie wollte nicht Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Männern sein, auch nicht zufällig. Deshalb klopfte sie an die Tür der Kabine des einzigen männlichen Passagiers der Fair Wind und hoffte, Richard Campbell möge schon auf sein. Es war noch sehr früh am Morgen, doch sie wusste, dass Richard ein leidenschaftlicher Frühaufsteher war.
»Ja bitte? Herein!«, ertönte Campbells Stimme hinter der Tür.
Mary war froh, dass sie keinen gereizten Unterton hörte, und trat ein.
»Entschuldigt meinen frühen Besuch, Mister Campbell. Und bitte lasst es mich wissen, sollte ich Euch zu dieser frühen Morgenstunde ungelegen kommen«, sagte Mary entschuldigend. »Ich möchte Euch nicht von wichtigen Geschäften abhalten. Ich sehe, Ihr seid in Eure Studien vertieft.«
Richard Campbell war seit Langem wach. Bekleidet mit engen Kniehosen und einem warmen wollenen Rock, saß er an dem kleinen Klapptisch und las im Licht einer Laterne in einem Buch. Auch in seine Kabine drang kein Tageslicht. Die Fair Wind war ein Frachtschiff, und erst viele Jahre nach ihrem Bau hatte ihr Eigner einige kleine Stauräume, die kaum benutzt wurden, zu kleinen Passagierkabinen umbauen lassen.
»Aber nicht doch!«, erwiderte Richard Campbell, erfreut über Marys Besuch, und klappte das in Leder gebundene Buch zu. »Von wichtigen Geschäften und Studien kann nicht die Rede sein, Miss Bancroft. Ich las ein wenig in den Schriften von John Dickenson, der dieses Buch, ›Briefe eines Farmers‹, verfasst hat.«
Mary blickte ihn unverhohlen erstaunt an. »Ich wusste gar nicht, dass Ihr Euch so für Farmwirtschaft interessiert, Mister Campbell.«
Richard lachte. »Nein, nein, mit Farmwirtschaft haben die Dickenson’schen Briefe wenig zu tun.«
»Aber sagtet Ihr nicht gerade, der Titel des Buches laute ›Briefe eines Farmers‹?«
»Das ist schon richtig. Doch Dickenson ist Rechtsanwalt in der Kolonie Pennsylvania und kritisiert in diesen seinen Briefen, die zuerst in amerikanischen Zeitungen erschienen sind, die englische Handels- und Steuergesetzgebung in Hinsicht auf die Kolonien.«
»Ach so«, erwiderte Mary unsicher, denn weder sagte ihr der Name John Dickenson etwas, noch konnte sie sich zu der englischen Handels- und Steuergesetzgebung äußern. Sie wünschte, sie wüsste mehr über Dinge, die Männer wie Richard Campbell so interessant fanden. »Ich befürchte, Euch auf diesem Gebiet nicht folgen zu können.«
»Große soziale und politische Umwälzungen zeichnen sich in den Kolonien ab«, fuhr Richard begeistert fort. »Es wird gar nicht mehr lange dauern, und der Bruch zwischen dem Mutterland und den Kolonien wird unvermeidlich sein. Ich bin froh, dass ich gerade in dieser Zeit des Aufbruchs nach Virginia zurückkehren kann. Ich bin zwar Engländer, doch fühle ich mich ganz als Amerikaner.«
Mary verstand nicht, wo da ein Unterschied lag, gehörten doch die amerikanischen Kolonien zur Britischen Krone. Gern hätte sie Richard eingehend dazu befragt, doch sie scheute sich, ihm ihre Unwissenheit zu offenbaren. Deshalb nickte sie zögernd.
»Ihr seid sicherlich nicht gekommen, um Euch von mir etwas über Schriften irgendeines Rechtsanwalts in Pennsylvania erzählen zu lassen«, überspielte Richard den Moment der Verlegenheit und bot Mary seinen Stuhl an. Er selbst setzte sich auf einen Schemel. »Wie geht es Miss Shadwell? Hat sie die Nacht gut verbracht?«
Mary setzte sich und bereute plötzlich, dass sie sich nicht doch umgezogen hatte. Unbewusst versuchte sie ihr Kleid glatt zu streichen. Sie schämte sich ihres wohl wenig ansprechenden Äußeren. »Es geht ihr unverändert …«
»Unverändert schlecht?«
Mary nickte stumm.
»Was würde ich dafür geben, könnte ich Euren Kummer lindern und etwas für Eure Herrin tun«, bat Richard sanft und voller Mitgefühl. »Ihr habt wirklich ein schweres Los zu tragen.«
Marys Körper straffte sich. Sie hasste Wehklagen. »Diese ganze Reise war ein großer Fehler. Wir hätten London nie verlassen dürfen, doch daran lässt sich nun nichts mehr ändern. Miss Shadwell bat mich diese Nacht, Euch aufzusuchen und mit Euch zu reden.«
Richard hob überrascht die Augenbrauen. »Und womit kann ich Euch und Miss Shadwell dienen?«
»Miss Shadwell macht sich große Sorgen, was nach ihrem … ihrem Tod mit ihrem Erbe, mit Hickory Hill, geschehen wird«, begann Mary widerstrebend und berichtete ihm in kurzen, knappen Sätzen, was Alice ihr vorgeschlagen hatte. Sie schloss mit den Worten: »Ich habe Euch davon erzählt, weil Miss Shadwell mich darum gebeten hat und ich ihr mein Versprechen gab. Sie hält große Stücke auf Eure Meinung, Mister Campbell. Und das ist gut so, denn ich befürchte, nur Ihr seid in der Lage, ihr diesen unsinnigen Plan auszureden. Auf Euch wird sie hören.« Richard hatte Marys Bericht aufmerksam, und ohne sie ein einziges Mal zu unterbrechen, gelauscht. Und auch als sie geendet hatte, verharrte er in nachdenklichem Schweigen.
»Miss Shadwell ist ohne Zweifel eine außergewöhnliche Frau«, sagte er endlich. »Und was ihren Vorschlag angeht, so zeugt er von großer Güte und Liebe.«
»Das stand für mich niemals infrage«, erwiderte Mary, und ein leicht ungeduldiger Unterton war aus ihrer Stimme herauszuhören. »Es geht darum, ihr diesen unmöglichen, verrückten Plan auszureden. Und ich sehe mich nicht in der Lage, sie von der Aussichtslosigkeit ihres Vorhabens zu überzeugen. Es ist ein Unrecht, versteht Ihr nicht?«
»Doch, ich verstehe sehr wohl«, sagte Richard Campbell zurückhaltend.
»Dann bitte ich Euch, mich dabei zu unterstützen, sie davon abzubringen«, bat Mary.
Er sah sie prüfend an. »Und Ihr glaubt, ich sei die geeignete Person, die Eurer Herrin beibringen soll, dass sie über das Wenige, das ihr noch geblieben ist und an dem sie mit ganzem Herzen hängt, nicht frei nach Herzenswunsch verfügen kann?«
Heiß schoss das Blut in Marys Gesicht. So wie Richard es ausgedrückt hatte, bekam ihre Bitte um Beistand eine völlig neue und von ihr nicht beabsichtigte Bedeutung, die sie geradezu als herzlos erscheinen ließ.
»Es war nicht meine Absicht, mich vor einer undankbaren Aufgabe zu drücken«, verteidigte sich Mary.
»Ich weiß, Miss Bancroft. Nichts läge mir ferner, als Euch unterstellen zu wollen, dass Ihr etwas Derartiges bewusst tun würdet. Aber darauf läuft es letztendlich hinaus, nicht wahr?«, erwiderte Richard, ohne dass seine Stimme einen Vorwurf enthielt. »Es ist der Herzenswunsch Eurer Herrin, Euch Hickory Hill zu vererben. Doch sie ist vorausschauend genug, um zu erkennen, dass ihr Vermächtnis vor Gericht keinen Bestand haben würde. Deshalb ihr scheinbar irrwitziger Vorschlag, die Identität zu tauschen. Damit bürdet sie Euch eine nicht unbeträchtliche Last auf … trotz des Erbes als solches quasi eine undankbare Aufgabe, die Mut, Selbstbeherrschung und ein nicht geringes Maß an geistiger Regsamkeit erfordert. Ist es nicht so?«
Mary nickte stumm.
»Nun denn, ich werde mir Gedanken machen und mit Miss Shadwell sprechen, wenn es Euer Wunsch ist«, erklärte er und lächelte sie aufmunternd an. »Sagt mir nur, wann es Euch und Miss Shadwell recht ist, dass ich mit ihr darüber rede.«
Dankbarkeit stand in Marys Augen. »Wenn es Euch nichts ausmacht, werde ich Sally zu Euch schicken, sowie Miss Shadwell sich kräftig genug fühlt, mit Euch zu reden. Ich hoffe, ich kann sie dazu bringen, etwas Suppe und Tee zu sich zu nehmen.« Sie würde alles daransetzen, dass dieses Gespräch sobald wie möglich stattfand. Alice musste diesen unsinnigen Plan einfach vergessen, und mit Richard Campbells Unterstützung konnte ihr das gelingen.
»Ich werde Eure Nachricht erwarten, Miss Bancroft.«
Mary schenkte ihm ein zögerndes, hoffnungsvolles Lächeln und verließ seine Kabine, um wieder nach Alice zu sehen. Eigentlich hätte sie nach dem Gespräch mit Richard Campbell erleichtert und beruhigt sein sollen, doch merkwürdigerweise war dies nicht der Fall. Ja, ihr schien viel eher, als wäre das Gefühl dumpfer Unruhe und Ungewissheit noch stärker geworden …
5
Kurz nachdem Alice aus dem Schlaf erwachte, schickte Mary die Kammerzofe, die bleich und übernächtigt aussah, in die Schiffsmesse, um das klägliche Frühstück zu holen. Alice hatte nur nach Tee und trockenem Schiffszwieback gefragt. Seit Tagen nahm sie kaum noch etwas zu sich. Bald würde ihr entkräfteter Körper dem verzehrenden Fieber nichts mehr entgegenzusetzen haben.
»Hast du über das, was ich gesagt habe, nachgedacht und mit Mister Campbell gesprochen?«, wollte Alice wissen, als sie nach einer Tasse Tee und einem halben Zwieback das Tablett zurückschob. Es war erschreckend, wie wenig sie nur noch zu sich nahm.
Mary nickte. »Ja, ich habe es getan, wie du es gewünscht hast.«
»Und?«
»Er möchte nachher mit dir darüber reden, falls du dich in der Lage fühlst, ihn zu empfangen«, sagte Mary, ohne Einzelheiten zu erwähnen, denn auch Sally Lee hielt sich in der Kabine auf und hörte mit gespitzten Ohren zu. Sicher fragte sie sich im Stillen schon neugierig, was es so Wichtiges zu besprechen gab.