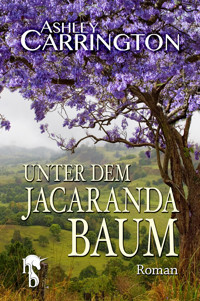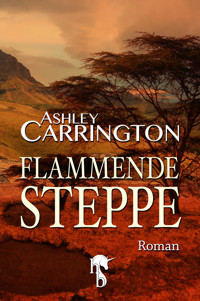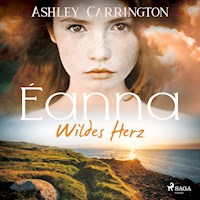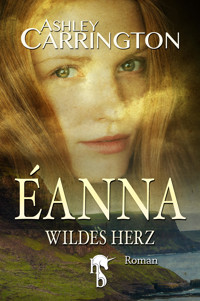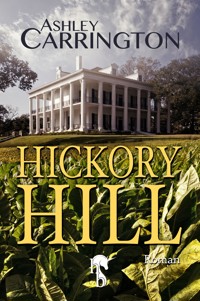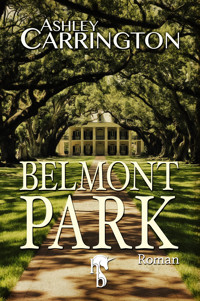6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der packende Gangster- und Liebesroman des Bestseller-Autors Ashley Carrington spielt während der aufregenden Zwanzigerjahre in den Südstaaten Amerikas. Schwarzbrenner und Gangster profitieren von der Prohibition, Korruption ist an der Tagesordnung. Die 20-jährige Mallory Kendrick hat ein besonderes Talent von ihrem Großvater geerbt: Ihr »Moonshine« gehört zum besten schwarz gebrannten Alkohol der Gegend. Trotzdem kommen sie, ihr Vater und ihr Bruder nur schwer über die Runden auf ihrer kleinen Farm in Virginia. Als ein neuer Gangsterboss auftaucht und ihre Familie zerstört, wird sie zur erbitterten Kämpferin. Als »Lady Moonshine« verfolgt sie in den zwielichtigen Clubs zwischen skrupellosen Gangstern, einem erpresserischen Verehrer und Gesetzeshütern unbeirrbar ihre Rachepläne, obwohl sie dadurch ihre große Liebe Henry verliert. Oder doch nicht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 918
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ashley Carrington
Lady Moonshine
Roman
ForKaren & NormanNilufer & MuratNatalie & JulioNadine & AlexanderOlga & JorgeThe one and onlyAtlanta »Piri-Piri« Gang
Prolog
Mai 1936
Sie hungerte nach seinen Zärtlichkeiten. Seine Lippen und Hände erforschten sie, und sie genoss das Gefühl, völlig entblößt zu sein und zugleich in seiner Liebe geborgen. Immer schneller trieb sie auf jenen magischen Punkt zu, an dem die Lust schier unerträglich wurde und in einer Explosion unsäglicher Wonne die Erlösung kam.
Das Kratzen von Metall über Stein machte alles zunichte. Seine Lippen und Hände entglitten ihr. Sie wollte ihn nicht gehen lassen, doch je verzweifelter sie ihn zu halten suchte, desto mehr entzog er sich. Wieder drang ein Kratzen in ihr Bewusstsein, und sie verlor ihn ganz. Die Glut in ihr fiel wie ein Strohfeuer zusammen. Mit einem wehmütigen Seufzer ließ sie ihn gehen – den wunderschönen Traum.
Ausgeruht und ein Lächeln auf dem Gesicht, schlug Mallory die Augen auf. Als sie das Kratzen, diesmal in Verbindung mit einem leisen Scheppern, erneut vernahm, schob sie sich in den seidenen Kissen nach oben. Die Schatten der Nacht behaupteten sich noch im Schlafzimmer, doch ein dünner Streifen Morgenlicht kündete bereits vom neuen Tag. Er stahl sich an einer der Terrassentüren durch einen winzigen Spalt zwischen den königsblauen Samtvorhängen, schnitt als helles Band schräg durch den Raum, hob einen der vier Pfosten ihres Baldachinbettes aus der Dunkelheit, streifte den gebeugten Rücken einer schwarz gekleideten Gestalt, die vor dem Kamin kniete, glitt zwei Schritte weit über das honigfarbene Parkett und berührte schließlich die matt glänzende Seidentapete.
Es war Daisy, die sich da vor dem mit Marmor eingefassten Kamin zu schaffen machte. Das neue Zimmermädchen, das sie erst zwei Tage zuvor eingestellt hatte. Bald knisterte ein Feuer, und Daisy huschte aus dem Zimmer, das nun ins Licht der Flammen getaucht lag.
Mallory streckte sich wohlig unter der Daunendecke und lauschte träge den vertrauten Geräuschen, mit denen der Haushalt unten in ihrem herrschaftlichen Haus zum Leben erwachte. Hier in den Blue Ridge Mountains von Virginia waren selbst jetzt im Mai die frühen Morgenstunden oft noch empfindlich kühl, und so wartete sie mit dem Aufstehen einige Minuten, bis das Kaminfeuer das Zimmer mit Wärme erfüllt hatte.
Ihre Gedanken wanderten zurück zu seinem Anruf, den sie so sehnlichst erwartet hatte. Nun fand alles zu einem glücklichen Ende! All den Bitternissen, Verletzungen und schrecklichen Irrungen zum Trotz würde der Kreis sich schließen. Und irgendwann würde auch die Wunde, die Bobby ihr geschlagen hatte, heilen. Die Hoffnung auf Versöhnung gab sie niemals auf.
Sie lächelte, als sie das Bett verließ, an die hohen Terrassentüren trat und die schweren Samtvorhänge aufzog. Blinzelnd spähte sie ins helle Morgenlicht, das in der Ferne über die tief gestaffelten, blau schimmernden Bergzüge fiel. Die Sonne warf ihren milden morgendlichen Schein über die lange Magnolienallee, die von der Landstraße heraufführte und ein atemberaubendes Bild weißer Blütenpracht bot.
Es hatte sie damals ein kleines Vermögen gekostet, auf jeder Seite der alten Farmauffahrt anderthalb Dutzend gut mannshohe Magnolienbäume pflanzen zu lassen. Die Leute im Franklin County hatten sich darüber die Mäuler zerrissen, woran sie sich nicht im Mindesten gestört hatte. Dass ihr prächtiger Landsitz, der am Fuß des Stone Ridge Mountain auf den brandgeschwärzten Ruinen der bescheidenen elterlichen Farm stand und dessen umlaufende Veranden von weißen Säulen getragen wurden, dass ihr ganz eigener Phönix aus der Asche im ganzen Landkreis mit Bewunderung und nicht selten auch mit Neid Magnolia Manor genannt wurde, erfüllte sie mit Stolz.
Sie begab sich ins Bad, streifte das blassblaue Musselin-Nachtgewand von den Schultern und musterte sich im bodenlangen Spiegel. Erste feine Linien hatten sich um Mund und Augen gegraben, auch wenn man schon genau hinsehen musste, um sie zu bemerken. Der betörende Glanz der Jugend und die natürliche Frische, die keiner Cremes, Düfte und aufwendiger Schminke bedurfte, waren unwiederbringlich verloren. Aber ihre schlanke Gestalt und weibliche Anmut mit all ihren Rundungen hatte sie sich bewahrt, und für eine Frau von Mitte dreißig hatte sie selbst bei kritischem Hinschauen keinen Anlass, der Jugend allzu sehr nachzutrauern. Noch immer drehten Männer sich bewundernd nach ihr um, und sie war sich ihrer besonderen Ausstrahlung wohl bewusst.
Was nichts daran änderte, dass sie nicht mehr die naive junge Frau war, die sie gewesen war, als ihre scheinbar so fest gefügte Welt innerhalb weniger Wochen wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen war. So viel hatte sie in so kurzer Zeit verloren, nicht zuletzt ihre moralische Unschuld. Viele Jahre lang hatte sie sich unbesiegbar und voll und ganz im Recht gewähnt, nur um sich später für Abschaum zu halten.
Mittlerweile war sie zu dem Schluss gekommen, dass weder das eine noch das andere zutraf. Nie, nicht einmal als junges Mädchen, hatte sie zu denen gehört, die das Leben als romantisches Unterfangen betrachten. Das Leben bestand nicht aus Schwarz und Weiß, sondern aus einer endlosen Palette von Grautönen. Und gab es überhaupt so etwas wie einen freien Willen? Wurde man nicht eher vom Schicksal, von Unkenntnis, Naivität, Verblendung, von seinen eigenen Unzulänglichkeiten und, ja, auch niederen Instinkten getrieben? Hätte man die Wahl gehabt, sein Leben noch einmal zu leben, hätte man dann nicht immer wieder dieselben Entscheidungen getroffen, wenn auch die Umstände und die eigenen Unzulänglichkeiten dieselben blieben? Der freie Wille war eine Illusion. Jeder tat, was er tun musste – oder was tun zu müssen er glaubte.
Seufzend wandte Mallory sich vom Spiegel ab. Wie schnell die Jahre vergangen waren! Sie hatte für das, was sie selbst in ihren kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten und dennoch erreicht hatte, einen hohen Preis gezahlt. Aber daran wollte sie jetzt nicht denken. Nicht an diesem Tag, da er auf dem Weg zu ihr war!
Sie hielt sich nicht lange im Badezimmer auf. Es galt, die frühe Stunde mit ihrer belebenden Luft für einen Ausritt zu nutzen; es drängte sie nach Bewegung. Doch als sie in einem bequemen Reitkostüm in den Morgen hinaustrat und unwillkürlich hinauf zum Stone Ridge Mountain schaute, änderte sie ihren Plan und schickte den Stallburschen mit ihrem geliebten grauschwarzen Wallach Mountain Smoke zu den Stallungen zurück.
Dort oben befand sich die Grundlage all dessen, was ihr an Gutem und Bösem widerfahren war und sie zu der gemacht hatte, die sie war. Dort oben hatte ihre Wandlung von der unbedarften »Mallory Moonshine« zur »Lady Moonshine« ihren Anfang genommen. Seit fast anderthalb Jahrzehnten war sie nicht mehr an jenem blutgetränkten Ort gewesen. Es wurde Zeit, den Aufstieg noch einmal anzugehen, den Bann zu brechen und endgültig einen Schlussstrich unter die düsteren Kapitel der Vergangenheit zu ziehen!
Zügig schritt sie über den Hügel, über den eine mächtige, uralte Sykomore ihren Schatten warf, und ließ den Rosengarten mitsamt Zierteich und Pavillon links liegen. Während sie auf den Waldsaum zuhielt, tauchte vor ihrem inneren Auge flüchtig das Tabakfeld auf, das sich früher hier erstreckt und ihnen Jahr für Jahr in brütender Sommerhitze Ströme von Arbeitsschweiß abverlangt hatte.
Kurz darauf erreichte sie den kühlen Schatten hoher Lebenseichen und Hickorybäume, und bald ging der ebene Wald in die Bergflanke über. Mit beständigem Schritt stieg Mallory bergan, durch den hohen Wald mit seinem würzigen Duft, den sie seit Kindertagen mit dem rauchigen Geschmack von Whiskey verband.
Das Unterholz wurde dichter, je höher sie kam. Sträucher, Dornendickichte, immergrüne Ranken sowie ganze Felder aus Farnen und Rhododendren wucherten zwischen den Bäumen. War der einstige Pfad vorher schon kaum auszumachen gewesen, schien er sich in diesem Teil des Bergwaldes ganz zu verlieren. Er wurde zu einem Geheimnis, das nur zu enträtseln vermochte, wer die Wildnis kannte und diesen Weg selbst in tiefster Nacht unzählige Male gegangen war.
Mit traumwandlerischer Sicherheit kletterte Mallory zur Destillerie hinauf. Sie wusste sogar noch, wo die Drähte gespannt gewesen waren. Dort hatten Konservendosen gehangen, in denen zur Warnung Nägel gescheppert hatten, sobald jemand an einen der Drähte kam.
Endlich gab das Dickicht sie frei. Das Gelände zwischen den Bäumen öffnete sich, wurde lichter, und dann lag der Platz vor ihr, an dem sich die still der Kendricks mit ihren primitiven Gärboxen, dem Druckkessel und der Kupferschlange des Kondensators befunden hatte. Schon Grandpa Carl hatte hier den besten Whiskey und den feurigsten Schnaps im ganzen County gebrannt, Kendrick-Moonshine eben, eine Klasse für sich! Das Dynamit hatte von all dem nicht mehr übrig gelassen als geborstene Hölzer und rostige Trümmer.
Die Morgenluft war erfüllt vom süßlichen Duft der Geißblattranken. Gerade wollte Mallory die letzten zehn, zwölf Schritte zum Felsüberhang hinaufsteigen, als sie mit der linken Stiefelspitze an einem Hindernis hängen blieb und beinahe gefallen wäre. Als sie zu Boden sah, entfuhr ihr ein Schrei und das Blut wich ihr aus dem Gesicht.
Die leeren Augenhöhlen eines Totenschädels starrten sie an. Sie wusste sofort, zu welcher Leiche er gehörte, wer hier, ein Stück unterhalb der still, verscharrt worden war.
Übelkeit stieg in ihr hoch. Schlagartig hatte sie wieder die Ausdünstungen der Blasen schlagenden Maische in der Nase, den scharfen Geruch von Männerschweiß, den fauligen Atem, der ihr aus nächster Nähe entgegenschlug; sie schmeckte das Blut, das ihr ins Gesicht spritzte, nahm die ganz eigene Note von nackter Todesangst wahr, die sich mit der süßen Schwere des Geißblatts vermischte und sie unsäglich ekelte. Ihr war, als füllten sich die Höhlen des Totenschädels wieder mit jenen bösartigen Augen; sie sah den Dorn hochfahren und sich tief in den Augapfel bohren. Und dann hörte sie den gellenden Schrei im nächtlichen Wald und die drei Schüsse, kaum lauter als das gedämpfte Entkorken von Champagnerflaschen!
Plopp, plopp, plopp!
Tod, Tod, Tod!
Wie gelähmt stand sie da, überwältigt von den Erinnerungen, die sie mit sich rissen wie die Brandung ein Stück Treibholz. Kein Luftzug regte sich, keine Vogelstimme ertönte, nicht ein Blatt bewegte sich. Sie war umgeben von einer Stille, die sie bis ins Mark erschauern ließ.
Aus der Tiefe des Waldes starrten die Toten sie an.
Erster Teil
Juni 1921
1
Es war ein selbst für den Süden Virginias ungewöhnlich warmer Junitag. Das Tabakfeld der Kendricks stand in voller Blüte. Über Nacht schien sich ein leuchtend rosafarbenes Tuch über die fast mannshohen Pflanzen gelegt zu haben. Aber der schillernden, süßlich duftenden Pracht war kein langes Leben vergönnt. Die Blütenstände raubten den Blättern die Nährstoffe, die für die Qualität des Tabaks ausschlaggebend waren, daher mussten sie schnell abgeschnitten werden.
Mallory Kendrick war harte Arbeit gewohnt. Sie kannte es nicht anders, und es gab keinen Grund, sich darüber zu beklagen. Das Leben aller, die hier im Franklin County und anderswo in den Bergen, Tälern und Niederungen der Blue Ridge Mountains vom Ertrag ihrer kleinen Farmen lebten, war karg und mühselig.
An diesem Tag fiel es ihr jedoch schwer, zu ihrem Bruder Robert auf das Tabakfeld zurückzukehren und die ermüdende Arbeit wieder aufzunehmen. Dennoch durfte sie sich nicht vor ihrer Pflicht drücken. Als große Schwester musste sie für den Bruder, der in einigen Monaten fünfzehn wurde, Vorbild sein. Und seit dem Tod der Mutter lastete diese Verantwortung besonders schwer auf ihren Schultern.
Drei Jahre zuvor war sie gestorben, innerhalb von sieben Monaten, dahingerafft von tückischen Krebsgeschwülsten. Noch nicht ganz siebzehn war Mallory in jenem Frühling gewesen, als überall auf der Farm die Geißblattranken ihre Blütenpracht entfalteten und die Mutter oben bei den jahrhundertealten Lebenseichen zu Grabe getragen worden war.
Mallory stand an der Wasserpumpe im Hof und ließ sich Zeit, die beiden verbeulten Feldflaschen aufzufüllen, derentwegen sie vom Tabakfeld gekommen war. Sie genoss den Schatten, den das schlichte Farmhaus mit seinen Wänden aus überlappenden Eichenbrettern und der kleinen Veranda warf. Hinter dem Haus stieg das Gelände allmählich an und ging dann in die dunklen, dichten Wälder des Stone Ridge Mountain über. Alles Kendrick-Land, von der Landstraße unten bis hinauf zur zerklüfteten Bergkuppe.
Ein halbes Dutzend Hühner lief über den Hof und pickte im Dreck. Abe, ihr schwarzer Hahn mit dem feuerroten Kamm, scheuchte zwei Junghühner aus seinem Harem vor sich her.
Mit einem leisen Seufzer nahm Mallory den ausgefransten Strohhut ab, zog ein kariertes Taschentuch aus ihrem stellenweise schon fadenscheinigen Overall und wischte sich Schweiß und Blütenstaub vom Gesicht. Wie üblich hatte sie ihr schulterlanges gelocktes Haar, das die Farbe dunklen Honigs hatte, zur Arbeit mit einem einfachen Einweckgummi im Nacken zu einem Zopf zusammengebunden.
Ihr Blick ging kurz zur Scheune hinüber, aus der harte, fast zornig klingende Hammerschläge drangen. Metall auf Metall. Die beiden Torflügel aus verwitterten Brettern standen weit offen. Im Halbdunkel der hohen Durchfahrt zeichneten sich die Umrisse ihres alten Pick-up-Trucks aus Armeebeständen ab. Ein Halbtonner von Ford mit schmaler Fahrerkabine und einer kurzen, von Bretterwänden umschlossenen Ladefläche. Wieder einmal mühte ihr Vater sich, einen Schaden an der alten Kiste zu beheben, doch es klang nicht so, als mache er große Fortschritte. Dabei brauchten sie den Pick-up für ihre wöchentlichen Touren zu den Stammkunden. Mit Old Nick, ihrem alternden Esel, ließen die Lieferungen sich nicht bewerkstelligen.
Gemächlich betätigte Mallory den gusseisernen Schwengel der Pumpe. Kaltes Wasser stieg aus der Tiefe und schoss aus dem geschwungenen Maul des Rohrs. Sie beugte sich in den kräftigen Strahl, stillte ihren Durst und schlug sich kühles Wasser ins Gesicht.
Zugleich schämte sie sich ein wenig, dass sie so herumtrödelte und dem Herrgott den Tag stahl, wie Grandpa Carl in solchen Fällen gesagt hatte. Schnell stülpte sie sich den Strohhut wieder über den Kopf und beeilte sich, die Feldflaschen aufzufüllen.
2
Gerade hatte sie die Deckel zugeschraubt, da vernahm sie Motorengeräusche. Sofort dachte sie an Henry Irving, und ihr Herz begann schneller zu schlagen. Sie lächelte über sich selbst. Nun ja, sie freute sich eben, ihn zu sehen. So viel Besuch bekamen sie ja auch nicht. Und hatte er nicht versprochen, nach der Arbeit im Sägewerk zu kommen und bei der Reparatur des Trucks zu helfen? Henry kannte sich mit Motoren aus wie kein anderer.
Ihre freudige Erwartung währte jedoch nur einen kurzen Moment. Es war nicht sein Auto, das da von der Landstraße auf Kendrick-Land abbog. Sie erkannte Motorengeräusche von zwei sehr unterschiedlichen Automobilen, ein dunkles, fast melodisch anmutendes mechanisches Summen und gleich darauf das Rattern und Bellen eines schweren Trucks. Letzteres hörte sie nicht zum ersten Mal. Es klang nach dem Pierce-Arrow-Liberty-Truck des Bootleggers Barney Gifford aus Roanoke1, der großen Stadt jenseits der Berge.
Der kahlköpfige und schwergewichtige Alkoholschieber war ein Selbstständiger. Er fuhr auf eigene Rechnung und gehörte keiner der Banden an, die in der Stadt das Sagen hatten und seit Inkrafttreten der Prohibition durch den Volstead Act anderthalb Jahre zuvor2 den Alkoholhandel kontrollierten und die lukrativen Flüsterkneipen oder Speakeasies betrieben. Aber natürlich musste er eine Lizenzgebühr – also Schmiergeld – an die Oberbosse Eddie Wheeler und Arnie Flint bezahlen. Ohne diese sogenannte granny fee hätten weder die beiden noch die örtlichen Behörden ihn seinen Geschäften unbehelligt nachgehen lassen. Und die bestanden darin, dass er seine Großabnehmer in der Stadt mit Moonshine, schwarzgebranntem Schnaps, Whiskey und Brandy aus dem bergigen Hinterland von Roanoke, versorgte, insbesondere mit Erzeugnissen aus dem Franklin County. Wobei die still der Kendricks in diesem Bezirk seit eh und je dafür bekannt war, dass aus ihren Kupferschlangen der beste Schwarzgebrannte rann. Das galt für Kendricks klaren Apfelschnaps namens Crazy Apple ebenso wie für den Mountain Smoke genannten Whiskey.
Mallory sah zwei Staubfahnen vor dem Hintergrund der bläulich schimmernden Bergzüge in den Himmel steigen. Die vordere hing schräg in der Luft wie ein im Wind wehendes Banner. Dagegen glich die hintere eher einem langen, staubigen Vorhang, der sich vor die Bergzüge schob. Sie zogen hinter dem Waldstück vorbei, wo die sandige Zufahrt zur Kendrick-Farm von der windungsreichen Landstraße nach Rocky Mount abging, der größten Ortschaft im Franklin County, in der die örtliche Verwaltung ihren Sitz hatte.
Augenblicke später kam der erste Wagen in Sicht. Mallory machte große Augen, als sie eine elegante, königsblau lackierte Limousine mit offenem Verdeck bei den beiden Magnolienbäumen auftauchen und die lange Zufahrt heraufkommen sah. Vor dem Kühlergrill, dessen verchromtes Gitter im Sonnenlicht funkelte, saßen zwei große Scheinwerfer in polierten Chromgehäusen. Die geschwungenen Kotflügel gingen in breite Trittbretter über, reichten bis zu den hinteren Schutzblechen und leuchteten in demselben Cremeweiß wie die Weißwandreifen über den Speichenrädern und die feudale lederne Polsterung der Sitze.
Barney Gifford folgte dem königsblauen Cabrio mit seinem klobigen schwarzen Truck wie ein alter Frachtkahn einer herrschaftlichen Jacht.
Die Hammerschläge in der Scheune erstarben, und die groß gewachsene, sehnige Gestalt ihres Vaters erschien im offenen Tor. Er wischte sich die ölverschmierte Rechte an dem Putzlappen ab, den er mit dem linken Ellbogen gegen die Hüfte presste. Seit er in dem Winter nach Mutters Tod in einer vereisten Schlucht gestürzt war und sich die Schulter und den Arm mehrfach gebrochen hatte, war sein linker Arm zu nichts mehr nütze, was auch nur ein bisschen Gelenkigkeit oder Kraft erforderte.
Er kniff die Augen zusammen, als sich die Limousine und Giffords Truck dem Hof näherten. Sein wettergegerbtes Gesicht verschloss sich augenblicklich.
3
Das Studebaker-Cabrio rollte zwischen Farmhaus und Scheune aus. Würziger Tabakrauch wehte zu Mallory herüber. Er kam von dem Fremden auf der Rückbank; der Mann hatte in ebenso entspannter wie selbstgefälliger Pose die Arme ausgebreitet, in seinem Mundwinkel steckte eine Zigarre, lang wie eine Stange Dynamit.
Mallory schätze ihn auf Mitte bis Ende vierzig. Er war von mittelgroßer, eher fülliger Statur und trug einen hellgrauen Sommeranzug mit Weste, dazu ein himmelblaues Hemd mit weißem Kragen und eine Krawatte mit Blumenmuster. Ein bleistiftdünner schwarzer Strich von Bart zog sich über seine Oberlippe und betonte die kantigen Linien seines Gesichts. Auf dem Kopf saß ein Fedora-Hut mit vorn abgeknickter Krempe. Die Hutfarbe entsprach der des Anzugs, während das seidene Hutband zum Hemd passte. Auf eine herb maskuline Art sah er gut aus.
Der Fahrer stellte den Motor ab und schwang sich geschmeidig aus dem Wagen. Er war schlank und dunkelblond, mochte um die dreißig sein und hatte markante Züge. Mit seinen schwarzen Slippern, der weiten schwarzen Leinenhose, dem grauen Seidenhemd und dem schwarzen Halstuch wirkte er um einiges eleganter als der Mann auf der Rückbank. Für ihn schien formvollendete Kleidung eine Selbstverständlichkeit zu sein, er trug sie wie eine zweite Haut.
Ohne Eile ging er um den Wagen herum. Dabei fischte er im Vorbeigehen vom Beifahrersitz lässig eine schwarze, goldbetresste Schirmmütze.
»Mister O’Reilly«, sagte er, öffnete die hintere Tür und deutete eine Verbeugung an.
»Lass das Affentheater, Frankie!« Patrick O’Reilly erhob sich von der Rückbank und schlug ihm beim Aussteigen mit einer nachlässigen Handbewegung die seemännische Schirmmütze vom Kopf. Dann zupfte er seine Hosenbeine zurecht, die auf zweifarbige Gamaschen und braunes Schuhwerk fielen, wobei goldene Manschettenknöpfe aufblitzten.
Der Mann namens Frankie lachte leise, bückte sich nach der Schirmmütze und warf sie zurück in den Wagen.
Indessen hatte auch der Liberty-Truck von Barney Gifford den Hof erreicht und nahe dem Scheunentor angehalten. Diesmal prangte auf den Seitenwänden der kastenförmigen Frachtkabine in goldenen, rot umrandeten Lettern der Schriftzug Lion Oil Company. Warum sich der dicke Gifford alle paar Monate die Mühe machte, seinem Truck ein anderes Logo und manchmal auch einen neuen Anstrich zu verpassen, war Mallory ein Rätsel. Jeder – auch die Polizei – im County und vermutlich auch drüben in Roanoke und Umgebung wusste, dass er nichts transportierte, was nicht flüssig war und einen Alkoholgehalt von mindestens 120 Proof3 hatte.
Barney Gifford wuchtete seinen massigen Leib aus der Fahrerkabine. Auf seinem fleischigen Gesicht und dem kahlen Schädel perlte der Schweiß und unter den Achseln zeichneten sich große dunkle Flecken auf seinem Hemd ab. Ein nervöser Ausdruck stand in seinen tief liegenden Augen.
Zu Mallorys Verwunderung stiegen noch zwei Männer aus dem Liberty-Truck. Beide waren um die dreißig. Der eine besaß die bullige Statur und die Pranken eines Lastenträgers und hatte einen merkwürdig weichen Gesichtsausdruck. Unter seiner breit geschlagenen Nase wucherte ein rotbrauner Walrossbart, hinter dem auch noch die Unterlippe verschwand. Das borstige Haupthaar dagegen trug er raspelkurz geschnitten. Neben ihm sah der andere mit seiner asketisch hageren Gestalt wie ein vom Tod gezeichneter Hungerleider aus. Seine Nase war so dünn und gerade wie der Mittelscheitel, der durch sein spärliches, pomadisiertes kurzes schwarzes Haar schnitt. Seine Augen, die tief unter wulstigen Knochenbogen lagen, hatten die Farbe von Eiswasser.
Mallory erfasste mit einem Blick, dass die Männer, die mit dem dicken Alkoholschieber gekommen waren, nichts Gutes verhießen.
4
Barney Gifford flüsterte O’Reilly etwas zu und deutete auf William Kendrick, der abwartend im Scheunentor stand und den Daumen seiner linken Hand hinter seinen breiten Ledergürtel hakte. Was er immer tat, wenn er kaschieren wollte, dass der Arm fast lahm war.
»Patrick O’Reilly, Geschäftsmann aus Roanoke«, stellte der Fremde sich mit unverkennbar irischer Sprachfärbung vor, trat näher und streckte ihm mit einem jovialen Lächeln die Hand entgegen. »Mister William Kendrick?«
Mallorys Vater nickte knapp, ignorierte aber die dargebotene Hand. Seiner Miene war nicht zu entnehmen, was er von diesem »Geschäftsmann« und seinen Begleitern hielt.
»Nun ja, ist wohl auch besser so, Dutchman!«, sagte O’Reilly mit einem Blick auf die noch immer schmutzige Rechte seines Gegenübers, zog an seiner Zigarre, entließ eine dicke Rauchwolke aus seinem Mund. »Dutchman stimmt doch, oder?«
William Kendrick zuckte mit den Achseln. »Die Menschen lieben Etiketten«, sagte er trocken. »Die geben ihnen das Gefühl, alles richtig einordnen zu können und die Welt im Griff zu haben.«
Mallory wusste, was ihr Vater meinte. Ihre Familie hatte mit den Bewohnern der Niederlande, den tatsächlichen Dutch, so viel zu tun wie dieser O’Reilly wohl mit Franzosen oder Schweden. Ihre Großeltern waren 1882 aus Deutschland ausgewandert, ihr Vater war damals gerade sieben gewesen. Weil die Einheimischen aber das Wort »deutsch« nicht korrekt aussprechen konnten, hatten sie »dutch« daraus gemacht.
Patrick O’Reilly blickte kurz irritiert. Dann wedelte er, die Zigarre in der Hand, großspurig über sein Unverständnis hinweg. »Wie auch immer. Nach höherer Philosophie steht mir heute nicht der Sinn, mein Bester! Lassen Sie uns lieber zum Geschäftlichen kommen.«
»Und das wäre?«, fragte William ruhig zurück.
Der asketisch-knochige Mann schnaubte geringschätzig. Gleichzeitig zog er ein Springmesser hervor. Die Klinge schnellte aus dem Heft und rastete mit einem metallischen Klicken ein. An den Kühler von Giffords Truck gelehnt begann er, sich mit dem Messer die Nägel zu säubern.
»Ach, ich vergaß, Ihnen meine Begleiter vorzustellen«, sagte O’Reilly. »Das sollte ich schnellstens nachholen, werden Sie in Zukunft doch mehr mit ihnen zu tun haben als mit mir. Also, das da ist Knuckles«, er deutete auf den bulligen Mann, der sich gerade ein Kaugummi in den Mund schob und dann mit zwei Fingern seiner rechten Pranke an die Stirn tippte, »und das hagere Ende daneben ist Skinny the Blade. Der hat ’ne Schwäche für scharfe Klingen. Tja, und der gelangweilte Gentleman dort an meinem Studebaker ist Frank Marlowe. Er kümmert sich um die … nun ja, die feineren Aspekte meiner Geschäfte.« Er grinste breit, und sein schwarzer Strich von Oberlippenbart krümmte sich zu einem Bogen, als er die Zigarre genüsslich zwischen den Lippen hin und her rollte.
William Kendrick zeigte nicht die geringste Regung. »Wenn Sie zur Sache kommen würden, Mister O’Reilly«, sagte er nur.
O’Reilly schnippte ihm den Aschekegel von seiner Zigarre direkt vor die Stiefel. »Man sagt, die Leute hier in den Bergen geben was auf das, was Sie tun und sagen, Dutchman. Deshalb dachte ich, ich rede persönlich mit Ihnen, wo ich schon mal in der Gegend bin, um die Dinge, die noch nicht nach meinen Vorstellungen laufen, in die richtigen Bahnen zu lenken.«
William Kendricks Miene blieb ausdruckslos. »Gut, Sie sind hier, Mister O’Reilly. Also, was genau wollen Sie?«
O’Reilly furchte die Stirn und wandte sich zu Barney Gifford um. »Habe ich etwas nicht mitgekriegt? Ist heute vielleicht gar nicht der erste Samstag im Monat?«, fragte er scheinbar verwirrt.
»Doch, Mister O’Reilly!«, gab der Dicke zurück.
»Jesus, Maria und Josef sei Dank! Und ich hatte schon Angst, ich könnte mir nicht mal mehr merken, welchen Wochentag wir haben!«, rief O’Reilly. »Und hast du nicht mit dem Dutchman die Abmachung, dass du an jedem ersten Samstag im Monat kommst, um hundertzwanzig Gallonen4 von seinem Moonshine abzuholen, diesem Crazy Apple?«
Wieder nickte der Dicke. »Doch, so machen wir es seit September!«
Irritiert kniff O’Reilly die Brauen zusammen. »Und hat dir der Dutchman nicht erst vorgestern versichert, dass sein Schwarzgebrannter wie immer bereit zum Abholen ist?«
»Doch, hat er!«, versicherte der Dicke eilfertig.
O’Reilly schob sich die Zigarre in den Mund, bleckte die Zähne und klatschte theatralisch in die Hände. »Na, wunderbar, dann hat ja alles seine Richtigkeit!« Er drehte sich wieder zu Mallorys Vater um. »Damit dürfte sich Ihre Erinnerungslücke geschlossen haben, Dutchman!« Sein Lächeln nahm, wie es Mallory vorkam, einen geradezu wölfischen Ausdruck an. »Also dann, bringen wir das Geschäftliche hinter uns!«
Als wären damit alle Missverständnisse ausgeräumt, zog der Gangster eine dicke Geldrolle aus der Tasche, streifte das Gummiband von dem Packen, leckte über seinen Daumen und begann, Scheine abzuzählen.
»Also, das wären bei vier Dollar die Gallone vierhundertachtzig Flocken, abzüglich zehn Dollar Transportgebühr pro Truckladung. Den Zwanziger, der als granny fee monatlich fällig ist, ziehen wir der Einfachheit halber gleich mit ab, sodass Sie unterm Strich das hübsche Sümmchen von … ja, vierhundertfünfzig Dollar kassieren können! Wenn das kein guter Schnitt ist!« Er hielt William Kendrick ein entsprechendes Bündel Scheine hin.
Der machte keine Anstalten, das Geld zu nehmen. »Sie müssen falsch informiert sein. Mein Moonshine gehört zum Besten, was im Franklin County aus den stills kommt. Unser Crazy Apple kostet wie der Mountain Smoke seit Jahr und Tag fünf Dollar die Gallone, Mister O’Reilly«, sagte er kühl. »Zu dem Preis können wir gern ins Geschäft kommen, aber nur zu dem und keinen Cent drunter!«
Mallory war zu Bescheidenheit erzogen, konnte sich jetzt aber eines stolzen Lächelns nicht erwehren. Flüchtig huschte es über ihr Gesicht. Denn die viel gelobte … ja, genau genommen die einzigartige Qualität ihrer gut versteckten Destillerie oben in der Schlucht des Stone Ridge Mountain war vor allem ihr Verdienst – und natürlich das von Grandpa Carl. Ihr Vater war ein guter Schwarzbrenner; er beherrschte sein Handwerk, verstand, einen anständigen, sauberen Moonshine zu destillieren, und brauchte sich hinter keinem zu verstecken. Aber das außergewöhnliche Gespür für die einzelnen Abläufe der Alkoholherstellung und die Verfeinerung des Geschmacks, das ihr Großvater besessen und mit liebevoller Geduld an sie weitergegeben hatte, ging ihm ab. Seit Grandpas Tod fünf Jahre zuvor sorgte nun sie dafür, dass weiterhin Moonshine von überragender Qualität aus der Kendrick-still rann. Was der Vater freimütig eingestand, sogar vor ihren treuen Kunden. Nicht von ungefähr schwang in ihrem Spitznamen »Mallory Moonshine« bei aller gutmütigen Neckerei und gelegentlichen Anzüglichkeit mehr Anerkennung für ihr geschicktes Händchen und ihre feine Nase mit als alles andere.
Sie merkte, dass der Mann namens Frank Marlowe zu ihr herüberschaute. Er stand mit einem Fuß auf dem Trittbrett des Studebaker und kehrte seinem Boss und den beiden anderen Gestalten halb den Rücken zu, als lege er Wert auf die Distanz, ohne sie jedoch allzu offensichtlich einzunehmen. Sein Blick war so unverschämt direkt und forschend, dass sie sich darunter fast nackt vorkam, wie verrückt der Gedanke auch sein mochte. Ihr schoss das Blut ins Gesicht, und hastig sah sie weg.
»Und dabei bleibt es auch in Zukunft«, fuhr ihr Vater indessen mit fester Stimme fort. »Wenn Ihnen das nicht passt, steht es Ihnen frei, Ihr Geld anderswo auszugeben. An Anbietern fehlt es ja nicht. Und was Ihre Transportgebühr und das, was Sie granny fee nennen, angeht, so trifft Ihr Humor nicht ganz den meinen.«
Patrick O’Reilly gab sich perplex, riss Mund und Augen auf und wich einen halben Schritt zurück. »Wie bitte? Das ist nicht ganz deine Art von Humor, Dutchman?« Keine Spur mehr von respektvoller Anrede. »Zum Teufel, da muss ich einiges in den falschen Hals gekriegt haben! Hey, Barney, hast du ihm denn, als ihr euch getroffen habt, nicht gesagt, dass die Karten in Roanoke neu verteilt worden sind? Dass der gute Eddie Wheeler und die Flasche Arnie Flint eine Auszeit genommen haben?«
»Und zwar für ’ne Ewigkeit«, warf Knuckles ein. »Das Outfit von denen haben wir übernommen …«
»Zumindest das, was von ihren Gangs noch übrig war«, rief der Hungerhaken Skinny dazwischen.
»Und dass jetzt ein paar neue Spielregeln gelten?«, beendete O’Reilly seine rhetorische Frage und sah den dicken Gifford scheinbar ratlos an. »Sag bloß, du hast es an der nötigen Klarheit fehlen lassen!«
»Ich habe alles so gesagt, wie Sie es mir aufgetragen haben, Mister O’Reilly! Ich schwörs bei Gott und meiner Ehre!«, beteuerte Barney Gifford hastig. »Reinen Wein habe ich ihm eingeschenkt! Hab ihm klipp und klar gesagt, dass jetzt ein anderer Wind weht!«
»Gut, gut, ich glaube dir!«, knurrte O’Reilly und wandte sich mit einem dünnen Lächeln wieder William Kendrick zu. »Na also, Dutchman, wo liegt das Problem? Es wird dieselbe Musik gespielt, nur mit neu aufgezogenen Saiten und nach dem Takt, den ich angebe! Sie sind gut beraten, sich danach zu richten!«
Williams Augen verengten sich kaum merklich. »Mir ist egal, welche Saiten Sie aufziehen und welchen Takt Sie angeben. Ich verkaufe, an wen ich will. Und wenn Sie meinen Moonshine wollen, sind fünf Dollar die Gallone fällig!«
Mallory hatte die Fäuste geballt. »Ja, wir lassen uns nicht erpressen, Mister!«, rief sie. »Wir denken gar nicht daran, uns …«
»Du hältst den Mund!«, herrschte der Vater sie an.
»Aber Vater, ich …«
»Ich will kein Wort mehr hören, Mallory!«, schnitt er ihr das Wort ab. »Das hier wird unter Männern geregelt!«
War sie eben noch aus Verlegenheit rot geworden, stieg ihr nun die Zornesröte ins Gesicht. Aber sie wagte nicht, noch ein zweites Mal aufzubegehren. Sie wusste nur zu gut, welche Grenze sie besser nicht überschritt. Nicht, dass er ein tyrannischer oder gar gewalttätiger Vater gewesen wäre, ganz und gar nicht. Nie hatte er die Hand gegen die Mutter erhoben, nicht einmal im erbittertsten Streit. Auch Robert und sie brauchten nicht zu befürchten, von ihrem Vater im Suff oder aus einer Wut heraus verprügelt zu werden, wie es in so vielen anderen Elternhäusern gang und gäbe war. Ein Schlag in den Nacken, eine Kopfnuss oder eine Ohrfeige waren alles, was sie bei unbotmäßigem Betragen an körperlicher Züchtigung zu erwarten hatten. Aber er verlangte Gehorsam und hatte Prinzipien, von denen er, auch vor einem Ganoven wie Patrick O’Reilly, nicht abrückte.
»Okay, du hast deinen Stolz, Dutchman, und dafür habe ich ’ne Menge übrig. Ein Mann ohne Ehre taugt nichts, ist wie ein Drink ohne Kick«, sagte O’Reilly überraschend versöhnlich.
Mallory wurde kurz abgelenkt, als sie den eleganten Mann am Studebaker leise genervt aufseufzen hörte. Nur sie registrierte es, denn es trennten sie gerade mal drei, vier Schritte von ihm. Sie sah, dass er kaum merklich den Kopf schüttelte und sich mit spöttisch verzogenem Mund noch weiter von der Szene am Scheunentor abwandte, so, als habe er all das schon oft gehört und sei dessen überdrüssig.
Wie war sein Name noch mal?
Richtig, Frank Marlowe!
Jetzt zog er ein silbernes Etui hervor, nahm eine Zigarette heraus und klopfte das Ende auf dem Deckel fest. Als er beim Anzünden der Zigarette mit einem gleichfalls silbernen Feuerzeug den Kopf hob und zu ihr herübersah, begegnete er ihrem Blick.
Für einen kurzen Moment war ihr, als wollten die rauchblauen Augen des Fremden ihren Blick festhalten … ja, sie zu ihm hinüberziehen. Sie blinzelte, um den Bann zu brechen.
Ohne den Blick von ihr zu wenden, griff er in die Hosentasche, holte das Etui ein zweites Mal hervor, ließ den Deckel aufklappen und hielt es ihr mit hochgezogenen Brauen halb fragend, halb auffordernd hin.
Perplex, dass er sie so dreist in Gegenwart ihres Vaters aufforderte, sich aus seinem Etui zu bedienen, und sich über sein unschickliches Benehmen auch noch zu amüsieren schien, starrte sie ihn an. Selbst wenn Frauen mit Zigarette in der Öffentlichkeit längst keinen Skandal mehr auslösten, gehörte sich dennoch nicht, was er sich herausnahm!
Mallory schoss ihm einen Blick zu, von dem sie hoffte, dass er richtig giftig wirken möge, und schaute wieder zu dem irischen Gangsterboss hinüber. Dass der Chauffeur leise lachte und mit den Achseln zuckte, bekam sie jedoch sehr wohl noch mit.
»Wo jemand Respekt verdient, bin ich der Letzte, der ihm den verweigert. Deine Ware ist erstklassig, und meine Kunden wissen den Crazy Apple zu schätzen. Davon könnte ich mehr absetzen, und darüber könnten wir reden, aber eins nach dem anderen«, fuhr O’Reilly herablassend fort. »Schätze mal, die grundlegende Neuordnung in unserem Geschäft ist für euch Leute vom Land ein bisschen schnell gekommen und ihr durchblickt noch nicht, dass sich die Zeiten geändert haben. Deshalb mache ich dir ein Freundschaftsangebot.«
William sah ihn schweigend an.
»Für die heutige Ladung zahle ich dir die fünf Kröten pro Gallone! Was aber unter uns Brüdern bleibt, damit das klar ist! Möchte nicht, dass jemand auf die verrückte Idee kommt, der Dutchman hätte mir die Eier abgenommen!« Er lachte kurz, aber es klang mehr nach einem drohenden Bellen. »Dieses eine Mal, okay? Danach reihst du dich gefälligst ein und kriegst wie alle anderen vier für erste Ware. Dafür brauchst du dich nicht mehr um andere Kunden zu kümmern, denn von jetzt an nehmen wir alles, was du produziert, nicht nur den Crazy Apple, sondern auch deinen Whiskey.«
»Aber die granny fee muss er abdrücken, Boss! Da gibts gar nichts«, warf Skinny the Blade ein und schnippte den Dreck, den er unter seinen Nägeln herausgepult hatte, von der Messerspitze.
O’Reilly nickte. »Klar, das lässt sich nicht vermeiden. Um die granny fee kommt keiner herum, diese Regel ist sozusagen in Zement gegossen, wenn du verstehst, was ich meine.« Er lächelte anzüglich. Dass es unter den Gangstern in den großen Städten oben im Norden beliebt geworden war, unliebsame Konkurrenz und andere Feinde in einer Baugrube unter Zement oder mit einem Zementblock an den Beinen irgendwo in tiefem Wasser verschwinden zu lassen, diese Nachricht war über die Zeitungen selbst ins tiefste Hinterland gelangt. »Aber das ist gut investiertes Geld, Dutchman. Dafür kriegt ihr erstklassigen Schutz, und der hat nun mal seinen Preis. Es halten doch alle die Hand auf, vom Judge über den Bezirksstaatsanwalt bis zum Sheriff und seinen Fußsoldaten. Bei all den Countys, in denen wir operieren, ist das eine komplizierte Maschinerie von Blutsaugern, die ständig geschmiert sein will, damit sie ohne unschöne Störungen läuft.«
»Dafür haben wir hier schon immer bezahlt«, entgegnete William mit verschlossener Miene. »Und ich ziehe es vor, bei dieser Art zu bleiben!«
Mallory wusste, wovon er sprach. Meist lieferte ja sie den Moonshine an die Stammkunden aus. Auf diesen Touren bekam Judge Wilcox, ebenso wie Sheriff Henderson und seine Deputies sowie einige andere, mit denen es sich gut zu stellen galt, regelmäßig eine Gallone Crazy Apple oder Mountain Smoke in einer braunen Packpapiertüte an die Hintertür gestellt, und zwar in jeder Hinsicht frei Haus!
O’Reilly fixierte William. »Also, ich an deiner Stelle würde mir noch einmal gut überlegen, ob ich so …«
William fiel ihm ins Wort. »Sparen Sie sich die Mühe! Wer mit mir Geschäfte machen will, macht sie zu meinen Bedingungen oder gar nicht! Ich denke, damit ist alles gesagt!« Sein Ton unterstrich seine Unbeugsamkeit und gab dem herausgeputzten Gangster aus der Stadt zu verstehen, dass das Gespräch für ihn beendet war. »Einen guten Tag noch, Mister O’Reilly!«
»Du irrst, Dutchman! Mit dir sind wir noch lange nicht fertig!« O’Reilly stach mit der Zigarre nach ihm wie mit einem Messer. »Wenn du glaubst, du könntest dein eigenes Süppchen kochen und Geschäfte an uns vorbei machen, dann hast du dich geschnitten! Wir haben den gesamten Handel mit Moonshine im Griff, und du wirst da nicht aus der Reihe tanzen und für Unruhe unter den Zulieferern sorgen, darauf kannst du Gift nehmen! Du wirst Kreide fressen wie die anderen, sonst nimmt es ein übles Ende mit dir, ist das klar, du gottverdammter redneck5?«
Skinny the Blade hatte seine Maniküre eingestellt und Knuckles ein Zeichen geben, worauf dieser die Fahrerkabine des Trucks öffnete und einen Baseballschläger herausholte.
»Schätze, mit gutem Zureden kommen wir nicht weiter, wenn wir die Gallonen Crazy Apple heute noch auf dem Truck haben wollen«, sagte Skinny und stieß sich vom Kühler des Lasters ab.
Knuckles nickte und klatschte den Baseballschläger in seine linke Pranke. »Wird ’ne schnelle Runde, dann sind wir mit ihm durch.« Das sagte er so ruhig, als ginge es darum, auf die Schnelle ein paar Scheite Holz zu spalten.
5
William, der nahe am rechten Torpfosten stand, machte einen raschen Schritt zur Seite, griff in ein Fach, das mit einem alten Jutesack verhängt war, und zog eine Schrotflinte mit abgesägtem Doppellauf hervor. Es war die alte Donnerbüchse, die er immer zur still mitnahm, weil sie nicht halb so schwer war wie die doppelläufige Browning, mit der er Rebhühner und Fasane jagte. Die Donnerbüchse mit den abgesägten Läufen konnte er notfalls auch mit einer Hand gut halten. Blitzschnell stellte er sich seitlich zu O’Reilly und dessen Handlanger – so, dass er ihnen die linke Seite zeigte und das Gewehr auf seinem linken Ellbogen auflegen konnte – und richtete die Waffe auf den Gangsterboss.
»Elendes Pack! Jetzt reicht es!«, stieß er hervor. »Los, runter von meinem Land oder ich mache euch Beine!«
O’Reilly zuckte nicht mit der Wimper. »Okay, okay! Kein Grund, die Nerven zu verlieren, Dutchman! Die Runde geht an dich!«, sagte er gleichmütig, wich zurück und wies seine Männer an, die Wagen anzulassen und einzusteigen. »Also lass mal schön den Finger vom Abzug!«
Doch je weiter er sich von der Schrotflinte entfernte, desto drohender wurden seine Worte. »Im Augenblick hast du das bessere Argument in der Hand, aber das wird nicht immer so sein. Du wirst uns deinen Moonshine liefern, und zwar zu meinem Preis! Wenn du nur ein bisschen Grips hast, findest du dich damit ab und machst wie die anderen einen guten Schnitt. Und wenn nicht, legen wir dich trocken! Lass dir das gesagt sein!«
William erwiderte nur: »Runter von meinem Land! Das ist meine letzte Warnung!«
Der Studebaker Big-Six, der über einen elektrischen Anlasser verfügte, sprang sofort an, als Frank Marlowe sich hinter das Steuerrad klemmte und ihn betätigte. So bequem hatte Barney Gifford es nicht. Er musste den Truck-Motor mit der Kurbel anwerfen. Knuckles und Skinny the Blade, die sich schon in die Fahrerkabine zurückgezogen hatten, dachten nicht daran, ihm zu helfen. Mit hämischem Grinsen verfolgten sie, wie er sich abmühte. Schweiß tropfte ihm von Stirn und Nase, als der Motor schließlich lief.
O’Reilly winkte ihn zu sich. »Sieh zu, dass du diese alte Mühle loswirst und dir einen Truck zulegst, der was taugt!«, rief er ihm über das rhythmische Dröhnen des betagten Pierce-Arrow zu. »Ist das letzte Mal, dass du mit der Schrottkiste für mich gefahren bist. In meiner Truppe ist kein Platz für Trucks, die sich mit ’ner Ladung Moonshine auf den Brettern im Kriechtempo über die Berge quälen! Haben wir uns verstanden, Barney?«
In dem Moment kam Robert laut rufend über den Hügel gerannt, über den die alte Sykomore ihren Schatten warf.
6
Mallory bekam nicht mehr mit, was der dicke Moonshine-Schieber antwortete. Aber das war auch nicht nötig: Dass er ängstlich versicherte, er werde sich umgehend einen modernen und PS-starken Lieferwagen zuzulegen, stand außer Frage.
Mit einem Handzeichen bedeutete Mallory ihrem Bruder, dass er nicht zu rennen brauche, was er natürlich ignorierte. Für ihn war es der Höhepunkt des Monats, wenn Barney Gifford den Moonshine abholen kam, denn der Alkoholschieber steckte ihm jedes Mal einen Vierteldollar zu, nachdem er beim Aufladen der Kisten mit den bauchigen 2-Gallonen-Flaschen geholfen hatte.
Als William seinen Sohn über den Hof kommen sah, schwang er die Schrotflinte aus der Armbeuge, trat schnell zurück in die dunkle Scheune und schob die Waffe hinter den Jutevorhang.
»Vergiss den Quarter, den gibts heute nicht!«, rief Mallory ihrem Bruder zu, als der an ihr vorbei zu Gifford laufen wollte.
»Warum hast du mich nicht gerufen, Lory?«, stieß er vorwurfsvoll hervor. Er hatte es sich im Schatten der hohen Pflanzen gemütlich gemacht und war eingenickt, als Mallory nicht gleich mit den aufgefüllten Feldflaschen zurückgekommen war. Aber das behielt er lieber für sich.
»Komisch, dass du Giffords Truck nicht gehört hast. Bist doch sonst nicht schwerhörig«, gab Mallory zurück und bedachte ihn mit einem spöttischen Blick.
Ihr Bruder rettete sich aus der Verlegenheit, indem er zum Gegenangriff überging. »Du hast mich nicht gerufen, weil du den Quarter für dich wolltest, gib es doch zu!« Er ballte die Fäuste.
Er hatte das gleiche glatte schwarze Haar und die gleichen aufmerksamen hellen Augen wie der Vater, und eines Tages würde er zweifellos die gleichen männlichen Züge haben. Aber noch war er ein schlaksiger Vierzehnjähriger in kurzen Hosen, dessen magerer Körper und ungelenke Gliedmaßen noch nicht das richtige Verhältnis zueinander gefunden hatten. Er versackte förmlich in den abgelegten Kleidern des Vaters. Der gut aussehende Mann, der in ihm steckte, würde sich noch eine Zeit lang seinen Weg bahnen müssen, bis er zum Vorschein kam.
»Red keinen Quatsch, Bobby! Du solltest dich schämen! Als ob ich dich um deinen Quarter bringen würde!«, rief Mallory unwirsch. »Heute werden keine Kisten aufgeladen, deshalb gibt es nichts vom dicken Gifford!«
Robert ließ die Fäuste sinken und machte ein verdattertes Gesicht. »Wieso denn nicht? Die hundertzwanzig Gallonen Crazy Apple stehen doch seit Freitag zum Abholen bereit.«
Sie zögerte kurz, während sie sah, wie der Schieber etwas zu O’Reilly sagte und die beiden zu ihnen herüberblickten, als redeten sie über sie, was natürlich lächerlich war.
»So genau kann ich dir das auch nicht sagen, ich hab nicht alles mitgekriegt«, flüchtete sie sich in eine Notlüge, weil sie nicht wusste, wie weit der Vater Robert in seinen Streit mit diesem Gangster einweihen wollte. Sie vermutete, dass er nicht vorhatte, seinen Sohn über das ins Bild zu setzen, was sich zwischen ihm und O’Reilly abgespielt hatte. Gottlob saßen die beiden Schlägertypen schon in Giffords Truck und waren hinter dem verdreckten Glas kaum zu erkennen. Nein, der Vater würde Robert nichts erzählen. Um das zu wissen, brauchte sie keine Hellseherin zu sein, dafür reichte schon die Beobachtung, dass er die Schrotflinte schnell aus der Hand gelegt hatte, als Robert aufgetaucht war.
Sie unterdrückte einen Seufzer. Sie liebte ihren Vater, und sie wusste, wie viel auch sie ihm bedeutete – und zwar nicht nur, weil sie nach Mutters Tod so viel zusätzliche Arbeit im Haushalt und auf dem Feld klaglos übernommen hatte und auch nicht wegen ihres Fingerspitzengefühls beim Schwarzbrennen. Sie hatte einen festen Platz in seinem Herzen, daran hegte sie nicht den geringsten Zweifel.
Dennoch versetzte es ihr manchmal einen Stich, wenn ihr zu Bewusstsein kam, dass er für ihren Bruder andere Maßstäbe gelten ließ als für sie und dass er andere Zukunftspläne für ihn hegte. Er wollte, dass Robert James Kendrick einen anderen Lebensweg einschlug, als es ihm vergönnt gewesen war. Einen Weg, der ihn aus der engen, chancenlosen Welt des Franklin County hinausführte und es ihm ersparte, im Schweiße seines Angesichts einem kargen Stück Boden den Lebensunterhalt für sich und seine Familie abringen zu müssen. Dafür schuf der Vater die Voraussetzungen, indem er ihn nicht nur im Winter für zwei, drei Monate in die Schule schickte, wie es bei der überwiegenden Mehrzahl der Farmerskinder die Regel war. Für Robert waren ganzjähriger Schulbesuch sowie gute schulische Leistungen Pflicht, damit ihm eine weiterführende Ausbildung und damit eine vielversprechende Zukunft offenstanden.
Aus demselben Grund hielt der Vater ihn von so gut wie allem fern, was mit der Schwarzbrennerei zusammenhing, ihn mit dem Gesetz in Konflikt bringen und sich später als Makel auf seinem unbescholtenen Namen herausstellen konnte. Ihrem Bruder war es nicht erlaubt, sich auch nur in die Nähe der still zu begeben, geschweige denn, bei irgendeiner der Arbeiten dort oben am Berg Hand anzulegen. Was Robert überhaupt nicht gefiel, und zwar immer weniger, je älter er wurde.
Für Widerworte oder gar den offenen Aufstand gegen die väterliche Autorität fehlte Robert noch der Mut. Aber die Spannungen zwischen den beiden nahmen zu. Stein des Anstoßes war immer wieder das strikte Verbot für Robert, sich der still zu nähern, aber in ihm wuchs auch ein Widerwille dagegen, dass der Vater seine Zukunft verplante, ohne sich darum zu kümmern, ob diese Pläne sich mit seinen Wünschen deckten.
Das einzige Zugeständnis, das der Vater bislang gemacht hatte, betraf Barney Gifford. Er hatte ihrem Bruder erlaubt, dem Dicken beim Aufladen der Kisten zu helfen. Aber selbst das hatte er nicht aus freien Stücken getan. Vielmehr hatte es sich so ergeben, als er sich im vorvergangenen Winter beim Baumfällen oben im Windbruch verhoben hatte und mit einem bösen Hexenschuss tagelang praktisch bewegungsunfähig gewesen war.
»Aber was gab es denn da groß mitzukriegen?«, hakte Robert argwöhnisch nach.
Mallory zog eine säuerliche Miene. Es gefiel ihr nicht, ihren Bruder anzulügen. Aber es gefiel ihr auch nicht, wenn er sich mit ihrer Antwort nicht zufriedengab. »Mein Gott, ich hab dir doch gerade gesagt, dass ich es so genau nicht weiß!«, fuhr sie ihn an, um dann doch noch einen kleinen Brocken Information herauszurücken. »Gifford hat wohl einen neuen Großabnehmer. Das ist der Mann da hinten in dem Studebaker, und mit dem ist Vater wohl nicht ganz handelseinig geworden. Aber warum genau das Geschäft heute geplatzt ist, weiß ich nicht, okay? Also hör auf, mir Löcher in den Bauch zu fragen!«
»Ist ja gut.« Robert zog eine Schnute. Ihm war anzusehen, wie bitter enttäuscht er war.
In dem Moment rief Barney Gifford nach ihm.
7
»Bobby!« Der dicke Bootlegger lächelte ihm zu und winkte ihn zu sich. »Komm doch mal her, Junge!«
In der vagen Hoffnung, dass vielleicht doch noch nicht alles verloren war, zumindest sein Quarter nicht, lief Robert los, bevor Mallory die Hand heben und ihn zurückhalten konnte.
»Ja, Mister Gifford?« Erwartungsvoll sah er den Dicken an.
»Bobby, das hier ist Mister Patrick O’Reilly. Ich fahre für ihn, und ich habe ihm erzählt, dass du ein guter Junge bist und mir immer tapfer beim Aufladen hilfst. Tut mir leid, dass daraus heute nichts wird. Aber Mister O’Reilly hat was für dich, das dir gefallen wird.« Barney Gifford zwinkerte ihm verschwörerisch zu.
William Kendricks wütende Stimme schallte über den Hof. »Robert, weg von dem Wagen, hast du gehört? Zurück zu deiner Schwester, aber flott!«
Robert hatte es sehr wohl gehört. Aber da beugte sich O’Reilly schon über das gepolsterte Seitenbord des Wagens und drückte ihm mit einem wohlwollend-herablassenden Lächeln ein Geldstück in die Hand.
»Nimm, Junge! Du sollst nicht wegen der blödsinnigen Sturheit deines Vaters um dein Handgeld kommen! Aber keine Sorge, das zwischen deinem Vater und mir kommt schon wieder ins Lot.« Er tätschelte Robert die Wange wie ein guter Onkel. Dann sank er auf die Rückbank zurück, wedelte mit der Zigarre und rief: »Frankie, wir sind hier fertig, wir können!«
»Robert!«, brüllte der Vater erneut und kam angestürmt. »Hast du es auf den Ohren?«
Tatsächlich erreichte die Stimme des Vaters ihn nicht wirklich. Ungläubig starrte Robert auf die Münze in seiner Hand: Auf der Vorderseite des schweren Geldstücks prangte tatsächlich die Lady Liberty!
Was ihm der teuer gekleidete Mann mit dem verwegenen Strich von Schnurrbart in diesem luxuriösen Traumautomobil so lässig zugesteckt hatte, war kein Quarter, sondern ein ganzer Silberdollar! Für so viel Geld mussten der pickelige Lehrbursche in Hardy’s Drugstore in Rocky Mount oder die Frauen in den Spinnereien ein, zwei Tage arbeiten!
»Robert James Kendrick!«, donnerte die Stimme des Vaters über den Hof. Und wenn der Vater einen mit dem vollständigen Namen rief, war es allerhöchste Zeit, ihm Folge zu leisten.
Überwältig von dem Geschenk wirbelte Robert herum, reckte die Hand mit der Silbermünze hoch und rief glückselig: »Sieh doch nur, Vater! Er hat mir eine Lady Liberty geschenkt! Einen ganzen Silberdollar! Ich hab noch nie einen besessen!«
»Und es wird wohl auch noch dauern, bis du dir einen verdient hast!«, stieß William zornig hervor, riss ihm die Münze aus der Hand und warf sie nach O’Reilly.
In einem Reflex fing dieser sie aus der Luft und warf ihm einen verächtlichen Blick zu, während Frank Marlowe Gas gab und den Studebaker in einer scharfen Kurve vom Hof lenkte. Dreck und kleine Steine spritzten unter den Weißwandreifen auf. Gifford hängte sich mit seinem Truck an ihn. Staub tanzte in wirbelnden Wolken durch die warme Luft und trieb mit dem Gestank der Abgase über den Hof.
Mit verbissener Miene blickte William ihnen nach.
»Warum hast du das getan, Vater? Das war mein Silberdollar! Er hatte ihn mir geschenkt!«, stieß Robert hervor, und Mallory sah, dass ihrem Bruder vor ohnmächtiger Wut die Tränen in den Augen schossen.
»Ein Kendrick nimmt kein Geld, das ihm nicht zusteht! Nicht einen Cent!«, beschied ihn William mit harter Miene. »Und schon gar nicht von solchem Abschaum!«
»Das ist nicht fair!«
William lachte grimmig. »Ja, und? Wo steht denn geschrieben, dass es im Leben fair zugeht? Das findest du nicht mal in der Bibel, Junge! Und wenn du bis jetzt noch nicht begriffen hast, dass Fairness nicht zu den Gesetzen des Lebens gehört, dann wird es Zeit, dass du es endlich lernst!«
Empört funkelte Robert den Vater an und reckte trotzig das Kinn. »Aber mit dem dicken Gifford machen wir Geschäfte, ja? Warum kann ich dann nicht von diesem Mister O’Reilly …«
William schnitt ihm das Wort ab. »Du kannst einen Haufen Mist in Samt und Seide packen, der Gestank bleibt derselbe! Nicht die Qualität des Zwirns macht den Mann, schreib dir das gefälligst hinter die Ohren!«
Mallory sah ihrem Bruder an, dass er nicht verstand, wovon der Vater sprach. Was nicht verwunderlich war. Nur ihrem Vater entging in seinem Zorn, dass Robert ihm nicht folgen konnte.
»Und mit wem ich Geschäfte mache, entscheide immer noch ich«, fuhr er mit harscher Zurechtweisung fort. »Ist das angekommen, Robert James Kendrick?«
Robert schluckte. »Ja, ist es«, murmelte er kleinlaut und senkte den Blick. Aus seiner Miene waren Aufbegehren und Zorn verschwunden, nicht aber aus seinem Herzen.
»Gut, dass wir uns zumindest darüber einig sind«, knurrte William und ließ seinen harten Blick noch einen Moment auf Robert ruhen. »So, und jetzt Schluss mit dem Gerede! Die Arbeit tut sich nicht von allein!«
8
Der Studebaker und der klobige Pierce-Arrow fuhren mit flottem Tempo unten am Maisfeld vorbei. Sie hatten vielleicht noch dreißig, vierzig Yards bis zu dem lang gezogenen Bogen bei den beiden Magnolienbäumen, der um das Feld und das sich anschließende Waldstück herum zur Landstraße führte, als aus der anderen Richtung ein schwarzer Ford hinter dem hohen Mais auftauchte.
Es war ein Model T, das ebenso spöttisch wie liebevoll Tin Lizzy genannt wurde. Seit 1908 preiswert am Fließband produziert, dazu robust, zuverlässig und leicht zu reparieren, war es in kurzer Zeit zum Verkaufshit unter den Automobilen geworden. Allein mit der Geschwindigkeit war es nicht weit her. Selbst auf gerader Strecke brachte die Blechliesel es nur mit Mühe auf eine Spitzengeschwindigkeit von fünfundvierzig Meilen die Stunde, und Steigungen mochte sie gar nicht.
Keiner der beiden Wagen wich auch nur einen Inch aus der Mitte der Zufahrt, wie auch keiner von ihnen seine Geschwindigkeit verringerte. Vielmehr hielten sie auf den Ford zu, und das Blöken ihrer Signalhörner verkündete, dass sie den sandigen Fahrweg für sich beanspruchten.
Der Fahrer des Ford sah sich zu einem schnellen Ausweichmanöver genötigt. Wie ein kleines Boot in aufgewühlter See hüpfte und schaukelte die Tin Lizzy über holpriges Wiesengelände. Der Studebaker und der Truck rauschten an ihr vorbei, schleuderten in der Kurve ihre Staubwolke in die offene Fahrerkabine und verschwanden hinter dem Maisfeld.
»Ich glaube, du kriegst Hilfe bei deiner Arbeit, Vater«, sagte Mallory ein wenig spitz, doch schon im nächsten Augenblick vergaß sie ihren Groll darüber, dass er ihr weder von seinem Treffen mit dem dicken Gifford in Rocky Mount noch von der neuen Situation in Roanoke erzählt hatte – und wieder einmal zu hart zu ihrem Bruder gewesen war. Gegen die Freude, die der Anblick des auf den Fahrweg zurückhüpfenden Ford in ihr auslöste, kamen Groll und Unverständnis nicht an. Das konnte nur Henry sein!
In der Tat war es Henry Irving, der hinter dem Steuer der Tin Lizzy saß. Gut dreieinhalb Jahre hatte er gebraucht, um mit an Besessenheit grenzender Hartnäckigkeit einen Klumpen zusammengestauchter Bleche, geborstener Achsen und grotesk verbogener Motorteile in einen Ford Model T zurückzuverwandeln. Niemand hatte geglaubt, dass er es schaffen würde, dem Schrotthaufen wieder die vertraute Form zu geben, geschweige denn, ihn zum Fahren zu bringen. Wie auch niemand verstanden hatte, warum er sich derart in dieses Projekt verbissen hatte.
Immerhin war in diesem Wagen sein Vater gestorben, hatte seine Mutter über Stunden mit dem Tod gerungen und beinahe den Verstand verloren. Nicht zuletzt hatte sich mit dem kochenden Kühlerwasser, das seiner Mutter in jener Winternacht hinter der Brücke über den Goose Creek zusätzlich zu den Knochenbrüchen noch schwere Verbrühungen zugefügt hatte, auch seine vielversprechende Zukunft verflüchtigt.
Mallory hatte selbst oft gerätselt, ihn aber nie zu fragen gewagt. Wie und wann denn auch? Erstens sahen sie einander selten, wohnte er doch in Rocky Mount und damit gute fünf Meilen von ihnen entfernt, und zweitens war Henry Irving nicht der Typ Mann, der es einem leicht machte, ihn etwas derart Persönliches zu fragen. Genau genommen machte er es einem nicht leicht, ihn überhaupt etwas zu fragen, geschweige denn ein Gespräch mit ihm zu führen, das über einen Gruß und zwei, drei Allgemeinplätze hinausging.
Der Vater nickte mit grimmiger Miene. »Ja, auf Henry ist Verlass. Ich wünschte, das könnte ich von manch einem anderen auch sagen«, knurrte er, warf Robert einen vielsagenden Seitenblick zu und stiefelte davon. »Sag ihm, ich bin in der Scheune, Mallory!«
»Mach ich«, erwiderte sie und wandte sich, kaum dass ihr Vater außer Hörweite war, ihrem Bruder zu. »Geh schon mal und nimm die Feldflaschen mit, ich komme gleich nach.«
Unter normalen Umständen hätte Robert sie aufgezogen, hätte gesagt, sie schicke ihn ja bloß schnell weg, um ungestört mit ihrem Augenstern Süßholz raspeln und sich schöne Augen machen lassen zu können. In diesem Moment aber fehlte ihm jeglicher Antrieb, sich über irgendetwas lustig zu machen. Und so zuckte er mit finsterer Miene mit den Achseln, nahm ihr wortlos die Flaschen ab und machte sich auf den Weg zum Tabakfeld.
9
Henry Irving rollte langsam heran, hielt neben ihr im Schatten des Farmhauses, stellte den Motor ab und zog die Bremsstange an. Mit dem ihm eigenen verhaltenen Lächeln, das ausschließlich in ihrer Gegenwart etwas Verlegenes annahm, stieg er aus.
Er war vierundzwanzig und von schlanker Gestalt. Sein offenes, sympathisches Gesicht war geprägt von einer energischen Kinnpartie, die in merkwürdigem Widerspruch zu seiner zurückhaltenden Art stand. Sein wild gelocktes Haar hatte die Farbe von Kastanien und von einem ähnlich warmen Farbton waren auch seine Augen, nur eine Spur dunkler.
»Tag, Mallory.«
»Hallo, Henry.« Sie lächelte ihn an und hoffte, dass er ihr das Herzklopfen nicht ansah. Andererseits – vielleicht wäre es klüger gewesen, es nicht vor ihm zu verbergen.
»Ganz schön heiß heute, was?«
»Kann man wohl sagen«, gab sie zurück und wünschte, sie hätte noch Zeit gehabt, ins Haus zu laufen und die alte Latzhose gegen ein Kleid auszutauschen. Nicht, dass sie viele zur Auswahl gehabt hätte, aber selbst im einfachsten sah sie um Klassen besser aus als in diesem unförmigen Sack.
Er nickte, erwiderte ihr Lächeln und blieb einen Moment lang einfach stehen. Offensichtlich wusste er nichts weiter zu sagen, oder aber er fand nicht den Mut zu einer richtigen Unterhaltung. »Na, dann«, murmelte er schließlich und hob seinen Werkzeugkasten aus dem Wagen. »Wollen wir doch mal sehen, dass wir euren Truck wieder ans Laufen bringen.«
Dass ihm das gelingen würde, stand außer Frage. Er arbeitete seit vier Jahren als Automechaniker bei der Blue Ridge Lumber Company in Rocky Mount. Das Sägewerk gehörte Daniel Loomis, der als Holzbaron den Holzhandel nicht nur im Franklin County, sondern auch in den umliegenden Bezirken beherrschte. Henry kümmerte sich dort allerdings nicht nur um den Fuhrpark, sondern sprang auch als Truckfahrer ein, wenn Not am Mann war.
Dabei hätte er längst sein Studium abgeschlossen haben und irgendwo als Ingenieur arbeiten sollen. Der entsetzliche Unfall vier Jahre zuvor hatte sein Leben von einem Tag auf den anderen von Grund auf verändert. Die Tragödie hatte ihn gezwungen, das Studium in Roanoke abzubrechen und für seine Mutter zu sorgen, und zwar nicht nur finanziell.
Henrys Vater, erster Buchhalter mit Prokura in der Firma von Daniel Loomis, hatte auf dem Rückweg von einem Besuch bei Freunden einen Herzanfall erlitten. Er hatte die Kontrolle über den Wagen verloren, war von der Straße abgekommen, in einen Graben gestürzt und dort gegen einen Felsbrocken geprallt. Während er selbst auf der Stelle tot war, hatte seine Frau, mit zertrümmerten Knochen und blutend im Wrack eingeklemmt, ewig auf Rettung warten müssen. Nicht nur hatte sie in der Folge das linke Bein verloren, das einfach nicht heilen wollte und schließlich amputiert werden musste, sondern auch ihr Geist hatte in jener Nacht irreparablen Schaden genommen. Sie hatte nicht etwa den Verstand verloren, aber ihre Seele hatte sich nicht von dem Erlebten erholt, und so war ihr Leben, abgesehen von den körperlichen Beeinträchtigungen, von häufigen Angstzuständen und depressiven Phasen bestimmt.
Die horrenden Arztkosten hatten bald die Ersparnisse aufgefressen, sodass das hübsche Haus auf der Orchard Street hatte verkauft werden müssen. Henry war nichts anderes übrig geblieben, als sein Studium aufzugeben und sich eine Arbeit zu suchen, um seine Mutter nicht nur vor der Armut, sondern auch vor der Einweisung in eine staatliche Anstalt zu bewahren.
»Gleich ist er weg!«, schoss es Mallory durch den Kopf. Aber sie wollte ihn nicht gehen lassen. Noch nicht!
»Wie geht es deiner Mutter?«, fragte sie hastig und kam sich verlogen vor, weil sie das nicht wirklich interessierte. Aber es war das Einzige, was ihr auf die Schnelle einfiel. Und es musste doch möglich sein, dass sie länger als eine Minute miteinander redeten!
Sie spürte doch, dass auch sie ihm alles andere als gleichgültig war! Wenn er mit anderen zusammen war, wirkte er nicht so gehemmt – nur bei ihr blieben ihm die Worte im Hals stecken oder wollten sich erst gar nicht formen. Was immer es war, es musste ein Ende haben! Wenn er zu schüchtern war oder sich vor einer Zurückweisung fürchtete, dann musste eben sie die Sache in die Hand nehmen! Es wurde Zeit, sich nicht mehr nur in sehnsuchtsvollen Träumen zu ergehen und darauf zu warten, dass er sich endlich ein Herz fasste!
Henry stellte den schweren Werkzeugkasten ab, und sie hatte den Eindruck, er sei regelrecht erleichtert, dass sie ihn nicht gehen ließ.
»So einigermaßen. War schon mal besser, aber auch schon schlechter«, sagte er mit einem strahlenden Lächeln, das so gar nicht zu dem traurigen Thema passte. »Und wie geht es dir, Mallory?«
Sie liebte es, ihn ihren Namen aussprechen zu hören. Aus seinem Mund klang er so ganz anders. »War schon mal besser, aber auch schon schlechter«, neckte sie ihn.
Er lachte, und als sie einstimmte, verlor sein Lächeln endgültig die schüchterne Zurückhaltung. »Das passt eigentlich immer, nicht wahr?«
Sie nickte, lächelte und hielt seinen Blick fest. »Ja, damit kann man sich aus jeder Verlegenheit retten. Ich gestehe aber, dass es eine blöde Frage war. Mir ist bloß sonst nichts eingefallen, was ich dich fragen könnte«, sagte sie. »Hätte ich nicht irgendwas gefragt, wärst du ja gleich abgezogen mit deinem Werkzeugkasten, und das fand ich irgendwie nicht richtig.« Sie errötete unter seinem erstaunt-freudigen Blick.
»Nein, das wärs wirklich nicht!« Es war, als hätte sie ihm Mut gemacht. Plötzlich taute er auf, verlor die Wortkargheit, die er ihr gegenüber immer an den Tag gelegt hatte. »Ich wollte ja schon viel früher kommen, aber leider ging das nicht. Mister Loomis hatte noch Arbeit für mich, obwohl ich schon Feierabend hatte. Darauf gibt er ja nichts. Na ja, kein Grund, sich aufzuregen, immerhin zahlt er anständig. Und woher sollte er auch wissen, dass ich es heute besonders eilig hatte, weil ich zu euch wollte.«
Mallory konnte sich nicht erinnern, dass er jemals auch nur halb so viel an einem Stück zu ihr gesagt hätte. »Das macht doch nichts! Vater ist heilfroh, dass du ihm bei der Reparatur hilfst. Er wartet in der Scheune auf dich«, erwiderte sie beschwingt – und hätte sich im nächsten Moment am liebsten selbst geohrfeigt.
Warum hatte sie etwas so Idiotisches gesagt? Dass der Vater wartete! Das klang ja, als wollte sie Henry schnell wieder loswerden, wo doch das genaue Gegenteil der Fall war!
Zum Glück zog er nicht den falschen Schluss. Er räusperte sich umständlich. »Sag mal, was … ähm … was ich dich schon länger fragen wollte …«
»Ja?«